"Etzel": Forscher, Abenteurer und Agent: Die Lebensgeschichte des Mongoleiforschers Hermann Consten (1878-1957) 9783112208939, 9783879974153
Zentralasien, heiß umkämpfter Spielball im 'Great Game' der imperialistischen Mächte, war zu Beginn des 20. Ja
154 30 74MB
German Pages 617 [618] Year 2012
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Doris Götting
File loading please wait...
Citation preview
Doris Götting „Etzel“
Doris Götting
„Etzel“ Forscher, Abenteurer und Agent Die Lebensgeschichte des Mongoleiforschers Hermann Consten (1878–1957)
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.
Titelbild: Hermann Consten im mongolischen Fürstengewand, Ölgemälde von Heinz Munz, ca. 1923 Rücken: Vignette zu Constens Roman „Der rote Lama“, unbekannter Künstler Frontispiz: Hermann Consten mit Jade-Armreif und Shag-Pfeife, um 1913.
www.klaus-schwarz-verlag.com All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.
© 2012 by Klaus Schwarz Verlag GmbH Erstausgabe Gesamtherstellung: J2P Berlin Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier ISBN 978-3-87997-415-3
Meinen mongolischen Freunden und Anne & Rainer Hesse gewidmet, die vor vielen Jahren mit dem Geschenk der „Weideplätze der Mongolen“ den Grundstein zu diesem Buch legten
Ich suche immer noch nach dem Tempel des Lebens. Ob ich ihn finde? Hermann Consten
Wer aber nicht auswandert aus seinem alten Menschen, der wird in keiner Steppe frei. Hans Paasche
Man kann sicherlich sagen, dass bei denjenigen, die jemals die Welt der Geheimdienste betreten haben, die déformation professionelle nach wenigen Jahren so groß ist, dass sie nie wieder rückgängig gemacht werden kann. John le Carré
Inhalt Vorwort ................................................................................................................9 Einleitung ...........................................................................................................13 Abkürzungen .....................................................................................................16 I
VOM KIND ZUM MANN 1878–1904 ....................................................17 1. Das schwierige Kind – 2. Zwischen Freiheits- und Bindungsdrang – 3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara – 4. Abenteurer und Großwildjäger
II
WECHSEL DES K LIMAS UND DER KONTINENTE 1905–1913 ..........110 1. Von Ostafrika zum Studium nach Moskau – 2. Mongolei zum Ersten: „Köpfe sammeln“ für Russland – 3. Begegnung mit dem tibetischen Buddhismus – 4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs – 5. Wegbereiter mongolisch-deutscher Staatsbeziehungen
III
CODES UND CAMOUFLAGEN 1914–1918 ..........................................216 1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei – 2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition – 3. „Major“ Constens Sondereinsatz für Enver Pascha – 4. Als V-Mann in Budapest: „Etzel“ in feiner Gesellschaft – 5. Enttarnt: Mihály Graf Károlyi und die „Affäre Konsten“
IV
VOM BÜRGERLICHEN DASEIN 1919–1927 .........................................341 1. „Dr. Claudy“ – Constens Neubeginn als Privatgelehrter – 2. Wissenschaftler oder Karl-May-Verschnitt? – 3. „Krisenmanager“ in schwieriger Zeit – 4. Alte Netzwerke und neue Expeditionspläne – 5. Ende einer großen Liebe: Consten und die Frauen
V
DIE LETZTE EXPEDITION 1928–1929 .................................................401 1. Per Schiff nach China – Expeditionsvorbereitungen – 2. Mongolei zum Dritten: Über die Große Mauer Richtung Norden – 3. Unter Warlords, Räubern, Missionaren und Lamas – 4. Regennächte an den Gräbern der Liao – 5. Schlaraffenbriefe und andere Notizen – 6. Verhaftung und Verhöre an der Grenze – 7. Wiedersehen, Ärger und Abschiebung
VI
DIE CHINESISCHEN JAHRE 1929–1950 ..............................................481 1. Mittellos in Peking – Überleben als Reitlehrer – 2. Zwischen Hutong und Hakenkreuz – 3. Eleanor und Etzel – Ein ungleiches Paar wagt die Ehe – 4. Chinesischer Bürgerkrieg und japanische Bedrohung – 5. Lehrtätigkeit und Arbeit an der „Encyclopedia Mongolica“ – 6. Mao erobert Peking – Ausweisung und Heimkehr
VII SUMME DES LEBENS 1950–1957 .........................................................533 1. Wieder in Aachen: Der Kreis schließt sich – 2. Unvollendet im Nachlass: „Encyclopedia Mongolica“ Epilog. Statt eines Nachworts eine Schriftanalyse ..................................547 Anhang Danksagung ....................................................................................................550 Literatur und Bildnachweis ..........................................................................553 Über die Autorin ............................................................................................561 Namensregister ...............................................................................................562 Anmerkungen .................................................................................................567
Vorwort Wer sich mit der Geschichte der Äußeren Mongolei nach 1911 beschäftigt, weiß um die mehr als bescheidene Quellenlage. Besonders gering ist das Quellenangebot für die Zeit der Autonomie der Äußeren Mongolei (1911– 1919). Es reduziert sich im Grunde auf einige wenige Dokumente der Regierung des Bogd Gegeen, die zumeist Regierungserlasse bzw. juristischen Inhalts sind. Die Zeit nach dem im Jahr 1921 von den Sowjets initiierten politischen Umsturz, der in der mongolischen Geschichtsliteratur als „mongolische Volksrevolution“ bezeichnet wird, pflegen Historiker mit großer Mühe anhand von offiziellen Dokumenten wie Gesetzen, Parteitagstexten und Beschlüssen der Mongolischen Revolutionären Volkspartei, ideologisch eingefärbten Berichten von Beratern der sowjetischen Regierung und der Komintern zu erschließen. Sie sind damit zwar dazu in der Lage, den historischen Ablauf zu skizzieren, haben aber größte Mühe, sich der realen historischen Situation anzunähern. Zu den wenigen, recht objektiven und exakten Berichten für die Zeit der Autonomie gehört zweifelsfrei Hermann Constens Hauptwerk „Weideplätze der Mongolen“, dessen eigentlicher Wert von seinen Zeitgenossen nur bedingt wahrgenommen wurde. Wenn diese über das Buch ein eher kritisches Werturteil fällten, so nicht etwa deshalb, weil sie es besser wussten. Die Äußere Mongolei stellte zu dieser Zeit selbst für Wissenschaftler eine terra incognita im besten Sinne des Wortes dar. Es war vielmehr die persönliche Bekanntschaft mit Consten, die die Kritik der Zeitgenossen beeinflusste. Consten war eine vielschichtige Persönlichkeit. Die einen kannten ihn als einen brillanten, aber auch eitlen Erzähler seiner Abenteuer in der Mongolei, der dazu neigte, die erlebten Episoden wie Münchhausen zu übertreiben. Sie kannten ihn als jemanden, der sich einen akademischen Nimbus zu geben suchte, ohne aber wirklich über eine akademische Bildung zu verfügen. Die anderen dagegen wussten um seine geheimdienstliche Tätigkeit und sahen sich daher häufig nicht dazu in der Lage, zwischen Legende und Wahrheit zu unterscheiden. Als Mensch war Hermann Consten das Produkt seiner Zeit, rechtskonservativ in seiner Gesinnung, von Fernweh getrieben, immer auf der Jagd nach Ruhm und Anerkennung, aber auch nach Geld, um sein Leben und seine Reisen finanzieren zu können. Seine starke Verbundenheit mit der Mongolei veranlasste ihn zu engagier9
Vorwort
ten Forschungen und auch literarischen Versuchen. Dennoch wussten selbst Insider bisher nur wenig über den Menschen Hermann Consten. Mit der vorliegenden Biografie Hermann Constens ist Doris Götting ein wirklich großer Wurf gelungen, der es erstmals möglich macht, die Hintergründe der schillernden Persönlichkeit Hermann Consten zu beleuchten. Ich will nicht verhehlen, dass ich an dem Buch die Professionalität und den Spürsinn der erfahrenen Journalistin Doris Götting sowie seine sprachliche und stilistische Umsetzung sehr bewundere. Die Autorin hat lange daran gearbeitet und Quellen aus deutschen, österreichischen, britischen, amerikanischen und mongolischen Archiven mit großer Akribie befragt. Dass Doris Götting sich nicht allein auf den biografischen Ablauf konzentriert, sondern auch der inneren Biografie, den gesellschaftlichen Begleitumständen und politischen Hintergründen des Lebens von Hermann Consten angemessenen Raum gibt, macht diese Lebensgeschichte umso lesenswerter und verständlicher. Dem Buch ist daher ein breiter Leserkreis zu wünschen. Ich bin mir sicher, dass so mancher nach der Lektüre auch nach Constens Werk „Weideplätze der Mongolen“ greifen wird. Auf diese Weise wird das Vermächtnis Hermann Constens, wenn auch posthum, seine späte Rechtfertigung erfahren. Udo B. Barkmann Ulaanbaatar (Mongolei) 13. Dezember 2011
10
Einleitung Mehr im Windschatten der internationalen Politik und daher in ihrer geostrategischen Bedeutung für Zentral- und Nordasien immer noch unterschätzt, liegt die Mongolei eingeklemmt zwischen ihren mächtigen Nachbarn Russland und China. 2011 beging sie erstmals in ihrer jüngeren Geschichte das Jubiläum ihrer nationalstaatlichen Unabhängigkeit vor nunmehr einhundert Jahren. Die Rückbesinnung auf ihre ruhmreiche Vergangenheit als das Herzland eines mittelalterlichen Weltreichs, das vom Chinesischen Meer bis nach Russland und in den vorderen Orient reichte, erfolgte schon kurz nach der unblutigen Revolution 1989/90 und dem dadurch bedingten Untergang der Mongolischen Sozialistischen Volksrepublik. Seither hat das Land begonnen, sich durch das Bekenntnis zu Demokratie und Marktwirtschaft und eine Politik des „dritten Partners“ aus seiner geographischen Zwangslage zwischen zwei übermächtigen Nachbarn zu lösen und aus seinen noch weitgehend unerschlossenen Lagerstätten an Kohle, Erdöl, Edelmetallen und Uran auch selbst wirtschaftlich Kapital zu schlagen. Die Rückbesinnung der Mongolen auf die Anfänge ihres modernen Nationalstaats war also überfällig. Schon vor hundert Jahren war es der Wunsch der Nachfahren Čingis Chaans gewesen, sich aus politischer Abhängigkeit und ökonomischer Verschuldung zu befreien, „dritte Partner“ zu finden und die Geschicke des Nomadenlandes selbst in die Hand zu nehmen. Doch waren die Voraussetzungen dafür damals wesentlich ungünstiger als heute. Denn sein geopolitisches Umfeld war zum Spielball eines gigantischen Kräftemessens um die Sicherung von Einflusszonen zwischen dem britischen und dem russischen Imperium geworden, bei dem sich auch die aufstrebenden Kaiserreiche Japan und Deutschland ihren gebührenden Anteil sichern wollten und das geschwächte, aber immer noch mächtige China um den Erhalt seines Imperiums rang. In diesem „Great Game“, dem mit tödlichem Ernst betriebenen Schachspiel um Territorialbesitz, um die Kontrolle der Handelswege, um Zugriff auf die in Zentralasien vermuteten reichen Bodenschätze und Energiereserven, ging es nicht zuletzt auch darum, dass sich die drei Rivalen auf dem europäischen Glacis, Großbritannien, Russland und das Deutsche Reich, in Zentral- und Ostasien ebenfalls gegenseitig in Schach zu halten versuchten. Nicht ohne Grund war die deutsche Reichsregierung entschlos11
Einleitung
sen, ihre beiden Hauptgegner England und Russland mit Hilfe ihres türkischen Verbündeten im Ersten Weltkrieg auch auf fernen Kriegsschauplätzen in Mittelasien militärisch entscheidend zu schwächen oder gar, quasi hinterrücks, zu besiegen. Dieses Szenario bildet die Folie, vor der sich die ungewöhnliche Lebensgeschichte eines hierzulande weitgehend in Vergessenheit geratenen Deutschen abspielte: des aus Aachen stammenden Forschungsreisenden und Geheimagenten Hermann Consten (1878–1957). Consten, den seine Freunde – in Anspielung auf den Hunnenkönig Attila – „Etzel“ nannten, sprach viele Sprachen; er diente vielen Herren, hatte viele Feinde und nur wenige echte Freunde. In seinem Wesen war er ein geltungsbedürftiger, schwer durchschaubarer, innerlich zerrissener und getriebener einsamer Mensch, dem seine vielfältigen Begabungen Segen und Fluch zugleich bedeuteten. Er war ein Reisender und Suchender, den es nach Afrika, in den Nahen Osten, nach Südosteuropa, Russland und China verschlug. Vor allem aber zog es Hermann Consten immer wieder in die Mongolei. Dieses Land hat er in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie kaum ein zweiter Europäer erkundet und erfasst. Umgekehrt wiederum hat das Land der Mongolen, haben vor allem seine Menschen von ihm Besitz ergriffen und ihn eigentlich nie wieder losgelassen. In der Mongolei gilt Hermann Consten heute als einer der wenigen ausländischen Zeitzeugen und geheimen Akteure einer blutigen Epoche auf diesem wenig beachteten Nebenschauplatz des nun über 100 Jahre zurückliegenden „Great Game“. Hier verbrachte der XIII. Dalai Lama nach seiner Flucht vor den Engländern aus Lhasa mehrere Jahre im Exil; hier konkurrierten Russen und Japaner mit den Chinesen um Absteckung ihrer Interessensphären und Zugriff auf vermutete reiche Bodenschätze; hier strebten die mongolischen Fürsten angesichts des Niedergangs der Qing-Dynastie in Peking nach Eigenstaatlichkeit unter der geistlichen Oberherrschaft des Bogd Gegeen und einem Bündnis mit dem ähnliche Ziele verfolgenden Tibet, unter – so hoffte man – wohlwollender Duldung durch Russland. Hermann Consten lebte Anfang des 20. Jahrhunderts in Moskau. Während mehrerer Mongolei-Expeditionen in russischem Auftrag, die offiziell anthropologischen, geologischen und meteorologischen Feldstudien sowie der kartografischen Erfassung bestimmter Gebiete des Landes dienten, inoffizi12
Einleitung
ell jedoch der Sammlung geheimer Informationen für das Deutsche Reich, der Propagierung deutscher Industrie- und Waffentechnik und privat der Hochgebirgsjagd gewidmet waren, gelang ihm das Kunststück, das Vertrauen der Hauptbeteiligten an den damaligen kriegerischen Auseinandersetzungen pro- und antichinesischer Mongolenstämme zu gewinnen. Als Kurier trug der Deutsche zwischen 1911 und 1913 geheime Dokumente zwischen Mongolen, Chinesen und Russen über große Steppen-Distanzen hin und her. Er pflegte vertrauten Umgang mit Stammesfürsten, hohen Lamas und Banditen, mit russischen Diplomaten und Kaufleuten, mit chinesischen Handelsherren und dem engsten außenpolitischen Berater des XIII. Dalai Lama, dem gelehrten burjatischen Mönch Agvan Doržiev, der in dem Verdacht stand, ein Spion des Zaren zu sein. Ob dies zutraf, ist eher zweifelhaft. Mit Sicherheit jedoch betätigte sich Hermann Consten in diesem „Sonder-Forschungsbereich“ anfangs wohl eher, wie er einmal selbst bekannte, „auf eigene Faust“, später auch mit konkreten Aufträgen. Jedenfalls schickte er vertrauliche Berichte über seine Beobachtungen und Kenntnisse politischer und militärischer Vorgänge im russisch-mongolischen Grenzgebiet und in der Mongolei an das Deutsche Generalkonsulat in Moskau. Mit einem namhaften deutschen Industrieunternehmen arbeitete er außerdem an Plänen eines Projekts zur Erschließung der mongolischen Goldvorkommen und zur Übernahme des wegen der Vertreibung der Chinesen aus der Mongolei zusammengebrochenen mongolischen Exportmarktes durch deutsche Handelshäuser. Dieses Projekt kam letztlich nicht zustande. Rekrutierungen und Truppenbewegungen der Russen in Südsibirien veranlassten ihn Ende 1913, über Moskau in seine Heimat zurückzukehren. Der Erste Weltkrieg sah ihn, nach einer dubiosen Agenten-Episode beim deutschen Einmarsch in Belgien, als zeitweiligen Teilnehmer der türkisch-deutschen Afghanistan-Expedition von 1914/15, die als „Expedition Niedermayer“ in die Geschichte eingegangen ist, wobei allerdings Constens besondere Rolle in diesem Geheimunternehmen von der historischen Forschung bislang nicht beachtet wurde. Kurz darauf trat er als Geheimagent in türkischen, deutschen und ungarischen Diensten auf dem Balkan in Erscheinung. In Budapest wurde Consten schließlich im Frühjahr 1918 als Drahtzieher einer politischen Intrige gegen Mihály Graf Károlyi, wenig 13
Einleitung
später Ministerpräsident, dann Staatspräsident der ersten Ungarischen Republik, enttarnt und musste das Land verlassen. Nach dem Krieg lebte er in scheinbar geordneten bürgerlichen Verhältnissen in Thüringen und betätigte sich als Vortragsreisender, Schriftsteller und Privatgelehrter. Innerhalb weniger Jahre veröffentlichte er sein großes zweibändiges Werk „Weideplätze der Mongolen“ und mehrere Romane. 1927 zog es ihn wieder hinaus nach Asien. Widrige Umstände führten dazu, dass er in Peking strandete. Erst 1950 sollte er als alter Mann aus China zurückkehren. Hermann Constens Lebensgeschichte zu erzählen, stellte mich vor eine Reihe von Herausforderungen. In den vielen Jahren, die ich mich mit ihm beschäftigt habe, erschien er mir manchmal wie eine Romanfigur, die man nicht besser hätte erfinden können. Aber einen Roman über ihn zu schreiben hätte bedeutet, von ihm selbst gern kolportierte, oft übertrieben dargestellte Abenteuergeschichten aus seinem Leben und die ungelüfteten Geheimnisse seiner Agententätigkeit durch eigene Fiktion, erdachte Dialoge und künstlich aufgebauschte Spannung noch anreichern zu wollen. Eine Biografie wiederum, die sich allein auf nüchterne, belegbare Fakten beschränkte, würde zwangsläufig in einigen Phasen von Hermann Constens bewegtem Leben auffallende Lücken aufweisen, die auch durch intensive Recherchen bisher nicht geschlossen werden konnten. Deshalb verzichtete ich bewusst auf den Gattungsbegriff der Biografie. Ich erzähle also eine Lebensgeschichte, doch ist es eine Geschichte, die sich weitgehend auf nachgeprüfte Fakten stützen kann. Diese Geschichte geht nicht immer streng chronologisch vor, sondern folgt auch gern einmal den Nebenwegen, Überschneidungen und Brüchen in dieser Vita, die Constens eigenwilligem Verhalten, seinen politischen Überzeugungen und seinem gesellschaftlichen Umfeld geschuldet sind. Dazu gehören vor allem Exkurse in Constens belletristisches Schaffen, seine Briefe und Tagebuchnotizen. Dazu gehört auch ein Blick in seine Foto- und Kartensammlung, in seine Zettelkästen und die Hefte mit seinen Geheimcodes. Auf sich teilweise überlappenden Erzähl-Ebenen von Fiction und Non-Fiction, Ver- und Entschlüsselungen, Camouflage und Enthüllung, so meine Überlegung, soll sich der Mensch wieder herausschälen und lebendig werden, der Hermann Consten einmal gewesen ist. Diesem Ziel diente auch die Analyse seiner Handschrift am Ende des Buches. Die nachgelassenen Selbstzeugnisse und 14
Einleitung
die in seinen Romanen und Erzählungen versteckten autobiografischen Spuren waren mir ebenso wichtig wie die Gespräche mit Menschen, die ihn noch gekannt haben und das Aktenstudium in den in- und ausländischen Archiven. Dieses methodische Vorgehen gab mir als Autorin die Freiheit, gewissermaßen mein eigenes „Great Game“ mit Hermann Consten zu spielen, den ich persönlich nicht mehr erleben durfte. Er hätte mich als Frau, wäre mir nicht die „Gnade später Geburt“ zuteil geworden, zugleich abgestoßen und fasziniert; als Journalistin, die – wie er – lange in Asien zu Hause war, hätte er mich natürlich auch zu seinen Lebzeiten brennend interessiert. Mir ist darum zu tun, Hermann Constens Bedeutung nicht größer zu machen als sie tatsächlich war. Doch möchte ich ihn – zumal in einer Zeit, da uns bewusst geworden ist, dass vieles, was damals die Welt in Atem hielt, nicht an Aktualität eingebüßt hat – der Vergessenheit entreißen und damit seine unbestrittene Leistung als ein Grenzgänger zwischen den Kontinenten und Kulturen und als Initiator der deutsch-mongolischen Beziehungen würdigen. Nicht zuletzt soll das Buch Anstoß für andere sein, sich mit Hermann Consten und den geschichtlichen Ereignissen seiner Zeit zu beschäftigen. Wer wissenschaftlich an dem Thema interessiert ist, findet am Ende des Buches Quellenangaben und Anmerkungen. Literaturhinweise, Bildnachweis und Namensregister befinden sich im Anhang. Zur Verschriftung der russischen, chinesischen, mongolischen und türkischen Begriffe und Namen möchte ich noch Folgendes anmerken: in den von mir zitierten Originalquellen habe ich sie so belassen, wie sie dort geschrieben sind. Da Consten selbst in seinen veröffentlichten und unveröffentlichten Papieren keinerlei Systematik der Verschriftung erkennen ließ, sondern Namen und Begriffe je nach Gehör vielfältig variierte, habe ich dort gelegentlich eine Angleichung vorgenommen bzw. die aktuelle Umschrift in Klammern eingefügt. Im Buchtext selbst habe ich mich an der für die jeweilige Sprache international anerkannten wissenschaftlichen Umschrift, im Falle des Mongolischen, wo dies nicht verbindlich festgelegt ist, an der von Prof. Vietze entwickelten Umschrift für das moderne Mongolisch orientiert. Doris Götting, Münster, im Mai 2012 15
Einleitung
Abkürzungen ADMM BA/MA DITSL DKS HBO HIA MSA NAK NL MvO ÖHHStA PAdAA RHPG StuDeO
Archiv des Deutschen Museums, München Bundesarchiv/Militärarchiv, Freiburg i.Br. Deutsches Institut für Tropische und Subtropische Landwirtschaft, Witzenhausen Deutsche Kolonialschule Archiv der Hausbank Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln Hoover Institution Archives, Stanford University, Palo Alto Mongolisches Staatsarchiv, Ulaanbaatar National Archives Kew, London Nachlass Max von Oppenheim Österreichisches Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin Rheinische Handëi Plantagengesellschaft Studienwerk Deutsches Leben in Ostasien e.V., Eichenau
16
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904 1. Das schwierige Kind Geehrte gnädige Frau, […] Sie haben recht, Ihr Sohn Hermann ist eine saugutmütige Natur, die leicht sich begeistert, aber auch ebenso leicht wieder abwendet, die sich oft über den wahren Wert und ernste Schwierigkeiten einer Sache hinwegtäuscht. Aber ich habe den Eindruck, dass die Fehler seiner Natur durch seinen Lebensgang verursacht sind. Leute der Art wie er bedürfen ernster aber zugleich liebevoller Leitung. Sie müssen wissen, dass man es mit ihnen gut meint und dass man dennoch ihnen einen klaren festen Plan vorschreibt. Nun ist er zu alt geworden, um sich noch direkt beeinflussen oder sich etwas sagen zu lassen. Jetzt muss man, wie ich es versuche, ihn mit Gründen des Verstandes, der Ehre und des Gewissens zu leiten suchen, damit er selbst sich einen festen Weg sucht und mit Energie darauf bleibt. Ich hoffe, es gelingt uns. – Seine größte Gefahr ist die Neigung, sich nicht offen und frei im gewöhnlichen Verkehr zu geben, und dann auch, seinen Arbeiten, seinen Leistungen für gewöhnlich einen höheren Wert beizulegen, als das berechtigt ist. Spricht man aber unter vier Augen mit ihm und versteht man sein Ehrgefühl anzugreifen, dann tritt auch sein guter Kern zutage. Wie ich aus Ihren Briefen und seinen Reden durchfühle, scheinen Sie und die Ihrigen sich nur teilweise mit ihm recht zu verstehen. Wenn ich mir einen Rat zu geben erlauben darf, so meine ich, kommen Sie und ich am weitesten, wenn Sie ihn mit offenstem Vertrauen und mit freundlichem, gutem Rat entgegenkommen. Gegen Vorwürfe oder offenen Tadel in Gegenwart anderer verschließt er sich, das reizt ihn, weil er gerade die Neigung hat, vor anderen „zu blenden“. Aber ein gutes, offenes, liebevolles Wort zu ihm allein geredet, wirkt und bewahrt ihn auch vor falscher Einbildung und Trotz. Wie mir scheint, ist Ihr Sohn viel und zu oft gerade umgekehrt angefasst worden. Ich verkenne nicht, dass ein derartiger Charakter ihm gerade in den Kolonien zum Kummer werden kann; aber ich denke, er wird, je länger je mehr erkennen – schon hier, dass nur Tüchtigkeit, Offenheit und wirkliche Leistungen drüben zu dauerndem Erfolg führen. Wir weisen hier immer wieder darauf hin und richten die Übungen darauf ein, dass Schaumschlägerei für die Kolonien gar keinen Wert hat. […] Soweit ich sehe, weiß Ihr Sohn das auch, und 17
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
ich halte es darum bei seiner sonstigen mannigfachen Begabung für sehr wohl nützlich, dass er mit seinen Plänen, eine Viehzuchtstation sich anzulegen, auf einen grünen Zweig kommt. Denn an sich ist der Plan gut, vernünftig und aussichtsreich, wenn man einiges Kapital hat. 1 Ihr hochachtungsvoll ergebener Fabarius
Nicht der Brief eines feinsinnigen Psychologen und warmherzigen Pädagogen ist dies, sondern die Antwort von Dr. Ernst Fabarius, dem eher strengen, wiewohl menschenkundigen Direktor der Deutschen Kolonialschule im Werra-Städtchen Witzenhausen bei Kassel, auf die besorgte Nachfrage der Mutter – um präzise zu sein: der Stiefmutter eines seiner Schüler, Hermann Consten aus Aachen. Als Direktor Fabarius am 14. Mai des Jahres 1900 diese Zeilen schreibt, ist der junge Mann, um den es hier geht, 22 Jah re alt – in der Tat alt genug für gewisse Einsichten in den Ernst des Lebens, alt genug auch, seine Dinge allmählich selbst in die Hand zu nehmen. Aber offensichtlich erregen seine gelegentlichen Rückfälle in pubertäres Gehabe und sein unstetes Lernverhalten nicht nur immer von neuem heiligen Zorn bei den Eltern, sondern auch Besorgnis, ob aus ihm jemals etwas Anständiges werden kann. Der junge Hermann Josef Theodor Consten, Sohn eines wohlhabenden und angesehenen Aachener Schnapsfabrikanten und Brauereibesitzers, Ältester einer Schar von insgesamt neun Kindern, hat zu Beginn des neuen Jahrhunderts schon eine beachtliche Karriere als Schul- und Studienabbrecher hinter sich. Deren tiefere Gründe sind, so ist zu vermuten, tatsächlich wohl in den familiären Verhältnissen zu suchen, in die er am 14. März 1878 hineingeboren wurde, auch wenn dies als Erklärung allein sicher nicht ausreicht. Zweifellos dürfte der untersetzte, nicht unbedingt hübsche Junge mit seinem krausen dunklen Lockenschopf, auffallend wasserhellen Augen unter dichten Augenbrauen, dem immer etwas beleidigt wirkenden, wie ein ausschwingendes M nach unten gezogenen Mund und dem gespaltenen Kinn schon von Natur aus ein wildes, schwer zu bändigendes, ganz eigenwilliges, eben „zwiespältiges“ Kind gewesen sein. Doch kommt erschwerend hinzu, dass er im Alter von zehn Jahren plötzlich die leibliche Mutter, Maria Charlotte Consten, geborene Sauer verliert. Aus einfachen Arbeiterverhältnissen stammend, hatte die Tochter eines 18
1. Das schwierige Kind
Aachener Eisengießermeisters 1877 den Dampfbrennereibesitzer Hermann Josef Sebastian Consten geheiratet, der zur Aufsteiger-Generation der Gründerzeit gehörte. Von den fünf Kindern, die sie ihm gebar, überlebten drei. Die Geburt des letzten, 1888, kostete Mutter und Kind das Leben. Hermann wird nach dem Tod der Mutter in eine Klosterschule gegeben, wo Zwang, Zucht, Ordnung, Strafe und eine alles durchtränkende Katholizität den Tagesablauf bestimmen. Derweil heiratet, zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau, der Vater im Sommer 1890 erneut. Er nimmt Hermann aus der ungeliebten Schule, in der er bereits einmal sitzengeblieben ist und meldet ihn nach den Sommerferien 1890 in der Aachener Realschule an. Mit seiner zweiten Frau Anna Maria Huberty, einer hübschen, energischen und warmherzigen Bürgermeisterstochter aus Saeul im Großherzogtum Luxemburg, führt Hermann Josef Sebastian – wie 22 Jahre später sogar noch der Totenzettel des mit knapp sechzig Jahren Dahingegangenen ausdrücklich 2 vermerkt – eine „überaus glückliche und zufriedene Ehe“. Kein Wunder, dass in den Jahren nach der Eheschließung fünf weitere Brüder Hermanns und schließlich 1902 als jüngste die einzige Schwester, Anna Maria Josefa genannt Merette, den sich großbürgerlich gebenden Familienkreis der Constens erweitern. Dem Ältesten der großen Geschwisterschar, Hermann eben, dürfte diese Entwicklung wohl kaum behagt haben. Er fühlt sich ungeliebt, beiseite geschoben, was er durch auffallendes, geltungssüchtiges, unaufrichtiges Verhalten zu kompensieren sucht – mit der unausbleiblichen Folge, immer wieder elterliches, vor allem wohl väterliches Missfallen zu erregen. Er entwickelt sich zu einem schwierigen, sich unverstanden fühlenden Kind. Hermann Josef Sebastian Consten, der Vater, geboren 1852, war mit Geschäftstüchtigkeit und großem Fleiß zu Ansehen und Reichtum gelangt. Den Grundstein dazu hatte schon sein eigener Vater gelegt. 1829 hatte der Bauernsohn Johann Mathias Consten aus Kerkrade im Limburgischen in der Aachener Peterstraße – in jener Zeit ein Handwerker-, Arbeiter und Tagelöhnerviertel – eine Schankwirtschaft eröffnet, in der er selbstgebrautes Bier ausschenkte. Noch 1868 verzeichnete das Aachener Adressbuch Gärtner, Sackträger, Schuster, Fuhrleute, Kesselschmiede, Eisenarbeiter und einen Karussellbesitzer als Mitbewohner des schlichten dreistöckigen Hau3 ses Peterstraße 132. Johann Mathias hatte im Hinterhof eine kleine 19
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Schnapsbrennerei angebaut und, als das Geschäft zu florieren begann, das benachbarte, damals noch unbebaute Eckgrundstück am alten Kölntor, im Aachener Platt Köllepooz genannt, hinzu erworben. Hermann Josef Sebastian übernahm nach dem Tod seines Vaters im Herbst 1875 den inzwischen stadtbekannten Betrieb. 1878, als die Zukunft der Brennerei durch die Geburt des Sohnes Hermann gesichert schien, ließ er einen neuen Dampfkessel nebst Maschine einbauen. Bis 1909 kamen drei noch leistungsfähigere Kesselanlagen hinzu, die bauliche Erweiterungen des Brennereibetriebs er4 forderlich machten. Für seine Hausmarke Alter Consten schuf er sich im Laufe der Jahre ein Vertriebsnetz weit über Aachens Grenzen hinaus. Außerdem machte er glänzende Geschäfte mit einem Großhandel für Branntweine aller Art, Wein, Sekt und Liköre und mit der Generalvertretung der Sektkellerei Gebr. Schönberger, Mainz.
Abb. 1: Adler Brenn- und Brauerei Consten am Cölntor in Aachen. Postkarte um 1880
Von dem kontinuierlich gewachsenen Wohlstand kündete ab den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein hochherrschaftliches vierstöckiges Haus mit reichen Fassadenverzierungen, Türmchen und Erkern im Stil der Zeit auf dem Eckgrundstück am Kölntor. Zwei schwarze Adler auf der Brüstung des Eckbalkons der dritten Etage standen nicht nur für den neuen 20
1. Das schwierige Kind
Firmennamen Adler Brenn- und Brauerei, sondern auch für rheinpreußischen Geschäftssinn und den mit der Reichsgründung 1871 weithin propagierten deutschen Nationalstolz. Im Erdgeschoss des Hauses befand sich hinter dunkler Verglasung ein Brauhaus-Restaurant für das gehobene Publikum. In den darüber liegenden Geschossen, mit den Fenstern auf die vornehmere Heinrichsallee hinausgehend, richtete sich die vielköpfige Familie samt Dienstpersonal und Erziehern ein. Ein verblasstes Foto aus dem Jahre 1905, eines der wenigen aus jener Zeit, die sich noch im längst in alle Winde zerstreuten Familiennachlass befinden, zeigt das Ehepaar Consten – Hermann Josef Sebastian als wohlbeleibter Patriarch die Szene beherrschend – mit fünf der jüngeren Consten-Kinder und der Luxemburger Schwägerin Grédly, die einen reichen Grundbesitzer aus dem Aachener Umland geheiratet hatte, um den großen Tisch im Speisezimmer versammelt. Diesen schmückt eine kugelförmige Confiserieschale aus handbemaltem Porzellan – eines der wenigen Stücke aus dem Familienbesitz übrigens, das den Wechsel der Zeiten überdauert hat. Das Interieur des Raumes, in dem sich die Familie versammelt hat, spricht für sich: schwere Portieren an Fenstern und Türen, dunkle Tapeten mit Landschaftsgemälden in behäbigen Goldrahmen, marmorne Kaminsimse, reich mit kostbaren Vasen, Kandelabern, Kaminuhren und Porzellanfiguren geschmückt, darüber hohe, barock gerahmte Spiegel – fast kommt es einem vor, als befände man sich in einem Schloss. Kein Zweifel, die Constens hatten es zu etwas gebracht. Man war wer! Im geselligen, aber standesbewussten Aachen mit seiner über tausendjährigen ruhmreichen Vergangenheit als römische Garnison, Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation unter Karl dem Großen, der in der Kaiserpfalz des Aachener Doms seine letzte Ruhestätte fand und – in den nachfolgenden Jahrhunderten – als beliebter Kur-und Badeort von Kaisern, Königen und anderen Zelebritäten aus ganz Europa, war ein solcher gesellschaftlicher Aufstieg aus einfachen Verhältnissen gewiss keine Kleinigkeit. Doch die Zeiten waren günstig für Karrieren. Aachen selbst war eine aufstrebende Industriestadt geworden. Tuchfabriken und Eisenwerke zogen immer mehr Menschen an. In wenigen Jahrzehnten hatte sich die Einwohnerzahl der Stadt verdoppelt. 1890 zählte Aachen erstmals über100.000 Bürger und wurde damit die westlichste Großstadt der preußischen 21
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Abb. 2: Hermann Consten senior im Kreis seiner Familie. Privatfoto 1905
Rheinprovinz. Die Constens besaßen ohne Zweifel den Ehrgeiz, eines Tages zur feinen Gesellschaft Aachens zu gehören. Nicht zuletzt deshalb wurden in den Nachwuchs hohe Erwartungen gesetzt; in ihre Erziehung und Ausbildung wurde viel Geld investiert, war das Beste gerade gut genug. Die Kinder, allen voran Hermann als Ältester der acht Söhne Hermann Josef Sebastians, sollten es noch weiter bringen als der Vater. Und für das Nesthäkchen Merette wurde eigens ein englisches Fräulein engagiert. Die Vorfahren der Constens, Bauern und Handwerker, waren ab dem 17. Jahrhundert aus der Gegend von Kerkrade in der niederländischen Provinz Limburg in den Raum Aachen zugewandert. Sie hatten sich in den ländlichen Gemeinden der Soers, einer hübschen Hügellandschaft nordwestlich Aachens niedergelassen. Die Kirchenbücher von Sankt Laurentius in Laurensberg, das heute zu Aachen gehört, verzeichnen seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine ganze Reihe Hochzeiten, Kindstaufen und Sterbedaten von Trägern des Namens Consten oder Contzen aus den umliegenden Dörfern. Doch siedelten die direkten Vorfahren der Aachener Constens weiter östlich in Verlautenheide, nahe beim heutigen Autobahn22
1. Das schwierige Kind
kreuz Aachen. Bis ins späte 19. Jahrhundert hinein variierte die Schreibung des Familiennamens zwischen Consten, Contzen und Conzen. Erst Hermann Josef Sebastian ließ anlässlich seiner Eheschließung 1877 den Namen Consten, rückwirkend auch für seinen Vater, als amtlich verbindlich ins 5 Aachener Standesregister eintragen. Und so erhielt auch sein im Jahr darauf geborener erster Sohn Hermann den nunmehr offiziellen Familiennamen Consten. Hermann Constens „Lebensgang“, wie es Direktor Fabarius im anfangs zitierten Brief an die Stiefmutter formuliert hatte, steht wohl von Kindheit an nicht gerade unter einem glücklichen Stern, auch wenn es ihm materiell an nichts mangelt. Der frühe Tod der leiblichen Mutter, zwei klösterliche Internatsjahre fern von den jüngeren Brüdern und den Spielkameraden aus der Peterstraße, schlechte Schulleistungen mit allen ihren negativen Folgen für ein gedeihliches Familienleben belasten die Kindheitsbiografie. Als Gymnasiast scheitert Hermann offenbar schon im ersten oder zweiten Jahr, denn 1890 – eigentlich müsste er schon Quartaner sein – wechselt der inzwischen zwölfjährige Junge in die Quinta der Aachener Realschule, mit ähnlich enttäuschenden Ergebnissen. Als er zu Ostern 1892 wegen ungenügender Leistungen in fast allen wichtigen Fächern, selbst in Religionslehre und Singen, nicht von Quarta nach Untertertia versetzt wird, ist die erneute Trennung von der Familie vorprogrammiert. Zwar wird ihm im Abgangszeugnis attestiert, sich gut betragen zu haben, aber es habe ihm an Aufmerksamkeit und Fleiß gemangelt. Einzig Geschichte und Erdkunde hatten sein ungeteiltes Interesse am Unterricht zu wecken vermocht: das Doppelfach wurde mit Gut benotet, und im Fach Naturbeschreibung gelang ihm 6 immerhin ein Genügend. Doch wird wohl niemand unter den Erziehungsberechtigten der Aachener Realschule, auch der Vater nicht, den Fingerzeig künftiger Passionen und künftigen Lebensschicksals erkannt haben; das vernichtende Gesamtbild überwog nun einmal. Wie fühlt sich ein aufgewecktes Kind, dem sein Versagen in dieser Weise bescheinigt wird? Was geht in ihm vor? Es ist an der Zeit, sich hineinzudenken in einen Jungen, der angesichts dieser Lernmisere gar keine andere Wahl hat als abzutauchen in eine Traumwelt, in der er sich als starken Helden phantasieren kann, der Abenteuer sucht und Kämpfe besteht, aus denen er immer siegreich hervorgeht. Er baut sich, so ist zu vermuten, eine 23
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Phantasiewelt auf, die er sorgfältig vor den anderen zu verbergen sucht. Statt seine Hausaufgaben zu erledigen, vergräbt er sich in spannende Erzählungen über Helden der Antike und ferne Länder. Er schlüpft in die Rolle von Eroberern und sucht die Objekte ihrer Begierde, ferne Länder und Städte, mit dem Finger auf der Landkarte. Er reitet an der Seite der Häuptlinge Karl Mays durchs wilde Kurdistan und über die Prärien Amerikas. Er kämpft mit den Guten gegen das Böse. Er gewinnt Königreiche und schöne Prinzessinnen. Er durchstreift Urwälder und Wüsten und überquert Flüsse voll lauernder Gefahren. Er durchpflügt die Meere und klettert auf die höchsten Berggipfel. Er flaniert durch fremde Städte und kehrt ein bei Eremiten, die unbekannten Göttern dienen. Der kleine Hermann Consten träumt sich groß, auch in der Schule; er ist während der Mathematik- und Deutschstunden, im Französisch- und Gesangsunterricht wie auch bei den Unterweisungen in christlicher Sitte und Anstand ganz woanders als er sein soll. Seine Aufmerksamkeit und sein Fleiß richten sich auf andere Ziele als die, die von ihm erwartet werden. Und wenn man ihn aus diesen Träumen aufscheucht, wenn man ihn tadelt und bestraft, dann rebelliert, dann stört er, dann treibt er Unsinn, lügt, gibt „Widerworte“, dann verteidigt er sein geheimes Reich mit Aggressivität und Trotz. Ein „liebes Kind“ zu sein, sich „Liebkind“ zu machen, ist nicht seine Sache. Das entspräche auch nicht dem männlichen Charakter der Helden, in deren Rollen er heimlich schlüpft. Nur in den Spielen mit seinen Altersgenossen glaubt er seine Phantasien auch ausleben zu können, da will nur er der Anführer sein. Ihnen will er zeigen, was in ihm steckt, ihm sollen sie durch Dick und Dünn Gefolgschaft leisten. Wollen sie ihn aber als „Häuptling“ nicht anerkennen, macht ihm ein Anderer gar seinen kindlichen Führungsanspruch streitig, wird er wütend oder wendet sich schroff von seinen Freunden ab. Er ist ein Raufer und Raubautz, ein Angeber und Draufgänger, ein kleiner Dampfkessel, in dem es ständig brodelt, mit anderen Worten: ein Erwachsenen- und Kinderschreck. Doch der Sohn des Dampfbrennereibesitzers Consten hat auch ein Ventil, wenn der innere Druck zu stark wird. Bei den bäuerlichen Verwandten auf dem Lande, dort, wo heute die Bettentürme des Aachener Klinikums aufragen, da darf er sich austoben, dort gibt es Vettern und Cousinen zum Spielen und vor allem Pferde, mit denen er wilde Ritte in die nahe 24
1. Das schwierige Kind
Soers unternimmt. In der freien Natur fühlt er sich wohl, vielleicht ist er dort sogar für Stunden ein glückliches Kind. Aber was er wirklich will, weiß er selbst nicht genau. Nur was er nicht will, das weiß er: Er will nicht so werden wie sein Vater. Der aber bestimmt vorerst noch, was mit dem schwer zu bändigenden Schulversager weiter zu geschehen hat. Hermann Josef Sebastian Consten meldet seinen Ältesten zum Sommersemester 1892 beim Institut Garnier in Friedrichsdorf im Taunus an, einem Handelsinternat von internationalem Ruf, das – wie er nicht zu Unrecht vermutet – den Neigungen seines Sohnes eher entsprechen könnte. Dort soll man ihn „zur Vernunft bringen“ und aus ihm einen Kaufmann internationalen Zuschnitts machen, der eines Tages sein Nachfolger werden kann, der die Adler Brenn- und Brauerei zu einem globalen Unternehmen macht und das Familienprodukt Alter Consten weltweit vermarktet. Benannt war die „Garnier'sche Lehr- und Erziehungsanstalt“ nach ihrem Gründer Louis Frédéric Garnier, dem Sohn eines Friedrichsdorfer Tuchfabrikanten. Im Jahr 1836 eröffnete Louis Frédéric Garnier in dem 1687 gegründeten hessischen Hugenotten-Städtchen seine Maison d'Education für Jungen und füllte damit eine Marktlücke im angehenden Industriezeitalter. Ein auf den internationalen Handel ausgerichteter Fächerkanon in den Unterrichtssprachen Französisch und Deutsch sollte Zielgruppen im Inund Ausland ansprechen. Das Unterrichtskonzept war für das 19. Jahrhundert ausgesprochen modern und weltoffen. Neben einem von Muttersprachlern erteilten Sprachunterricht in Französisch, Deutsch und Englisch nebst Konversations- und Sprechübungen sowie Grundkenntnissen in Latein lernten die Jungen dort Algebra, Arithmetik und Geometrie, Physik und Chemie „mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendung auf Ackerbau und Industrie“, ferner Geographie und Geschichte, natürlich auch doppelte und einfache Buchführung, Handelskorrespondenz und – nicht zu vergessen – „Kalligraphie“. Damit ist jene schnörkelreiche, elegante Kanzleischrift gemeint, die die Lektüre trockenster Bilanzbücher des 19. Jahrhunderts immerhin zu einem ästhetischen Vergnügen macht – und die schließlich auch in Hermann Constens Handschrift ihre unübersehbaren Spuren hinterlassen wird. Hinzu kamen deutsche und französische Literaturgeschichte und, um auch gesellschaftlich glänzen zu können, Zeichnen, 25
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Gesang, Tanz und Turnen. Den evangelischen Religionsunterricht besorgte der ortsansässige Pfarrer aus der schräg gegenüberliegenden französisch-reformierten Kirche, für katholische Schüler wie Hermann war der Geistliche aus der Pfarre St. Johannes im benachbarten Kirdorf zuständig. Auch jüdische Schüler nahm das Institut auf. Der Abschluss mit der mittleren Reife (Obersekunda) entsprach der Prüfungsordnung des Fürstentums Hessen-Nassau für Oberrealschulen. Die Abschlussprüfungen fanden unter Aufsicht eines Vertreters des Kasseler Königlichen Provinzial-Schulkollegiums statt. Die Schüler, überwiegend Söhne von Kaufleuten und Unternehmern, aber auch von Gutsbesitzern, Architekten und Ärzten, kamen aus ganz Deutschland; etwa 16 Prozent waren Ausländer, meist Engländer, Österreicher und Amerikaner. Prominentester Lehrer am Institut Garnier war Mitte des 19. Jahrhunderts Philipp Reis gewesen, der Erfinder des Telefons; zu den prominentesten Schülern zählte Mathaeus Müller, der Gründer einer bekannten Sektkellerei im Rheingau. Die Erziehungsmethoden des Institut Garnier waren liberal, körperliche Züchtigungen verpönt. Zum Konzept gehörte jedoch, die Eltern der Zöglinge alle Vierteljahr, bei Bedarf auch häufiger, über Betragen und Leistungen ihrer Sprösslinge schriftlich auf dem laufenden zu halten. Dieser Schriftverkehr wurde in einem Korrespondenzbuch festgehalten, das – zusammen mit Schulmatrikel, Prüfungsunterlagen und Schülerarbeiten – heute im Stadtarchiv Friedrichsdorf aufbewahrt 7 wird. Leider sind ausgerechnet die Jahrgänge des Korrespondenzbuchs, in denen Hermann Consten dort Zögling war, nicht mehr vorhanden. Aber wir können davon ausgehen, dass er sich in Friedrichsdorf insgesamt wohler fühlte als in Aachen. Aufmerksamkeit und Fleiß nahmen zu, seine Leistungen verbesserten sich. Und tatsächlich schaffte er nach drei Jahren, im Herbst 1895, den Schulabschluss, das sogenannte „Einjährige“ – seine Aachener Altersgenossen büffelten da wohl schon für das Abitur. Vielleicht war es sein vergleichsweise schon „fortgeschrittenes“ Alter, das Hermann Consten später dazu verleiten sollte, die Annahme, auch er habe es in der Schule bis zur Universitätsreife gebracht, nicht zu dementieren. Erste Versuche, den eigenen Werdegang durch geringfügige autobiographische Manipulationen zu „schönen“, die ihm manchmal durch reinen Zufall zugespielt wurden, (in Friedrichsdorf lautete z.B. die Zählung der 26
1. Das schwierige Kind
Klassen ... Tertia, Sekunda, Prima, nicht Unter-, Ober- etc.) oder, wie sich der eingangs zitierte Dr. Fabarius auszudrücken beliebte, seinen Arbeiten, seinen Leistungen für gewöhnlich einen höheren Wert beizulegen, als das berechtigt ist, muss es bei Hermann Consten schon bald nach 1895 gegeben haben. Aber noch ist es nicht so weit, noch steht er erst am Anfang seiner Friedrichsdorfer Schulkarriere. In der Schulmatrikel des Institut Garnier vom Sommersemester 1892 ist der Neuzugang Hermann Consten aus Aachen unter der laufenden Nummer acht eingetragen. Ferner ist die Vorlage einer beglaubigten Abschrift des Abgangszeugnisses der Realschule Aachen mit dem Vermerk „Quarta (nicht versetzt)“ bestätigt, und dazu die knappen Hinweise: „Musikunterricht: keiner, Wäsche Nr. 104, Tag des Eintritts: 20.4.92“. Unter der Rubrik „Bemerkungen“ findet sich noch folgender Eintrag: Hat verschiedene Augen; soll untersucht werden; soll aber dann die Brille 8 nur bei der Arbeit tragen. Abends 1 Glas Bier. Zahlung geleistet.
Ein teurer Schulwechsel des Sohnes war dies für den Aachener Brennereibesitzer Hermann Josef Sebastian Consten gewiss. Denn dem hohen Anspruch des Institut Garnier entsprach die Höhe des Schulgeldes, das jeweils halbjährlich im voraus entrichtet werden musste. Allerdings schloss die zu zahlende Summe auch die Kosten für die Unterbringung im Internat, also Logis, Verpflegung, Wäsche, Arzt und „Domestiken“ mit ein. Für das Sommersemester betrug das Schulgeld 620 Mark – Goldmark versteht sich – und 670 Mark für das Wintersemester, schließlich musste im Winter geheizt werden. Hinzu kamen sechs Mark für Lehrmaterialien und weitere sechs Mark für die Lehrer-Pensionskasse. Von zuhause mitzubringen hatten die Zöglinge: 8 Handtücher, 4 Betttücher, 3 Kissenbezüge, 1 rote wollene Bettdecke, 3 Servietten, 4 Nachthemden, 2 Nachtjacken für den Winter, 3 Paar Unterhosen, 12 Hemden, 18 Paar Strümpfe, 24 Taschentücher, 1 Toilettenkas9 ten, 1 Federmesser.
So ausgestattet tritt denn Hermann Consten nach den Osterferien 1892, wenige Wochen nach seinem unrühmlichen Abgang von der Aachener Realschule die Reise nach Friedrichsdorf an. Da steht nun der 14-jährige Schüler 27
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
in fremder Umgebung, weit weg von Aachen mit all seinen familiären Bedrückungen. Und dies in einer Zeit, da der Stimmbruch eingesetzt hat und sich allmählich aus dem Knaben der künftige Mann herausschält. Hermann Consten befindet sich mitten in der Pubertät, was eher als Erschwernis seiner Lage angesehen werden könnte. Viel Eingewöhnungszeit in Friedrichsdorf bleibt ihm nicht, auf ihn kommt Arbeit zu. Denn der Schultag ist lang, der Fächerkanon umfangreicher als an der Aachener Realschule. Auch an den Abenden haben die Schüler nicht immer frei. Manchmal sind nach Beendigung des Abendessens im Speisesaal Vorträge angesetzt. Einer der Lehrer spricht über ein aktuelles Thema aus Politik und Wirtschaft, ein hervorragendes neues Buch oder über ein klassisches Dichtwerk. Für die SchülerMusikkapelle sind manchmal Probenabende angesetzt, doch davon bleibt der völlig unmusikalische Hermann glücklicherweise verschont. Er nutzt die Zeit bis zum Schlafengehen also, im Lesezimmer zu schmökern, er schreibt Briefe nach Hause – ein bisschen Heimweh hat er schließlich schon. Und bei gutem Wetter tobt er abends mit den rasch gewonnenen Kameraden noch auf dem Spielplatz, bis die Dunkelheit einsetzt. Ob er da immer als Anführer akzeptiert wird? Zunächst vermutlich einmal nicht, da dürfte er froh sein, wenn die anderen ihn überhaupt mitspielen lassen. Die Sonntage sind ziemlich langweilig in dem stillen Ort. Die Erkundung des Städtchens dürfte Hermann Consten schnell erledigt haben. Man kann die Hugenottenstraße mit ihren Hofreiten, der Kirche, dem Wohnhaus von Philipp Reis und den kleinen Färbhäuschen der ansässigen Leinen- und Flanellweber entlang laufen, auch mal einen Blick in einen der malerischen Innenhöfe werfen oder das Labyrinth der schmalen „Gängelchen“ erkunden, die sich zwischen den Gärten hinter den Häusern hinziehen. An warmen Tagen ist es auch schön, durch den Spießwald nach Burgholzhausen und von dort nach Seulberg hinüber zu wandern. Für die katholischen Schüler gibt es immerhin eine kleine sonntägliche Abwechslung, wenn sie zum Gottesdienst nach Homburg vor der Höhe gefahren werden. Da gibt es etwas mehr zu sehen, denn Homburg ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ein beliebter Kurort der Monarchen, ähnlich wie Aachen. Vor allem Kaiser Wilhelm II. verbringt die Sommermonate gern im Homburger Schloss mit seinem weitläufigen Park und nimmt die wohltuende Wirkung der Heilquellen in Anspruch. Sein Vater hatte dort 1883 sogar ein Kaiser28
1. Das schwierige Kind
manöver abhalten lassen. Die Größen des Deutschen Reiches und die aktuelle Politik rücken allmählich in das Bewusstsein des jungen Mannes. Einmal jährlich findet im Institut Garnier ein Schulfest statt. Wie diese Feste abliefen, zu denen auch ehemalige Schüler mit ihren Familien geladen waren, schilderte ein Bericht in einer der späteren Ausgaben der Schulzeitschrift Sonnez: Wie im Vorjahre so nahm der nicht-offizielle Teil unserer Festfeier auch dieses Mal seinen Anfang mit einem solennen Frühschoppen im Garten des Gasthofes zum Adler. […] Der spätere Nachmittag verfloss unter Konzert und Tanz und sonstiger Kurzweil nur allzu schnell. Dieses Mal hatte sich zum Feste auch fahrendes Volk mit Karoussell, Schnellphotographie u. dergl. eingefunden, sodass es an Abwechslung für Alt und 10 Jung nicht mangelte. […].
Eine der besonderen Festfeiern dürfte Hermann Consten miterlebt haben, das war 1894, zur Erinnerung an den Institutsgründer, die Einweihung des Wandbrunnens an der Seitenmauer des alten Schulgebäudes. Eingefasst von rotem Sandstein wurde über dem Wandbrunnen eine weiße Marmorplatte angebracht, in die mit goldenen Lettern folgender Leitspruch für die Schüler eingemeißelt war: Mein Sohn, / werd ein Mann; wie dies Wasser so rein, /und wie die Quelle so tief /sei dein Wissen.
Im Juli 1895 wird Hermann Consten mit 22 weiteren Klassenkameraden zur Abschlussprüfung zugelassen. Im August beginnen die schriftlichen Prüfungen in den Fächern französische und englische Übersetzung, Mathematik und Deutsch. In den Protokollen der drei Prüfungstage ist minutiös festgehalten, wann die Schüler mit den Prüfungsaufgaben beginnen, wann und wie oft sie zwischendurch den Raum verlassen und wann sie schließlich ihre Arbeiten bei der Prüfungsaufsicht abliefern. Consten gibt immer erst in der letzten Minute ab; die Reinschrift des Deutschaufsatzes schafft er nicht bis zu Ende. Aus den Lehrerbemerkungen am Rande der von ihm abgelieferten Arbeiten ist ersichtlich, dass seine Leistungen in etwa dem Niveau entsprachen, das er während der drei Jahre in Friedrichsdorf gehalten hat: Genügend, was unserem heutigen Befriedigend entspricht. 29
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Aufschlussreicher als dieses eher unspektakuläre Ergebnis ist Constens Themenwahl beim Deutschaufsatz. Drei Alternativen stehen zur Wahl: 1. Die Verbannung und das Ende der Jungfrau von Orleans (nach Schillers Drama) 2. Was verdankt die Welt der Thätigkeit des Kaufmannes? 3. Friedrich der Große als Friedensfürst. Consten entscheidet sich für das zweite Thema, behandelt es, entgegen der Erwartung der Prüfungskommission, aber nicht unter dem Gesichtspunkt der internationalen Bedeutung kaufmännischer Aktivitäten im ausgehenden 19. Jahrhundert; der mittlerweile 17-jährige junge Mann schweift vielmehr ab in die Historie und stilisiert den Handelsherrn weit zurückliegender Zeiten, vor allem die Hansekaufleute und die Phönizier, zu Kulturträ11 gern par excellence. Denn, so schreibt er in seiner noch etwas kindlichen Schrift, neben den landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkten ihrer Heimat, brachten sie auch Kunst und Wissenschaft zu deren Abnehmern. Doch hat der junge Consten schon erkannt, dass es in der Antike die Vorfahren der Deutschen gewesen waren, denen die Segnungen fremder, höherer Kulturen zuteil geworden sind. Unter anderem schreibt er dazu: Greifen wir noch weiter in der Geschichte der Völker zurück, so finden wir die kühnen phöninzischen [sic] Kaufleute, die mit ihren Schiffen alle bekannten Meere durchfurchten um den fremden Völkern die Erzeugnisse ihres Landes und ihres Geistes zu bringen. Nach dem Norden Deutschland brachten sie die süßen Früchte des Südens. In ihren Nachbarländern verbreiteten sie die Erfindung des Purpurs und des Glasses [sic] und sie verbesserten so die Sitten und Gebräuche der Völker.
Und der Prüfling erkennt auch bereits die Wirkung wechselseitiger Einflüsse, die der moderne Handelsaustausch mit sich bringt. In der Sprache des 17-Jährigen klingt das so: Dadurch das [sic] nun die Schiffe aus den fernen Ländern zurückkehren, bringen sie aber nicht nur die Boden- und Industrieprodukte und Geistesarbeiten mit in ihre Heimat, nein, sie bringen ihr auch die Kultur des fremden Landes. Der plumpe aber ehrliche Nordländer erhält durch die zurückkehrenden Schiffe die Sitten des gewandten aber leichtlebigen Südländers, von denen ein echter Volksstamm nur die guten Seiten an30
1. Das schwierige Kind
nehmen würde, umgekehrt bringt er die Festigkeit und Ehrenhaftigkeit der Nordländer dem leicht eregbaren [sic] Sohne des Südens. Wenn sich so die guten Sitten des Nordens mit denen des Südens paaren und vermischen, so wird langsam aber sicher die Kultur jenes Landes, worin der Kaufmann thätig ist, gehoben. Aber nicht nur führt er die Produkte und Sitten des Landes seiner Heimat zu, er verbessert durch seine Thätigkeit die Geldlage seines Vaterlandes, durch die Verarbeitung der roh eingeführten Produkten gibt er dem Arbeiterstand Gelegenheit zur Arbeit und 12 Verdienst und verteilt so wieder das Geld über das ganze Land.
Handelsimperialistisches und rassistisches Gedankengut der Zeit vermischt sich in der Schülersicht mit vagen Vorstellungen eines fruchtbaren gegenseitigen Kulturaustauschs und den eigenen Sehnsüchten, hinauszugehen und Abenteuer zu erleben. Der nüchterne Vermerk des Prüfers am Rand dieses Elaborats verweist auf Stärken und Schwächen des Schülers Hermann Consten: Dem Verfasser steht über das gestellte Thema reichlicher Stoff zur Verfügung, die Gedanken sind auch meist richtig, wenn auch manchmal übertrieben. […] Verfasser spricht mehr von den Phöniziern und Handelsstädten als von dem Kaufmann der Jetztzeit. In Hinsicht auf den Stil enthält der Aufsatz mehrere grammatische Fehler, sonst ist der Ausdruck logisch klar und authentisch, im ganzen betrachtet wohl befriedigend. Verfasser bemüht sich oft mit Geschick und Erfolg, lebendig, anschaulich und eindringlich darzustellen, freilich fehlt oft die Feile.
Immerhin, diese Hürde ist geschafft. Im September 1895 hält Hermann Consten erstmals ein Dokument in der Hand, das ihm Zukunftsperspektiven eröffnet, mit dem das Leben weitergehen kann und dessen sich auch die Familie in Aachen nicht zu schämen braucht: das „Zeugnis über die 13 wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Dienst“. Überraschend allerdings ist die in der Abschlussurkunde festgehaltene Berufswahl des jungen Mannes. Er will nicht etwa Kaufmann werden, wie sein Vater gehofft hatte, sondern Landwirt. So dürfte er ein weiteres Mal die Erwartungen der Familie enttäuscht haben. Allerdings stellt er schon wenig später selbst infrage, ob er es damit überhaupt ernst gemeint hat. Hermann
31
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
schreibt sich an der Technischen Hochschule seiner Heimatstadt Aachen ein – im Fach Architektur.
2. Zwischen Freiheits- und Bindungsdrang Ein eigenartiger Spannungsbogen zwischen unbändigem Freiheitsdrang und selbst gewählten Bindungen kennzeichnet die nächsten drei Jahre. Der Architekturstudent Hermann Consten verbringt sie zunächst in Aachen und dann in Karlsruhe. Das Studium selbst spielt zwar eine Rolle; er betreibt es sogar mit relativer Gewissenhaftigkeit, zumindest in den Fächern, die ihm zu liegen scheinen. Aber letztlich vermag er in der eingeschlagenen Berufsrichtung doch nicht jenes vage ins Auge gefasste Ziel zu erkennen, das seinem ständig unruhigen, suchenden Geist auf Dauer verlockend erscheint. Zunächst einmal jedoch genießt der siebzehnjährige junge Mann natürlich seine neuen Freiheiten, und dies so ausgiebig, dass er bald schon erneut Anstoß erregt. Schließlich wohnt er während der beiden Aachener Semester wieder bei den Eltern im Haus am Kölntor, er bewegt sich gewis sermaßen an der „langen Leine“. Doch das Studentenleben in der alten Kaiserstadt bietet ihm Abwechslung genug, es mangelt Aachen ja nicht an Bierkneipen und Tanzsälen. So manche Nacht dürfte der Studiosus der Architektur durchzecht haben, und dies mit Sicherheit nicht im väterlichen Lokal. Aachens Studenten treffen sich woanders. Ihr Quartier Latin liegt ganz in der Nähe der Technischen Hochschule; in den Kneipen rund um Templer- und Karlsgraben. Im Kloubert zum Beispiel, gleich auf der anderen Straßenseite, sind Bier und Tabak billig. Das Kolonialkaffee mit seinem dahinter gelegenen Bierstüberl ist bei Studenten ebenfalls beliebt. Ziele nächtlicher Kneiptouren sind außerdem einige Orte der Umgebung, darunter Vaals gleich hinter der holländischen Grenze oder Moresnet in Belgien. Zu Musik und Tanz zieht man mit den Töchtern der Stadt zum Belvedere auf den Lousberg oder ins Eich. Korporierte treffen sich in ihren eigenen Kneipheimen, die von der gut betuchten Altherrenschaft finanziert wer14 den. Schon bald tummelt sich der frischgebackene Studiosus im Kreis der Kommilitonen, er schließt sich einer Burschenschaft an, wo er Fechtunterricht nimmt und an den Kneip-Abenden die Trinkfestigkeit der Grünschnäbel unter Beweis gestellt werden muss. Dass Hermann sich, dem familiären 32
2. Zwischen Freiheits- und Bindungsdrang
Korsett noch nicht einmal ganz entronnen, damit erneut einem strikten Ritual, dem der florett- und säbelfechtenden Konformität akademischen Zeitgeistes und wilhelminischer „Traditionspflege“ unterwirft, steht zwar vordergründig im Widerspruch zu seinem Streben nach Unabhängigkeit; doch scheinen ihn diese selbst gewählten Fesseln weit weniger zu stören als die erzwungene Unterwerfung unter elterliche oder schulische Autorität, kommen sie doch seinem wilden Draufgängertum aufs Vortrefflichste entgegen. Zum Wintersemester 1895/96 hat sich Hermann Consten, unter dem Datum des 15. Oktober 1895, an der Technischen Hochschule am Aachener 15 Templergraben eingeschrieben. Die 1863 als Polytechnische Schule gegründete und 1870 eröffnete Studienstätte gehört im ausgehenden 19. Jahrhundert zu den Zentren berufsorientierter Forschung und Lehre im Deutschen Kaiserreich, sie ist eine der modernsten Einrichtungen ihrer Zeit. Der Fächerkanon umfasst neben Maschinenbau und Bauingenieurwesen auch Elektrotechnik, Chemie und Hüttenwesen sowie Architektur. Gleich eine ganze Fülle von Kursen belegt das Erstsemester in diesem Fach. Offiziell studiert Hermann nun Höhere Mathematik, Geometrie, Mechanik, Baukonstruktion, Formenlehre, Ornamentik, Allgemeine Kunstgeschichte, Moderne Kunst und Figürliches Zeichnen. Doch in etlichen der belegten Vorlesungen und Seminare dürfte er schon bald durch Abwesenheit geglänzt haben. Nicht zuletzt angesichts seines nicht minder intensiven Nachtlebens dürfte ihn das selbst auferlegte Pensum schlicht überfordert haben. Im Sommersemester 1896 reduziert er seine Kurse, von anfänglich neun auf nur noch fünf. Die mathematischen Fächer und Figürliches Zeichnen, die ihm zu viel der Geduld mit sich selbst und Disziplin abverlangen, hat er gleich ganz gestrichen. Und Moderne Kunst – Japonismus und Art Nouveau hatten den französischen Kunstgeschmack bereits umgekrempelt; in Deutschland war der Jugendstil gerade im Kommen – ersetzt er, dem gängigen historisierenden Zeitgeschmack eher entsprechend, durch das Fach Deutsche Kunst. Da scheint wohl die häusliche Umgebung im neogotisch und neobarock überladenen Gründerzeitbau des Vaters an der Aachener Köllepooz auf das Stilgefühl von Consten junior kräftig abgefärbt zu haben. In Formenlehre und Ornamentik wiederholt Hermann die Anfängerkurse. Immerhin, in den Fächern Baukonstruktion und Allgemeine Kunstge16 schichte kommt er einen kleinen Schritt voran. 33
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Der Vater jedoch dürfte über den bescheidenen Leistungsausweis seines Ältesten in den ersten beiden Studiensemestern nicht gerade entzückt gewesen sein. Und die nächtlichen Eskapaden des fidelen, zu jedem Unfug aufgelegten Studiosus dürften erst recht nicht väterliches Wohlwollen hervorgerufen haben. Im Sommersemester 1896 nehmen – ernsten Ermahnungen zum Trotz – die Tollheiten des Ältesten der Consten-Brüder sogar noch zu. Der gutbürgerlichen Aachener Gesellschaft, die dem studentischen Treiben in ihrer altehrwürdigen Stadt ohnehin keine besonderen Sympathi17 en abgewinnen kann, bleibt dies nicht verborgen, zumal da die Töchter einiger angesehener Familien vor den Nachstellungen Hermanns, den man wegen seines dunklen Lockenkopfes nur den „schwarzen Consten“ nennt, nicht sicher sein können. Dabei hat der jugendliche Heißsporn sein Herz offenbar an die Cousine Maria, genannt Mie verloren, die er schon aus Kindertagen kennt. Aber da gibt es wohl doch natürliche Hemmungen und gesellschaftliche Tabus, die auch er respektiert. So ist ungewiss, ob sie es war, der er mächtig imponieren wollte mit einem tollkühnen Ritt. Vielleicht war es eine andere Schöne, vielleicht auch nur eine Burschen-Wette, eine spätpubertäre Mutprobe vermeintlichen Mannestums, um den Kommilitonen zu beweisen, dass er ein ganzer Kerl ist. Jedenfalls gerät ein Husarenstück Hermanns nach Art des „Tollen Bom18 berg“ oder des Freiherrn von Münchhausen zum öffentlichen Skandal. Am Fronleichnamsfest 1896, einem hohen katholischen Feiertag, an dem sich eine feierliche Prozession vom Kaiserdom aus durch Aachens Straßen und Gassen bewegt, erscheint der Studiosus hoch zu Ross. Als plötzlich die Trompeten der die Prozession begleitenden Musikkapelle einsetzen, scheut sein Pferd und prescht kurzerhand mitten hinein in den frommen Zug. Priester und Gläubige stieben entsetzt auseinander, um nicht unter die Hufe zu geraten. Für den Vater, der um seine Reputation und die zahlungs kräftige Kundschaft fürchten muss, gibt es nur eine Konsequenz aus dieser Blamage. Zornrot legt er seinem Erstgeborenen nahe, möglichst umgehend aus Aachen zu verschwinden und sich vorerst dort nicht wieder blicken zu 19 lassen. Was soll nun aus dem angefangenen Architektur-Studium werden? Die TH Karlsruhe bietet sich zum Glück als Alternative an. Und die angebetete Mie? Sie wird eines Tages jemand anderen heiraten, aber zu Hermann immer freundschaftlichen Kontakt halten. 34
2. Zwischen Freiheits- und Bindungsdrang
Nun also Karlsruhe als neuer Studienort. Consten junior ist zum ersten Mal auf sich allein gestellt in einer fremden Stadt. Die väterlichen Ermahnungen, vielleicht auch Drohungen haben auf den mittlerweile Achtzehnjährigen einen gewissen Eindruck gemacht. Er will das Studium nun ernster nehmen, schreibt sich zum Wintersemester 1896/97 an der Technischen Hochschule des Großherzogtums Baden ein und mietet sich ein Zimmer am Zirkel 33a, nahe beim Karlsruher Schloss – was immerhin den Schluss zulässt, dass der Vater nicht die Mittel gekürzt hat, sondern auf standesgemäße Unterbringung des Sohnes weiterhin Wert legt. Die Technische Hochschule Karlsruhe, weit älter als die Aachener Schwesterinstitution, genießt einen anerkannten Ruf, vor allem was das Fach Architektur betrifft. Nach dem Vorbild der École Polytechnique in Paris stiftete Großherzog Ludwig bereits 1825 die Polytechnische Hochschule. 1865 wurde sie mit voller Hochschulverfassung ausgestattet und 1885 offiziell in Technische Hochschule umbenannt. 1899 erfolgte, wie im Falle anderer Technischer Hochschulen auch, die Verleihung des Promotionsrechts. Ab 1904 sollten dann sogar Frauen zum Studium zugelassen werden. Heute besitzt die Frideri20 ciana Universitätsrang. Ab dem Wintersemester 1896/97 ist Hermann Consten in der Karlsruher 21 Hochschulmatrikel unter der Fachabteilung Architektur eingetragen. Insgesamt vier Semester wird er durchhalten und, wie die Testate seiner Lehrer zeigen, trotz steigender Anforderungen sogar mit insgesamt recht gutem 22 Erfolg. Ihm wird, man staune, vor allem Fleiß attestiert. Bei den Vorlesungen und Übungen tut er sich allerdings weniger in den Fächern hervor, die die rechnerischen und zeichnerischen Grundlagen von Baukonstruktion und Werkstoffkunde betreffen; ihn interessiert nach wie vor Dekoratives mehr, altdeutscher Bauschmuck und Innenausstattung. Also belegt er über mehrere Semester Fächer wie Formenlehre der mittelalterlichen Baukunst, mittelalterliche Backsteinbauten, Geschichte des Kunsthandwerks, Entwerfen im Stile des Mittelalters, aber auch Ornament- und Figurenzeichnen, Aquarellieren und schließlich – als einzige Konzession an das technische Zeitalter – im Sommersemester 1898 das Seminar „Photographisches Atelier“. Das Erlernen des Umgangs mit Fotoapparaten und Fotolaborgeräten erweist sich am Ende als die einzige wirklich zukunftsträchtige Beschäftigung des jungen Mannes in den beiden Karlsruher Studienjahren. 35
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Abb. 3: Hermann Consten jun. als Student in Karlsruhe, um 1898
Entscheidend sind sie wohl mehr für seine politische und gesellschaftliche Prägung, denn auch in Karlsruhe schließt sich Hermann Consten einer schlagenden Verbindung, der 1876 gegründeten, bis heute bestehenden Karlsruher Burschenschaft Arminia an. Innerhalb nur eines einzigen Semesters vom Fux zum Burschen befördert, entwickelt er sich zu einem tollkühnen, auch bei anderen Karlsruher Verbindungen gefürchteten Mensurenfechter, mit Schmissen im Gesicht, streng gescheitelter, zu den Seiten gekämmter, mit Pomade gebändigter Lockenpracht und mit einem goldgeränderten Monokel im rechten, dem „ungleichen“, leicht einwärts schielenden Auge. Sieht man ein aus dieser Zeit noch erhaltenes Foto Hermann Constens, so denkt man unwillkürlich an Diederich Heßling, den Haupthelden in Heinrich Manns Roman „Der Untertan“, Prototyp und Karikatur zugleich des „Homo Teutonicus Wilhelminicus“. Nationalkonservativ und monarchistisch gesinnt, ist der Arminen-Bursche Hermann Consten nun36
2. Zwischen Freiheits- und Bindungsdrang
mehr fest entschlossen, sich ganz in den Dienst von Kaiser, Volk und Vaterland zu stellen. Allerdings scheint ihm schon in der Karlsruher Zeit klar geworden zu sein, dass er die deutsche Sache besser außerhalb als innerhalb der nationalen Grenzen vertreten sollte. Schließlich werden fähige junge Männer für die Kolonien des Deutschen Reiches dringend gebraucht. Auf fremden Kontinenten und dennoch unter deutscher Flagge, so scheint der mittlerweile 20-jährige Consten überzeugt zu sein, kann er sich nicht nur als Mann und Patriot bewähren, sondern endlich auch die dunkel lockenden Abenteuer bestehen, von denen er schon als Kind geträumt hat. Jedenfalls gibt er das Architekturstudium mit Ende des Sommersemesters 1898 unvermittelt auf; dabei hätten ihm höchstens noch zwei Semester bis zum Diplom-Examen gefehlt. Bei der Arminia meldet er sich inaktiv mit der Be23 gründung, er sei „zum Militär nach Pforzheim eingerückt“. Das klingt ganz so, als wolle er sich den letzten Schliff holen, der ihn zu seinen neuen Lebensplanungen noch fehlt und den Umgang mit Schusswaffen erlernen. An dieser Stelle stockt die Chronistin ein erstes Mal. Denn ein Beleg, wonach Hermann Consten seinen Militärdienst auch tatsächlich angetreten hat, ließ sich nicht finden. Nicht nur, weil Pforzheim in jener Zeit gar keine Garnison war; auf badischem Territorium hätte sich der preußische Untertan Hermann Consten allenfalls in Karlsruhe oder Rastatt als Einjährig-Freiwilliger melden können. Eigentlich hätte er dazu aber nach Aachen, seinem Hauptwohnsitz, zurückkehren müssen, wie es das Militärgesetz von 1874 für die Einjährig-Freiwilligen vorschrieb. Auch ist kein militärischer Rang bekannt, mit dem er seinen Dienst absolviert hätte. Ein Dokument aus der Zeit des Ersten Weltkrieges hingegen belegt sogar, dass Hermann 24 Consten „nicht gedient“ hatte. Selbst auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkrieges sollte er für hohe deutsche Militärkreise, für die er in Budapest 25 Informantendienste leistete, schlicht „Herr Consten“, also ein Zivilist sein. Was in jenem Herbst 1898, als Hermann Consten sein Architektur-Studium hinwarf und aus Karlsruhe verschwand, wirklich geschehen sein könnte, bleibt also rätselhaft. Falls er sich tatsächlich zum Militär gemeldet haben sollte, wäre es da nicht denkbar, dass er nicht genommen worden ist, aus welchen Gründen auch immer? Zwar konnte sich ein männlicher Militärpflichtiger, der die mittlere Reife besaß, im Deutschen Kaiserreich bis zur 37
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Vollendung seines 23. Lebensjahres jederzeit und überall, wo Militär stationiert war, freiwillig zum Militärdienst melden und schon nach einem Jahr, nachdem er neben dem Grunddienst auch noch eine entsprechende Spezialausbildung erfolgreich absolviert hatte, mit einem Reserveoffizierspatent 26 ins Zivilleben zurückkehren. Aber dazu bedurfte es – bei körperlicher Tauglichkeit, die man Consten getrost unterstellen konnte – außer dem Nachweis der „wissenschaftlichen Befähigung“ auch der ausdrücklichen Einwilligung des Vaters oder eines Vormunds; schließlich musste dieser ja die Kosten für die militärische Ausbildung, inklusive Ausrüstung übernehmen. Außerdem musste der Antragsteller ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Oder, ganz abwegig ist dies nicht, Consten hatte seine Arminen bewusst getäuscht, um in der Verbindung weiterhin als Mitglied geführt werden zu können und hatte sich mit unbekanntem Ziel davongemacht, war einfach durchgebrannt. Wobei er gewiss damals noch nicht ahnen konnte, dass ihm die treuen Arminen gut 30 Jahre später, als er völlig abgebrannt in China festsaß, noch eine große Hilfe sein würden. Nur: wohin war er dann verschwunden? Und vor allem: Warum war er untergetaucht? Was war geschehen, dass er Karlsruhe, seinem Architekturstudium und seiner Arminia unter vermutlich falscher Begründung den Rücken kehrte? Wer oder was verbarg sich hinter dem „Militär in Pforzheim“? Hermann Constens Biografie weist für 1898/99 eine Lücke von einem Jahr auf – ein Faden-Ende, das erst einmal lose aus diesem Lebensgeflecht heraushängt. Es wird nicht der einzige lose Faden bleiben, und vielleicht wird es einen anderen geben, der sich mit diesem bei Gelegenheit verknüpfen lässt. Eigentlich ist es müßig zu spekulieren. Dennoch: Da Consten später gelegentlich von sich behauptete, er habe als Freiwilliger am südafrikanischen Burenkrieg teilgenommen, war es nahe liegend, auch einer eventuell nach Afrika führenden Spur zu folgen. Zuzutrauen wäre meinem „klei27 nen Helden“ schon, so meine Überlegung, dass er sich heimlich auf ein Schiff begibt, um Richtung Südafrika zu dampfen und sich dort mit anderen kampfesmutigen Burenfreunden aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und der Schweiz den bedrängten holländischen Siedlern kämpfend zur Seite zu stellen, gesetzt den Fall, dass die 1895 erfolgreich abgewehrten Briten, die es auf die reichen Gold- und Diamantvorkommen in 38
2. Zwischen Freiheits- und Bindungsdrang
den Burenstaaten Oranje und Transvaal und auf eine Abrundung ihres Kolonialbesitzes in Südafrika abgesehen hatten, ein weiteres Mal angreifen sollten. Die Parteinahme Kaiser Wilhelms II., der mit seinem Glückwunschtelegramm zur erfolgreichen Abwehr des britischen Übergriffs auf die burischen Freistaaten, der sogenannten „Krüger-Depesche“ vom Januar 1896, erheblichen Unmut in London ausgelöst hatte, spiegelte durchaus die proburische Stimmung seiner Untertanen. Die öffentliche Meinung im Kaiserreich war, vor allem nach der heftigen britischen Reaktion auf die „Krüger-Depesche“, von „tiefster Bitterkeit 28 und regstem Misstrauen gegen alles Englische erfüllt“. Und auch Hermann Constens militant anti-britische Haltung hatte sich wohl gerade in dieser Zeit herausgebildet. Doch war die deutsche Reichsregierung andererseits peinlich bemüht, ein direktes militärisches Engagement in dem weiterschwelenden südafrikanischen Konflikt und damit die offene Konfrontation mit Großbritannien zu vermeiden. Für eine wirksame Intervention auf dem schwarzen Kontinent fehlten dem Deutschen Reich zu jener Zeit ohnehin die logistischen Mittel, eine hochseetüchtige kaiserliche Kriegsflotte befand sich erst im Aufbau. Freiwilliges Engagement, zumal deutscher Militärangehöriger, für die Sache der Buren, wurde als Störfaktor angesehen und später sogar strafrechtlich verfolgt. Dennoch sollen sich hunderte junger Männer – die meisten von ihnen bereits in Transvaal lebende deutsche Siedler und reichsdeutsche Militärangehörige, aber auch etliche Abenteurer vom europäischen Kontinent – 1898/99 für den Einsatz im fernen Afrika 29 gemeldet haben. Hatte sich Hermann Consten etwa auch anheuern lassen? In Pforzheim? Zweifel sind erlaubt, denn Belege dafür gibt es nicht. Aber ganz ausschließen kann man es auch nicht. Wie auch immer, als im Oktober 1899 der zweite Burenkrieg tatsächlich ausbricht, ist Hermann Consten nachweislich nicht in Afrika, sondern in seiner deutschen Heimat. Entweder hatte Vater Consten gerade noch rechtzeitig Wind von den neuerlichen Eskapaden seines Sohnes bekommen und ihn unverzüglich nach Hause beordert, oder das afrikanische Abenteuer Hermanns fand aus gesundheitlichen, vielleicht auch aus disziplinarischen Gründen ein vorzeitiges Ende. Aber Afrika scheint wohl tatsächlich sein Ziel gewesen zu sein, und der Vater scheint eingesehen zu haben, dass er den Sohn, der einmal sein Erbe als Bierbrauer und Schnapsbrenner antreten 39
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
sollte, auf Dauer nicht halten kann, dass er ihn wohl ziehen lassen muss. Er nimmt seinen zweiten Sohn Franz, ein Jahr jünger als Hermann, als Lehrling ins eigene Geschäft. Dem Erstgeborenen legt er dringend nahe, bevor er die Heimat endgültig verlässt, bei der Deutschen Kolonialschule in Witzenhausen bei Kassel wenigstens noch eine Fachausbildung zum Tropenlandwirt zu machen. Er hat sich bereits vorsorglich erkundigt, und man hat ihm mitgeteilt, dass zum Semesterbeginn im Oktober noch ein Platz frei sei. Man möge sich mit der Entscheidung aber beeilen, die Nachfrage sei groß. Doch Hermann zögert, denn die reguläre Ausbildung dort dauert drei lange Jahre; nur in besonderen Fällen kann eine verkürzte Ausbildung ebenfalls zum Abschluss führen. Er aber will so schnell wie möglich weg. Die Vorstellung, noch einmal drei Jahre die Schulbank zu drücken und in Reichweite väterlicher Autorität zu verbleiben, erscheint ihm unerträglich. Beim Vater beißt er jedoch auf Granit und gibt schließlich nach. Er sendet, sozusagen auf den letzten Drücker, folgendes Telegramm mit Datum 13. Oktober 1899 an Direktor Fabarius nach Witzenhausen: Wenn Platz noch unbesetzt, trete ich ein. 30 Hermann Consten, Aachen, Peterstraße.
Und der Vater schickt umgehend die offizielle Anmeldung zusammen mit Hermanns Zeugnissen und den Studienbelegen aus Aachen und Karlsruhe per Post hinterher, bevor es sich der Sohn wieder anders überlegt. Hermann Constens beim Abgang vom Institut Garnier 1895 geäußerter Wunsch, Landwirt zu werden, soll nun also doch in Erfüllung gehen und dazu auch noch einen „exotischen Touch“ erhalten. Doch wie wenige Jahre zuvor Friedrichsdorf, so wird auch das Provinzstädtchen Witzenhausen sein Ungestüm noch einmal auf eine harte Probe stellen. Schlimm genug, dass sich der schon recht selbstbewusst auftretende „fidele Student“ noch einmal als „Schüler“ ansprechen und behandeln lassen muss, doch schlimmer noch: der inzwischen großjährig gewordene Hermann Consten wird noch einmal Internatszögling in einer hessischen Kleinstadt. Die Deutsche Kolonialschule (DKS) ist eine private Lehr- und Forschungseinrichtung, gegründet 1898 auf Initiative des Koblenzer Divisionspfarrers Ernst Albert Fabarius (1859–1927), um junge Leute in überseeischer Farmarbeit auszubilden und verbesserte Zuchtpflanzen und Anbau40
2. Zwischen Freiheits- und Bindungsdrang
methoden für die Tropen zu entwickeln. Erst wenige Monate vor Hermann Constens Eintritt, am 29. Mai 1899, war die Schule auf dem Wilhelmshof, einer etwas heruntergekommenen, günstig erworbenen ehemaligen Kloster-Domäne mit Ställen, Äckern, Gärten und Molkerei am Ortsrand von 31 Witzenhausen, mit gerade einmal zwölf Studenten eröffnet worden. Sie mussten beim Herrichten der weitläufigen Gutsanlage für Studien- und Wohnzwecke erst einmal selbst mit Hand anlegen. Die hinter der Schulgründung stehende Idee war im ausgehenden 19. Jahrhundert – heute würde man sagen – „innovativ“ für Deutschland. Zwar gehörte das Deutsche Kaiserreich seit den frühen achtziger Jahren als Nachzügler zu den Kolonialmächten, bislang hatte man aber noch nicht recht begriffen, wie dem chronischen Mangel an fachlich geeigneten, tropentauglichen Männern und Frauen, die diese Kolonien auch besiedeln und effektiv bewirtschaften sollten, zu begegnen war. Zielgebiete deutscher Auswanderer waren bevorzugt Australien und Nordamerika. So gesehen hatte sich der Kolonialbesitz für das Deutsche Reich wirtschaftlich bislang als äußerst unrentabel erwiesen. Daher hielten ihn weite Kreise der deutschen Öffentlichkeit auch für politisch verfehlt. Noch bis 1905 drehte sich die öffentliche Diskussion vor allem um die Frage, ob das Kaiserreich überhaupt Kolonien besitzen sollte oder nicht, und wenn ja, ob Handelskolonien oder Siedlungskolonien der Vorzug zu geben sei. Im Berliner Reichstag wurden die Interessen der Kolonien erst nach den Wahlen von 1907, von Kritikern deshalb auch abschätzig als „Kolonial- oder Hottentottenwahlen“ apostrophiert, durch eine Gruppe junger Abgeordneter aktiv vertreten. Ihr Wortführer war einer der Mitbegründer der DKS, ihr späterer Direktor Dr. Wilhelm Arning, der zwischen 1892 und 1896 als Stabsarzt in der Kaiserlichen Schutztruppe in Deutsch-Ostafrika gedient hatte. Für Hermann Consten sollte Arning in den frühen dreißiger Jahren noch eine Rolle spielen. In anderen europäischen Kolonialstaaten gab es ebenfalls wachsenden Bedarf an praxis- und anwendungsorientierter Lehre und Forschung in Sachen Tropenlandwirtschaft, aber dort hatte man sich längst früher an eine systematische Ausbildung von Fachleuten gemacht. Vorreiter waren ab 1884 die Holländer mit ihrer Reichsackerbauschule in Wageningen gewesen, die Engländer hatten das Colonial College als Ausbildungsstätte, und auch in Frankreich gab es eine Fachschule für angehende Kolonisatoren. In 41
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Deutschland dagegen bot im späten 19. Jahrhundert nur das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin Sprachkurse für angehende Kolonialbeamte an; dieses Angebot wurde jedoch kaum genutzt. Staatliche Einrichtungen für Praxis, Lehre und Forschung existierten nicht. Erst nach der Jahrhundertwende, als durch den Aufschwung in den überseeischen Gebieten allmählich ein wirtschaftlicher Nutzen für das Mutterland sichtbar zu werden begann, konnte überhaupt von einer Akzeptanz des Kolonialbesitzes in der deutschen Bevölkerung die Rede sein. Erst dann auch zogen die staatlichen Bildungsinstitutionen nach. Ab 1907, dem Jahr der Schaffung eines Reichskolonialamtes, boten endlich auch deutsche Universitäten kolonialkundliche Seminare an. 1908 wurde in Hamburg ein Kolonialinstitut eröffnet, das Beamte auf den höheren Kolonialdienst vorbereitete. Und Halle an der Saale erhielt durch einen Zusammenschluss kolonialwissenschaftlich orientierter Professoren der dortigen Universität eine Kolonialakademie. Ihr Initiator, Prof. Ferdinand Wohltmann, ein Pflanzenspezialist, gehörte, wie Arning, zu den Gründungsmitgliedern der DKS und saß dort im Aufsichtsrat. Ernst Fabarius war also mit dem Projekt der Gründung einer privaten Kolonialschule in eine Lücke gestoßen. Ihm war es gelungen, für sein Vorhaben Finanziers zu finden. Die meisten von ihnen waren rheinische Unternehmer und Bankiers, die Geschäftskontakte mit den Kolonien unterhielten oder dort eigene Pflanzungen betrieben, also auch direkt von dem chronischen Mangel an Fachkräften betroffen waren. Eine Schlüsselrolle, nicht zuletzt auch für Hermann Consten, wie sich bald herausstellen sollte, spielte im Gründerkreis Dr. Richard Hindorf (1863–1954) aus Köln. Hindorf hatte sich nicht nur mit einer wissenschaftlichen Studie über die Einführung der Sisalkultur in Ostafrika einen Namen gemacht, sondern war auch Generalbevollmächtigter der Rheinischen Handëi-Plantagengesellschaft, die in Deutsch-Ostafrika und auf Sansibar unter Federführung der angesehenen Kölner Privatbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kaffee- und Sisalanbau betrieb. Auch genoss das durchaus umstrittene Kolonialschulvorhaben die Protektion höchster Adelskreise, darunter Fürst Wilhelm zu Wied und Großherzog Johann Albrecht zu Mecklenburg, beide führende Vertreter der 1887 gegründeten Deutschen Kolonialgesellschaft. Mit solchen „Schutzherren“ war die Unterstützung des Projekts, bis hin zum Kaiser persönlich, garan42
2. Zwischen Freiheits- und Bindungsdrang
tiert. Weniger Zuspruch fand der protestantische Theologe Fabarius hingegen bei den Missionsgesellschaften, von denen eigentlich die ersten Anstöße zur Gründung einer solchen, „im deutsch-evangelischen Geist“ ausgerichteten kolonialen Bildungsstätte ausgegangen waren. Man hatte sich aber über Details der Konzeption zerstritten, und die protestantischen Missionsgesellschaften zogen sich noch vor der Realisation aus dem Vorhaben zurück. Eher reserviert verhielten sich zunächst auch staatliche Stellen, was sich später jedoch, nicht zuletzt dank allerhöchster Protektion, ändern sollte. Ernst Fabarius, der Hauptinitiator der Deutschen Kolonialschule, wurde auch ihr erster Direktor. Er blieb dies bis zu seinem Tod im Jahre 1927 und prägte den Schulbetrieb mit seinem streng konservativen pädagogischen Geist und seinen Vorstellungen eines mit der Kolonialisierung eng verbundenen Kulturauftrags bäuerlicher deutscher Pflanzer und Siedler. Seiner Bildungseinrichtung sollte beschieden sein, Kaiserreich und Kolonien wie auch zwei Weltkriege zu überdauern. Nachfolge-Institution heute ist das Deutsche Institut für Tropische und Subtropische Landwirtschaft (DITSL) in Witzenhausen, eine Stätte von internationalem Ruf, die als GmbH zum Fachbereich Landwirtschaft, Internationale Agrarentwicklung und Ökologische Umweltsicherung der Universität Kassel gehört und Entwicklungsfachleute aus aller Welt ausbildet. Die Ausbildung von Tropenlandwirten in Witzenhausen kann somit inzwischen auf eine mehr als 110-jährige Geschichte zurückblicken. Im dortigen Archiv befindet sich noch immer die recht umfangreiche „Schülerakte Consten“. Sie hat sich als höchst ergiebige Quelle für die Jahre 1899 bis 1905 und dann auch noch von 1923 bis 1933 erwiesen, da Hermann Consten später dem Altherrenverband der Kolonialschule angehört und überhaupt mit Witzenhausen nach dem Studienabschluss und während mehrerer Auslandsaufenthalte über Jahre hinweg eine zeitweilig recht lebhafte Korrespondenz gepflegt hat. Eines der Ziele der Schulgründung war es gewesen, den Strom deutscher Auswanderer auf die eigenen Kolonien umzulenken. In Anbetracht des dort herrschenden chronischen Fachkräftemangels maß die Kolonialschule in Witzenhausen der praktischen Arbeit – Direktor Fabarius nannte sie „Dienst“ – hohe Bedeutung bei. Den Absolventen sollte ein Rüstzeug an praktischen wie auch an theoretischen Kenntnissen mitgegeben werden, 43
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
das sie befähigte, sich als Pflanzer und Siedler in den Tropen zu bewähren. Hingegen war „Beamtenmentalität“, wie sie für die Kolonialverwaltungen erforderlich war, ebenso unerwünscht wie „Abenteurertum und Schaumschlägerei“. Nicht zuletzt deshalb hatte Fabarius die Eingangsvoraussetzungen mit hohen Ansprüchen an die Ernsthaftigkeit der Berufswahl und den persönlichen Charakter der Bewerber auf einen Studienplatz verknüpft. Aufgenommen in Witzenhausen wurden junge Männer zwischen 17 und 26 Jahren, die ihre Schulbildung mit der Mittleren Reife abgeschlossen hatten; dies entsprach den damals üblichen Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium der Landwirtschaft an den Universitäten. Aber darüber hinaus unterwarf Fabarius seine Schüler seiner ganz speziellen „Kolonialpädagogik“, einer ganzheitlichen, körperlich-geistigen wie auch charakterlichen Erziehung. Körperliche Arbeit in Landwirtschaft und Handwerk dienten dabei ebenso dem Zweck der Charakterbildung wie auch die Unterordnung unter eine rigide Hausordnung, die den Pflichtenkatalog der Kolonialschüler bis ins Kleinste reglementierte und wenig individuelle Freiräume ließ. Fabarius selbst verglich diese Erziehungsform in einer Denkschrift für den Reichstag 1907/08 mit dem von Priesterseminaren, Kriegs32 schulen oder englischen Colleges. Sie diente darüber hinaus aber auch der Imprägnierung der angehenden Kolonisten mit dem Geist des Kolonialismus, wenn man so will: der Indoktrination. Mit ideologischer Disziplinierung seiner Studenten glaubte Fabarius verhindern zu können, dass Pflanzer planlos in die Kolonien auswanderten und dort Gefahr liefen, fremden Kulturen – wie er es auszudrücken beliebte – als „Dünger“ zu dienen, also in einer Art melting pot auf- oder unterzugehen, wie dies vor allem im anglophonen Nordamerika der Fall war. Nach seiner Vorstellung sollten vielmehr sie selbst in als „wild“, mithin als „kulturlos“ und „unzivilisiert“ imaginierten Weltregionen als „Kulturdünger“ germanisierend auf die „Eingeborenen“ einwirken. Kurz, sie sollten „Vorkämpfer des Deutschtums, Neusassen auf eigener Scholle mit breitem Ell33 bogenraum, Kulturpioniere“ sein. Erreichen wollte Fabarius dieses Ziel, wie er in seiner Denkschrift von 1907 festhielt, durch eine möglichst wenig aufdringliche, aber bewusste Pflege idealer Weltanschauung, durch Belebung edelnationaler, gut deutscher Gesinnung und schlicht-christlichen Bewusstseins. 44
2. Zwischen Freiheits- und Bindungsdrang
Einer von Fabarius selbst redigierten und herausgegebenen Zeitschrift, die dazu beitragen sollte, den ausgereisten Absolventen diesen Geist auch in der Fremde weiter bewusst zu machen und sie vor den in den Tropen lau ernden Gefahren des Verlusts ihres Deutschtums zu bewahren, gab er den bezeichnenden Titel Der deutsche Kulturpionier. Die vielen Jahrgänge des Kulturpioniers in der Witzenhausener Bibliothek, zu dem die ausgereisten ehemaligen Schüler und zahlreiche Fachautoren regelmäßig Artikel und Briefe beisteuerten, bieten ihrerseits aufschlussreiches Material über Ideal und Wirklichkeit in den deutschen Kolonien. Auch Briefe Hermann Constens finden sich dort abgedruckt, in denen er seine Erlebnisse und Erfahrungen schildert. Dass Fabarius’ Ausbildungskonzept letztlich durchaus erfolgreich war, zeigte nicht nur die wachsende Nachfrage nach Studienplätzen, sondern auch die große Zahl von Absolventen und die zunehmende Anerkennung, die diese Form der Fachausbildung bei Plantagenbesitzern und Kolonialbehörden fand. Fabarius konnte als Ergebnis seiner Umfragen bei Plantagengesellschaften in den Kolonien zahlreiche Referenzen vorweisen, die gerade 34 seinen Absolventen hervorragende Leistungen bescheinigten. Sogar in England, dem größten Rivalen des Kaiserreichs im Wettlauf um den Erwerb von Kolonialbesitz, wurde das deutsche System der kolonialen Ausbildung bald als vorbildlich angesehen. Bis 1914 wanderten ca. 80 Prozent der DKS-Absolventen aus, davon gingen ca. 60 Prozent nach Afrika, ca. 30 Prozent nach Nord- und Südamerika, der Rest ging nach Südostasien, Polynesien und nach China. Der auf dem Wilhelmshof herrschende Geist wird durch die Hausordnung und die Aufzeichnungen im Tages- und Dienstbuch des Herrn Direktors besonders anschaulich. Die fast täglichen Eintragungen von Fabarius verdeutlichen, wie er das Leben der Schüler vom Morgengrauen bis in die 35 Nacht in zum Teil kleinlicher Weise persönlich überwacht und steuert. Selbst die Dozenten und die auf dem Gut beschäftigten Handwerker und Knechte sind diesem Kontrollsystem unterworfen. Gelegentlich sieht er sich aber auch veranlasst, das Dienstpersonal vor den Ansprüchen der Schüler in Schutz zu nehmen. So heißt es z. B. im Dienstbuch unter dem 23. Mai 1901: Der Hausdiener Jathow ist nicht verpflichtet, jedem der Herren täglich 45
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
mehr als zwei Paar Stiefel zu reinigen, 1 Paar Arbeits- und 1 Paar Hausstiefel. Ich bitte sämtliche Herren im eigenen gegenseitigen Interesse peinlichst darauf zu achten, da jede Rücksichtslosigkeit des Einen zu einer Benachteiligung des Anderen unbedingt führen muss. Auch ist der Hausdiener Jathow nicht verpflichtet, Kleider und Arbeitsstiefel zu reinigen, welche Sonnabends später als 7 Uhr Abends oder gar erst Sonntags 36 morgens vor die Thür gestellt werden.
Für Verstöße gegen die Hausordnung hatte sich Fabarius einen differenzierten Strafenkatalog ausgedacht, der von der Verwarnung über Haus-, Stubenarrest und „Verruf“ bis zum Verweis von der Anstalt reichte. Mit „Verruf“ war ein zeitlich begrenzter Ausschluss des Delinquenten vom gesellschaftlichen Beisammensein gemeint; er konnte in dieser Zeit öffentlicher Ächtung auch keine Ämter wahrnehmen. Bei gröblicher Zuwiderhandlung gegen die Hausordnung erteilte der Direktor einen Verweis. Dauernd ungebührliches Betragen hatte auf Beschluss des Lehrerkollegiums Entlassung aus der Anstalt ohne Anspruch auf Erstattung des vorausgezahlten Vierteljahresbetrages zur Folge. Dass das Studieren unter so rigiden Bedingungen eine hohe Abbrecherquote zur Folge hatte, mag selbst Fabarius zu denken gegeben haben. Immerhin hatten bis 1904 fast 25 Prozent der Schüler die Ausbildung abgebrochen bzw. abbrechen müssen, weil sie we37 gen disziplinarischer Verfehlungen von der Anstalt verwiesen wurden. Aber er zog aus solchen Erfahrungen nicht die Konsequenz, sein straffes Regiment etwas zu lockern, im Gegenteil: Er verschärfte vielmehr die Selektion der Bewerber auf einen Studienplatz. So engstirnig jedoch der Internatsbetrieb auf dem Wilhelmshof geregelt war, so breit angelegt war der Fächerkanon, den die Deutsche Kolonialschule ihren Studenten anbot. Er reichte von agrar- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern bis zu Kulturwissenschaften und Fremdsprachen. Dabei deckte Fabarius den Bereich der Kulturwissenschaften überwiegend persönlich ab. Er unterrichtete Kultur- und Religionsgeschichte, Völkerkunde, Kolonialgeschichte und Kolonialpolitik, Landwirtschaftsgeschichte und -politik. Ihm lag vor allem daran, seinen Studenten bewusst zu machen, wie abhängig Pflanzer und Siedler in den Kolonien von der einheimischen Bevölkerung waren, wie wenig sie sich den „Luxus souveräner Nichtbeachtung und selbstgewisser Nichtachtung“ leisten konnten, wie naiv es sei, zu 46
2. Zwischen Freiheits- und Bindungsdrang
glauben, man könne „ohne genaue Einsicht in ihre Gewohnheiten, Sitten und ihre Lebensweise“ mit fremden Völkern Handel treiben oder sie als Arbeitskräfte gewinnen. Der chronische Mangel auch an einheimischen Arbeitskräften in den deutschen Kolonien gebot seiner Auffassung nach geradezu, den Bedürfnissen der Eingeborenen und ihren Lebensgewohnheiten Rechnung zu tragen, sie weder zu streng noch zu nachgiebig zu behandeln, ihnen aber in jedem Fall mit Achtung zu begegnen. Man solle, so Fabarius, weniger den gebietenden Herrn herauskehren als Erzieher sein – ein Erzieher im umso strengeren Sinne des Wortes, als die meisten Völker, die für unsere deutschen Pflanzungen und Betriebe als Arbeiter in Betracht kommen, tatsächlich sind – in ihren guten wie ihren bedenklichen Seiten – „wie die Kinder“.
So gesehen bekomme Völkerkunde geradezu die Bedeutung einer Pädagogik, die man auf die für die Arbeit in den Pflanzungen und Viehzuchtfar38 men benötigten „Naturkinder“ anwenden solle. Wenn uns dieser „pädagogische“ Ansatz heute auch höchst befremdlich erscheint, so muss man Fabarius dennoch zugute halten, dass er mit seinem Konzept auf deutliche Distanz zu den gewaltförmigen Auswüchsen des Kolonialismus seiner Zeit ging. Er war übrigens auch ein entschiedener Gegner der Sklaverei wie auch der sogenannten „Völkerschau-Ethnologie“, die glaubte, man könne aus der Vermessung und Klassifizierung von Körpermerkmalen Rückschlüsse auf völkische Charaktereigenschaften ziehen. An Fremdsprachen wurden in Witzenhausen als Pflichtfach Englisch und als Wahlfächer Spanisch, Portugiesisch, Holländisch, Französisch, Kisuaheli und Malaiisch angeboten. Wirtschaftswissenschaften waren durch die Fächer Volks- und Kolonialwirtschaftslehre sowie Landwirtschaftliche Buchführung und Handelslehre vertreten. Aus dem Bereich der Naturwissenschaften wurden Chemie, Physik, Botanik und Landwirtschaftstechnologie, ferner Geologie, Mineralogie und Klimalehre sowie Tropengesundheitslehre unterrichtet. Die Agrarwissenschaften umfassten heimische und tropische Pflanzenlehre, Tierzuchtlehre, Tierheilkunde, Gartenbaulehre und Forstwirtschaftslehre. Zu den Techniken, die man bei den Ingenieuren und Handwerksmeistern der Kolonialschule erlernen konnte, gehörten Baukonstruktion, Vermessungswesen, Be- und Entwässerung, Planzeichnen, 47
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Schmiede, Zimmerei, Tischlerei, Sattlerei, Stellmacherei. Und der bereits erwähnte Hausdiener Jathow brachte Interessenten sogar das SchuhmacherHandwerk bei. Neben den regelmäßigen Arbeiten in der Landwirtschaft und der Gärtnerei gab es auf dem Wilhelmshof noch in der Mühle und der Molkerei zu tun. Außerdem war studentische Mitarbeit beim Boots- und Hausbau gefordert. Die Kolonialschüler lernten Schlachten, Seifensieden, 39 Zimmern und Maurern. Sportunterricht gab es auch. Alle Schüler mussten in der Werra schwimmen lernen. Sie hatten die Möglichkeit, in der ländlichen Umgebung Witzenhausens auf die Jagd zu gehen oder Ausritte zu unternehmen – alles natürlich nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herrn Direktors. Immerhin dürfte letzteres Hermann Consten mit vielem versöhnt haben, was ihm in Witzenhausen missfiel. Die Wurzeln seiner lebenslangen Jagdleidenschaft sind wohl hier zu vermuten. Consten bringt für Witzenhausen neben der Mittleren Reife noch seine in sechs Semestern gesammelten architektonischen Kenntnisse mit ein; immerhin hat er während seines Studiums ja auch einige handwerkliche Fertigkeiten erworben, die in den Tropen durchaus nützlich sein können und die er auf der Kolonialschule noch vertiefen kann. Aber mit seiner akademischen Freiheit ist natürlich erst einmal Schluss, und bei der körperlich teilweise recht schweren Arbeit, die die Kolonialschüler bei der Bewirtschaftung des Wilhelmshofes, auf den Feldern, in Gärten und Stallungen zu leisten haben, leidet, wie sich schnell herausstellt, die theoretisch-fachliche Unterweisung. Manchmal ist Consten nach frühmorgendlichem Stalldienst zwischen vier und sechs Uhr einfach zu müde, nach dem anschließenden Frühstück auch noch den um 7:15 Uhr beginnenden Vorlesungen zu folgen. Ihm geht es da nicht besser als seinen Kommilitonen. Nachmittags schließen sich noch Laborarbeiten und praktische Übungen im Feld an. So dürfte er über die von Direktor Fabarius verordnete frühe Nachtruhe so manches Mal ganz froh gewesen sein. Doch sollen noch einige Jahre vergehen, bis Fabarius selbst erkennt, dass sein ursprüngliches Konzept der kombinierten praktischen und theoretischen Ausbildung nachteilig für den Wissenschaftsteil ist. 1902 schließlich stellt er das Curriculum auf ein Praktikantenjahr mit sich anschließenden vier Hörsaalsemestern um. Consten hat also im Schuljahr 1899/1900, seinem einzigen in Witzenhausen, das ursprüngliche Lehrkonzept des unmittelbaren Nebeneinanders von prakti48
2. Zwischen Freiheits- und Bindungsdrang
schem und theoretischem Lernen miterlebt, und dies an sechs Tagen in der Woche. Billig ist die Ausbildung auch in Witzenhausen nicht. Das Schulgeld, das zunächst auf 800 Mark jährlich festgelegt worden war, hatte Direktor Fabarius schon im Juli 1899 auf 1.000 Mark heraufgesetzt, davon 400,– für Unterkunft und Verpflegung und 600,– als Unterrichtsgeld. Vater Consten muss für sein schwieriges Kind also wieder tief in die Tasche greifen. Und Hermann muss, vermutlich zum ersten Mal in seinem Leben, richtig hart arbeiten. Es ist nicht anzunehmen, dass ihm der auf die Minute genau geregelte und vom Herrn Direktor persönlich überwachte Tagesablauf mit Stalldienst, Unterricht, Nachmittagen im Labor und auf den Feldern und nur wenig Freizeit behagt. Sein erster Beschwerdebrief an die Familie in Aachen gilt, wenige Tage nach seiner Ankunft in Witzenhausen, den spartanischen Wohnverhältnissen auf dem Wilhelmshof und veranlasst die Mutter, umgehend zu einem Geschäftsbogen mit Briefkopf Hermann Consten, Dampfbrennerei zu greifen und folgende Zeilen an den Herrn Direktor Fabarius zu schreiben: Aachen, 22.10.1899 Sehr geehrter Herr, beehre mich, Ihnen das Schriftstück mit verlangter Unterschrift zurückzusenden. Gleichzeitig ersuche ich Sie höflichst, uns genau über die Leistungen unseres Sohnes in Kenntnis zu setzen und uns auch zu sagen, ob er sich wirklich zu diesem Fach eignet. In einem Schreiben von Hermann, das uns gestern zuging, bat er uns, ihm einige wollene Decken nebst Federbett zu schicken. Sollten denn bei einem so hohen Pensionspreis die Betten nicht komfortabel sein? Wäre dies denn doch der Fall, so bitte ich gütigst, wenn es sich machen lässt, das Verlangte ihm anzuschaffen und in Anrechnung zu bringen. Sehr lieb wäre es mir, wenn ich besser erahnen könnte, ob die Betten nicht genügend gedeckt sind. Die jungen Leute machen oft mal Ansprüche, die gar nicht angebracht sind. Im voraus bestens dankend grüßt achtungsvoll 40 Frau Herm. Consten
Hermann Consten belegt in seinem Witzenhausener Studienjahr 16 Fächer: Völkerkunde, Religionsgeschichte und Wirtschaftsgeschichte bei Direktor 49
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Fabarius, Chemie und Botanik, Mineralogie, Tierzucht, Tierernährungslehre und Tierheilkunde, Tropengesundheitslehre, Kolonialpolitik, Klima- und Bodenlehre der Tropen und Subtropen, tropischer und subtropischer Pflanzenbau, Wein- und Gemüsebau, Forstwirtschaft und Buchführung und schließlich noch ihm bereits Vertrautes: die allgemeine Baulehre samt den 41 dazu gehörigen praktischen Übungen. Hinzu kommen Stalldienst und andere Dienstleistungen in der Landwirtschaft und im Haus. Zum Winter hin dürfte die harte körperliche Arbeit drinnen und draußen der Gesundheit so manches Bürgersohns recht unzuträglich gewesen sein. Die ersten Wochen sind rasch vergangen; zum Weihnachtsfest 1899 fährt Hermann mit einer fiebrigen Erkältung nach Hause, die sich schnell zu einer ernsten Grippeerkrankung entwickelt und ihn für viele Wochen ans Bett fesselt. Mit Beginn des neuen Jahres schreibt Bruder Franz an Direktor Fabarius: Unterzeichneter erlaubt sich hiermit mitzuteilen, dass sein Bruder sehr erkrankt ist und vorderhand die Schule zu besuchen nicht im Stande ist. Etwaige Briefe bittet man nicht nachzuschicken. 42 Hochachtungsvoll Franz Consten
Wenige Tage später verfasst der Vater, Hermann Josef Sebastian Consten, selbst ein Schreiben an Fabarius, in dem er Art und Schwere der Erkrankung seines Sohnes näher erläutert. Er will wissen, wie dies passieren konnte und auch hören, ob Hermann seit seinem Eintritt in die Kolonialschule überhaupt ernsthaft gearbeitet habe. Geehrter Herr, theile Ihnen ergebenst mit, dass unser Sohn Hermann seit dem 26. Dezember an der Influenza schwer erkrankt darniederliegt. Von Beginn der Krankheit hat er sehr hohe Temperatur, 40/41, und augenblicklich noch 39,5. Wie er angibt, soll er schon vor seiner Heimkehr erkrankt gewesen sein und hohes Fieber gehabt haben. Ich bitte Sie, uns hierüber Aufklärung geben zu wollen. Ferner bitte ich Sie, mir gleichzeitig zu berichten, was Hermann leistet. Meiner Ansicht nach hat er bis jetzt nicht viel gethan, dieses schließe ich daraus, dass er einen ganzen Haufen Hefte [Wort unles.] seiner Freunde mitgebracht hat, um die darin niedergeschriebenen Vorlesungen, welche während des Fortseins Hermanns gehalten worden sind, abzuschreiben. Als ich an ihn die Frage richtete, weshalb er diesen Vorlesungen nicht selbst beigewohnt hätte, erwiderte er, 50
2. Zwischen Freiheits- und Bindungsdrang
die hätten vor seiner Zeit stattgefunden. Da ich ihm aber nun das Datum – 10. Oktober bis Ende Dezember vorlegte, wusste er mir nichts mehr zu antworten. Ich wäre Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, wenn Sie mir so bald als möglich über sein Lernen, sein Wissen, Leben und Treiben meines Sohnes klare Auskunft geben wollten. Ich könnte ihn dann, wenn es nöthig ist, gehörig ins Gebet nehmen. Einer baldigen Antwort entgegensehend grüßt achtungsvoll 43 Herm. Consten
Direktor Fabarius sieht sich nun doch veranlasst, zu antworten. Hermann sei tatsächlich in den Wochen vor Weihnachten wiederholt krank gewesen, schreibt er an Hermann Josef Sebastian. Er habe mehrfach nicht am Unterricht teilnehmen können. Ermahnungen, sich zu schonen, schreibt Fabarius weiter, habe Hermann mit Hinweis auf seine robuste Konstitution zurückgewiesen. Eine erste Influenza-Erkrankung habe er beim Winterfest der Kolonialschule „mit kräftigem Glühwein und Pfannkuchen“ zu kurieren versucht und sei tatsächlich schon nach zwei Tagen wieder wohlauf gewe44 sen. Gut zwei Monate braucht Hermann, um nach der schweren Influenza wieder auf die Beine zu kommen. In der ersten Märzwoche kehrt er nach Witzenhausen zurück und setzt sein Studium fort. Erst jetzt erfährt er, dass im Winter 1899/1900 mehrere Schüler an der grassierenden Epidemie gestorben sind. Fabarius hat nun ein Auge auf ihn, damit er das Versäumte rasch nachholt und dennoch seine Kräfte schont. Hermanns ernsthaftes Interesse, möglichst bald mit einem präsentablen Abschluss nach Afrika auswandern zu können, dürfte sich in den bedrängenden Wochen der Krankheit und des dadurch erzwungenen Aufenthaltes bei der Familie in Aachen eher noch verstärkt haben. Fabarius ist bemüht, etwas für ihn zu tun, wie ein Schreiben der Mutter Constens vom Mai 1900 verrät: Geehrter Herr Direktor, Aachen, den 8.5.1900 im Auftrage meines Mannes frage ich ergebenst an, wie Sie mit den Leistungen Hermanns zufrieden sind. Vor einiger Zeit teilten Sie uns mit, er sei dem Deutschen Kolonialamt in Berlin vorgeschlagen worden als Assistent auf der Versuchsstation nach Kwai, Usambara oder nach [?] Kinomatschara zu Herrn 45 Bronsart von Schellendorf. Da Hermann uns oft manches vorgeschwätzt hat, was keinen Sinn hatte, wenden wir uns an Sie und bitten, uns hierüber genau 51
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Aufklärung zu geben, auch bei derselben Gelegenheit zu sagen, wie Sie ihn beurteilen und welche Versprechungen Sie sich über seine Zukunft machen. Wir sind seinetwegen in großer Unruhe und wären Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Ich erwarte auch Ihre Verschwiegenheit Hermann gegenüber und grüße hochachtungsvoll 46 Frau Herm. Consten 47
Fabarius’ Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Er bestätigt, dass er Schritte unternommen habe, Hermann nach Ostafrika zu vermitteln. Hermanns Lieblingswunsch sei es, bei der Versuchsstation der Deutschen Ostafrika-Gesellschaft (DOAG) in Kwai/Usambara unterzukommen, und er fährt fort: Es ist mir nach Möglichkeit Berücksichtigung zugesagt, d.h. wenn zur entscheidenden Zeit eine Stelle frei wird und ich ihn dann als tüchtig und zuverlässig empfehlen kann. Ob und inwieweit die Bronsart v. Schellendorf'sche Unternehmung aussichtsvoll genug ist, lässt sich zur Zeit noch nicht sagen. Jedenfalls würde ich Ihrem Sohn auch nur nach weiterer Erkundigung dahin zu gehen raten.
Was folgt, ist die eingangs dieses Buches zitierte Betrachtung Fabarius’ über Wesen und Charakter Hermann Constens und seine ziemlich unverblümte Kritik am Erziehungsstil des Elternhauses in Aachen, der Hermanns Fehler, seine Neigung zu Angeberei und Unaufrichtigkeit, eher noch verstärke. Und er schließt sein ausführliches Schreiben mit der Bekräftigung, Hermanns Plan, in Ostafrika Viehzucht betreiben zu wollen, habe etwas durchaus Vernünftiges, vorausgesetzt natürlich, man habe einiges Kapital. Wichtig an diesem Schreiben für Hermanns schwierigen Stand im Elternhaus ist die rückhaltlose Anerkennung seiner „mannigfachen Begabung“ durch Fabarius, zu der ohne Zweifel auch eine rasche Auffassungsgabe zählt. Denn Hermann bringt in den wenigen ihm noch verbleibenden Monaten bis zum Ende des ersten Studienjahres das Kunststück fertig, trotz der vorangegangenen Versäumnisse den vorzeitigen Abschluss zu schaffen. Damit er in dieser Zeit nicht immer wieder auf dumme Gedanken kommt, bindet ihn Fabarius ein in die Mitverantwortung der Schülerschaft zur Aufrechterhaltung der Disziplin. Er macht ihn zu einem stellvertretenden Mit48 glied des Ehrenrates und zum Hausordner. Und im Laufe des Sommers 52
2. Zwischen Freiheits- und Bindungsdrang
klappt auch die Vermittlung einer Volontärstelle auf einer Kaffee-Plantage in Deutsch-Ostafrika zum Herbst. Viel Zeit bleibt also nicht mehr zum Studium, denn August ist Ferienmonat, auf den zur Domäne Wilhelmshof gehörenden Feldern ist die Ernte in vollem Gang. Ende August unternehmen Lehrer samt ihren Familien und die in Witzenhausen verbliebenen Schüler einen gemeinsamen Ausflug zur Ruine Hanstein mit einem Picknick auf der Teufelskanzel. Nach dem Abstieg ins Werra-Tal geht es am Abend mit Paddelbooten nach Witzen49 hausen zurück. Anfang September schließlich verabschiedet Direktor Fabarius die kleine Schülergruppe seines ersten Studienkollegs, die als DKSPioniere mit dem Segen des Direktors hinausgeschickt werden in die Kolonien. Das Ereignis beschrieb Fabarius in der nächsten Nummer seiner Zeitschrift Der Deutsche Kulturpionier: Mit fröhlichem Ernte- und Sedansfeste schloss das Sommerhalbjahr am 2. September ab, besonders noch geweiht durch die Abschiedsfeier für eine stattliche Zahl ausziehender Kameraden. Das Fest, am Morgen durch wehende Flaggen begrüßt, begann Nachmittags wieder mit feierlichem Umzuge durch das Anstaltsgebiet der Arbeiter, Beamten, Lehrer und Schüler, vorauf mit Musik die Erntekränze der Landwirtschaft und der Gärtnerei. Im Innenhofe unserer stimmungsvollen Festhalle unter freiem Himmel, wo gerade frisch ausgegrabene, teilweise wundervoll erhaltene Reste des alten Kreuzganges und der Kirche neugelagert waren, machte der Zug halt, der Direktor hielt eine kurze Ansprache unter Hinweis auf die Dankesschuld, zu der dieser doppelte Festtag mahnte, zum Dank für Erntesegen, nationalen Segen, Menschenhülfe und Gotteshülfe, Gottessegen. Mit dem Gesang „Nun danket alle Gott“ schloss die Feier. Darauf war im Festsaale gemeinsames Kaffeetrinken aller Anstaltsglieder, einschließlich der Arbeiter und Arbeiterkinder, verschönt durch Chorgesänge der Dohrenbacher Ernte-Arbeiterinnen und Arbeiter mit nachfolgendem fröhlichen Tänzchen, das um 7 Uhr ein gemeinsames Abendbrot abschloss. – Im Rahmen des üblichen sonnabendlichen Gesellschaftsabends gestaltete sich dann der Festabend, zu einer schönen Abschiedsfeier für die Kameraden Linder (Lindi), Meyer (Samoa), Uhl (Samoa), Consten (Usambara), Willi (Togo) und Frank (Militär), sowie Hamel (Kapland). In ernster und heiterer Weise, mit Rede, Gegenrede, Liedern und Musik53
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
vorträgen verlief der Abend nur allzu schnell, und am Montag morgen winkten dann die Fahnen und mischten sich Hurrarufe mit Büchsensal50 ven zum letzten Scheidegruß der Ausziehenden.
Wieder einmal hält ein erleichterter Hermann Consten ein wichtiges Dokument in Händen, das ihm für seine weitere Zukunft wichtig sein wird: seine Studienbescheinigung. Herrn Hermann Consten aus Aachen wird hiermit bescheinigt, dass er vom 16. Oktober 1899 bis 5. September 1900 die Deutsche Kolonialschule besucht hat. Er hat sich in dieser Zeit sowohl praktisch als theoretisch in Landwirtschaft, Gärtnerei und Technik für den kolonialwirtschaftlichen Beruf vorbereitet. In Rücksicht auf seine vorher schon gewonnene anderweitige Ausbildung wurde er bereits vor Vollendung des vollen Lehrganges nach einem Jahre entlassen. In der Hoffnung, dass er sich und uns draußen Ehre machen wird, begleiten ihn unsere besten Wünsche für seine fernere Zukunft. Witzenhausen-Wilhelmshof, den 5. September 1900 51 gez. Fabarius, Direktor.“
Knapp zehn Tage hält sich Hermann Consten noch in Aachen auf. Er besorgt sich eine Tropenausrüstung, packt seine Sachen, verabschiedet sich von Eltern, Geschwistern und Freunden und steigt am Aachener Hauptbahnhof in den Zug nach Antwerpen. Dort legt am 14. September ein Dampfer ab, der ihn auf dem Weg durch das Mittelmeer und den SuezKanal über Aden und Mombasa nach Deutsch-Ostafrika bringt.
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara Mit der Musterplantage in Kwai hatte es, wie gesagt, nicht geklappt, auch nicht mit einem Volontariat auf der Farm des Generals Bronsart von Schellendorf. Aber die Rheinische Handëi Plantagengesellschaft kann den Absolventen der Deutschen Kolonialschule in Witzenhausen gebrauchen. Denn schon länger sucht Joris Akkersdijk, Pflanzungsleiter der Kaffeeplantage von Ngambo in den Bergen Ost-Usambaras, für die Nachbarpflanzung Kwamkuju einen tüchtigen Assistenten, der kurzfristig für den malariakranken Verwalter Gerlich einspringen kann. Im September 1900 erreicht
54
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
ihn folgendes Schreiben aus der Kölner Geschäftszentrale, das eine Lösung des Problems ankündigt: Sehr geehrter Herr Akkersdijk, […]Wir haben uns entschlossen, Ihnen den Volontär, der sich angeboten hat, einen Herrn Hermann Consten aus Aachen zu schicken. Er wird voraussichtlich am 14. September von Antwerpen die Ausreise antreten. Herr Consten ist Techniker von Beruf, und er wird Ihnen voraussichtlich bei der Aufstellung des Trockenhauses und des Wasserwerkes gute Dienste leisten können. Wir haben Herrn Consten davon unterrichtet, dass wir einen Volontär, der den großen Herrn spiele und nur arbeite, wenn es ihm beliebt, natürlich in Ngambo nicht gebrauchen könnten. Er sei Ihnen ebenso gut Gehorsam schuldig und müsse eben jede ihm übertragene Arbeit tun, wie jeder andere Assistent. Herr Consten hat sich hiermit völlig einverstanden erklärt und wir haben den Eindruck gewonnen, dass es ihm damit Ernst ist und dass er Ihnen und uns in Ngambo wohl von Nutzen sein kann. Wir werden Ihnen mit der nächsten Post weiteres in dieser Angelegenheit schreiben. 52 Hochachtungsvoll Dr. Hindorf“
Dr. Richard Hindorf, Generalbevollmächtigter der Rheinischen Handëi Plantagengesellschaft und angesehenes Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Kolonialschule, ist also über Hermann Constens charakterliches Problem informiert, sich gern wichtig zu machen. Dennoch ist er offensichtlich der Empfehlung von Direktor Fabarius gefolgt, dem jungen Mann mit immerhin etwas technischer und tropenwirtschaftlicher Vorbildung eine Chance zu geben. Natürlich ist Hindorf ein nüchterner Geschäftsmann; sein Angebot ist unverbindlich und jederzeit widerrufbar. Für Consten aber reicht es aus, erst einmal wegzukommen. Auch für ihn wird sich das weitere finden, so wird er sich gedacht haben, obwohl er sich gegenüber Hindorf bereit erklärt hat, sich gegebenenfalls auch längerfristig an das Kölner Plantagenunternehmen zu binden. Mit seinem nächsten Schreiben an Akkersdijk, in dem er Constens inzwischen erfolgte Abreise bestätigt, schickt Hindorf eine Abschrift des Lebenslaufs, der Auskunft gibt über Schule und Studium und fügt hinzu: Wir hoffen, dass Herr Consten gut einschlagen wird und dass Sie ihn gut ge55
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
brauchen können. Sollte das nicht der Fall sein, macht es ja keine Schwierig53 keit, sein Verhältnis zu uns in kurzer Frist zu lösen.
Akkersdijk reagiert in seiner Antwort an Hindorf erleichtert. Nach mehreren ungeeigneten Bewerbern steht, mitten in der ersten Ernte der 1897 eröffneten Kaffeepflanzung, endlich jemand in Aussicht, mit dem er etwas anfangen kann. Er erläutert, wie er Consten einzusetzen gedenkt: Es hat allen Anschein, dass wir es hier mit einem gebildeten und eifrigen Mensch zu tun haben, dessen Bleiben in unserem Dienst uns wertvoll werden kann. Aus diesem Grunde haben wir (Gerlich und ich) entschieden, dass Herr Consten mit Herrn Gerlich zusammen trocknen wird vorderhand, was zwei Vorteile hat: Über eine Woche bei mir ihn mit Herrn Mucker trocknen zu lassen, hielt ich für unratsam – nämlich, dass er Kwamkuju, sein eigentliches erstes Arbeitsobjekt, sofort kennenlernt und dass er Herrn Gerlich, dessen Gesundheit zur Zeit nicht ohne Bedenken ist, baldigst die Arbeit etwas erleich54 tern kann; ich schlage mich hier schon allein durch, solange ich gesund bleibe.
Das Jahr 1900 ist bisher kein leichtes für die beiden ostafrikanischen Kaffeeplantagen der Handëi Gesellschaft gewesen. Schon die Neuanpflanzungen des Vorjahres hatten im Herbst 1899 unter extrem trockener Witterung zu leiden gehabt. 1898 war sogar ein ausgesprochenes Dürrejahr gewesen. Tausende junger Bäumchen waren eingegangen und hatten nachgepflanzt werden müssen. Dafür wiesen die ersten, 1897 gesetzten Pflanzen einen so reichen Fruchtansatz auf, dass ein Teil der Früchte sogar entfernt werden musste, um einer Entkräftung der Bäumchen vorzubeugen. Für die nun also anstehende Ernte, die erste auf der Plantage überhaupt, muss eine Aufbereitungsanlage gebaut werden. Um auch in Zeiten geringer Niederschläge das zum Antrieb der Schäl- und Sortiermaschinen und zum Waschen des Kaffees benötigte Wasser zur Verfügung zu haben, hat man gerade begonnen, im durch die Plantage fließenden Ngambo-Bach zwei Staudämme zu errichten, die der Fertigstellung harren. Bei der Inangriffnahme dieser Arbeiten hat sich die Knappheit an einheimischen Arbeitskräften als besonderes Problem erwiesen. Von ursprünglich 500, teils sogar aus anderen Regionen Ostafrikas stammenden schwarzen Arbeitern sind nämlich nur noch etwa 260 geblieben. Teils wegen schlechter Behandlung, teils wegen der schwierigen Ernährungslage und hoher Nahrungsmittelpreise haben die 56
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
meisten das Handëi-Gebiet wieder verlassen. Versuche, eine Viehzucht in Ngambo aufzubauen und damit eine bessere und vor allem weniger kostspielige Versorgung der Arbeiterschaft zu gewährleisten, mussten aufgege55 ben werden. In der Nachbarpflanzung Kwamkuju kommen neben den genannten Problemen noch die häufigen krankheitsbedingten Ausfälle des dortigen Verwalters Gerlich hinzu. Das erschwert den Fortgang der Arbeiten. Doch trotz all dieser Schwierigkeiten ist die Erweiterung der Kaffeeanbauflächen geplant. Das bedeutet, dass hunderte Hektar Urwald abgeholzt und der Boden durch Brandrodung für die Auspflanzung von Kaffeesträuchern und Schattenbäumen vorbereitet werden müssen. Pflanzungsleiter Akkersdijk will daher den in Aussicht gestellten Volontär, sollte sich sein positiver Eindruck bestätigen, möglichst bald auf die freie Assistentenstelle setzen, um ihn längerfristig an Ngambo und Kwamkuju zu binden. Nun wartet er auf Constens Kommen. Die Schiffsreise von Antwerpen nach Tanga, der nördlichsten Hafenstadt der Kolonie Deutsch-Ostafrika, dauert knapp fünf Wochen. Am 18. Oktober endlich tauchen die dem ostafrikanischen Festland vorgelagerten Korallenriffe auf; in der weiten Bucht, auf die der Dampfer nun Kurs nimmt, wimmelt es von Auslegerbooten, Barkassen und arabischen Dhaus. Von der rechterhand liegenden Halbinsel Ulenge grüßt ein weißer Leuchtturm die Ankommenden. Nachdem er die sogenannte „Toteninsel“ passiert hat – Quarantänestation für Seuchenkranke und Begräbnisplatz Tangas, Menetekel für jeden also, der sich hier eine Zukunft erhofft –, wirft der Dampfer mit dem 22-jährigen, erwartungsvoll aufgeregten Hermann Consten an Bord, auf der Reede vor Tanga Anker. Vom Wasser aus bietet sich dem jungen Mann ein malerisches, ein geradezu idyllisches Bild. In südlicher Richtung säumen, auf einem Stück Steilküste etwa 15 Meter oberhalb der Wasserlinie gelegen, zahlreiche im europäischen Stil erbaute villenartige Häuser und große Verwaltungsgebäude nebst einer Kirche inmitten üppiger tropischer Vegetation die Bucht. Weiter landeinwärts müssten die Wohnviertel der einheimischen Bevölkerung liegen, die Häuser und Hütten der in Tanga und Umgebung lebenden Afrikaner, Araber und Inder. Aus der Entfernung lassen sie sich aber nur vage ausmachen. Über dem von grünen Palmenhainen eingerahmten Ort erhebt sich dafür, klar erkennbar, 57
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Abb. 4: Urwaldeinschlag in Ngambo, Deutsch-Ostafrika, um 1903
die mächtige blaue Silhouette der Usambara-Berge am Horizont. Consten sieht sein eigentliches Reiseziel in greifbarer Nähe vor sich. Seine Ungeduld wächst. Die Passagiere, die in Tanga von Bord gehen, werden ausgeschifft und mit Barkassen zur Hafenmole gebracht, wo sich dunkelhäutige Lastenträ56 ger – im Kolonialjargon Negromobil genannt – der Handgepäckstücke der eben eingetroffenen Passagiere bemächtigen und sie in die angegebenen Quartiere bringen. Das übrige Gepäck landet erst einmal im Zollamt am Hafen. Hermann Consten taucht ein in die afrikanische Welt, auch wenn sie ihm, trotz der tropischen Vegetation und der feuchten Hitze, irgendwie vertraut erscheint. Was hatte er unterwegs, als er Port Said oder die farbenfrohen Hafenstädte Arabiens und am Horn von Afrika durchstreifte, nicht schon alles gesehen und erlebt, was nicht schon an fremden Gewohnheiten, Gerüchen und Geräuschen mit allen Sinnen aufgesogen und genossen? Doch seltsamerweise fällt ihm hier in Tanga ausgerechnet die peinliche Sauberkeit des Ortes als erstes angenehm ins Auge. Straßen und Plätze auf dem Weg zu seiner Unterkunft tragen zudem bekannte deut58
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
sche Namen: Kaiser-Wilhelm-Straße liest er im Vorbeifahren, BismarckPlatz und Friedrichstraße. Das klingt ganz so, als befinde sich Tanga mitten in Preußen. Eine der Straßen Tangas ist nach dem Mann benannt, der der ostafrikanischen Hafenstadt, die einst dem Sultan von Sansibar unterstand, ihr deutsches Gesicht gegeben hat: nach dem früheren Bezirksamtmann Walther von St. Paul-Illaire – dem übrigens auch, dies sei nur am Rande vermerkt, das aus deutschen Wohnstuben nicht wegzudenkende UsambaraVeilchen ihren lateinischen Gattungsnamen, Saintpaulia ionantha Hybride, verdankt. Consten ahnt bei seiner ersten Riksha-Fahrt durch Tanga wohl kaum, dass er diesem Mann in nicht allzu ferner Zukunft begegnen wird. All diese ersten Eindrücke in dem so deutsch anmutenden Ort in den Tropen könnten geeignet gewesen sein, in ihm einen Anflug von Heimweh zu wecken. Doch dürfte er dergleichen Sentimentalitäten rasch wieder beiseite geschoben haben. Er brauchte sich nur in Erinnerung zu rufen, wie viele Kämpfe es ihn gekostet hatte, sich gegen den Vater durchzusetzen und die familiäre Bedrückung in Aachen endlich hinter sich zu lassen. Dieser Triumph, dass er seinen Kopf durchsetzen konnte, hat sein Selbstbewusstsein ungemein gestärkt. Wie es nun einmal seine Art ist, steigt der junge Herr aus Aachen im ersten Haus am Platze ab, dem Gasthof Deutscher Kaiser, auch Kaiserhof genannt. Unter dem Dach der offenen Vorhalle, wo den Gästen Speisen und Getränke serviert werden, wo man sich aber auch beim Billard die Zeit vertreiben kann, erfrischt er sich erst einmal mit einem Glas Bier, um dann Tanga, bevor es dunkel wird, zu Fuß näher zu erkunden. Vor dem Kaiserhof liegen zum Indischen Ozean hin unter schattigen, vom Seewind bewegten Bäumen mehrere vernachlässigte Gräber. Dort sollen Inder bestattet sein, einstmals angesehene Kaufleute, wie es heißt. Wie entlang der gesamten Küste Ostafrikas beherrschen Inder, meist aus Bombay oder Goa stammend, und Araber auch in der Kolonie des Deutschen Reiches Handel und Kleingewerbe. Hinter der Grabanlage ragt Tangas Markthalle auf und nicht weit davon das Klubhaus. Damit ist Consten auch schon im Zentrum angelangt, dem von Bäumen bestandenen Bismarck-Platz, den eine Büste des Eisernen Kanzlers ziert. Dabei hat Bismarck, das weiß man, vom Erwerb von Kolonien für das Deutsche Reich nicht übermäßig viel gehalten. In dem weißen, im luftigen Kolonialstil errichteten Klubhaus kann man 59
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
der Hautevolee von Tanga begegnen: Kolonialbeamten, Plantagenbesitzern, Vertretern der Handelsgesellschaften, Lehrern, Ärzten, Missionaren, Offizieren der Schutztruppe. Eine ehrbare Gesellschaft, so scheint es, mit der Hermann Consten dort Bekanntschaft macht, eine überwiegend aus Männern bestehende weißhäutige, aber bärtige Gemeinde in Uniformen, Dinner-Jacketts, hochgeschlossenen Hemden mit steifen Krägen – mit dem Unterschied nur, dass die preußischen Uniformmützen, Pickelhauben und Zylinder durch die luftigeren hellen Tropenhelme oder die kühnen Kreationen der breitkrempigen, an einer Seite hochgeklappten Südwester-Hüte ersetzt wurden. Der Neuankömmling wird mit einer Mischung aus Neugier und Reserve zur Kenntnis genommen; der Oberkellner führt ihn an einen Tisch, an dem bereits einige Herren in Rattansesseln mit ihren Drinks sitzen. Man stellt sich vor, kommt ins Gespräch. Hermann Consten erhält schon bald ein paar nützliche Hinweise für seine ersten Tage auf ostafrikanischem Boden. Er erfährt etwas über die Stadtgeschichte Tangas, seine rasche Entwicklung zu einem Handels- und Umschlagzentrum, zum wichtigsten und produktivsten weißen Siedlergebiet Deutsch-Ostafrikas innerhalb weniger Jahre, der wachsenden Bevölke57 rungszahl, dem florierenden Hafen. Auch über das Klima mit seinen drei Monsunzeiten, über gesundheitliche Risiken, den Umgang mit den Eingeborenen und die besten Reiserouten wird er aus erster Hand informiert. Er hört erste, nicht immer freundliche Bemerkungen über die Pflanzer in den Bergen, ihre Frauengeschichten, Alkohol- oder Geldprobleme. Er lauscht voller Neugier den Fachsimpeleien über die wirtschaftlichen Aussichten des Kaffeeanbaus, die nicht allzu rosig eingeschätzt werden. In den Anfangsjahren seien mit der aus Mittelamerika eingeführten Kaffeepflanze gravierende Fehler gemacht worden, erfährt er. Die überhastete Anpflanzung der schattenliebenden Kaffeesträucher auf riesigen ungeschützten und teilweise unfruchtbaren Rodungsflächen habe sich gerächt. Die Sträucher gediehen nicht, seien krank geworden, eingegangen. Unter der gnadenlosen Sonne, den heftigen Monsunregen Ostafrikas, unter Schädlingsbefall und Baumkrankheiten seien die Investorenträume in der fernen Heimat auf raschen Profit inzwischen ausgeträumt. Die Erträge seien bislang nicht der Rede wert, die Kaffeepreise im Hamburger Zollhafen zudem so niedrig, dass Gewinne aus dem Kaffeegeschäft auf Jahre hinaus nicht zu erwarten 60
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
seien. Einige dieser Informationen hatte Consten schon der einschlägigen Fachliteratur in der Bibliothek der Kolonialschule in Witzenhausen entnommen. Damals kam ihm dies alles wie graue Theorie vor. Aber hier, in dieser Herrenrunde auf der Terrasse des Klubhauses von Tanga, gewinnen die Informationen auf einmal Plastizität, sie werden konkret. Denn jetzt gehen sie ihn unmittelbar an. Mit solchen Insider-Kenntnissen, so mag er blitzschnell begriffen haben, kann er bei seiner Ankunft auf der Kaffeepflanzung in wenigen Tagen bereits glänzen und sich dann selbst überzeugen, was davon stimmt und was nicht. Inzwischen hat sich die Nacht über Tanga gesenkt, in den Straßen flammt die Petroleumbeleuchtung auf. Auf der hell erleuchteten Veranda des Klubhauses am Bismarck-Platz genießen die weißgekleideten Europäer, einige wenige mit ihren Damen, den Abend. Das Schiffsorchester des Dampfers, mit dem Consten eintraf, spielt klassische Musik. An einem solchen Ort entbehrt sie nicht einer gewissen Exotik, denn in den tiefen nachtdunklen Schatten, wo die schwache Petroleumbeleuchtung nicht mehr ganz hinreicht, hocken die schwarzen Diener und die armen Lastenträger dieser illustren Gesellschaft, die Tagelöhner und kleinen Händler Tangas. Sie lauschen den fremdartigen Klängen der weißhäutigen Musiker. Vor knapp zwei Jahrzehnten erst sind diese Fremden übers Meer gekommen und haben sich an diesem Ort, einer jahrhundertealten arabischen Gründung, niedergelassen. Sie haben entlang der Küste des Indischen Ozeans ihre festen Steinhäuser, ihre Villen, Ämter, Kasernen, Krankenhäuser und Kirchen gebaut und sich zu Herren des Landes aufgeschwungen. Sie haben Gesetze und Städteordnungen erlassen, ihre Gesellschaftsordnung für allgemein verbindlich erklärt, die Ausbreitung des Christentums begünstigt. Sie haben Gärten und Schulen angelegt, Tanga in ein deutsches „Kolonialparadies“ verwandelt – und die einstige Führungselite in den Schatten gedrängt, sich unterworfen, den Götter- und Geisterglauben der Eingeborenen schlecht gemacht. Konzertabende werden meist gegeben, wenn draußen ein Dampfer auf Reede liegt, der neue Gäste in die Stadt gebracht hat. Viel Abwechslung bietet das Leben für die wenigen Europäer hier sonst nicht, eher gepflegte Langeweile. Man bleibt unter sich, man kocht im eigenen Saft und dünkt sich dennoch der einheimischen, der „eingeborenen“ Bevölkerung gegenüber unendlich überlegen. 61
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Für den frisch eingetroffenen Hermann Consten ist alles erst einmal neu und aufregend. In seiner ersten Nacht in Tanga schläft er kaum. Er will so schnell wie möglich weiterreisen. Doch vorerst liegen seine Sachen noch im Zoll. Am nächsten Morgen, einem Samstag, eilt er, nachdem er auf der Hotelveranda sein Frühstück eingenommen hat, zum Hafen, um sich nach dem Verbleib seines Gepäcks zu erkundigen. Verärgert muss er feststellen, dass das Zollamt geschlossen hat. An der verriegelten Tür ist die Mitteilung angeschlagen, der Zoll werde erst am kommenden Dienstag wieder öffnen. Sonntags sei Ruhetag, und am Montag dem 21. Oktober begehe die deutsche Gemeinde von Tanga den Geburtstag der Kaiserin Auguste-Victoria als offiziellen Feiertag. „Kaiserin Geburtstag“ in Deutsch-Ostafrika! Das hatte ihm noch gefehlt. Damit hatte er nicht gerechnet. Doch was will man da machen? Die Herren Akkersdijk und Gerling müssen sich halt noch ein bisschen gedulden. Und Hermann Consten hat erst einmal reichlich Zeit. Er nimmt sich vor, einen Blick in die Dukas, die kleinen Geschäfte der Inder zu werfen und sich dann eine Riksha zu mieten, um Tanga und seine nähere Umgebung, vor allem die schönen Plantagenanlagen am Stadtrand zu erkunden. Auch die jenseits der Bahnlinie gelegene Eingeborenenstadt von Tanga weckt seine Entdeckerlust. Außerdem heuert er einen Boy an, der ihn auf seiner Reise in die Usambara-Berge begleiten soll und lässt sich von ihm erste Worte der Landessprache Kisuaheli beibringen. Die Feiern zum Geburtstag der Kaiserin schließlich geraten bei glühender Hitze zu einem ganz besonderen Höhepunkt dieser ersten Tage auf ostafrikanischem Boden, einem deutsch-afrikanischen Event, von dem sich Hermann Consten sogleich Notizen macht. Morgens war große Parade der Askaris (Polizeisoldaten), man merkt ordentlich den deutschen Drill den schwarzen Kerlen an. An der Spitze zog die etwa 30 Mann starke schwarze Musikkapelle Tangas – die unter Leitung des Lehrers Blanc in Tanga steht –, vorüber; selbstverständlich von einer Menge schwarzer Gassenjungen, die den europäischen in keiner Weise etwas nachgeben, begleitet. Nachmittags war große Volksbelustigung. Hier gaben sich sämtliche Europäer, etwa 80 an der Zahl, ein Stelldichein. Unsere schwarzen Mitbürger vergnügten sich mit Stangenklettern, Sacklaufen, Topfschlagen und Wassertragen. Wenn man für einen 62
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
Augenblick die Augen schloss und den Jubel und Trubel um sich herum anhörte, hätte man annehmen können, man wäre auf einem deutschen Volksfeste, wo nur die Karussells mit ihren fürchterlichen Drehorgeln 58 fehlten.
Am Dienstag kehrt endlich wieder Alltag in Tanga ein. Das Zollamt hat geöffnet. Consten kann sein Gepäck auslösen und lässt es gleich zum Bahnhof schaffen, wo gegen Mittag ein Zug in Richtung der Usambara-Berge abgehen soll. Von der Usambara-Bahn, deren Bau für die weitere Erschließung der Kolonie von entscheidender Bedeutung ist, hat man im Jahr 1900 allerdings erst einen etwa 40 Kilometer langen Streckenabschnitt fertig gestellt. Den Rest bis zur rund 120 Kilometer von der Küste entfernt, in knapp 1.000 Meter Höhe gelegenen Handëi-Plantage wird Consten wohl zu Fuß oder mit einem Reittier bewältigen müssen. Er löst eine Fahrkarte bis zur derzeitigen Endstation Muhesa. Der Boy verstaut das Gepäck in dem wartenden Zug. Constens wahres Afrika-Abenteuer nimmt seinen Anfang. Nachdem die eingleisige Schmalspurbahn die Mango- und Kokoshaine Tangas in westlicher Richtung hinter sich gelassen hat, geht es hinaus in die Parklandschaft des ostafrikanischen Küstengebiets. Hier sieht Hermann Consten zum ersten Mal die merkwürdigen Leberwurstbäume mit ihren bräunlichen bis rotvioletten Glockenblüten und den kiloschwer niederhängenden, wurstförmigen Früchten. Bei der Station Ngmonemi, der dritten auf dieser kurzen Strecke, fällt sein Blick auf die ersten Kaffeesträucher im Schatten hoher Albizzien – eine etwa drei Jahre alte Versuchsplantage mit 500 Liberia-Kaffeepflanzen, wie ihm ein Mitreisender sachkundig erklärt. Nach dreistündiger Fahrt ist die Endstation Muhesa erreicht, ein hübsch gelegener lebendiger Marktflecken. Viele Menschen, die hier leben, sind beim Bahnbau beschäftigt. Auf dem Markt werden, wie Consten auf dem Weg von der Bahnstation zu seiner Unterkunft registriert, Zuckerrohr, Mais und Maniok, Früchte und Pfeffer feilgeboten. In Stichworten hält er am Abend seine Eindrücke in seinem Reisejournal fest. Später will er sie genauer ausformulieren. Seit er Deutschland verlassen hat, ist Hermann Constens Lust am Festhalten der Tagesereignisse, am Schreiben und Fotografieren geweckt. Kameras, Glasplatten und ein kleines mobiles Labor gehören von nun an auf allen seinen Reisen zu seiner Ausrüstung. Wie gut, dass er das Fach Fotografie in seinem letzten Karlsru63
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
her Semester noch belegt hatte. Es hat den Anschein, als sei bei ihm eine innere Wand weggebrochen, durch die er sich bisher gegen seine Umwelt abgeschirmt hatte, als könnten sich viele seiner verborgenen Talente mit einem Mal frei entfalten. An die Familie und an Freunde dürfte er, wie es für spätere Jahre belegt ist, in seinen afrikanischen Jahren lange Briefe geschrieben haben, in denen er seine Erlebnisse schilderte, er dürfte Fotos geschickt haben. Leider ist von diesen Dokumenten nichts mehr aufzufinden. Einziger verifizierbarer Adressat seiner ersten ausführlichen Berichte aus Afrika war Direktor Fabarius in Witzenhausen, der Constens Briefe in dessen Schülerakte gesammelt und aufbewahrt hat. Das Niveau seiner Friedrichsdorfer Schulaufsätze hat Hermann Consten, wie diese Briefe zeigen, weit hinter sich gelassen. Er feilt jetzt an seinen Sätzen. Die Briefe aus Afrika verraten Constens erzählerisches Talent. Die Fahrt führte mich allmählich durch die Steppe ins Bondeiland. Bei der dreistündigen Fahrt konnte man so recht die Steppe mit ihren echten Tropengewächsen beobachten. Bei einer der kleinen Stationen frug mich einer der mitreisenden Herren, ob ich Lust hätte, eine Weiße zu trinken. Erstaunt sah ich den Herrn an. Er hatte, wie er mir erst vorher versichert hatte, so wie ich nichts Trinkbares bei sich. Sich an meinem Erstaunen weidend, forderte er mich auf, ihm zu folgen; gelassen öffnete er die Wagentüre und stieg aus dem fahrenden Zuge, sofort sprang auch ich hinaus. Das Experiment gelang ganz gut, denn der Zug stieg einer steilen Höhe hinan und man konnte bequem nebenher traben, schneller als eine gewöhnliche Pferdebahn ging es an dieser Stelle sicherlich nicht. Mein Begleiter schlug einen Waldpfad ein und bald hatten wir die nächste Station erreicht, wo wir auch tatsächlich die besprochene Weiße zu einer Rupie erhielten. Nach zehn Minuten fuhr erst der Zug in die Station ein. Allmählich näherten wir uns den Usambarabergen. Das Usambaragebirge fällt schroff und steil zur Steppe ab; wenn man sich ihm von der Küste aus nähert, so erinnert seine ganze äußere Erscheinung lebhaft an den Schwarzwald. Gegen 4 Uhr erreichte ich den Endpunkt der jetzigen Bahnstrecke Muhesa im Bondeiland. Hier wurde ich liebenswürdig von den beiden einzigen Europäern in Muhesa aufgenommen. Die Nacht verbrachte ich bei einem Goanesen. Die Hütte schimpfte sich Gasthof oder Hotel, ich hatte doch wenigstens ein Dach überm Kopf und ein Bett zum Schlafen. Vorher wurde mir noch von dem Wir64
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
te selber geraten, meine Tür zu verschließen, da sich allerlei Gesindel durch den Bahnbau hier herumtreibe und auch der Leopard in der letzten Zeit sehr häufig seinem Hühnerstall einen Besuch abgestattet habe. Ich ließ den Kerl reden, schob ihn zur Tür hinaus und legte mich, nachdem ich allerdings die Tür verriegelt hatte, schlafen. Punkt fünf Uhr traten die Träger – der eine Europäer hat ein Lastentransportgeschäft – bei mir an. Meine Karawane bestand aus acht Trägern, meinem Boy, den ich von der Küste mitbrachte, und dem Pferdejungen, der mich mit meinem Maultiere schon seit acht Tagen erwartete. Noch einmal ritt ich bei den beiden Herren vor. Ein letzter Händedruck, ein letztes Gottbefohlen und der Urwald nahm mich und meine Begleiter auf. Nach einer halben Stunde gelangten wir noch einmal in die Steppe. Es mochte gegen halb sieben Uhr sein. Eine Menge schwarzer Frauen und Kinder, die nach Muhesa zum Markte gingen, begegneten mir hier. Mais und Bananen nebst süßen Kartoffeln sind, soviel ich bemerken konnte und tags vorher auch auf dem Markte, wo ungefähr 300 Schwarze anwesend waren, bemerkte, die hauptsächlichsten Handelsartikel. Muhesa selber ist durch Herrn Zschantz, der dort ungefähr 300 Träger unterhält, ein bedeutender Ort geworden, Herr Zschantz hat auch den Markt selber eingerichtet. [...] So zog ich denn weiter. Nach einstündigem Ritt gelangte ich wieder in dichten Urwald. Der Eingeborenenpfad, der sich langsam in die Höhe windet, war verhältnismäßig gut. Nach zweistündigem Marsche warfen die Träger die Lasten zur Erde. Wir hatten die Höhe erreicht. Bei einer kleinen Quelle hatten sie Halt gemacht. Mein Boy machte mir klar, dass die schwarzen Herren zu essen wünschten. Da nun auch ich ein menschliches Rühren in meiner Magengegend verspürte, so gab ich gerne die gewünschte Erlaubnis. Ein kräftiges Stück in Kalktuch eingeschlagene Wurst, ein Stück Brot und einen tüchtigen Zug aus der Feldflasche, daraus bestand mein Frühstück und mein Mittagessen zu gleicher Zeit. Zu meinen Füßen lag nun die gewaltige Steppe, so weit das Auge reichte nichts als Gras. Aber nein, dort drüben am westlichen Horizont erscheinen in blauen Dunst gehüllt die Berge von West-Usambara. Nach kurzer Rast geht es weiter. Hier und da begegnen wir Eingeborenen. Sofort ertönt der Ruf der Träger: ‚Macht Platz für den Europäer’. Die Leute drücken sich seitwärts in die Büsche und geben den Pfad ganz frei. Ein ehrfurchtsvolles ‚bwana jambo’ (gutes Geschäft, gleichbedeutend mit unserem ‚Guten Tag, Herr’), zeigte mir, in wie großem Ansehen die Europäer hier stehen. Gegen Mittag überschritt ich 65
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
den Sigi, den bedeutendsten Wasserlauf in Ost-Usambara. In Longusa, einem großen Vorwerk von der Pflanzung Derema, begegneten mir eine Menge Träger mit Kaffeelasten. […] Bei dem derzeitigen Chef von Derema führte ich mich durch mitgenommene Briefe aus Tanga ein. Allerdings erreichte ich Derema erst nach zweistündigem Ritt, denn der Weg war sehr schwierig und stieg beständig bergan. Von Herrn Feilka, dem derzeitigen Chef, wurde ich sehr freundlich aufgenommen. Lebhaft erkundigte er sich nach der Kolonialschule und war über das, was ich ihm mitteilte, sehr erfreut. Es wurde bereits dunkel, als ich von Derema aufbrach, die freundliche Einladung zum Bleiben musste ich ablehnen, da ich noch selbigen tags erwartet wurde. Zum Überfluss gefiel es dem Himmel, mir jetzt nach des Tages Hitze etwas Abkühlung zu verschaffen, es fing an zu regnen, aber was für einen Regen, wer einen richtigen Tropenregen noch nicht mitgemacht hat, macht sich gar keinen Begriff davon. Tropfen waren das nicht, sondern es goss nur so herunter. Dabei dunkle Nacht, die Wege wurden stellenweise zu kleinen Bächen, links und rechts krachten verdorrte Äste nieder. Den bei Jordan gekauften wasserdichten Poncho übergehängt, überließ ich mich vollständig dem Instinkt meines Maultieres. Hier lernte ich zum ersten Mal den Wert eines solchen Tieres persönlich kennen. Keinen Fehltritt machte das Tier, ruhig und sicher prüfend kletterte das Tier meinen Trägern nach. Endlich nachdem auch noch ein halsbrechender Abstieg bewerkstelligt worden war, erreichte ich das Dorf Kwamkuju. Lebhaft wurde mein Pferdejunge, der nach einem 8 Tage langen Ausbleiben einen neuen ‚Europäer’ brachte, begrüßt. Aber ich war noch nicht an meinem Endziel angelangt. Noch einen Aufstieg in strömendem Regen und 59 nach einer halben Stunde langte ich in Kwamkuju (der Pflanzung) an.
Die Aufnahme Hermann Constens in der Kaffeepflanzung Kwamkuju und tags darauf auch in der Hauptpflanzung Ngambo ist überaus freundlich. Der an Schwarzwasserfieber erkrankte Erste Assistent Gerlich, der Kwamkuju verwaltet, bewirtet den von seinem 14-stündigen Ritt durch Steppe und Urwald ermüdeten Consten mit einem vorzüglichen Abendessen, zeigt ihm dann sein Zimmer und zieht sich selbst, fiebergeschwächt, bald wieder zurück. Die Einrichtung von Hermann Constens neuer Bleibe besteht aus einem großen Bett mit Moskitonetz, einem Schreibtisch, Waschtisch und Kleidergestell nebst einigen Stühlen. Das im Haupthaus gelegene Zimmer, das auf eine umlaufende Veranda hinausgeht, ist zwar einfach, wie er fest66
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
Abb. 5: Kaffeepflanzung in Ngambo, um 1903
stellt, aber es gefällt ihm. Kaum dass er die nötigsten Dinge aus seinem Gepäck entnommen und sich zur Ruhe gelegt hat, übermannt ihn auch schon der Schlaf. Er erwacht am anderen Morgen erst gegen acht Uhr. Die Arbeit auf der Plantage ist um diese Zeit bereits seit zwei Stunden in vollem Gange, die Arbeiter sind draußen in der Pflanzung mit dem Jäten von Unkraut beschäftigt. Gerlich erwartet seinen neuen Mitarbeiter im Salon zum Frühstück. Er ist ein älterer, kräftiger und ruhiger Mann in den Vierzigern; seit über 16 Jahren, so berichtet er Consten, lebe er nun schon in Afrika, davon die meiste Zeit unter den in Deutschland so sehr bedauerten Buren. Die Kriegsereignisse dort hätten ihn bewogen, das Gebiet zu verlassen und nach Deutsch-Ostafrika zu gehen. Kwamkuju hat Gerlich vor bald fünf Jahren mit aufgebaut. Auch die Hauptpflanzung Ngambo, so erfährt Consten, ist erst vor fünf Jahren angelegt worden. Ob er sich vorstellen könne, fragt Gerlich, während er seinem neuen Mitarbeiter bei einem ersten Rundgang nach dem Frühstück einen Eindruck vom Umfang der baulichen Anlage und der Kaffeepflanzung vermittelt, dass das ganze Areal vor sieben Jahren noch von dichtem Regenwald bedeckt gewesen sei? Die Vorgeschichte der beiden Pflanzungen und damit auch die Entstehungsgeschichte der Rheinischen Handëi Plantagengesellschaft stellt, 67
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
nimmt man die Kolonialhistorie des Deutschen Reiches insgesamt in den Blick, ein eher marginales, aber dennoch höchst aufschlussreiches Kapitel des deutschen Kolonialismus dar. Denn die Umstände, unter denen der Erwerb eines Gebietes von der Größe eines Duodez-Fürstentums durch eine einzelne Person und zu geradezu lächerlichen Konditionen erfolgte, dürften typisch für die Art und Weise gewesen sein, wie in der Kolonialära überhaupt ganze Territorien über Nacht den Besitzer gewechselt haben. Die Geschichte von Ngambo und Kwamkuju hängt eng mit einem Mann zusammen, der eher ein Schöngeist und Kunstsammler, ein Forschungsreisender, Islamwissenschaftler und Archäologe war, dazu ein weltläufiger Diplomat und Nachrichtenspezialist, kurz: eine Persönlichkeit, die auf ganz anderen Feldern brillierte als auf gerodeten Urwaldflächen. Max Freiherr von Oppenheim, aus rheinischem Bankiersgeschlecht stammend, aber in Berlin, Kairo und Konstantinopel zuhause, berühmt geworden durch seine Ausgrabungen antiker Steinskulpturen im Tell Halaf im heutigen Syrien und berüchtigt als geistiger Urheber des preußischen „Jihad“ – der gezielten Aufwiegelung muslimischer Völker im Ersten Weltkrieg – war, was nur wenigen bekannt ist, der eigentliche Begründer der beiden Plantagen in den Usambara-Bergen, die nun für die kommenden zwei Jahre Hermann Constens Arbeits- und Lebensraum sein werden. In seinen Lebenserinnerungen, die als maschinenschriftliches Manuskript im Hausarchiv des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie. aufbewahrt 60 werden, schildert Max von Oppenheim im vierten Kapitel, wie er 1893 während einer Reise, die ihn unter anderem nach Sansibar und DeutschOstafrika führte, eher beiläufig zum Besitzer eines Stückchens Urwald wurde. Es hatte damit angefangen, dass der damalige Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, Friedrich Freiherr von Schele, Oppenheim anlässlich eines Essens im Gouverneurspalast in Daressalam ans Herz gelegt hatte, „in der Heimat für die Deutsch-Ostafrikanische Kolonie Propaganda zu machen. Er bedauerte es“, schreibt Oppenheim in seinen Erinnerungen, „dass zu wenig deutsche Kapitalien hier angelegt würden, sei es durch Plantagenbau, durch Handel usw.“ Und damit sich Oppenheim auch einen Eindruck vom Land selbst machen konnte, lud ihn Schele ein, an einer Reise in den Norden Deutsch-Ostafrikas teilzunehmen, zu der der oberste Justitiar der Kolonie, Herr Eschke, in Kürze aufbrechen werde. Oppenheim nahm 68
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
die Einladung dankend an und lernte auf diese Weise den nördlichen Küstenstreifen, das Flussgebiet des Pangani und vom Ostteil der UsambaraBerge das von tropischem Regenwald bedeckte Handëi-Gebirge kennen. Mehrere Tage hielt man sich auf der Pflanzung Derema auf, die der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft (DOAG) gehörte, und wo auch Consten, sieben Jahre nach Oppenheim, auf seiner Reise nach Kwamkuju Station machte. Oppenheim ließ sich in Derema über den Plantagenbau und seine Gewinnchancen genau informieren und fasste ziemlich spontan den Entschluss, selbst einen möglichst großen Landbesitz in der Handëi-Region zu erwerben. Eingedenk dessen, was ihm der Gouverneur nahegelegt hatte, wollte er das Areal später durch Freunde mit Kaffee bebauen und die durch den erforderlichen Holzeinschlag anfallenden Edelhölzer exportieren lassen. Ohne Zweifel auch für sich persönlich ein gutes Geschäft witternd, ging Oppenheim davon aus, dass der jungfräuliche Boden von Handëi, der Jahrtausende durch den Urwald geschützt und genährt worden war, als eine Geldgrube zu betrachten sei.
Die Anwesenheit Eschkes, ein mit den Besitzverhältnissen im Urwaldgebiet von Handëi bestens vertrauter Mann, kam Oppenheim insofern zugute, als sich sehr schnell ermitteln ließ, dass das bislang noch nicht verkaufte Areal „mindestens noch vier Quadratmeilen“ umfassen müsse. Dieses Areal unterstand der Herrschaft eines Stammeskönigs namens Kipanga, von dem die umliegenden Plantagenbesitzer bereits große Landflächen aufgekauft hatten. Das bislang noch nicht veräußerte Reststück wollte Oppenheim nun erwerben. Also begab man sich in das Dorf Engambo, wo der Stammeskönig sein Lager aufgeschlagen hatte und einigte sich mit ihm auf folgendes Geschäft: Eschke setzte einen Kaufvertrag zwischen Kipanga und mir auf, nach welchem ich 600 Rupien, der aus Indien eingeführten, in unserer Colonie gebräuchlichen Landesmünze – gleich etwa 1,15 Mark die Rupie – an Kipanga zu zahlen haben würde. Außerdem erhielt Kipanga noch eine Flasche Schnaps, diese aber erst, nachdem der Vertrag gefertigt und von ihm angenommen war. Kipanga freute sich über das von ihm zu erwartende Geld, mit dem er sich neue Frauen, Bekleidungsstücke etc. kaufen wollte. 69
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Den Verlust seines Oberhoheitsrechtes über das Land schätzte er wenig hoch ein. Im Gegenteil, er wusste aus Erfahrung von früheren Verkäufen an die erwähnten Plantagengesellschaften, dass hierdurch seine Leute Arbeit und Geld erhalten würden und dass er von dem letzteren einen Teil auch in seine Taschen würde fließen lassen können. […] Voller Dankbarkeit trug mir der Sultan Kipanga nach unserem Besuch von Engambo meinen Paletot bis an die Grenze seines Reiches. Er ließ mich von 61 einigen seiner Vertrauensleute bis zur Küste begleiten.
In Tanga ließ Oppenheim den Kaufvertrag durch den damaligen Bezirkshauptmann Walther von St. Paul-Illaire mit Datum 22. November 1893 beglaubigen und siegeln. Allerdings bedurfte es nach seiner Rückkehr nach Deutschland noch fast ein Jahr zäher Verhandlungen, bis Bedenken des Gouverneurs „wegen der Größe des von mir erworbenen Landgebiets“ ausgeräumt und Auseinandersetzungen mit der DOAG, die eigene Ansprüche geltend machte, erfolgreich beigelegt werden konnten. Niemand geringerer 62 als Reichskanzler Leo von Caprivi persönlich hat den Vertragsabschluss am 17. Oktober 1894 endgültig genehmigt. „So war ich“, resümierte Max von Oppenheim in seinen Memoiren nicht ohne Stolz, „der Herr eines Fürstentums geworden, das größer war als Reuß älterer und jüngerer Linie zu63 sammen genommen oder als Waldeck.“ Und das alles für knapp 700 Reichsmark und eine Flasche Schnaps! Für einen vermögenden Mann wie Max von Oppenheim waren dies peanuts, oder in diesem Fall passender: „Kaffeeböhnchen“. Zu seiner Ehre sei allerdings gesagt, dass er sein spontan erworbenes Fürstentum nicht etwa mit Gewinn weiter verkauft, sondern gleich wieder verschenkt hat: und zwar an seinen Vetter Simon Alfred Freiherr von Oppenheim, seines Zeichens damaliger Chef des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie. Dieser sollte nun, zusammen mit gemeinsamen Freunden aus den führenden Kölner Kreisen, dem deutschen Adel sowie einigen Forscher- und Jagdkollegen Max von Oppenheims, ein Unternehmen gründen und die dazu erforderlichen finanziellen Mittel aufbringen, um aus dem letzten Fleckchen ostusambarischen Regenwalds, das noch zu haben gewesen war, möglichst bald eine ertragreiche und gewinnorientierte Kaffeeplantage emporwachsen zu lassen. Als Grundkapital für die zu gründende Plantagengesellschaft mit Sitz in Köln war eine halbe Million Reichsmark vorgesehen, die von 70
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
den Gesellschaftern sukzessive einzuzahlen war. Simon Alfred von Oppenheim wurde Präsident der Rheinischen Handëi Plantagengesellschaft; ohnehin sollten alle Finanzierungen über das Bankhaus abgewickelt werden. Nachdem sich das Unternehmen 1895 etablieren und die Rodungsarbeiten im Urwaldgebiet von Handëi aufgenommen werden konnten, zog sich ihr Initiator Max von Oppenheim daraus zurück, begab sich auf seine zweite große Orientreise und widmete sich fortan nur noch Aufgaben für das Auswärtige Amt in Berlin sowie seinen pan-islamischen und archäologischen 64 Neigungen. Die weitere Entwicklung in Ngambo und Kwamkuju, für die sein Freund Manfred Graf Matuschka auf einer Reise in die Kaffeeanbaugebiete Sumatras und Javas den Holländer Joris Akkersdijk als erfahrenen Plantagenleiter gewinnen konnte, verfolgte Max von Oppenheim aber stets mit wachem Interesse. Die spätere Bestellung Walther von St. Paul-Illaires zum Nachfolger Richard Hindorfs, der zum Jahresende 1900 als generalbevollmächtigter Direktor des Plantagenunternehmens ausschied, ging zum Beispiel auf Max von Oppenheims Anregung zurück. Und so ist auch nicht auszuschließen, dass er die Einstellung Hermann Constens als Pflanzungsassistent im November 1900 zur Kenntnis genommen hat und dass ihm dieser offenbar hochintelligente, umtriebige und erstaunlich anstellige junge Mann, der sich eines Tages auch für das Auswärtige Amt und für ihn persönlich als nützlich erweisen sollte, schon damals aufgefallen sein dürfte. Jedenfalls finden sich im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes Hinweise aus späteren Jahren, aus denen hervorgeht, dass sich Max von Oppenheim und Hermann Consten gekannt haben müssen. Darauf wird an anderer Stelle einzugehen sein. Pflanzung Kwamkuju, 2. Dez. 1900 Sehr geehrter Herr Direktor! […] Ich habe hier, ich kann es Ihnen mit frohem Herzen berichten, eine Aufnahme gefunden, wie ich sie […] kaum erwartet hatte. Mein Chef, Herr Akkersdijk ist lange Zeit in Java als Leiter größerer Kaffeeplantagen thätig gewesen, jetzt weilt er schon mehr denn fünf Jahre hier in Ngambo, und seine Arbeit gilt weit und breit als mustergültig. Er kommt mir als ehemaligem Kolonialschüler doppelt freundlich entgegen, auch verfehlte er nicht, mir ausdrücklich zu versichern, wie sehr er persönlich für unser Thun und Treiben in Wit71
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
zenhausen, das er nicht, wie leider viele andere hier, bloß als eine bessere Spielerei auffasst, sondern als ein ernstes Streben bezeichnet, interessiert. […] Das Resultat der Unterredung war, dass ich vom 1. November ab in den Dienst der Rheinischen Plantagengesellschaft mit einem sehr schönen Gehalt getreten bin. So bin ich hier denn bloß 8 Tage Volontär gewesen. Einen Vertrag habe ich mit Herrn Akkersdijk dahin geschlossen, dass mir sowohl wie meinem Chef [gemeint ist Gerlich; D.G.] eine dreimonatliche Kündigung erlaubt ist. Meinen Dienst musste ich vom ersten Tage ab in Kwamkuju selber machen, da Herr Gerlich fast ständig zu Bett lag. In den ersten Tagen fiel mir die Sache sehr schwer; denn die Verständigung mit den Leuten war sehr schwierig. Bald hatte ich mich mit kräftiger Hilfe des Herrn Gerlich, dessen Vertretung mir ja oblag, dareingefunden. Meine Tagesarbeit ist folgende: Um fünf Uhr stehe ich morgens auf, wecke den Boy, überhaupt mein ganzes Dienstpersonal, das übrigens 5 Mann stark ist (Koch, Pferdejunge, Boy, ein kleiner schwarzer Bengel nebst einem Krüppel, dem hier beim Waldschlagen das Bein zerschmettert wurde, beide letztere fungieren als Mädchen für alles). Beim Wecken läuft der Kleine zur Glocke. Dieselbe besteht aus einer an einem Gestell aufgehängten Zwölfer-Schiene. Auf das Zeichen der Glocke, die erst langsam und dann immer schneller geschlagen wird, kommen die Leute nach dem Wohnhaus. In Gruppen von je 20 unter Aufsicht je eines Aufsehers gehen sie zum Schuppen und holen sich ihr Handwerkszeug. Getrennt stellen sich die Arbeiter zu zwei und zwei auf. Ihr Handwerkszeug wird aufgeschrieben und sie begeben sich zur Arbeit. Die mit Messer und Hacke ausgerüstet sind, reinigen im Akkord 80 Bäume pro Tag von Unkraut, das oft über Manneshöhe in der Schamba [= Pflanzung, D.G.] steht. Regnet es, so wird gepflanzt, doch nur während der Regenzeit, also hat jetzt bei uns das Pflanzen ein Ende. Das Pflanzen geschieht folgendermaßen: Die Leute werden in drei Abteilungen geteilt. Ein Drittel mit großen Pflanzstöcken bewaffnet, macht mit dem Pflanzstock das eigentliche Pflanzloch in dem vorher größeren und dann zugeschmissenen Loche. Das zweite Drittel pflanzt nun mit der Hand den jungen Pflänzling ein, indem darauf geachtet wird, dass die Wurzel nicht schief in die Erde gesenkt wird; die dritte Rotte deckt den jungen Pflänzling zu. Es darf unbedingt nicht mehr gepflanzt werden, als noch am selben Tage gedeckt werden kann: Die Decker senken zwei Bambusstäbchen kreuzweise über die junge Pflanze, wickeln um diese Stäbchen das eigens zu diesem Zweck geschnittene 72
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
Farrenkraut haubenförmig, sodass die junge Pflanze im Innern der Haube vollständig im Schatten steht. Wird nicht gut gedeckt, so geht die Pflanze bei etwas Sonne sofort ein. Die Arbeit an den Saatbeeten ist beinahe dieselbe wie 65 bei Herrn Sonnenberg. Nur dass wir die ganzen Saatbeete mit einem großen Dach von Farrenkraut vor den Sonnenstrahlen schützen. Wenn man so wie ich als Anfänger 130 Arbeiter in der Schamba hat, so muss man den Kopf zusammennehmen, um seine Arbeit gut zu machen. Jeder Tag brachte mir was Neues. Und ein Unglück kommt selten allein. So auch hier. Nicht genug, dass Herr Gerlich krank war, plötzlich erkrankte auch Herr Akkersdijk an einem leichten Fieber. Drei Tage übernahm ich nun auch die Plantage Ngambo zu Kwamkuju. Herr Akkersdijk ließ mir die Anordnungen für Ngambo schriftlich zukommen. Ich war jetzt beinahe, die Mittagspause abgerechnet, von Morgens um sechs bis Abends um sechs Uhr, wo ich die Leute auszuzahlen hatte, im Sattel. Doch nach einiger Zeit schien Herr Akkersdijk sich erholt zu haben, er übernahm seinen Dienst wieder, doch leider hatte er 66 sich und wir uns getäuscht. Ein heftiges Schwarzwasserfieber warf ihn wieder aufs Krankenlager. Gegenwärtig weilt mein Chef zur Genesung an der Küste in Ulenge. Herr Gerlich hat jetzt, auf dem Wege der Besserung begriffen, die Leitung von Ngambo übernommen, und ich sitze hier jetzt allein, beinahe eine gute Stunde von der nächsten Plantage (Ngambo) entfernt, als Leiter auf Kwamkuju. Übrigens sollte ich Kwamkuju sowieso im Februar (1901) übernehmen, da dann unser Chef zur Erholung nach Europa zurückkehrt. Unsere 67 anderen Assistenten sind bei der im Bau begriffenen Fabrik beschäftigt. Wenn Sie nun, verehrter Herr Direktor, diesen Brief erhalten, so wird’s bald Weihnachten und Neujahr sein. In Deutschland liegt Schnee und Eis und hier, nun bei uns hier hat so eine richtige Trockenzeit eingesetzt. Übrigens muss jetzt bald die alte Post fertiggestellt sein und der Platz für das Museum wird 68 wohl auch vorhanden sein. Nun möchte ich Ihnen, Herr Direktor, einen Vorschlag zur Güte machen. Ich bin im Begriffe, mir eine Sammlung der hiesigen Schmetterlinge und Käfer zuzulegen. Da nun hier das Spannen der Schmetterlinge wegen der zu großen Hitze nicht möglich ist, so möchte ich den Herrn, der die Verwaltung des Museums übernimmt, bitten, für mich die Schmetterlinge aufzuspannen und in dem Museum aufzubewahren als mein Eigenthum. Dafür erbiete ich mich, jedes Exemplar doppelt zu schicken und jede Doublette wird Eigenthum der Schule. Sollten Sie gesonnen sein, auf meinen Vorschlag 73
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
einzugehen, so bitte ich um baldige Antwort. Zum Schluss wünsche ich Ihnen und Ihrer werten Frau Gemahlin nebst sämtlichen Kameraden in Wilhelmshof ein fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr. 69 Ihr H. Consten
Der Berufsanfänger Hermann Consten wird in der ostafrikanischen Kaffeepflanzung der Rheinischen Handëi Plantagengesellschaft also gleich voll eingesetzt. Innerhalb nur einer einzigen Woche vom Volontär zum Assistenten befördert, muss er Verantwortung übernehmen und zeigen, was in ihm steckt. Ohne Zweifel wächst er mit seinen Aufgaben, er fühlt sich ernst genommen und anerkannt, was sich auch darin ausdrückt, dass er schon nach kurzer Zeit mehr Geld bekommt: statt 150 zahlt ihm Akkersdijk nun 175 Rupien pro Monat, was nach dem damaligen Kurs etwa 240 Reichsmark entspricht. Dies alles motiviert ihn ungemein. Nur übertreibt Consten ein bisschen, wenn er in seinem Brief an Fabarius den Eindruck zu erwecken versucht, das Wohl und Wehe der beiden Kaffeepflanzungen hänge nun einzig und allein von ihm ab. Allerdings ist schon auffallend, dass Pflanzungsleiter Akkersdijk ihm, dem Neuling, und nicht dem schon länger in Ngambo tätigen Assistenten Mucker, für die Zeit seiner krankheitsbedingten Abwesenheit die Verantwortung für die Einteilung der schwarzen Arbeiter wie auch für die täglichen Abrechnungen überträgt. Den Grund erfährt Consten erst später: Mucker ist ein Sadist, er behandelt die Arbeiter schlecht, schreit sie an, prügelt sie grundlos, verhängt bei kleinsten Verfehlungen drastische Strafen. Consten nimmt die ihm zugefallene Aufgabe wirklich ernst, in wenigen Wochen lernt er mehr als in Witzenhausen in einem ganzen Jahr. Wie sehr ihm dieses Kolonialschuljahr dennoch von Vorteil war, offenbart seine Fähigkeit, theoretisch angeeignetes Wissen nun in der täglichen Praxis parat zu haben, die erworbenen Kenntnisse kreativ anzuwenden und zu nutzen. Außerdem ist er bemüht, sich dessen bewusst zu bleiben, was Dr. Fabarius den Kolonialschülern in seinen völkerkundlichen Vorlesungen nahe zu bringen versucht hat, nämlich ein gutes Verhältnis zu den ihnen anvertrauten Arbeitern zu entwickeln, Interesse und Verständnis für ihre fremde Kultur zu zeigen, ihnen ein zwar strenger aber gerechter Vorgesetzter zu sein. Die Art allerdings, wie Consten die so verstandene „gerechte Behandlung“ praktiziert – körperliche Züchtigungen nicht ausgenommen –, wirft 74
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
dennoch ein bezeichnendes Licht auf die Ausübung herrschaftlicher Gewalt der Kolonialherren gegenüber der angestammten Bevölkerung wie auch gegenüber angeheuerten Fremdarbeitern aus anderen Gebieten Afrikas. In einem seiner Briefe gibt Consten freimütig Auskunft über Probleme mit den schwarzen Arbeitskräften, über ihre Bezahlung und gesundheitliche Versorgung, ihre Unterkunft und Verpflegung wie auch über Belohnung und Bestrafung – wohl wissend, dass sein Bericht, den Fabarius im Kulturpionier veröffentlicht, von vielen gelesen wird. Übrigens, was ihm zunächst nicht klar zu sein scheint, auch von der Kölner Geschäftszentrale. Dort ist man allerdings weniger entzückt über den schreibenden Assistenten in Kwamkuju. Kwamkuju, 26. März 1901 Sehr geehrter Herr Direktor! Soeben trifft mein schwarzer Postbote mit Ihrem lieben Schreiben bei mir ein. Von weitem glänzte schon sein schwarzes Vollmondgesicht, denn bringt er einen barua ya alaya (Brief aus Europa), so gibt es unfehlbar ein Bakshish. Er bekam den Bakshish und ich den Brief. Ich war schon unterwegs, um meine Tagesarbeit zu machen, aber das macht nichts, so las ich denn den Brief im Sattel, während mein Maultier behutsam Schritt für Schritt abwägend, den etwas schlüpfrigen Weg – vorher hatte es so ein bisschen geregnet, ich glaube 25 mm in 20 Minuten – herunterkletterte. Ich war nämlich auf dem Wege nach Ngambo, wo auf der Grenze zwischen der Hauptpflanzung Ngambo und Kwamkuju meine Leute die Schamba von Unkraut reinigen. Wie sehr ich mich über Ihren Brief gefreut habe, brauche ich Ihnen gar nicht erst zu versichern, war es doch das erste Zeichen aus der Kolonialschule, dass man mich in meinem lieben Wilhelmshof nicht ganz vergessen hatte. […] Kaisersgeburtstag wurde hier sehr stille gefeiert, da ich zur Zeit der einzige Gesunde hier war, alle Herren waren fieberkrank, aber nicht wegen schlechter klimatischer Verhältnisse hier, Ngambo und Kwamkuju sind allem Anschein nach noch vollständig fieberfrei, die Herren befinden sich nämlich beinahe alle über zehn und zwanzig Jahre in den Tropen. […] Soviel ich mich noch erinnere, habe ich Ihnen in meinem letzten Schreiben ausführlich über meine Arbeit, Wohnung und dgl. geschrieben. Wenn noch mein photographisches Papier zeitig eintrifft, erhalten Sie mit dieser Post das Bild meiner Wohnung ‚Kwamkuju’ zugeschickt, wenn nicht, dann mit der 75
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
nächsten Post. Kwamkuju liegt etwa 1000 m hoch, auf einem der vielen Hügel, an denen unsere Schamba so außerordentlich reich ist. In Kwamkuju stehen zur Zeit 80.000 lebende Kaffeebäume, während die Hauptpflanzung Ngambo 70 rund 600.000 Bäume umfasst. An Arbeitern sind bei mir in Kwamkuju etwa 140 mit einem Durchschnittslohn von etwa 9 Rupien und täglich 8 Pesa (Pesa = 2 Pfg.) Poscho (Futtergeld). Der Unterhalt der Schamba Kwamkuju wird ungefähr monatlich auf 2000 Rp. (die Rp. zu 1,39 Mark gerechnet) kommen. Also gehört zum Unterhalten einer solchen kleinen Schamba doch schon ein ganz schönes Kapital.
Ausführlich geht Consten in diesem langen Brief an Fabarius auf den Gesundheitszustand der Kaffeesträucher ein, verbreitet sich über Unkrautbekämpfung und seine eingehende Untersuchung der auftretenden Blatt- und Wurzelkrankheiten wie auch über Krankheiten unter den Plantagenarbeitern. So habe er sich durch Impfungen und das Desinfizieren ihrer Hütten bemüht, die in Kwamkuju grassierenden Pocken einzudämmen. Auch äußert er sich besorgt über die Gefahren der durch britische Schiffe aus Bombay eingeschleppten Pest, die besonders die schwarze Bevölkerung treffen dürfte. Er schreibt an Fabarius: Hier in Ostafrika, wo die Schwarzen sich zum Teil fast ausschließlich mit Bombay-Stoffen kleiden, die bis tief ins Innere verkauft werden, ja fast unser ganzer Handel in Händen der Indier liegt, können Sie die Gefahr bemessen, in denen unsere Kolonie und besonders die Hafenplätze schweben. Hoffentlich geht die Sache gut. Im Grunde ist für uns Europäer nichts zu fürchten, aber 71 die armen Schwarzen müssen daran glauben.
Die in diesen Zeilen zum Ausdruck kommende Fürsorge Constens und sein Verantwortungsgefühl für die ihm anvertrauten Menschen haben natürlich auch damit zu tun, dass er für die Erhaltung ihrer Arbeitskraft verantwortlich ist. Dass er gelegentlich auch dem Arbeitswillen der ihm Anvertrauten energisch nachhelfen muss, gibt er gegenüber Fabarius freimütig zu, wenn er schreibt: Was nun die Schwarzen selber betrifft, so bin ich mit meinen Arbeitern im allgemeinen zufrieden und sie, wie sie anderen Europäern gegenüber geäußert haben, mit mir. Nur in einem Punkte verstehen wir uns noch nicht: bei 76
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
schlechter Arbeit, die übrigens selten vorkommt, giebt es ein heiliges Donnerwetter und dann und wann, wenn es mal sein soll, giebt es ein paar Jagdhiebe mit der Reitpeitsche. Nun bin ich, ohne es zu wollen, auf ein ganz heikles Thema geraten und will mich denn offen über meine Stellung zur Prügelstrafe äußern. Prügeln um zu prügeln, den Leuten mit Fußtritten und Faustschlägen gegenüber aufzutreten, wo man das, was man will, mit ein bisschen mehr Geduld ganz gut erreichen könnte, halte ich für vollständig verwerflich. Aber dann und wann so einen unverbesserlichen Faulenzer einmal ein paar gründlich überziehen zu lassen, halte ich für unumgänglich notwendig. Nur hüte man sich, ungerecht zu schlagen, hierfür hat der Neger ein sehr gutes Verständnis. Gegen Faulenzer, Spitzbuben, die den Leuten noch ihr bisschen Geld und selbstgepflanztes Essen stehlen, Gewohnheitstrinker bin ich unerbittlich, hier giebt es Prügel und die gründlich. Wie sehr der Neger selber damit einverstanden ist, beweist dies, dass sie mir selber solche „Herren“ zur Aburteilung vorführen. So ein fürchterliches Instrument die Kiboko (Nilpferdpeitsche) für unsere Begriffe ist, so wenig macht sich der Neger daraus. Ich möchte am liebsten die Kiboko in diesem Fall mit dem auch nicht gerade zarten spanischen Rohrstock des Schulmeisters vergleichen. Aber Prügeln und Prügeln ist zweierlei. Deshalb soll man nur stets gerecht und mit Mäßigung und nur dort, 72 wo unumgänglich notwendig prügeln.
Trotz der harten Arbeit in ungewohntem Klima, trotz einer Verletzung, die er sich bei einem seiner Ritte durchs Gelände zugezogen hat und die ihn für einige Tage ans Bett fesselt, scheinen für Hermann Consten diese ersten Monate in den Usambara-Bergen ein einziges großes Abenteuer zu sein. Er lernt Ostafrika, seine Menschen und ihre Sprache kennen und lieben, er eignet sich mehr und mehr Fachkenntnisse der Tropen, des Plantagenbaus und des Holzeinschlags an, er fotografiert fleißig, macht sich regelmäßig Notizen über alle Vorkommnisse, pflegt lebhaften Kontakt mit den Nachbarplantagen. Er geht auf Jagd nach Wildtieren in den Urwald. Wohl bald schon hat er einen schlanken, hochgewachsenen Massai-Krieger als verlässlichen, treuen Jagdgefährten an seiner Seite, den er schlicht mit seinem Stammesnamen Ngombe nennt. Und schließlich fällt ihm auch eine kleine afrikanische Geliebte zu, seine Bibi, ohne die ein zum Junggesellendasein verurteilter weißer Pflanzer in den Tropen auf die Dauer wohl nicht überleben könnte. Von ihrer Existenz verrät er dem sittenstrengen, auf Wahrung 77
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
christlich tugendhaft gelebten Deutschtums in der Fremde bedachten Fabarius lieber nichts. Das unverhoffte Wiedersehen mit Paul Weise, einem ehemaligen Mitschüler aus Witzenhausen, der es mit seiner Stelle in Deutsch-Ostafrika wohl nicht so gut getroffen hatte wie Consten und eines Tages ziemlich abgerissen in Kwamkuju auftaucht, ist ihm weniger angenehm. Sein Versuch, dem stellenlos gewordenen Kameraden zu helfen, wird ihm, so ist sein Eindruck, schlecht gedankt. Und erstmals fühlt sich auch Fabarius, der in dem nun anhebenden Ehrenhändel zwischen zwei Streithähnen vermitteln soll, von Consten und dessen schriftlicher Eloquenz schlicht überfordert. Die Briefe, die von nun an gewechselt werden, eignen sich nur noch sehr bedingt für eine Veröffentlichung im Kulturpionier, werden teilweise auch als persönlich, privat oder vertraulich klassifiziert. Aber sie spiegeln, vor allem wenn man Weises teilweise ätzende Stellungnahmen hinzunimmt, die sich ebenfalls noch im Archiv des Instituts für tropische und subtropische Landwirtschaft (DITSL) in Witzenhausen befinden, ein doch etwas schwärzeres Bild des deutschen Kolonial-Alltags auf den Pflanzungen in Ostafrika. Zwar war es Paul Weise zum Sommer 1901 noch gelungen, auf einer Kokos- und Sisalplantage der DOAG, für kurze Zeit wenigstens, wieder beschäftigt zu werden, aber an seinem negativen Gesamturteil über den Zustand auf den deutschen Pflanzungen – Ngambo und Kwamkuju nicht ausgenommen – änderte dies nichts. Die Missstände waren seiner Meinung nach bedingt durch mangelnde Erfahrung der Pflanzer, Nachlässigkeit, aber nicht zuletzt auch durch die schlechten Absatzmöglichkeiten der dort erzeugten Produkte auf dem europäischen Markt – eine Meinung übrigens, die auch von fachkundigeren Kritikern geteilt wurde. „Sie glauben gar nicht, wie viele stellungslose Plantagen-Assistenten zur Zeit hier herumlaufen“, schrieb Weise an Fabarius. Alle größeren Gesellschaften stoppen kolossal ab. Die Etats auf den einzelnen Plantagen sind so gekürzt worden, dass es schier zum Verzweifeln ist. Von Neuanlagen will überhaupt niemand mehr etwas wissen. Überall steht mit 73 großen Lettern angeschlagen – Sparen, Sparen!“
Und dann zog er vom Leder, übte scharfe Kritik am Management einzelner Plantagen, schonte vor allem nicht seinen ehemaligen Chef, dessen Pflanz78
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
methode er als „Blödsinn“ abqualifizierte, weil sie sich nicht mit dem deckte, was ihm in Witzenhausen beigebracht worden war. „Da ich nun gerade so beim schlecht machen bin“, fuhr Weise schließlich, nicht ohne Neid, fort, will ich gleich mal zur Plantage, auf der unser Kamerad Consten beschäftigt ist überspringen. Die Pflanzung steht ja und trägt auch schon, aber schön ist anderes. Der Leiter ist eben auch ein Holländer und arbeitet nach seinem Schema F. Jedenfalls könnte Consten hier mal zeigen was er kann und wieweit er Auge hat für den ganzen Kaffeebau. Er hat eine Abteilung für sich erhalten und hier würde ich unbedingt durch sachgemäße Bodenbearbeitung und intensives Reinhalten meinen Chef sehr bald überzeugen, von welch kolossalem Nutzen gerade dieses für den Kaffee ist. Consten behauptet nun er könne dies nicht, ich weiß nicht was ihn daran hindert. Sein Chef ist zurzeit nicht da und der stellvertretende Leiter ein fortwährend kränklicher Herr, der zufrieden ist, wenn man ihn zufrieden lässt. Da könnte er meiner Ansicht nach sehr viel thun, denn gerade seine Abteilung sieht aus, dass es einen Hund jammern kann. Consten trifft ja nun darin kein Vorwurf, denn er hat ihn [sic] nicht angelegt. Jedenfalls ist der von Consten so vergötterte Leiter auch mit Vorsicht zu 74 genießen.
Dass hinter diesen abschätzigen Bemerkungen noch etwas anderes steckt, belegt ein kurzes Schreiben Paul Weises vom 17. September 1901 an Consten selbst, in dem er ihm wegen dessen „Klatschereien“ jeden weiteren Kontakt aufkündigt und ihm mit der Bemerkung „Du scheinst wieder auf Deine alten Colonialschul-Sprünge zu kommen“ zugleich die Warnung zu75 kommen lässt, in Zukunft vorsichtiger mit seinen Äußerungen zu sein. Hintergrund des Streits war: Consten hatte den stellenlosen Weise nicht nur über viele Wochen auf Kwamkuju beköstigt und übernachten lassen, sondern ihm auch noch 50 Rupien geliehen, die dieser bis dato nicht zurückgezahlt hatte. Nun kündigt Paul Weise die postwendende Rückgabe der Summe an, streut aber das Gerücht aus, Consten hätte ihm diese Summe beim Glücksspiel abgenommen. Dieser reagiert, als ihm das Gerücht zu Ohren kommt, mit der Androhung einer Privatklage. In einem späteren Schreiben entschuldigt sich Weise bei Consten wegen „unkameradschaftlichen Verhaltens“ und nimmt geradezu unterwürfig einen großen Teil seiner Kritik an verschiedenen Pflanzungsleitern in aller Form zurück. Für 79
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Consten bleibt das Tischtuch dennoch zerschnitten. Er will mit Paul Weise nichts mehr zu tun haben, verlangt von Fabarius sogar dessen Ausschluss aus dem eben erst gegründeten Altherrenverband der Kolonialschule. Was dieser jedoch ablehnt. Eine Lappalie, könnte man meinen, doch die Radikalität, mit der der sich in seiner Ehre verletzt fühlende Consten Satisfaktion einfordert, geht selbst einem Mann wie Direktor Fabarius entschieden zu weit. Dafür mahnt er bei seinem ehemaligen Schüler ein Versäumnis an: Consten möge endlich die versprochenen Sammlerstücke für das in Witzenhausen entstehende völkerkundliche Museum schicken, teilt ihm Fabarius 76 mit. Und dieser antwortet unter dem 27. Oktober 1901 etwas verlegen: Was nun meine Sammlungen anbetrifft, so habe ich jetzt noch nicht viel zusammengebracht. Außer ein paar ethnographische Kleinigkeiten, Waffen und dergleichen habe ich bis jetzt nichts zusammengebracht. Übrigens dies alles nur mit sehr großem Geldopfer, da sich der Schwarze von seinem weißen 77 Herrn alles sehr teuer bezahlen lässt.
Von den Schmetterlingen, die Consten ebenfalls zu schicken versprochen hatte, ist nicht mehr die Rede. Den mittlerweile 23-Jährigen beschäftigt, ein Jahr nach seiner Ankunft auf ostafrikanischem Boden, bereits eine ganz andere Frage, nämlich wie die Zukunft der deutschen Siedler in Ostafrika, wie vor allem seine eigene Zukunft aussehen könnte. Denn auch er kann seine Augen vor den Schwierigkeiten eines eigenständigen Lebens in den Kolonien auf Dauer nicht verschließen. Noch weniger allerdings kann er sich eine Rückkehr in die Heimat vorstellen. „Mein hiesiges Leben gleicht einem gut gehenden Uhrwerk und Sie glauben kaum, wie schnell da die Tage, Wochen und Monate vorübergehen. Und ehe man sich so recht versehen hat, ist ein Jahr um“, schreibt er am 27. Oktober 1901 an Fabarius. Er fährt fort: Andere Kameraden werden sich freuen, wenn sie wie ich sagen können: ‚Jetzt noch zwei Jahre und ich kehre in die Heimat, zu den Eltern und Geschwistern und all den Lieben, die mich klopfenden Herzens haben scheiden sehen, zurück.’ Ich weiß nicht, obwohl auch ich dann und wann eine große Lust verspüre, alle diejenigen, die hier draußen mich nicht vergessen haben, wieder zu sehen, so ist mir doch der Gedanke an eine Rückkehr nach Deutschland[,] ohne irgendeinen meiner Pläne verwirklicht zu haben, nicht wohl vertraut. Doch 80
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
wer weiß, was da kommen mag. Jedenfalls habe ich mich schon etwas mit der ‚orientalischen Philosophie’ vertraut gemacht und warte eben hier oben ab, was mir mein Kismet bringen wird. Sie brauchen allerdings nicht dabei anzunehmen, dass ich mit den Händen in dem Schoß die Sache an mich herantreten lassen werde, oh nein, dazu steckt zu viel rheinisches Blut in mir. Aber so 78 etwas Lebensphilosophie des Orients hat oft eine wunderbare Wirkung.
„So etwas Lebensphilosophie des Orients“ – hier klingt erstmals eine neue Grundmelodie an, die Constens späteres Leben prägen, sein rheinisches Blut, wie er es nennt, sein unstetes Wesen – ein bisschen wenigstens – zähmen, ihm letztlich zum Schicksal werden wird. Stellt man sich den Hermann Consten jener Jahre auf der abgelegenen Kaffeefarm in den Usambara-Bergen und die Männer, mit denen er Umgang pflegte, vor, so kann es nur einen Menschen gegeben haben, der dem raubeinigen, tatkräftigen, eher extrovertierten jungen Mann etwas von der Lebensphilosophie des Orients erzählt haben könnte: Joris Akkersdijk, sein „vergötterter“ holländischer Pflanzungsleiter. Akkersdijk hatte Jahre in Südostasien verbracht, war dort in Kontakt gekommen mit der Götter- und Gedankenwelt des Hinduismus und Buddhismus – und findet nun in seinem „gebildeten“ Assistenten einen aufmerksamen, viele Fragen stellenden, kurz: einen ernsthaft interessierten Zuhörer für alles, was er von seinen asiatischen Erfahrungen für berichtenswert hält. Er gibt ihm, so ist zu vermuten, nach langen Gesprächsabenden schließlich auch Bücher über die östliche Geisteswelt zu lesen, über Java, Sumatra, die Menschen und die Pflanzungen dort. Solche Lesefrüchte jedenfalls schlagen sich in Constens Briefen an Fabarius nieder. Mitten in Afrika tut sich für Hermann Consten, wie eine ferne Verheißung, die Welt Asiens auf. Als ein Mensch, der sich schnell für etwas zu begeistern vermag, der eine rasche Auffassungsgabe besitzt, der, wenn die Nacht über Ngambo und Kwamkuju hereinbricht, beim Schein der Petroleumlampe liest, träumt und sich Geschichten ausdenkt, die nicht nur in Afrika spielen, erschließt sich für ihn damit eine ganz neue Dimension, die zu ergründen ihm reizvoll erscheint. Und welche Bücher hatte Consten selbst mit nach Afrika genommen, abgesehen vielleicht von Werken der Geschichte und Geographie Afrikas und etwas Fachliteratur über Plantagenwirtschaft in den Kolonien? In einer seiner Afrika-Erzählungen erwähnt er die Lektüre mehrerer Bücher. Sie 81
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
spielen alle in Osteuropa. Zu Constens Urwald-Lektüre gehörten demnach Lev Tolstojs berühmte Kreutzer-Sonate und seine Kosaken. Titel und Autor eines „kleinen unscheinbaren Büchleins, das mich durch seine Eigenart fesselte“, verschweigt er, beschreibt aber seinen Inhalt: Die Erzählungen waren packend geschrieben und spielten in Prag und Lemberg. Es waren Versuche eines jüdischen Schriftstellers, das Leben und Treiben jüdischer Familien im achtzehnten Jahrhundert festzuhal79 ten.
Offensichtlich scheint ihn auch die slawische Welt, in die er wenige Jahre später eintauchen wird, vor allem Russland, schon damals beschäftigt zu haben. Wie auch immer, seinen alten Plan, erst einmal auf dem schwarzen Kontinent zu bleiben und eine Viehzuchtstation aufzumachen, hat Consten über den neuen Erkenntnissen keineswegs aus dem Auge verloren. Was ihn hindert, den Plan zu verwirklichen, ist offenbar nach wie vor die Weigerung des Vaters, ihm finanziell unter die Arme zu greifen. Ohne Eigenkapital, ohne Sicherheiten, so viel ist klar, kann aus diesen Plänen nichts werden. Doch nicht ohne Grund vermutet Consten als zweites Hindernis die Kolonialpolitik der Reichsregierung in Berlin und dementsprechende Weisungen ihres Gouverneurs in Daressalam. Seine Anmerkungen dazu sind überaus kritisch, wenn er an Fabarius schreibt: Man soll sich doch nicht einbilden, dass wir deutsche Ansiedler ins Land ziehen, wenn das Gouvernement einen Vermögensnachweis von zehntausend Mark verlangt. Wollen wir hier vorwärts kommen, sollen Eisenbahnen,Verkehrswege usw. gebaut werden, so heißt vor allen Dingen die Losung: ‚Menschen her und das recht viele.’ Wo Menschen sind, gibt es Bedürfnisse, wo Bedürfnisse vorhanden, blüht der Handel, wo Handel da Verkehr und wo ein reger Verkehr ist, da kommen die Eisenbahnen von ganz allein. ‚Also nochmals, Menschen her.’ Was wäre heute Amerika, wenn es von jedem Einwanderer der sich als Ackerbauer dort niederließ einen Vermögensnachweis von zehntau80 send Mark verlangt hätte.
Viele bäuerliche Auswanderer hat es in der Tat gerade aus diesem Grund bislang nicht in die deutschen, sondern lieber in andere Kolonien gezogen. Als Folge der restriktiven Siedlungspolitik Berlins hinkt die wirtschaftliche 82
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
Entwicklung der deutschen Kolonien in Afrika auch in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts noch weit hinter den in sie gesetzten Erwartungen hinterher. Während die Reichsregierung jährlich rund eine Milliarde Mark für den Import ausländischer Kolonialprodukte aufwende – so rechnete Prof. Ferdinand Wohltmann in der Zeitschrift Der Tropenpflanzer vor –, beliefen sich die staatlichen Zuschüsse für die Anlage von Pflanzungen in den eigenen Kolonialterritorien gerade einmal auf 30 Millionen Reichsmark. Mit Ausnahme Deutsch-Südwestafrikas, wo die Auswandererzahlen höher lagen, hätten sich in den übrigen afrikanischen Kolonien bis 1902 gerade einmal 177 Pflanzer angesiedelt, davon 90 in Deutsch-Ostafrika, 80 in 81 Kamerun und ganze sieben in Togo. Zur Kaffeekultur in Deutsch-Ostafrika merkte Wohltmann im selben Beitrag kritisch an: In Deutsch-Ostafrika hat man sich seit 1890 mit größter Energie auf Kaffeekultur gelegt. Etwa zehn große kapitalkräftige Pflanzungen wurden nach und nach mit Vorwerken angelegt, vornehmlich im Usambara-Gebirge. In den dortigen zehn großen Kaffee-Unternehmen stecken heute etwa 16 Mio. Mark Anlagekapital. Die Erfolge lassen jedoch, trotz billiger Arbeitskräfte, trotz Eifer und Umsicht, und neuerdings auch guter Sachkenntnis noch sehr zu wünschen übrig. Die Ernten sind nur sehr mäßig. Das Jahr 1901 dürfte schwerlich mehr als 5.000 Zentner Kaffee gebracht haben, im Werte von rund 300.000 Mark. Bohrkäfer, Wurzellaus und Hä82 mileia bedrohen neben der Nährstoffarmut des Bodens und Unsicherheit des Klimas vielerorts den infolge der Urwaldasche anfänglich guten Bestand. Es ist zur Zeit noch nicht möglich, ein letztes Wort über die Rentabilität dieser Anlagen zu reden. Soviel steht jedoch leider fest, dass ein Teil des in Kaffee angelegten Kapitals verloren ist. Andere Kulturen sind vereinzelt bereits an Stelle des Kaffees getreten, und in Zukunft wird 83 dieses noch immer mehr erforderlich sein.
Immerhin, trotz dieser wenig ermutigenden Gesamtbilanz deutet sich für Consten gegen Ende des Jahres 1901 eine weitere Konsolidierung seiner Position auf den beiden Kaffeepflanzungen der Rheinischen Handëi Plantagengesellschaft an. Zum einen teilen die Gesellschafter der RHPG den Pessimismus Wohltmanns trotz der aktuellen Schwierigkeiten nicht unbedingt, erwarten sie doch, dank der günstigen Entwicklung Ngambos und dank der 83
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
sparsamen Wirtschaftsführung Akkersdijks, spätestens im Jahr 1904 sogar Überschüsse aus den Erträgen ihrer Pflanzungen zu erwirtschaften. Als weiterer Umstand kommt Consten die Tatsache zugute, dass Akkersdijk dem Assistenten Mucker „wegen Nichterfüllung von Aufgaben und grober Unhöflichkeit“ zum Ende des Jahres 1901 kündigt und der Zentrale in Köln mitteilt, er gedenke Consten, mit dem er Ngambo nun allein bewirtschaften und daher den Bau der Trocknungsanlage einstweilen liegen lassen müsse, einen regulären Dienstvertrag zu verbesserten Konditionen anzubieten; er bitte daher um die Zusendung eines Modell-Dienstvertrags für Assisten84 ten. Consten, soeben erst von einer Lebensmittelvergiftung genesen, die ihn für mehrere Wochen erheblich schwächte, spürt für sich neuen Auftrieb. Nun kann er sich wirklich als unentbehrliche Stütze des ganzen Unternehmens fühlen und, wer weiß, selbst auch ein bisschen Kapital ansammeln. Um seine Chancen bei der Kölner Geschäftsleitung nicht unnötig zu gefährden, muss er allerdings, wie ihm Akkersdijk bedeutet, in Zukunft darauf verzichten, weitere Berichte über die Verhältnisse in Ngambo und Kwamkuju, seine Erfahrungen als Kaffeepflanzer und seine Einschätzung der Aussichten dieses Wirtschaftszweiges in irgendwelchen Zeitungen oder im Kulturpionier zu veröffentlichen. Man sehe dies in Köln nicht gern. Publikationen behalte man sich selbst vor. So erschien beispielsweise seit 1897 im Tropenpflanzer regelmäßig der von der Gesellschafterversammlung verabschiedete Jahresbericht. Consten teilt Direktor Fabarius unter dem 27. November 1901 diesen Sachverhalt mit – und schreibt fortan erst einmal für die Schublade. Es entstehen kleine Naturstudien und völkerkundliche Betrachtungen, autobiografisch gefärbte Afrika-Geschichten voll tropisch-erotischer Schwüle. Stilistisch ergeht er sich bei seinen Schreibereien mal in lyrischem Gesangston, mal in wild alliterierenden, einander überstürzenden Wortkaskaden und gerät auch schon mal hart an die Grenze zu Kolonial- und Heimatkitsch. 1926 erst, also ein Vierteljahrhundert nach seinen afrikanischen Jahren, finden Hermann Constens erste literarische Gehversuche Eingang in sein 85 Buch „... und ich weine um dich, Deutsch-Afrika“, in dem er nicht nur den verloren gegangenen deutschen Kolonien auf dem schwarzen Kontinent, sondern auch den Menschen, denen er dort begegnet ist, ein Denkmal setzt. 84
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
Der Tauben dumpfer Ruf schallt durch den Urwald. Papageientauben in strahlendem, blassblaugrünem Gefieder streichen mit hartem, pfeifendem Flügelschlag ab. Hell schimmert das Korallenrot des Schnabels und der Füße. Reis-, Blut- und Goldfinken, sowie Pfefferfresser zucken hin und her. „Vorwärts Herr“, drängt Ngombe, als uns dreist und keck ein Honigvogel mit seinem Geschrei so umflattert, als wolle er uns etwas mitteilen. […] Edelhölzer, soweit das Auge reicht, ragen zwischen schattenden Baumfarnen. Hell blinkt die Birkenrinde des Ebenholzbaumes, während der kostbare Sandelbaum und die Zedern sich zwischen kletterndem, wildem Gewirr gen Himmel recken. Endlich haben wir den unbewohnten Urwald hinter uns, und vor uns liegt die Kaffeepflanzung, auf der Bwana Großjahn haust. Zwischen kleinen und größeren Kaffeebäumen hindurch führt der Weg seinem Hause zu. Überladen sind die Kaffeebäume zu gleicher Zeit mit grünen, gelben, roten und dunkelbraunen Früchten, dazwischen wie ein holdes, weißes Wunder die jasminartigen Blüten. […] Sauber und rein ist die Schamba von Unkraut, durch Hunderte messerschwingender Neger gereinigt. Roteisenhaltig leuchten die scharfumrissenen Erdterrassen, auf denen die Kaffeebäume stehen, in der Spätnachmittagssonne. Bwana Großjahn liegt bleich und matt auf seinem Bett. Ein glückliches Lächeln huscht über sein eingefallenes Gesicht, als er mich mit den Worten begrüßt: „Jambo, Bwana, jetzt brauche ich doch wenigstens nicht einsam und verlassen zu sterben.“ Ein schneller Blick überzeugt mich, dass sein Urin dunkelrot wie Blut ist. „Nun hören Sie mal, Bwana, so schnell stirbt es sich in Ostafrika doch nicht“, tröste ich ihn, „aber wenn schon gestorben werden soll, so wollen wir uns wenigstens einen anständigen Abschiedstrunk genehmigen. Also, Bwana, wie wäre es mit einer Flasche Champagner. Das ist jedenfalls in Ihrem Fall gesünder und besser wie Chinin.“ Ich hatte nämlich von dem alten Papa Gerlich einmal gehört, dass die meisten an Schwarzwasserfieber Erkrankten dadurch sterben, dass sie noch zuletzt aus lauter Angst und Verzweiflung, nach Ausbruch des perniziösen, Chinin zu sich genommen haben, wogegen Champagner angeblich die Nieren wieder zu neuer Tätigkeit anregen soll. „Aber ehe ich etwas trinke“, sprach Bwana Großjahn müde und stumpf, „will ich doch wenigstens meine letzten Anordnungen treffen.“ […] 85
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Stunden waren vergangen. Vom vielen Champagner lag Bwana Großjahn in schwerem Schlaf. Ich aber ritt, gefolgt von meinem Massai, durch die nächtliche, mondbeschienene Pflanzung zurück. […] Heute ist Heiliger Abend, fährt es mir plötzlich durch den Sinn, und neben mir stand an des Freundes Bett, als Dritter im Bunde, Bruder Hein. Heiliger Abend! Jetzt flimmert und funkelt der Nordhimmel über eisigkalte Nordlandsnacht der deutschen Christenheit. […] „Herr, wir sind den falschen Weg geritten“, unterbricht meinen Gedankengang Ngombe, „die vielen Wege der Pflanzung haben mich verwirrt. Wir stehen vor dem Sumpfe, der sich hier in das Tal festgesetzt hat. In der Richtung, wohin wir jetzt wollen, führt der Weg in zwei Stunden zu Bwana Muker.“ „Auch gut, zurückreiten hat doch keinen Zweck und bedeutet nur einen Umweg.“ Schon schreitet der Massai, das Maultier am Zügel führend, durch den dichten Vorbusch, auf den phantastisch beleuchteten Sumpf zu. Leise klirren die Bügel. Das Maultier knirscht im Gebiss, ich schiebe den Patronengürtel zurecht und lege die Büchse quer über den Sattel. Hart klappern die Hufe des Maultieres auf dem Knüppeldamm, der hinüberführt. Tropfende Quellen, leisplätschernde Wasser. Weißbesäter, dunkelblauer Sternenhimmel. Um Vollmond und Kreuz des Südens jagendes Wolkengrau im endlosen Raum. Nebelfrauen ziehen singend im wechselnden Mondlicht über das Sumpfschilf. Das kichert und gluckst, das schnellt aus trüben Wassern empor, aus Wellen und Wirbeln leuchten geheimnisvoll riesengroße Phosphoraugen. Silberhell die Stimmen im Inneren: Leuchtakkorde des Mondes ertönen… Christ ist geboren… es wispert das Leben des Sumpfes. Leise wie klingender Kristallglaston vom Mondlicht durchsilbert, ziehen jubelnd unzählige Mücken angriffslustig über uns hin. Fernher schwingender Orgelton… Es braust und klingt, getragen über Sumpf 86 und Gebüsch … der Choralgesang des Orgelwürgers. – – –
Die Jahreswende 1901/02 steht nicht gerade unter einem guten Stern. Zwar hat sich Gerlichs Gesundheit ein wenig gebessert, dafür trifft nun aber Joris Akkersdijk ein neuer Anfall von Schwarzwasserfieber. Consten muss über die Weihnachtstage auf Ngambo einspringen. Während meiner Krankheit ließ ich Herrn Consten hier wohnen, und blieb er bei mir bis Monatsschluss, 86
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
lässt Akkersdijk die Geschäftsleitung in Köln wissen und fährt fort: Ich fand so unbemerkt die fast dankbare Gelegenheit, ihn kennen zu lernen in seinem Verkehr mit den Arbeitern und überhaupt im Ganzen, was mir viel werth ist mit Hinsicht auf Herrn Gerlichs unsichere Gesundheit. Mein Schlusseindruck ist durchwegs günstig. Indessen hatten die Ratten oben in Kwamkuju unter seinen Sachen etwas schlimm hausgehalten, und fand ich 87 Veranlassung, ihm mit einem Zuschuss von 45 Rs. entgegen zu kommen.
Wenige Tage später dankt Akkersdijk, „auch seitens Herrn Consten“, für das aus Köln eingetroffene Weihnachtsgeschenk der Geschäftsleitung für 88 die Mitarbeiter der Pflanzung. So sorgt er auf seine Weise dafür, dass die Vertragsangelegenheit Consten auf der Agenda der Kölner Direktion bleibt. Dr. Hindorfs Nachfolger Walther von Saint Paul-Illaire fühlt sich dann auch bemüßigt, in einem Antwortschreiben an Akkersdijk zu erklären: Ihre Schreiben vom 7. und 12. Januar liegen uns vor. Es freut uns zu hören, 89 dass Sie von Herrn Consten einen guten Eindruck gewonnen haben.
In der Zwischenzeit hat Akkersdijk schon in einem weiteren Schreiben angedeutet, dass eine baldige Entscheidung drängt. Und auch Consten hat, so scheint es, seine Hände nicht in den Schoß gelegt, sondern – ganz „rheinisches Blut“ – über den Umweg Aachen den Versuch unternommen, Bewegung in die Angelegenheit zu bringen. So schreibt Akkersdijk mit Datum 27.1.1902 unter anderem an die Geschäftsleitung in Köln: Heute Mittag war Herr Consten bei mir und erzählte mir, dass er von seinem Vater mit letzter Post aufgefordert ist nach Hause zu kommen und die Leitung des Brauereigeschäftes, wo schon zwei jüngere Brüder thätig seien, zu übernehmen. Seine persönliche Neigung ginge mehr in Richtung des Pflanzerbetriebes; und deshalb möchte er, bevor sich zu entscheiden, von mir wissen, ob wir ihm eine mehr gesicherte Existenz anbieten können oder seine jetzige mit 175,-- Rs. und dreimonatlicher Kündigungsfrist. Diese Mitteilung ist mir sehr unwillkommen, weil sie dahin geht, dass wir mehr zahlen müssen, oder wieder das volle Risiko laufen von einem neuen Menschen, der uns (wie Mucker) die Arbeiter verscheuchen kann und im günstigsten Falle während mindestens 6 Monaten mehr Last bringt als Lust. Ich rate dann doch zu dem ersteren und
87
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
wird es Herrn von St. Paul leicht sein zu erfahren […], was für Kontrakte man 90 im Durchschnitt abschließt mit den Assistenten.
Die Antwort kommt postwendend. Akkersdijk soll in jedem Fall versuchen, Consten zu halten. St. Paul-Illaire vermerkt dazu: Was Herrn Consten betrifft, so hat sich dieser Herr, bevor er als Volontär zu uns ging, schriftlich bereit erklärt, länger in unseren Diensten zu bleiben. Er schrieb am 8.8.1900: ‚Ich bin nämlich gesonnen, zwecks weiterer Ausbildung in Ostafrika auf irgendeiner Plantage als Volontär einzutreten, würde mich aber nach Ablauf meiner Volontärzeit gern bereit finden, mich im Interesse Ihrer werthen Gesellschaft auf längere Zeit zu binden.’ Es scheint uns wünschenswerth, Herrn Consten länger zu behalten, da Sie mit ihm zufrieden sind. Wir ermächtigen Sie daher auch, mit ihm einen längeren Vertrag, vorbehaltlich der Genehmigung unseres Vorstandes abzuschließen und haben bereits wegen eines geeigneten Formulars und wegen der Bedingungen an die DOAG geschrieben und hoffen Antwort vor Abgang der Post zu erhalten. […] Wir sind der Meinung, dass Sie Herrn Consten so stellen, wie die zweiten Assistenten 91 auf anderen Plantagen gestellt sind.
Die Chancen, einen regulären Vertrag mit besseren finanziellen Konditionen zu bekommen, stehen für Consten bis zum Frühjahr 1902 also gut. Doch zögert sich eine endgültige Entscheidung, bedingt durch widrige äußere Umstände, immer wieder hinaus. In der Zwischenzeit hatte die Rheinische Handëi Plantagengesellschaft beschlossen, ihre unrentable Sisalpflanzung in Kurasini auf Sansibar einstweilen aufzugeben. Dadurch wurden Arbeitskräfte frei, die entweder auf den Kaffeepflanzungen Verwendung finden oder aber gekündigt werden mussten. Zu allem Unglück verschlechtert sich Akkersdijks Gesundheitszustand im März erneut. Der Arzt im Spital von Ulenge rät dringend zu einer längeren oder gar endgültigen Rückkehr nach Europa. Auch Gerlich geht es nicht gut. Durch wiederkehrende Anfälle des gefährlichen Schwarzwasserfiebers ist er bis auf weiteres nicht voll einsatzfähig. Consten ist in diesen schwierigen Wochen so etwas wie ein Mädchen für alles geworden. Er muss ständig zwischen Kwamkuju und Ngambo hin- und her reiten, damit die Arbeiten auf beiden Pflanzun gen trotzdem voran gehen können. Schließlich lässt Akkersdijk, bevor er im
88
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
April in Tanga das Schiff nach Europa besteigt, von Kurasini den Assistenten Hanisch kommen, um Consten zu entlasten. Währenddessen beschäftigt sich in Witzenhausen Direktor Fabarius mit der Satzung des zu gründenden Altherrenverbandes. Er schickt Consten den Satzungsentwurf und hat schon bald darauf dessen Erwiderung in Händen. Sie zeigt, dass Constens Groll gegen Paul Weise noch nicht verraucht ist und dass er äußerst schroff reagieren kann, wenn ihm etwas nicht passt: Wer einmal den Dank eines Kerls wie (Weise) ist, geerntet hat, der sieht sich ein zweites Mal vor und ist etwas sparsamer mit seiner Bestätigung kameradschaftlicher Gesinnung einem ehemaligen Kolonialschüler gegenüber. Vielleicht wäre der Sache so abzuhelfen, indem es [in der geplanten Satzung; D.G.] einfach so hieß: „… in Freud und Leid gegenüber jedem ehrenhaften Kameraden …“, denn es kann mir doch nicht zugemutet werden, dass ich nochmals einen Menschen, von dem ich und die einsichtsvolleren Kameraden schon früher wussten, dass er ein Lump war, nochmals bei mir aufnehme. Ich überlasse es übrigens Ihrem eigenen Ermessen, ob (Weise) noch dem Verbande ehemaliger Wilhelmshöfer wert ist anzugehören und möchte Sie als Vorsitzenden des Ehrenrats bitten, in diesem Falle die nötigen Schritte zu thun. Sollte Weise in dem Verband alter Herren verbleiben, so bitte ich Sie, dieses Schreiben als 92 mein Austrittsgesuch ansehen zu wollen.
Dann geht Consten noch auf eine Anfrage von Fabarius ein, ob nicht einer der abgehenden Kolonialschüler in Ngambo oder Kwamkuju unterkommen könnte. Er kommt bei dieser Gelegenheit jedoch schon bald auf sein eigenes Problem zu sprechen, die ungeklärte Vertragssituation: Hätte Herr Buchmann oder sonst jemand mich vorher in Kenntnis gesetzt, so hätte ich ihn vielleicht hier unterbringen können. Ich glaube jetzt ist das verlorene Liebesmüh, umso mehr wie ich von dritter Seite und direkt von meinem Chef weiß, dass ich in Köln ‚sehr gut’ angeschrieben bin. Wir standen vor kurzem vor einer Assistenten-Frage und da hätte es vielleicht einer Fürsprache meinerseits nur bedurft und die Sache wäre erledigt gewesen. So habe ich nun meinen Chef […] geraten, keinen mir unbekannten jungen Mann zu nehmen, ohne dass er selber oder Herr v. St. Paul in Witzenhausen gewesen sei. So wird die Sache jetzt persönlich an Sie herantreten, und in dem Falle geben Sie, wenn 89
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
ich mir erlauben darf Ihnen zu raten, nur den Besten oder das beste Assistentenmaterial was Sie zur Verfügung haben. […] In dem Schreiben von Herrn von St. Paul an meinen Chef […] heißt es wörtlich: ‚Da Sie mit Herrn Consten so sehr zufrieden sind, würde es sich empfehlen, in einer kommenden Assistentenfrage uns wieder nach der Kolonialschule zu wenden.’ – Ich glaube eine Anerkennung, wie sie in diesen kurzen Worten liegt, kann der Kolonialschule 93 und mir nur zur Ehre gereichen. Ich stehe heute noch mit Köln – die Verhandlungen mussten wegen der plötzlichen Krankheit meines Chefs abgebrochen werden – in Verhandlung wegen eines neuen Kontrakts. Ich habe einstweilen 3.600, 4.200, 4.800 Mark Verdienst nebst freier Heimreise und Gehalt während meines sechsmonatlichen Urlaubs verlangt. Ich denke, dass ich schon mit nächster Post eine bestimmte Antwort erhalte. Sie sehen also, dass ich die Sache hochgehalten habe und stolz darauf bin, etwas tüchtiges leisten zu können. Heute habe ich die Leitung der gesammten [sic] Pflanzung, was Pflanzungsarbeiten betrifft unter mir, die laufenden Geschäfte erledige ich zusammen mit dem Leiter von Kurasini, der zur Zeit hier weilt, da die ganze Arbeit 94 allein doch etwas viel geworden wäre.
Was Consten unerwähnt ließ: Akkersdijk rechnet nicht mehr mit seiner Rückkehr nach Ngambo. Er hat vor seiner Abreise seinen geschäftlichen und persönlichen Nachlass geregelt. Die Vertretung für die Pflanzung hat er Gerlich anvertraut, die Aufsicht über die Arbeiten dem älteren und erfahreneren Hanisch. Damit Consten sich nicht zurückgesetzt fühlt, räumt 95 er beiden Assistenten die Zeichnungsberechtigung für Schecks ein. Der Kölner Gesamtvorstand nimmt von der geplanten Rückkehr Akkersdijks nach Europa Kenntnis, heißt die von ihm getroffenen Vorkehrungen gut und bewilligt beiden Assistenten eine Gehaltserhöhung. Eine Klärung der Vertragssituation Constens verschiebt er jedoch auf die nächste Gesellschafterversammlung, zu der auch Akkersdijk zur Berichterstattung einge96 laden werden soll. Dass Consten etwa wegen seiner Vertragsangelegenheit in direkter Verhandlung mit der Kölner Geschäftsleitung gestanden haben könnte, ist übrigens in den Korrespondenzakten im Hausarchiv der Bank Oppenheim nirgendwo belegt. Im Gegenteil: Der gesamte diesbezügliche Schriftverkehr läuft weiterhin über Akkersdijk. Im Juni beantragt Walther von St. Paul-Illaire eine Dienstreise nach Deutsch-Ostafrika, um eine Revision der Plantage vorzunehmen und für 90
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
den erkrankten, inzwischen in seine niederländische Heimat zurückgekehr97 ten Pflanzungsleiter einen Nachfolger zu finden. Derweil geht bei der Kölner Geschäftsleitung die Bewerbung eines Herrn Rohde ein. Nun soll Akkersdijk entscheiden, wer von den dreien das Zeug hätte, Erster Assistent zu werden, das heißt, für den Fall, dass auch Gerlich wegen Krankheit ausscheiden muss, die Leitung der kleineren Pflanzung Kwamkuju zu über98 nehmen. Während Consten noch immer glaubt, die besten Karten zu haben, hat sich in Köln unmerklich der Wind gedreht. Nicht nur der Vorstand, auch Constens Mentor Akkersdijk haben den Eindruck gewonnen, dass seine Gehaltsvorstellungen und sonstigen Extrawünsche wohl doch zu hoch sind. Akkersdijk schreibt in dieser Angelegenheit am 16.6.02 aus Den Haag an die RHPG Köln: Die Arbeit der Herren Gerlich, Hanisch und Consten kenne ich ziemlich gut; diese von Herrn Rohde kenne ich nicht und ich kann diesen Herrn nur einschätzen nach den Zeugnissen, Berichten […] und nach dem Eindruck, den seine Person auf mich machte. Als erster Assistent wäre mir am liebsten Gerlich, dann Rohde. Consten kommt noch nicht dafür in Betracht, dann würde ich schon eher Hanisch haben. […] Es scheint mir vollkommen überflüssig aus obigem noch den Schluss zu ziehen, dass wir womöglich Herrn Rohde engagieren sollten, vorderhand an Constens Stelle. Dass Letzterer uns ziemlich hohe Forderungen gestellt hat für seinen Vertrag, macht uns auch moralisch freier 99 ihm gegenüber.
Und wenige Tage später ergänzt er: Am 6. des Monats schrieb ich Ihnen: Herr Consten wünscht umfassend einen Kontrakt für mindestens drei Jahre mit einem Gehalt von M. 3.600,– M. 4.200,– und M. 4.800,– im 1., 2. und 3. Jahre. Nach Ablauf des Kontraktes freie Rückreise nach Europa respective M. 800,– oder wenn ein neuer Vertrag gemacht wird, ½ Jahr Urlaub mit freier Reise und halbem Gehalt. Wenn krankheitshalber nach Europa geschickt, auch ein Billet 1. Klasse und schließlich die 100 Stelle als Erster Assistent, falls diese während seiner Kontraktzeit offen kommt.
Am 10.7.1902 teilt die Kölner Geschäftsleitung Akkersdijk mit, sie habe Herrn Rohde aufgefordert, sich bei der nächsten Sitzung persönlich vorzustellen und wolle wissen, welches Gehalt Akkersdijk für angemessen hielte 91
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
und was, falls Rohde angestellt werden sollte, mit Consten geschehen solle. „Soll er dann entlassen werden?“ Akkersdijk antwortet, er empfehle, mit Rohde einen Vierjahresvertrag abzuschließen und fährt fort: Consten rathe ich, falls Rohde angenommen wird, zu entlassen, und zwar gegen der Zeit, dass Herr Rohde gut 1 Monat oder 1 Monat in Ngambo kann eingetroffen sein. Sie haben doch die Absicht, Herrn Constens Retourbillet zu zahlen, falls er nach Hause will? Er hat seinerzeit seine Ausreise selbst bezahlt und sich außerdem nichts anderes zuschulden kommen lassen als dass ich Herrn Rohde ihm vorziehe – und Herr Gerlich wird sich bestimmt meiner 101 Meinung anschließen.
Und plötzlich geht alles ziemlich schnell. Noch im Juli 1902 beschließt der Vorstand der Rheinischen Handëi Plantagengesellschaft die Einstellung des neuen Bewerbers, fordert Akkersdijk auf, die Kündigung Constens mit einer Dreimonatsfrist möglichst umgehend auszusprechen, avisiert Gerlich aber vorher noch den Inspektionsbesuch des Generalbevollmächtigten St. Paul-Illaire für Ende August. Doch ausgerechnet in den Tagen des hohen Besuchs aus Köln, den er auf seinen Ritten durch die Kaffeepflanzungen begleitet und dem er beim Vermessen der Anbauflächen assistiert, ist es schließlich Hermann Consten selbst, der seine Stelle zum 1. November kündigt.: „Als Grund gab er Nachrichten von zuhause an“, schreibt der über102 raschte Gerlich an Akkersdijk. Dieser sieht sich wiederum veranlasst, gegenüber der ebenfalls überraschten Geschäftsleitung in Köln zu erklären: Die Kündigung durch Herrn Consten habe ich veranlasst um diesem jungen Mann, dem ich persönlich gewogen bin, das Unangenehme des „Gekündigt worden“ zu ersparen. Mit dieser Post habe ich Herrn v. St. Paul die Sachlage 103 mitgetheilt, damit dem Consten die Rückreise vergütet werde.
Constens hochfliegender Traum von einer besser bezahlten und vertraglich abgesicherten Stelle als Assistent, vielleicht sogar als künftiger Herr auf Kwamkuju, hat sich wider Erwarten zerschlagen. Obwohl er, wie alle Dokumente belegen, ein überaus geschätzter Mitarbeiter der Kaffeeplantagen in Kwamkuju und Ngambo war, ist er gescheitert – an seinen überzogenen Gehaltsvorstellungen, nicht zuletzt gescheitert wohl auch an sich selbst. Wut und Enttäuschung werden ihn gehindert haben, dies zu erkennen. Der 92
3. Plantagen-Assistent in Ost-Usambara
Rat seines ihm wohl gesonnenen Chefs Akkersdijk, lieber selbst zu kündigen als von der Geschäftsleitung in Köln vor die Tür gesetzt zu werden, dürfte nur ein schwacher Trost für den tief gekränkten Consten gewesen sein. Ob Walther von St. Paul-Illaire ihm Geld für die Rückreise gegeben hat, geht aus den Akten der Rheinischen Handëi-Plantagengesellschaft nicht mehr hervor. Anzunehmen ist, dass Consten in keinem Moment die Absicht hatte, nach zwei Jahren Tätigkeit in den Usambara-Bergen die Heimreise nach Aachen anzutreten. Das hätte dann doch zu sehr nach Scheitern ausgesehen. Wenn überhaupt, dann wollte er eines Tages als gemachter Mann heimkehren, schlimmstenfalls gezwungenermaßen – sollte ihn zum Beispiel eine der gefürchteten Tropenkrankheiten erwischt haben, von denen er bislang zum Glück noch verschont geblieben war. So dürfte er das Rückkehrgeld, falls er es erhalten hat, wohl genommen haben, um andere Regionen endlich kennen zu lernen und – vielleicht – eine neue Stelle oder das Fleckchen Erde zu finden, wo er einen eigenen Plantagenbetrieb oder eine Rinderfarm aufziehen könnte. Der Verlust seiner Stelle in Usambara schenkte ihm – das ist die positive Seite dieses Schicksalsschlags – neue Freiheit.
4. Abenteurer und Großwildjäger In den beiden Jahren, die Hermann Consten als Kaffeepflanzer in den Usambara-Bergen verbrachte, hatte sich das Kriegsgeschehen in Oranje und Transvaal zum Nachteil der Buren entwickelt. Schon im Oktober 1900, als sich Consten auf dem Weg nach Deutsch-Ostafrika befand, war der Krieg praktisch verloren. Präsident Krüger war unter Mitnahme der Kriegskasse an die Küste geflohen und an Bord des niederländischen Kriegsschiffes Gelderland ins Exil abgereist. Die militärischen Auseinandersetzungen waren damit nicht beendet – sie mündeten in einen äußerst grausamen und blutigen Guerillakrieg, der auf beiden Seiten zehntausende von Opfern forderte und zeitweise den britischen Sieg wieder in Frage stellte. Doch im Mai 1902 kapitulierten die burischen Siedler endgültig und akzeptierten die Friedensbedingungen Großbritanniens. Die beiden Freistaaten wurden, mit begrenztem Autonomiestatus, dem britischen Empire einverleibt. Die öffentliche Meinung in Europa hatte sich im Lauf der Jahre gewandelt, auch in Deutschland. Zwar hatte „Ohm“ Krügers Flucht, sein vergeblicher Ver93
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
such, von Kaiser Wilhelm II. in Audienz empfangen zu werden, den Burenkrieg noch einmal in die Schlagzeilen gebracht, und als die britischen Truppen dazu übergingen, Farmhäuser niederzubrennen, Frauen und Kinder in Concentration Camps zusammenzutreiben, wo etwa 27.000 von ihnen an Hunger und Krankheiten starben, kochte der gegen England gerichtete Volkszorn gewaltig hoch. Doch letztlich überließ man die Buren ihrem 104 Schicksal. Hermann Consten hatte in Ngambo und Kwamkuju den Kriegsverlauf beiläufig verfolgen können. Zeitungen und Post aus Europa erreichten die abgelegene Plantage oft erst mit mehrwöchiger Verspätung, doch die in Tanga und Daressalam erscheinenden Wochenblätter Usambara Post und Deutsch-Ostafrikanische Zeitung berichteten recht aktuell und ausführlich über die Kämpfe und ihre politisch-ökonomischen Hintergründe. In Herrn Gerlich, der die Burenregion aus eigener Anschauung kannte und die von „Ohm“ Krüger betriebene, viel kritisierte Uitlander-Politik am eigenen Leib erfahren hatte, hatte Hermann Consten einen Gesprächspartner, der ein realistischeres Bild von den Verhältnissen in Oranje und Transvaal zeichnete als er in seinen Karlsruher Studentenjahren der deutschen Presse hatte entnehmen können. Auch tauchten in Tanga deutsche Rückkehrer vom Kriegsschauplatz auf, die auf die Buren noch schlechter zu sprechen waren als auf die Engländer. Abgerissen und teilweise verwundet warteten sie oft wochenlang auf Geld von zuhause und auf Papiere der deutschen Kolonialbehörden, die ihnen die Schiffspassage in die Heimat ermöglichten. Einige von ihnen mussten bei ihrer Rückkehr sogar, wegen unerlaubter Entfernung von der Truppe, mit unehrenhafter Entlassung aus der Armee und 105 Festungshaft rechnen. Was Hermann Consten aus all diesen Geschichten und Berichten zusammentrug, fand Niederschlag in seiner Erzählung „Die 106 Küste“. Sie ist zugleich eine kritische Abrechnung mit der deutschen Kolonialbürokratie in Ostafrika. Wir sitzen zusammen im Hotel zum deutschen Kaiser in Tanga. Unter „wir“ verstehe ich ein Häuflein junger und älterer Männer, die teilweise der verlorene Burenkrieg an die Küste der heimatlichen Kolonie gespült hat. Not und Entbehrung in den Gesichtern. Aber auch jenes unscheinbare Etwas blitzt in ihren Augen, das man sich nur in offener Feldschlacht erwirbt. Wir sitzen einsam und verlassen, während drüben an 94
4. Abenteurer und Großwildjäger 107
langer gedeckter Tafel die Bwana mkubas Platz genommen haben, die unseren kleinen Nebentisch mit misstrauischen, neugierigen Blicken beobachten. Jeder von ihnen ist von der unbedingten Wichtigkeit seines selbstbewussten Nichts überzeugt, trägt tadellosen weißen Anzug mit Bügelfalten, gestärkten weißen Kragen, weiße Schuhe, womöglich noch eine arabische Perle in dem bunten Selbstbinder und einen indischen goldenen Siegelring protzig am Finger. Es sind die selbständigen Kaufleute, die Herren Angestellten der DOAG und die Herren Regierungsbeamten von Tanga. Jede Gruppe aber bleibt hübsch für sich, zwischen ihnen steht unsichtbar die deutsche Scheidewand der Zwietracht und des Kastengeis108 tes. Geräuschlos auf nackten Sohlen, im schneeweißen Kanga, darüber eine bunte Sansibar-Weste, huschen die Boys hin und her. Mitten zwi109 schen uns aber sitzt Bwana Jusuf, der schon zur Zeit der Araberherrschaft im Lande war. Er rekelt und streckt sich, gießt schmunzelnd eine auf halb und halb gemischte Whisky-Soda hinunter, fängt grinsend die erstaunten und verweisenden Blicke unserer Nachbarschaft auf, streicht sich seinen langen Bart und legt mit seiner hohen Kinderstimme los: „Wissen Sie meine Herren, aus dem Verhalten dieser Heringsbändiger dort drüben müssen Sie sich nichts machen. Ich kenne diese Sorte. Der Kern ist gut. Aber jeder von ihnen dünkt sich wie ein kleiner König erhaben über seine lieben Mitmenschen, die gerade nicht soviel Pesas für ihr Faulenzen und Repräsentieren ausbezahlt bekommen wie er. Und nun 110 erst die Herren von der Boma, die in der Heimat teilweise nur kleine Beamte waren. Die Bande wird hier zum Halbgott. Na wenn ich erzählen wollte. Jeder bringt uns einige Dutzend neuer Paragraphen mit, vom 111 Gouverneur angefangen bis hinunter zum letzten Tintenkuli. Dabei haben sie von Land und Leuten soviel Ahnung wie der Ochs vom Harfenschlagen. […] Und nun erzählen Sie weiter, Bwana“, wandte sich Jus112 uf an den Grafen Königsfeld. „God sal hem verdomme“, knurrte dieser, „der Ohm hat sich wie ein Schwein uns Deutschen gegenüber benommen. Ich war mit Graf Donnersfeld von den Garde-Ulanen bei ihm, es ist der, 113 der seinen linken Arm bei Tugela Hill verloren hat – und bat ihn um freie Überfahrt für die Schwerkriegsverletzten bis Sansibar, wo wir einen deutschen Konsul zu erwischen hofften. Ja, gepfiffen! Wissen Sie, was der Kerl, der mit vierzig Millionen, der gesamten Kriegskasse der Buren, 95
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
nach Delagoa-bai durchgebrannt war, uns antwortete: ‚Junge, ich glaube, meine Frau hat mich gerufen.’ Damit ließ er uns stehen. Verdomme hem!“ […]
Zu den vielen Geschichten, die Hermann Consten gern gegenüber Familie und Freunden zum Besten gab, gehörte auch die, er sei „Ohm“ Krüger persönlich begegnet. Immer offen für die Fabulierkünste anderer und selbst mit lebhafter Phantasie begabt, mag ihm manche Story später so vorgekommen sein, als hätte er sie selbst erlebt. Wenn überhaupt, dann könnte eine solche Begegnung nur in den allerersten Tagen nach seiner Ankunft in Tanga stattgefunden haben. Doch dies ist eher unwahrscheinlich. Krüger hatte Afrika am 20. Oktober von der zur portugiesischen Kolonie Mozambique gehörenden Delagoa Bay aus auf der Gelderland, die ihm Königin Wil114 helmina entgegen gesandt hatte, in Richtung Europa verlassen. Zwei Tage zuvor, am 18. Oktober 1900, war Hermann Consten in Tanga eingetroffen. Sollte Krügers Schiff auf seinem Weg nach Europa kurz darauf etwa in Tanga vor Anker gegangen sein? Könnten sich die Wege der beiden also wenigstens flüchtig gekreuzt haben? Wohl nicht. Ganz abgesehen davon, dass Consten mit ziemlicher Sicherheit in seinem ersten Brief aus Afrika ausführlich und nicht ohne Stolz über ein solches Ereignis nach Witzenhausen berichtet hätte, ließ sich anhand einer Meldung der DeutschOstafrikanischen Zeitung feststellen, dass die Gelderland erst am 26. Oktober 1900 im Hafen von Daressalam vor Anker ging, um Kohlen zu fassen 115 und von dort aus direkt Kurs auf Mombasa nahm. Da war Consten längst auf seiner Kaffeefarm, die er nun, zwei Jahre später, verlässt. Zum November 1902 packt er im Verwalterhaus von Kwamkuju seine Siebensachen. Seinen Chef Akkersdijk hat er nicht mehr wiedergesehen, Herrn Gerlich, der bis zum Eintreffen eines Nachfolgers die Stelle des Pflanzungsleiters erst einmal kommissarisch übernahm, hat er noch beim Umzug ins Haupthaus in Ngambo geholfen. Den neuen Assistenten Rohde, der seit wenigen Wochen anwesend ist, hat er, zähneknirschend wohl, mit eingearbeitet. Und Herrn von St. Paul Illaire, den er insgeheim und nicht ganz zu unrecht für das Scheitern seiner Karriereträume verantwortlich macht, geht er aus dem Weg. Jetzt hat er hier nichts mehr verloren. Seine Bemühungen, in einer der umliegenden Plantagen eine neue Stelle zu finden, waren vergeblich. Consten reiht sich also ein in die große Zahl stel96
4. Abenteurer und Großwildjäger
lungsloser Pflanzungsassistenten, die nutz- und tatenlos in den ostafrikanischen Küstenstädten herumhängen. Als er schließlich mit Sack und Pack in Tanga eintrifft, ist ihm klar, dass er, will er nicht ebenfalls als Tramp enden, hier nicht bleiben kann. Er muss sein Glück woanders versuchen. Wieder tut sich in der Lebensgeschichte Hermann Constens eine Lücke auf. Sein Verbleib ist unbekannt, der Strom der Briefe nach Witzenhausen versiegt. Wo sich Consten nach 1902 herumgetrieben haben könnte, ob in den weiten Gebieten Ostafrikas oder gar im Burengebiet, darüber lassen sich nur Mutmaßungen anstellen. Einige Indizien weisen tatsächlich in südliche Richtung: Zur Jahreswende 1903/04 erscheint zum Beispiel im Kulturpionier ein anonymer, mit N.N. gezeichneter „Brief aus dem südafrikanischen Kriegsgebiet“. Hochverehrter Herr Direktor! Es ist beinahe ein Jahr her, dass ich den letzten Brief an Sie schrieb, es war aus Port Elisabeth und handelte über 116 die damalige Lage in der Kolonie, den letzten Vorstoß der Bauern, die damals fast bis an die Küste vordrangen. Ich musste damals plötzlich nach hier aufbrechen, deshalb hinterließ ich den Brief dem deutschen Pastor in P.E. zur Besorgung auf einen deutschen Dampfer, denn, da Martial Law (Belagerungszustand) herrschte, wurden alle Briefe geöffnet, und er hätte nicht nur seinen Zweck nicht erreicht, sondern auch mich in große Unannehmlichkeiten, sehr wahrscheinlich sogar ins Gefängnis gebracht. Jedoch ist dies keine große Schande hierzulande mehr, wegen politischer Sachen brummen zu müssen, da die angesehensten Männer oder Buren mit King’s Boardinghouse Bekanntschaft gemacht haben. Seit Dezember letzten Jahres also bin ich hier bei einem Deutschen im Geschäft. Hier habe ich beste Gelegenheit, mich auszubilden, Land und Leute tüchtig kennen zu lernen. Meine Arbeit ist eine vielseitige. Neben dem Geschäft arbeite ich auch im photogr. Atelier. Oft muss ich über Land photographieren, oder Windmühlen und Pumpen aufsetzen. So lerne ich Land und Leute gründlich kennen, bin der holländischen Sprache völlig und der englischen so ziemlich mächtig. In einem halben Jahre gedenke ich mal auf eigne Faust anzufangen, wo, weiß ich allerdings noch nicht, vielleicht hier in der Kolonie, Freistaaten oder auch in Deutsch117 Südwest-Afrika. 97
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Eine Handvoll Fotos aus dem Burengebiet im Bildarchiv der Deutschen Kolonialschule, die sich, verglichen mit dem sonstigen vorhandenen Bildbestand, durch besondere fotografische Qualität auszeichnen, könnten sich 118 dem anonymen Briefschreiber bzw. Hermann Consten zuordnen lassen. Die Beherrschung der holländischen Sprache dürfte einem Aachener, zumal wenn seine Vorfahren aus dem Limburgischen stammten, durchaus zuzutrauen sein. Und schließlich thematisiert die zitierte Szene in Constens Erzählung „Die Küste“ den verlorenen Burenkrieg und seine Folgen für einige deutsche Freiwillige. Das ist aber auch schon alles. Zweifel bleiben, ob es wirklich Consten war, der sich nach einer längeren Schreibpause aus dem Burengebiet gemeldet hatte. Es könnte durchaus auch ein anderer ehemaliger Kolonialschüler gewesen sein. Denn weder fand sich das Original des Briefes aus dem südafrikanischen Kriegsgebiet in der Schülerakte Consten, noch ist auf der Rückseite der Fotos der Name des (oder der) Fotografen genannt. Einen eindeutigen Hinweis gibt es also nicht. Dafür finden sich spätere Andeutungen Constens in seinen Büchern wie auch Behauptungen gegenüber anderen Institutionen, die Aufenthalte in Indien und Burma erwähnen. So erinnerte er sich in den „Weideplätzen der 119 Mongolen“ an ein „Weihnachtsfest in den Dschungeln Indiens“ und eine Flussfahrt auf dem Irrawady. In einer Bewerbung für einen Sonderauftrag des Auswärtigen Amtes 1914 behauptete er, ab 1903 u.a. Arabien, Afgha120 nistan und Indien bereist zu haben. Nun lässt sich Constens späterer Lebensweg ziemlich lückenlos verfolgen; er hat ihn in ganz andere Regionen geführt. Eine durch Fotos und Aufzeichnungen verbürgte Reise nach Südund Südostasien, die ihn dann weiterführte bis nach China und von dort noch einmal in die Mongolei, taucht erst im Jahr 1927 auf. Also bleibt einzig die Möglichkeit, dass er, wenn seine Angaben kein Schwindel waren, zum Beispiel, statt das von der Handëi Plantagengesellschaft ausgezahlte Geld für die Heimreise zu verwenden und das Weihnachtsfest 1902 im Kreis der Familie in Aachen zu verbringen, genau in die entgegengesetzte Richtung davon dampfte, um etwas „Lebensphilosophie des Orients“ zu tanken – dem fernen Java entgegen, von dem ihm Akkersdijk erzählt hatte. Oder er hat, weil ihm die Mittel fehlten, angeheuert auf einem Frachtschiff, das in Richtung Südostasien unterwegs war und das ihn auf der Rückfahrt etliche Wochen später wieder in einem ostafrikanischen Hafen absetzte. 98
4. Abenteurer und Großwildjäger
Der sonst so erzählfreudige Consten hüllt sich über seine weiteren Unternehmungen in Afrika oder anderswo auffallend in Schweigen, auch noch Jahre danach. „Eine Zeitlang war ich in Ostafrika auf den Kaffeeplantagen in Usambara, Handei als Leiter [sic!] thätig. Durchzog die verschiedensten Theile Afrikas, um mich aus eigener Überzeugung mit den Lebensbedingungen der Naturvölker bekannt zu machen.“ Diese beiden mageren Sätze, enthalten in einem handschriftlichen Lebenslauf Constens vom Januar 1914, der sich in den Akten des Kaiserlich Deutschen Generalkonsulats in Moskau fand, lösen das Rätsel nicht. Die gleich danach folgenden Sätze tragen vollends zur Verwirrung bei, wenn er schreibt: „Eine schwere Kopfwunde machte mich militäruntauglich. Später lebte ich längere Zeit in 121 Russland – seit 1902 – speciell in Moskau.“ Es sieht ganz so aus, als hätte Hermann Consten seine Spuren bewusst verwischt. In einem zweiten selbstverfassten Schreiben, seinen Werdegang betreffend, ebenfalls aus dem Jahr 1914, diesmal direkt für das Auswärtige 122 Amt in Berlin bestimmt, will sich Consten seit 1903 in Russland aufgehalten haben. Dort verweist nur ein einziger knapper Satz auf seine afrikanischen Jahre: „Ich bereiste Deutsch-Ostafrika 1901 –1902“. Glaubte Consten in späteren Jahren etwa, einen Gutteil seiner afrikanischen Vergangenheit verleugnen zu müssen, da sie seinen weiteren Ambitionen schaden konnte? Gab es Dinge, deren er sich zu schämen hatte? Wie hatte er sich die erwähnte „Kopfwunde“ zugezogen, die ihn zwar für den Militärdienst untauglich machte, nicht aber für ein Leben als Abenteurer und Forschungsreisender? Erst seine im Herbst 1926 erschienenen Afrika-Geschichten lassen Rückschlüsse über seinen tatsächlichen Verbleib zu. 123 Die autobiographisch inspirierte Erzählung „Bibi Faida“, ein schwülstig-melodramatisches Jagdabenteuer, in dem die gleichnamige exotische Schönheit und Geliebte seines Jagdgefährten „Graf K.“ am Ende einen grausamen Tod erleidet, liefert möglicherweise eine Antwort auf die Frage nach seiner „Kopfwunde“. Constens alter ego, ein zynisch-sentimentaler junger Großwildjäger namens Bwana Wolf – „in den Schultern breit und untersetzt von Gestalt, mit fröhlich unbekümmertem Gesicht“ – berichtet seinem Gefährten am nächtlichen Lagerfeuer von einer länger zurückliegenden Expedition im deutsch-britischen Grenzgebiet der Massai-Steppe. Bei einem Überfall durch Viehräuber aus dem Stamme der Sogonoi-Massai, 99
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
so erzählt er, sei er schwer verwundet worden. Ein Speerstich hatte ihn getroffen, zwar nicht am Kopf, aber in der Seite. Trotz der stark blutenden Wunde, so berichtet Bwana Wolf weiter, habe er zunächst den Angreifer mit einem gezielten Kopfschuss getötet, sich dann hinter einer weggeworfenen Safarikiste zu Boden geworfen und „auf alles, was sich fratzenhaft bemalt, mit Straußfederbusch oder Löwenmähne im hohen Grase gegen uns anpirschte“, wahllos geschossen. Folgt man dieser Binnenerzählung, so erwies sich die ostafrikanische Geliebte Bwana Wolfs, eine 16-jährige Schönheit aus dem Stamme der Wanjamwesi, als Retterin ihres weißen Herrn. Während einige der eingeborenen Lastenträger blindlings Reißaus nahmen und von den Massai massakriert wurden, verband sie kurzentschlossen seine Fleischwunde mit dem Kanga, ihrem weißen Gewand. Dann schleppte sie zusammen mit einem der Träger eine Munitionskiste heran, hockte sich nackt, wie sie nun war, hinter den Verletzten und bedrohte die Angreifer mit dem in Panik weggeworfenen Jagdgewehr seines Boys. Sie lud die leer geschossenen Flinten nach und reichte sie ihrem am Boden liegenden Herrn, bis der Massai-Angriff nach längerem Gefecht abgewehrt werden konnte. Blutend und hoch fiebernd habe er eine Stunde später das Bewusstsein verloren, berichtet der Erzähler. Seine Kibibi habe schließlich das Kommando über die restliche Karawane übernommen und dafür gesorgt, dass er hinab zur Küste, ins Spital nach Tanga geschafft wurde. Vierzehn Tage habe der Transport in der Hängematte gedauert, er sei bei seiner Einlieferung mehr tot als lebendig gewesen. In Tanga habe man ihn wieder zusammengeflickt, und nach seiner Genesung habe er erst einmal einen Europa-Urlaub angetreten. Diese Passage könnte für die Lebensgeschichte Hermann Constens insofern aufschlussreich sein, als sich anhand eines Vergleichs mit historischen Fakten nun mit einiger Sicherheit sagen lässt, dass er sich nach seinem Weggang von Ngambo und Kwamkuju im Jahr 1903 noch oder wieder in Deutsch-Ostafrika aufgehalten haben muss. Denn gerade in dieser Zeit häuften sich räuberische Überfälle der Massai auf die viehreichen Steppengebiete im Gebiet des Kilimandjaro und des Viktoria-Sees – was im übrigen Spannungen zwischen der deutschen Kolonialbehörde mit dem britischen Nachbarn jenseits der das Stammland der Massai linear durchschneidenden, weitgehend unbewachten Grenze zur Folge hatte. Den Briten wurde 100
4. Abenteurer und Großwildjäger
unterstellt, sie würden Raubzüge der auf ihrer Seite lebenden „englischen Massai“ auf deutsches Gebiet billigend in Kauf nehmen. Die lokale deutschsprachige Kolonialpresse empörte sich aber auch über die „deutschen Massai“. Dass es auf dem Territorium Deutsch-Ostafrikas – im Gegensatz zu anderen „friedliebenden und brav ihre Steuern zahlenden“ Eingeborenen – noch immer einen „Negerstamm“ gab, „der in zügellosester Ungebundenheit dem deutschen Recht und Gesetz Hohn sprechend, alten Traditionen anhängend und natürlichen Neigungen folgend, seine ganze 124 Existenz nur auf den Raub stützt“, war mit preußischen Ordnungsvorstellungen und kolonialer Herrschaftsideologie unvereinbar. Meist waren die Räuber mitsamt dem gestohlenen Vieh längst wieder verschwunden, wenn Askaris der Schutztruppen an Ort und Stelle eintrafen. Doch werden auch kriegerische Zusammenstöße erwähnt, bei denen es Tote und Verletzte auf beiden Seiten gab. Oft folgten „strenge Bestrafungen unbothmäßiger Häuptlinge“, in der Regel wurden sie zur allgemeinen Abschreckung kurzerhand aufgeknüpft und ihre Dörfer niedergebrannt. Dennoch musste die Kolonialverwaltung einräumen, dass weder Drohungen noch Strafexpeditionen bisher vermocht hatten, die kriegerischen, freiheitsliebenden Massai „zur Anerkennung der deutschen Oberhoheit zu zwingen und sie zu friedlichen Viehzüchtern, ja stellenweise auch zu fleißigen Ar125 beitern zu erziehen.“ Die „Massai-Frage“ stellte somit ein ernstes Sicherheitsproblem dar, dem selbst mit brutaler Gewalt nur schwer beizukommen war. Es gab nicht wenige Stimmen, die die Meinung vertraten, „dass erst 126 dann Ruhe ins Land kommt, wenn der letzte Massai ausgerottet ist“ – eine Vorstellung, der der keineswegs zimperliche Hermann Consten gewiss vehement widersprochen hätte. Durch seinen Gefährten Ngombe, der ihn auf seinen Streifzügen durch die ostafrikanischen Jagdgründe begleitete, kannte Consten die „MassaiFrage“ nämlich auch aus dem anderen Blickwinkel: dem derer, die deutsche wie britische Fremdherrschaft gleichermaßen ignorierten und nur ihren eigenen Gesetzen folgten. Mit dem Massai Ngombe verbringt Consten nach dem Ende seiner Tätigkeit als Kaffeepflanzer seine Tage in der Grassteppe, auf der Pirsch nach Löwen, Elefanten, Nashörnern, Tigern und Affen. Ngombe ist es auch, der ihn in die Geschichte und die Riten seines Stam mes einweiht, ihn die Massai-Sprache lehrt und ihm erzählt, weshalb sein 101
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
Volk Ansprüche auf die Herden anderer Stämme erhebt. Einmal wird der Ich-Erzähler während eines nächtlichen Pirschgangs ungewollt Zeuge einer geheimen Zusammenkunft seines schwarzen Gefährten mit „irgendwo aus der Steppe“ aufgetauchten Stammesgenossen. Sie haben sich in vollem Kriegsschmuck zur Beratung in eine Schlucht zurückgezogen und führen dort einen rituellen Tanz auf. In den Augen der besorgten Kolonialverwaltung waren solche von Gesang begleiteten Tänze immer der Auftakt für 127 neue kriegerische Überfälle. In Constens Erzählung „Ngombe“ dagegen kündet der nächtliche Tanz auch vom Schmerz des Massai-Volkes über den Verlust einstiger Größe. Im Wechselgesang der Krieger hört der Autor „die Seele der Steppe schluchzen“. Ein besonders weißes Sternbild funkelt dort drüben am Himmel. Darunter, wie aus einem Märchen, hebt sich ein schwarzer überlebensgroßer Schattenriss, Ngombes Gestalt, von den Felsen unseres Hügels ab. Mondschein schmiegt sich rot und weiß um seine Glieder. Um die Felsen aber lagert breit und mächtig die Unendlichkeit. Jede Farbe, jeder Laut ist in dem großen hellen Schweigen der Mondeinsamkeit gedämpft. Die Züge von Ngombes Gesicht sind durch Farbe und Schatten verhüllt. Ich aber erkenne ihn an seinem Kriegsschmuck. […] Ngombe neigt sein Haupt, blickt dann in den silberschildklaren Mond, tastet mit den Händen, stampft mit den Füßen, schnellt hoch, als wolle er das Mondlicht einfangen und ergreifen. Das sind Hände und Füße, die Leben haben! Es funkelt und klirrt das rote Kupfer der Armringe im Mondglast. Ngombe tanzt… Geheimnisvolle Vorstellungen, Gedanken schweben, schaurig umflüstert, umkrochen vom allgegenwärtigen Leben, um den Tanz. Leben und Tod – Kain und Abel reichen sich hier die Brüderhände. Klagegesang schwingt durch die tausendäugige Wildnis. Es erklingen geheimnisvoll dumpf die Stimmen im Wechselgesang zwischen den Felsen von Kampf und Sterben. Ngombe tanzt… Er schwebt über den Boden. Die Straußenhelmfedern, die Ohrgehänge, die Marabufedern auf den Schultern, der Geiermantel, die blitzende Speerklinge wiegen sich im gleichmäßigen Schwung des gleitenden Körpers. Ngombe tanzt! […] Kriegsgesang springt auf. Das wilde Fußgetrampel der Krieger erschallt, die in rasendem Lauf durch die unendliche, weite Steppe fliegen. Sie sind ausgezogen, um die von Gott den Massai übergebenen Rinder durch Gewalt und Raub 102
4. Abenteurer und Großwildjäger
zurückzuholen. Harte eiserne Steppenjahre gewinnen Leben. Die Stimmen werden grausam, scharf wie singender Stahl. Immer hastiger, wilder erklingt das „Wo-o-woho – woo-hoo –“ im Wechselgesang dumpf drohend, dort bei den Felsen hinter den hohen Schilden der fünf Steinmenschen hervor und steigert sich schließlich zum donnernden Kampfruf der Massai.
Im weiteren Verlauf der Erzählung entdeckt Ngombe seinen Herrn im Gebüsch und führt ihn zu seinen Kampfgefährten. Am Feuer erzählt er ihm die Geschichte seines nomadischen Hirtenvolkes, dem ein Gott einst alles Vieh der Erde zugesprochen hatte. Durch ein großes Viehsterben waren sie verarmt und teilweise in der Gegend des Berges Meru sesshaft geworden. Aber kleinere Gruppen waren Viehzüchter und Viehräuber geblieben. Ngombe schildert die besondere Bedeutung des Ortes, an dem sie sich nun versammelt haben. Die Schlucht war Schauplatz einer blutigen Niederlage seiner Stammesbrüder nach einem Raubzug gewesen. Er selbst hatte damals unter einem Berg von Leichen das Gemetzel überlebt, sich verletzt in den Heimatkral zurückgeschleppt und war wenige Tage später an der Spitze einer neuen Kriegergruppe wiedergekehrt, um die Feinde zu erschlagen und das Vieh zu holen. Der nächtliche Tanz an der Stelle der einstigen Schlacht war die nachgeholte Totenfeier für die gefallenen Krieger. Sie diente der Besänftigung ihrer Seelen. Ngombe schweigt… Die Nacht lebt kaum noch. Weit und fremd die Steppe unter sterbendem Sternenhimmel. Fliehende Steppennacht. Die große Nachteinsamkeit versinkt. Der Rauch unseres Feuers steigt durch den grauenden Morgen. Heller lodern die Flammen. Drüben gabelt eine Dumpalme in wundervoller Klarheit im Türkisgrün des kommenden Morgens. Grell leuchtet noch der Morgenstern. Wir schweigen… Die Steppe schweigt… schweigt… Leben und Tod gleichen sich nicht… Uns friert…
Für Consten sind die großgewachsenen Massai edle Wilde, die sich ihren Stolz nicht durch weiße Kolonialherren brechen lassen. Ngombe, der Exot 128 als verstandener Partner und Freund, ist der Held mehrerer Afrika-Ge103
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
schichten Hermann Constens. Die ihm durch Ngombes kriegerische Stammesgenossen zugefügte Wunde hat der Freundschaft mit dem Massai niemals Abbruch getan. In Constens Afrika-Sammlung, inmitten von Schilden, Speeren, vergifteten Pfeilspitzen, Buschmessern, Elefantenzähnen, Trommeln, Masken und anderen Trophäen befand sich auch ein farbiges Porträt jenes hochgewachsenen, stolzen Massai in vollem Kriegsschmuck. Consten hat das Bild in den zwanziger Jahren von dem Hannoveraner Künstler Heinz Munz, vermutlich nach einem Foto, als ständige Erinnerung an 129 Ngombe malen lassen. Im November 1903 meldet sich Hermann Consten nach langer Schreibpause wieder bei Direktor Fabarius – nicht aus Afrika, nicht aus Indien, schon gar nicht aus Moskau, sondern aus Aachen. Er ist am Ende also tat130 sächlich nach Deutschland zurückgekehrt. Seine Verletzung und der Ausbruch des Tropenfiebers waren wohl der Grund, obwohl er in seinem Schreiben beides unerwähnt lässt. Dafür wird deutlich, dass den mittlerweile 25-Jährigen der Familienalltag eingeholt hat, dass es wohl wieder einmal Kämpfe mit dem Vater gab. Aachen 13.11.03 Sehr geehrter Herr Direktor! Haben Sie besten Dank für die Grüße, die Sie und die Kameraden mir vom Martinsfeste zugehen ließen. Leider hatte ich durch widerliche Familienverhältnisse, die meine ganze Zeit zur Behebung in Anspruch nehmen, die Verbindung mit Witzenhausen verloren. Ich verspreche Ihnen aber, dass, sobald ich wieder ungesorgt in die Zukunft schauen kann, ich der Alte sein werde. Jetzt noch eine Bitte. Bei meinem Abgange von der Kolonialschule ist mir kein Zeugnis ausgestellt worden, obwohl dies im Kulturpionier angegeben ist. Ich stehe mit zwei Gesellschaften wegen einer Stellung als Leiter einer Agavenplantage in Unterhandlung und bitte Sie mir mein Abgangszeugnis zugehen zu lassen. Seien Sie versichert, dass ehe ich mich wieder an die Kulturarbeit nach Afrika begebe, ich Ihnen und den Kameraden in Witzenhausen noch einen Besuch abstatten werde. Mit den herzlichsten Grüßen für Sie und Ihre werte Familie sowie für alle Kameraden in Wilhelmshof bleibe ich Ihr ergebener Hermann Consten ju Heinrichsallee 57
104
4. Abenteurer und Großwildjäger
„Widerliche Familienverhältnisse“ – die wenigen Zeilen an den Direktor der Deutschen Kolonialschule verraten, dass es Hermann Consten bis dahin nicht gelungen war, dauerhaft in Afrika Fuß zu fassen. Vorstellbar ist, dass er vom Vater die Auszahlung seines Erbteils verlangt hat, um sich eine eigene Pflanzung kaufen zu können, ihn möglicherweise sogar verklagt hat – und dass er damit gescheitert ist. Die nachfolgenden Unterhandlungen mit den Plantagengesellschaften, seine Bewerbung als Leiter einer Sisalplantage, können als Versuch betrachtet werden, einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation zu finden. Dabei hat sich offenbar doch als Nachteil herausgestellt, dass Consten keinen richtigen Studienabschluss vorzuweisen hatte. Ein reguläres Zeugnis, das seine Leistungen in den einzelnen Fächern benotet, gibt es in Constens Witzenhauser Schülerakte nicht, lediglich eine Bestätigung, dass er die DKS ein Jahr lang besucht hat, und eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, welche Fächer er belegte. Über die Qualität seiner Leistungen ist nirgendwo etwas ausgesagt. Also dürften auch diese Verhandlungen um die Leiterstelle erfolglos gewesen sein. Consten weigert sich aber hartnäckig, seine Zeit in Afrika als beendet zu betrachten. Er will um jeden Preis wieder zurück. Und offenbar findet er auch eine Lösung für sich. Den Bruch mit dem Vater hat Hermann Consten wohl billigend in Kauf genommen, als er sich, vermutlich Ende 1903, erneut Richtung Afrika einschifft. In Geschäften, die mit „Kulturarbeit“ wenig zu tun haben, ist er nun offiziell im „schwarzen Kontinent“ unterwegs. Consten ist in den florierenden Handel mit Wildtieren, Jagdtrophäen und Elfenbein eingestiegen. Laut Familienüberlieferung war er zeitweise Geschäftspartner von Carl Hagenbeck in Hamburg, der mit gefangenen Wildtieren Zoos in aller Welt belieferte und Tierfänger von der Arktis bis Australien, von Feuerland bis Formosa für sich arbeiten ließ. Welchen Umfang diese Geschäfte hatten, welche vertraglichen Grundlagen es dafür gab und auf welche Regionen des afrikanischen Kontinents sie sich erstreckten, lässt sich anhand der im Hagenbeck-Archiv vorhandenen Dokumente aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts für Consten selbst nicht mehr verifizieren, da der größte Teil 131 des alten Archivbestandes in den Bombennächten von 1943 verbrannt ist. Da aus jenen Jahren auch keine Briefe oder Tagebuchnotizen Constens
105
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
überliefert sind, bleibt auch hier nur die Möglichkeit, den autobiografischen Spuren in seinen Afrika-Erzählungen zu folgen. In der bereits erwähnten Erzählung „Bibi Faida“ schildert Consten eine Szene, in der sein alter ego Bwana Wolf mit der Bemerkung „Mal sehen, was passiert!“, aus purem Übermut seine Schrotflinte auf eine Pavianfamilie richtet und sie regelrecht hinrichtet. Erst knallt er ein vorwitziges Affenkind ab, dann seine wütend-verzweifelt herbeistürzende Mutter und schließlich den alten Anführer der Affenherde, dem er, als der sich mit gefletschten Zähnen und gesträubtem Mähnenkamm vor dem Übeltäter bedrohlich aufbaut, mit einem gezielten Schuss den Kopf zerschmettert. Erst als Wolf mit weiteren Schüssen auch noch die gefährlich näher rückenden Clanmitglieder verscheucht hat, hält er in seiner blutigen Mutprobe inne. Wolf knüpft an den grausigen Tiermord ein längeres, fast philosophisch zu nennendes Gespräch mit seinem adligen Jagdgefährten, Graf K., über Familienzusammenhalt bei den Affen im auffallenden Gegensatz zu familiärer Kälte, Zerstrittenheit und Feindseligkeit in den Menschenfamilien Europas. „Da habe ich etwas Schönes angerichtet!“ brummt Bwana Wolf vor sich hin. „Die ganze Sippschaft hält bei Gott fester und treuer zusammen wie manche Menschenkinder.“ In Gedanken verloren geht er zum Zelt zurück. Er kann, innerlich ein froher, guter Mensch, über das soeben Geschehene und Erlebte nicht mit einem Achselzucken hinwegkommen. Es war ihm so, als ob er unnütz auf Menschen geschossen und diese getötet hätte. „An der Sippentreue dieser Paviane und dem Mut dieser Affenmutter könnte sich manche Dame und manche alte Familie ein Beispiel nehmen“, sagte der Graf […] zu seinem Weggenossen. […] Wo haben Sie 132 das in Uleia? Da streiten sich Mann und Frau und zerren an verschiedenen Strängen, um ihre eigene Ehe und die Sippe auseinanderzureißen. Da verklagt der Sohn den Vater, die Mutter die Tochter und diese wieder die Eltern wegen des schnöden Mammons und läuft schließlich mit irgendeinem Lausekerl der ganzen Verwandtschaft zum Trotz davon. Diese wiederum freut sich, wenn irgendein lästiger Miterbe sterbend von der Bildfläche verschwindet. […] „Sie haben recht“, bestätigt kopfnickend der Jüngere, und seine großen grauen Augen starren mit leisem Weh hinüber, dorthin, wo am Rand des Galeriewaldes noch die Äffin mit ihrem Jungen lag. […] „He, Ali, bring uns ein paar Madafu, ein paar frische 106
4. Abenteurer und Großwildjäger
Kokosnüsse her und dazu etwas Rotwein“, ruft Bwana Wolf dem Boy zu und verteidigt sich hartnäckig mit dem Rauch seiner Shagpfeife gegen die anschwirrenden, sirrenden Mücken.
Von Bibi Faida, der afrikanischen Geliebten seines Jagdgefährten – deren Schönheit und erotische Ausstrahlung Consten übrigens in üppigsten Farben schildert – erfährt Wolf, Angehörige des ansässigen Pygmäen-Stammes, Kannibalen, hätten sich die toten Affen geholt, um ihr Fleisch zu braten und zu verzehren. Er schickt seinen Boy, um sich wenigstens die Felle der getöteten Tiere aushändigen zu lassen. Denn sie sind für ihn bares Geld. Die erwähnte Szene lässt den Schluss zu, dass Consten nicht allein reiste, sondern mit einem erfahrenen Geschäftspartner unterwegs war: dem besagten Grafen K., dessen Identität bisher nicht geklärt werden konnte. Dass die Geschäfte mit Hagenbeck, der in Deutsch-Ostafrika eine Fang- und Ein133 kaufsagentur unterhielt, recht einträglich für Consten gewesen sein müssen, ist anzunehmen. Kommerzieller Tierfang und Jagd kamen seiner Abenteuerlust, seinem Draufgängertum und seinem Erwerbssinn mehr entgegen als ein zwar geordnetes, gesichertes, aber für seine Ansprüche nur mäßig bezahltes Dasein auf einer Plantage. Seit 1903 galt in Deutsch-Ostafrika ein an den preußischen Jagdgesetzen orientiertes Jagdrecht. Auch der Tierfang war amtlichen Regulierungen unterworfen. Gewerbsmäßiger Tierfang bedurfte sogar einer Sondererlaubnis des Gouverneurs. Während die Jagd auf Giraffen, Zebras, Antilopen, Schimpansen, Strauße und Geier verboten war, zahlten die Behörden für die Tötung von Raubtieren und Reptilien, wie Löwen, Leoparden oder Krokodile sogar eine Prämie „gegen Ablieferung des frischen Fells mit Klauen und Kopf“. Für andere Wildtiere musste der Jäger ein Schussgeld entrichten, die Anzahl erlegter Tiere auf einer zum Jagdschein gehörenden Abschussliste eintragen und zum Jahresende unterschrieben bei der zuständi134 gen Kontrollbehörde abliefern. Der Handel mit Elfenbein war in jenen Jahren eines der einträglichsten Geschäfte für Großwildjäger und ihre Zwischenhändler. In Deutsch-Ostafrika allerdings, wo die Elefantenbestände wegen der begehrten Stoßzähne bereits von Ausrottung bedroht waren, wurden Handel und Ausfuhr des „weißen Goldes“ mit bürokratischer Gründlichkeit reguliert; der Staat woll107
I. Vom Kind zum Mann 1878–1904
te natürlich mitverdienen und verlangte deshalb für Elefanten ein besonderes Schussgeld von 100 Rupien extra oder, wie es die Jagdschutzverordnung von 1903 vorsah, „einen Zahn des erlegten Tieres“. Consten habe einmal, so die Familiensaga, unter Hinweis auf den Wortlaut der Vorschrift mit Backenzähnen bezahlt. Ein 50 bis 70 Kilo schwerer Stoßzahn brachte im Han135 del immerhin zwischen 1.400 und 2.000 Reichsmark. Etwa zwei Jahre streift Consten durch Afrika, geht auf die Jagd, fängt wilde Tiere, sammelt Trophäen, macht Geschäfte mit Elfenbein und wird, wie es scheint, auf diese Weise ein vermögender Mann. Einer, dessen Auftreten zwischen Angeberei und echtem Herrentum pendelt. Der aber auch, wenn er mit seinen eingeborenen Trägern und Führern in Steppe und Urwald unterwegs ist, deren Sitten und Gebräuche ernsthaft studiert und ihnen Achtung zollt. Jahre waren vergangen. Ich saß wieder bei Papa Schall und hatte schon längst die Pflanzungsgeschichte satt und hinter mir. Bwana Jusuf und ich hielten beim Whisky-Soda gleichen Schritt und störten einander nicht 136 durch vieles Fragen. Ich wollte diesmal in die Umba nyika, um dort zu jagen. Der Weg führte mich wieder wie vor Jahren über Moa nach Jassini in die große weite Grassteppe, die in damaliger Zeit noch das Streifgebiet der Sogonoi-Massai war. Nun war ich selbst ein Bwana mkuba geworden. Hinter meinem Stuhl stand Rajabu, während oben im großen luftigen Zimmer mit dem indischen Riesenbett und Moskitonetz Sindano und Tosiri alles für den Aufbruch fertigmachten. Draußen lagerten die Träger seit Tagen unter der Kontrolle des Karawanenführers und meines Massai Ngombe. […] Mitten zwischen den Leuten lag mein Simba, mein Gepard, mein Jagdleopard, und Mtoto, der große Hundsaffe, jeder mit seinem Boy, der ihn an seiner Hundekette hielt. […] Es ist spät geworden. Papa Schall, Jusuf und ich plaudern noch lange miteinander, hatte mich das Schicksal doch schon damals weit herumgetrieben. Plötzlich taucht aus dem Dunkel der Nacht Ngombe auf und meldet: „Safari tajari, Bwana mkuba, die Karawane ist fertig zum Abmarsch, Herr.“ Nun hieß es wiederum Abschied nehmen. Bwana Jusuf drückte mir lachend, wobei ihm die Tränen in die Augen steigen wollten, zum Anden137 ken ein kleinkalibriges Gewehr in die Hand, das ihm Emin Pascha gelegentlich einmal verehrt hatte. Beide, Papa Schall und Jusuf, begleiteten 108
4. Abenteurer und Großwildjäger
mich dann, ob ich wollte oder nicht, zum Hafen. Der Hafen und die ganze Tangabucht ist finster und öde. Die Zollabfertigung ist schon längst am Nachmittag erledigt worden. Jetzt drückt mir nur noch ein verschlafener Goanese meine Papiere in die Hand und wünscht mir mit seinem quäkenden Englisch „Gute Fahrt“. […] Eine halbe Stunde später trug mich und meine Leute die große arabische Dhaw, ein altes Sklavenjäger138 schiff, mit meiner ganzen Safari aus dem Hafen nach Norden.
Im Jahr 1904 wirft ihn ein schweres Schwarzwasserfieber aufs Krankenbett. Auf Anraten seines Arztes verlässt Hermann Consten das tropische Afrika, der dauerhafte Aufenthalt in einem kühleren Klima ist ihm dringend empfohlen. Für Consten, dem der Abschied von Afrika und seinem einträglichen Broterwerb dort schwer fällt, stellt sich wieder einmal die Frage nach seiner beruflichen Zukunft. Erst einmal kehrt er nach Aachen zurück und erholt sich im Elternhaus von den Fieberanfällen. Sobald er einigermaßen wiederhergestellt ist, streckt er neue Fühler aus – nach Russland.
109
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente 1. Von Ostafrika zum Studium nach Moskau Ein gewaltiger Sprung ist dies, aus den tropischen Gefilden des afrikanischen Kontinents ins historische Herz des Zarenreiches, nach Moskau. Nicht nur ein Wechsel des Klimas und der Kontinente, auch ein Wechsel der Kulturen findet hier statt, wie man ihn sich krasser kaum vorstellen kann. Was mag den nach bald vier Jahren Afrika für die Tropen nun nicht mehr tauglichen jungen Mann bewogen haben, sich ausgerechnet dieses neue Zielgebiet für seine Aktivitäten auszusuchen? Zwar steht wegen der „widerlichen Familienverhältnisse“ die dauerhafte Rückkehr nach Aachen für Hermann Consten außerhalb jeder Debatte. Aber er hätte, wenn er denn für seine Gesundheit unbedingt ein kühleres Klima benötigte, genauso gut nach London, Kopenhagen oder nach Nordamerika gehen können. Doch: wie frei ist er eigentlich, diese Frage selbst zu entscheiden? „Man schickte mich also in ein kaltes Klima“, schreibt Consten an einer Stelle. „So 139 kam ich 1905 nach Moskau, wo ich Bekannte hatte.“ Die Würfel fallen für Moskau, so könnte man aus diesen beiden Sätzen schließen, weil der Arzt, der Vater, „das Schicksal“, wer oder was auch immer, es so wollten. Aber – und dies war wohl der eigentliche Grund für die Wahl des Ortes – für Consten junior musste ja eine Beschäftigung gefunden werden, eine Arbeit, mit der er Geld verdienen oder sich endlich mal nützlich machen konnte für den väterlichen Betrieb. Nicht auszuschließen ist, dass es sich bei den von Consten erwähnten Bekannten um Geschäftsfreunde des Vaters handelte und er – um des Familienfriedens willen – auf ein konkretes Arbeitsangebot einging. In seinem Hinterkopf dürfte er jedoch eigene Pläne gewälzt haben, die er dem Vater gegenüber wohlweislich verschwieg. Seine Tolstoj-Lektüre auf der Kaffeeplantage in den Usambara-Bergen hatte Spuren hinterlassen, hatte ihm ein Bild von Russland vermittelt, das kennenzulernen ihm offenbar reizvoll erschien. Er hatte die Geschichten Tolstojs und anderer russischer Autoren über Sonderlinge wie den Gattenmörder Pozdnyšev in der „Kreutzer-Sonate“, über die dekadente Adelskaste, Popen in weihrauchgeschwängerten Kirchen, wilde Kosaken, autokratische Beamte, über den seinem Volk entrückten Zaren nicht vergessen. Consten schwebte eigentlich 110
1. Von Ostafrika zum Studium nach Moskau
weniger ein Leben in der Großstadt Moskau vor als vielmehr die Bekanntschaft mit einem überwiegend ländlichen, einem einfachen, melancholischen, „wilden“ Russland, einem Russland mit passiven, schicksalsergebenen, gläubigen, schlichten, urtümlichen Menschen. Vor seinem inneren Auge tauchten weite Steppengebiete auf, die Höhenzüge des Ural, die breiten, träge dahin fließenden Ströme Russlands, die lichten Birkenwälder, die Kirchlein und Holzhäuser. Er sah Schneeflächen bis zum Horizont, hörte das Glöckchengeläut dahineilender Troikas. Vor allem aber sah er sich selbst in diesem weiten Land – reisend, reitend und jagend. Wieder unterwegs. Schon bald nach Constens Ankunft zeichnet sich jedenfalls ab, dass er sich Moskau eigentlich nur als Ankerplatz gedacht hat, als Ausgangspunkt und Anlaufstelle von Reisen kreuz und quer durch das eurasische Großreich und seine Nachbarregionen, vor allem durch Sibirien und weit über Russlands Grenzen hinaus. Bis nach Zentral- und Ostasien. Die Matrikel des Kaiserlich Deutschen Konsulats in Moskau, in der Reichsangehörige eingetragen werden, die im Zuständigkeitsbereich des Konsulats ihren Wohnsitz nehmen, vermerkt Hermann Consten erst unter dem 22. August 140 1906 als Eintrag Nr. 112. Hinter der Rubrik „Stand und Gewerbe“ steht schlicht: Reisender. Das kann natürlich alles Mögliche sein, vom Handelsvertreter bis zum Forschungsreisenden. Und es ist schon auffallend, dass Consten im Laufe der Zeit beides, das geschäftliche und das „forschendabenteuernde“ Interesse, miteinander zu verbinden sucht. Schließlich braucht er eine solide finanzielle Basis, um sich seinen aufwendigen Lebensstil, seine teuren Expeditionsvorhaben und seine Jagd-Ambitionen überhaupt leisten zu können. Nicht auszuschließen auch, dass er, gerade was Letzteres betrifft, noch immer mit Hagenbeck in Verbindung steht. Was auf der anderen Seite die Entscheidung für Moskau – wer immer sie getroffen hat – auf den ersten Blick seltsam, ja geradezu befremdlich erscheinen lässt, das sind die Verhältnisse im Lande selbst. Consten kommt nämlich in einer denkbar schwierigen Zeit nach Russland, einer Zeit, in der auch das Reisen alles andere als einfach ist. Es ist eine Phase, in der das Zarenreich politisch, wirtschaftlich und militärisch in seinen Grundfesten erschüttert wird. Denn es herrscht Krieg, und das Land ist in Aufruhr. Trotz angespannter Wirtschaftslage leistet sich das Russische Reich einen mili111
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Abb. 6: Mit dem Jagdkarren in der Steppe. Unbekannter Fotograf, um 1905
tärischen Schlagabtausch mit einer sträflich unterschätzten asiatischen Macht: dem aufstrebenden Japan. Und es verliert diesen Krieg. Die Kämpfe in Russisch-Fernost während des Jahres 1904, schließlich der Fall Port Ar141 thurs im Januar 1905 und die Vernichtung der Baltischen Flotte bei Tsushima im Mai – für das sich überlegen dünkende Zarenreich ist diese Niederlage gegen Japan eine Katastrophe. Obwohl sich das Kriegsgeschehen zehntausende Werst von den urbanen Zentren diesseits des Urals entfernt abspielt, wird das Scheitern des blutigen Kräftemessens um Einflussgebiete in Nord-China und Korea weltweit als Schwächung der Zarenmacht verstanden. Russland gilt bei anderen europäischen Großmächten fortan als 142 besiegbarer Gegner in künftigen Kriegen. Die Russlandpolitik des deutschen Kaiserreichs kündet bald schon von einer atmosphärischen Verschlechterung im beiderseitigen Verhältnis, auch wenn dies an den traditio143 nell engen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zunächst wenig ändert. Gravierender ist jedoch, dass vor dem Hintergrund des Kriegsgeschehens von 1904/05 im Zarenreich selbst die Forderungen nach inneren Reformen, nach politischer Partizipation des Volkes immer drängender artikuliert werden. Während die Hiobsbotschaften von der ostasiatischen Front das anfängliche Propagandagetöse und die Siegesmeldungen in der russischen 112
1. Von Ostafrika zum Studium nach Moskau
Presse allmählich übertönen, erlebt Russland im Inneren seine erste Revolution. In Russlands Industriestädten häuften sich schon seit 1904 Unruhen und Arbeiterstreiks. Auf dem Lande erhoben sich die Bauern gegen ihre Grundherren. Hunderte Gutshäuser des Landadels gingen in Flammen auf. Der „Blutsonntag“ in der Hauptstadt St. Petersburg im Januar 1905 dann, als die Palastwache in eine unbewaffnete, friedlich demonstrierende Menge schoss, markierte einen ersten Höhepunkt des landesweiten Protests. Die Ermordung des Großfürsten Sergej Alexandrovič, eines Onkels des Zaren, der als Gouverneur über Moskau regierte, war nach einer kurzen Phase der Beruhigung der Auftakt für eine erneute, diesmal gewaltsame Form des Widerstands gegen die Despotie der Romanovs. Nun drohte das gesamte Zarenreich in Anarchie zu versinken. In Odessa meuterten die Matrosen des Panzerkreuzers Potemkin und verbündeten sich mit streikenden Arbeitern. Große Teile der Bevölkerung kündigten Nikolaus II., der sich gegenüber den Zeichen der Zeit blind und taub stellte, die Gefolgschaft auf. Ja, sie stellten sogar seine Herrschaft in Frage – ein ungeheuerlicher Vorgang für die seit bald 300 Jahren herrschende Dynastie der Romanovs. Selbst der alte Lev Tolstoj, die größte moralische Autorität jener Zeit, richtete einen eindringlichen Appell an den Zaren, endlich Reformen in Gang zu setzen. Unter dem Druck des allgemeinen Aufruhrs erklärte sich der Zar schließlich zu halbherzigen politischen Konzessionen bereit. Mit seinem Manifest vom 17. Oktober 1905 kündigte er die Einsetzung einer Reichsduma als Legislative und Volksvertretung an. Seinen Anspruch als Alleinherrscher gab er dennoch nicht auf. Reformbeschlüsse der Volksvertreter beantwortete er mit seinem Veto und mehrmals sogar mit der Auflösung der Duma. Selbst gemäßigte Volksvertreter wandten sich enttäuscht den radikalen Gruppen der Sozialisten zu, wo Vladimir Iljič Lenin nach seiner Rückkehr aus dem Genfer Exil im November 1905 seine ersten spektakulären Auftritte hatte und sich an die Spitze der Bol’ševiki setzte. Dass der nunmehr 26-jährige Consten während der erzwungenen Muße der Genesung von seiner Tropenkrankheit in der Aachener Tagespresse die Meldungen über den Ausbruch des Russisch-Japanischen Kriegs und die revolutionären Ereignisse im Zarenreich aufmerksam verfolgt hat, ist anzunehmen. Doch in Moskau dürfte er zunächst nicht viel davon gemerkt haben. 113
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
In der zweiten Oktoberhälfte 1904 war Hermann Consten, mit dem Schnellzug von Aachen über Berlin, Warschau, Minsk und Smolensk anreisend, auf dem Brester Bahnhof, dem heutigen Weißrussischen Bahnhof, in 144 Moskau eingetroffen. Die Bekannten hatten ihn gastfreundlich aufgenommen und ihm in den ersten Wochen geholfen, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Seine Erkundungsgänge in der fremden Metropole führten ihn zunächst zum historischen Stadtkern, Moskaus Herzstück, der Basilius-Kathedrale mit ihren buntfarbig gedrehten Zwiebeltürmen, zum Roten Platz und zum Kreml. Die ghibellinischen Zinnen der Kreml-Mauer, die Pracht der Paläste und der goldschimmernde Glanz der Kirchen dürften ihn ebenso beeindruckt haben wie das Leben und Treiben auf den Märkten und an den Uferpromenaden der Moskva. Der junge Mann, der zu Jahresbeginn noch fiebernd und Wildtiere jagend durch die Steppengebiete Ostafrikas zog, muss Moskau als Weltstadt empfunden haben. Das heimatliche Aachen war, verglichen damit, tiefste Provinz. Schließlich mietet er sich auf der Ulica Tverskaja im Haus Gučkov 145 ein. Die Tverskaja, Moskaus kilometerlange Prachtstraße mit ihren zahlreichen reklamegeschmückten Geschäften und Kontoren, den Stadthäusern der wohlhabenden Kaufmannschaft und den Hotels für ihre auswärtige Klientel, gehört zu den besseren Adressen Moskaus. Consten sucht und findet rasch Kontakt zu Deutschen und Russen. Die Wintermonate 1904/05 nutzt er, um Russisch zu lernen und sich in das gesellschaftliche Leben mit seinen Soireen, Bällen, Trinkgelagen und Glücksspielen zu stürzen. So manches Mal kehrt er nach solchen Intensivkursen in russischer Lebensart, die seinem eigenen Temperament zutiefst behagen und ihn lebhaft an seine wilden Zeiten der Aachener und Karlsruher Studentenjahre erinnern, erst in den frühen Morgenstunden heim. Doch nimmt er durchaus auch die dunkle Kehrseite dieser vergnügungssüchtigen Gesellschaft wahr. „He, Fjodor Karlowitsch“, wendet sich ein hochgewachsener blonder 146 Mann an seinen Freund, mit dem er die Marmorstufen von Yar zu seinem Schlitten, umringt von diensteifrigen, sich verbeugenden Russen, 147 heruntersteigt. „Hast du heute abend Rjabuschinski in Tätigkeit gesehen?“ „Na, und ob!“ lacht der andere. „Das war wieder so ein richtiger 148 Streich eines Kulak. Diese russischen Ausbeuter wissen nicht, was sie mit ihrem Gelde anfangen und wie sie damit protzen sollen.“ „Nitsche114
1. Von Ostafrika zum Studium nach Moskau 149
wo!“ entgegnete der Blonde. „Es war doch zu köstlich, als das kleine unscheinbare Männchen, dieser größte Krösus Russlands, dem Kellner aus Versehen einige Kristallbecher von seinem Bedienungsbrett herunterstieß und dieser ihn anfauchte: ‚Können Sie das auch bezahlen?!‘“ – „Ja, ja, das verblüffte Gesicht des Alten war kostbar! Zum Wälzen! Aber dann packte ihn doch die Wut. Ein Schlag mit der Faust, und das Tablett flog mit den Kristallen den benachbarten Gästen um die Ohren. Dann hämmerte er mit seinem Stock zwischen dem Edelporzellan und kostbaren Kristall herum, zerschmetterte die großen chinesischen Vasen, warf das halbe Büffet herunter und brüllte dabei immer wieder bei jedem 150 Schlag und Stoß: ‚Du Schafskopf! Das kann ich bezahlen! Durak …! Und das kann ich bezahlen!‘ Krach, da lag wieder so eine kostbare Vase zertrümmert auf dem Boden. Pautz, flog ein anderes Silbergeschirr gegen die Spiegelwand, die in Scherben ging, und immer wieder fauchte der erboste Kleine, unter dem Gejohle der Gäste, den erstarrt dastehenden Kellner an: ‚Schafskopf! …. Durak …! und das kann ich auch noch bezahlen!‘“ – „Köstlich!“ […] Immer wieder lachend stiegen die beiden, deren Russisch man es anhörte, dass sie Deutsche waren, aber als echte Deutsche für waschechte Russen gehalten werden wollten, in ihre Schlitten. Sie wurden sorgsam von den in russische Tracht gekleideten Türstehern und Bedienten von Yar in ihre Pelzdecken gepackt. Der riesenhafte Pförtner macht noch auf das gute 151 Trinkgeld hin seinen Paklon. Die Troika sirrt geräuschlos davon. Die Kerle stecken ihr Trinkgeld ein, und der eine brummt. „Was die verdammten Wurstmacher, diese Deutschen, sich nur über unsre breite Natur lustig zu machen haben!“ Plötzlich bricht er ab und starrt, gespannt horchend, auf die Landstraße hinaus. Leise klirrt von dort durch den kommenden Morgen Eisen, das gegen Eisen schlägt. Schatten tauchen auf. 152 Morgenfahl der Stahl der Gewehre, Lanzen und Säbel … Kasacken zu 153 Pferde! Die Nagaika in der Hand! Gefängnissoldaten zu Fuß, die gezogenen Säbel in der froststarren Faust! … Sie führen eine Abteilung politischer Verbrecher gegen den Brester Bahnhof zu, um sie in dem großen 154 155 Transportgefängnis für Sibirien auf der Dolgoruwskaja abzuliefern.
Bis zum Sommer 1905 verläuft das Alltagsleben in Moskau, der Gang der Geschäfte noch vergleichsweise normal. Doch nachdem Zar Nikolaus II. im 115
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Oktober sein Manifest proklamiert hat und viele, die daran Hoffnungen auf echte Reformen geknüpft hatten, sich getäuscht sehen, reagieren die Moskauer Gewerkschaften mit einem Generalstreik. Die Streikenden riegeln die 156 Millionenstadt von der Außenwelt ab. Brot, Wasser und Beleuchtung werden knapp, es fahren keine Züge und Straßenbahnen mehr, kurz: das gesamte öffentliche Leben ist lahmgelegt. Im Laufe des November 1905 treffen Meldungen über Meutereien von Truppeneinheiten in der Mandschurei, an der Transsibirischen Eisenbahn und in Zentralrussland ein. In Moskau selbst meutert ein Infanterieregiment und nimmt Offiziere als Geiseln. Fast fünf Wochen legen Moskaus Post- und Telegraphenbeamten die Arbeit nieder. Längst haben radikale Kräfte die liberaleren Oppositionellen verdrängt und schüren den Widerstand unter den Fabrikarbeitern. Sie errichten Barrikaden in der verschneiten Moskauer Innenstadt, werfen Bomben und liefern sich bei eisigen Temperaturen Schießereien und Straßenschlachten mit der Polizei. Der Gouverneur verhängt das Kriegsrecht. Ein weiterer Generalstreik am 20. Dezember wächst sich zum offenen Aufstand aus, der bis zum 1. Januar 1906 andauert. Tagelang ist der größte Teil der Stadt, insbesondere der 8. Rayon an der westlichen Peripherie in den Händen bewaffneter Revolutionäre. Schließlich gelingt es, Entsatztruppen der Artillerie von St. Petersburg heranzuholen, die den Aufstand blutig niederschlagen und die Kontrolle zurück gewinnen. Die Niederwerfung des Moskauer Aufstandes entscheidet über den Zusammenbruch der Revolution. Die Streiks im ganzen Land ebben ab, doch bleibt die Lage instabil. Bis 1907 noch sind politische Attentate, Überfälle auf Banken, Fabriken und Geschäftsräume 157 an der Tagesordnung. Die in der Kreml-Metropole lebenden deutschen Geschäftsleute und Fabrikanten, unter denen wir auch die Bekannten Hermann Constens vermuten müssen, bleiben von den sozialen Spannungen nicht verschont. Mit etwa 10.000 Einwohnern ist die deutschsprachige Ausländergruppe, die Deutsche, Österreicher und Schweizer umfasst, zu Beginn des 20. Jahrhunderts die größte der nichtrussischen Bewohner Moskaus. Die Moskauer Deutschen sind wirtschaftlich und gesellschaftlich arriviert, bleiben gern unter sich, unterhalten eigene Zeitungen, Schulen, Krankenhäuser und Kirchengemeinden und pflegen ein reges Vereinsleben. Aber sie stehen den116
1. Von Ostafrika zum Studium nach Moskau
noch in gutem Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung, sprechen in der Regel fließend Russisch, bewundern die Leistungen russischer Literatur und Kunst und haben viele der russischen Lebensgewohnheiten übernommen. Mehrheitlich gehören sie zur vermögenden Schicht. Unter ihnen sind Kaufleute, Fabrikanten, Ingenieure, Techniker, Bank- und Versicherungsbeamte, aber auch Pfarrer, Ärzte und Hochschullehrer; nicht zu vergessen viele Frauen, die als Erzieherinnen und Lehrerinnen in Moskau arbeiten. Ein Teil der schon seit den Zeiten Ivans des Schrecklichen bestehenden deutschen Kolonie ist selbst für russische Begriffe sehr vermögend. Diese Familien besitzen große Stadthäuser und prächtige Landgüter vor den Toren Moskaus. Deutsche Unternehmer betreiben Fabriken, in denen Russen 158 für sie arbeiten. Es erscheint also folgerichtig, dass sich proletarischer Zorn und allgemeiner Fremdenhass der unteren Klassen während der Revolution des Jahres 1905 auch gegen sie wenden. Betriebsleiter und Meister werden tätlich angegriffen, von bewaffneten Arbeitern unter einem Hagel von Steinen und Wurfgeschossen auf Schubkarren aus den Fabrikanlagen gekarrt und mit dem Tod bedroht. Die streikenden Arbeiter erpressen Geld von den Fabrikanten und richten Schäden an Maschinen und Gebäuden an. Als im Spätherbst 1905 die Unruhen von den Vororten auf das Stadtzentrum von Moskau übergreifen und man nicht mehr ohne Gefahr für Leib und Leben nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße gehen kann, wenden sich viele verängstigte Deutsche an ihr Konsulat mit der Bitte, Sonderzüge zu organisieren, um das Land verlassen zu können. Ein Ding der Unmöglichkeit in einer Zeit, da die meisten Bahnen in der Hand der Revolutionäre sind. Es werden Pläne gewälzt und wieder verworfen, einen bewaffneten Selbstschutz einzurichten, nachdem mehrere Deutsche auf offener Straße überfallen und verletzt wurden. Man erwägt sogar, ein leerstehendes Zirkus-Gebäude als allgemeinen Sammelpunkt und Zufluchtsort für die Moskau-Deutschen anzumieten und es mit Hilfe eines Dekrets aus Berlin unter den Schutz der Reichsflagge zu stellen. Besonders Ängstliche suchen im Konsulatsgebäude um Asyl nach. Doch gibt es auch einige, meist handelt es sich um Schüler des evangelischen St. Petri-Pauli-Gymnasiums und eine Handvoll Studenten – nach Einschätzung des Generalkonsulats insgesamt um die 50 junge Leute beiderlei Geschlechts –, die sich unter dem Einfluss ihrer russischen Freunde und Kommilitonen aktiv an den De117
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
monstrationen beteiligen und insbesondere Forderungen der Aufständischen nach Schul- und Universitätsreformen unterstützen. Nach der Niederschlagung der Unruhen werden sie verhaftet, vor Gericht gestellt und mit Gefängnis, Verbannung oder Ausweisung bestraft. So erhalten etliche deutsche Familien in Moskau Besuch von der Ochrana, der gefürchteten russischen Geheimpolizei, die Hausdurchsuchungen, Verhaftungen und 159 Verhöre vornimmt. Ob sich Hermann Consten während der Krisenmonate in Moskau aufhielt, ließ sich nicht zweifelsfrei feststellen. Möglicherweise befand er sich 160 in Begleitung eines deutschen Bekannten, eines Hauptmann Rausch, auf seiner ersten großen Jagdreise in die Steppengebiete Zentralasiens, im AltajGebirge oder in Kirgisien. Im Frühjahr 1906 jedenfalls scheint er zurück in Moskau und entschlossen zu sein, dauerhaft in Russland zu bleiben. Über einen Aachener Anwalt beantragt er von Moskau aus einen zunächst für 161 fünf Jahre gültigen Heimatschein, der ihm den langfristigen Auslandsaufenthalt ermöglicht, ohne dass er Gefahr läuft, seine preußische bzw. reichsdeutsche Staatsangehörigkeit zu verlieren. Dann schickt er sich an, ein weiteres Mal in seinem Leben ein Studium aufzunehmen. Einer Empfehlung des deutschen Generalkonsuls Dr. Kohlhaas folgend, schreibt sich 162 Consten im renommierten Lazarev-Institut für orientalische Sprachen ein. Er belegt die Fächer Geographie, Kartographie, Völkerkunde und zentralasiatische Sprachen. Das Institut befindet sich in einem noch aus dem 17. Jahrhundert stammenden, später klassizistisch überformten Gebäude an der Armjanskij pereulok, der Armenischen Gasse. Als eines der wenigen hat es den großen Brand von Moskau im Jahr 1812 heil überstanden. 1815 als Kulturzentrum der armenischen Diaspora in Moskau gegründet und seit 1827 zunächst als Lehranstalt für Kaukasus- und Turksprachen anerkannt, im Laufe des 19. Jahrhunderts dann um Länder- und Völkerkunde Zentral- und Ostasiens erweitert, genießt das Lazarev-Institut, nicht zuletzt dank seiner Lehrer, einen hervorragenden Ruf weit über Russlands Grenzen hinaus. Bedeutendster Sprachwissenschaftler am Institut ist zugleich ihr Direk163 tor: Professor Vsevolod F. Miller, ein universal gebildeter Mann, der sich unter anderem als Verfasser eines ossetisch-russisch-deutschen Wörterbuchs, als Volkskundler und Archäologe einen Namen gemacht hat. Neben 118
1. Von Ostafrika zum Studium nach Moskau
orientalischen Sprachen unterrichtet Miller Geschichte und mythologische Überlieferung zentralasiatischer Völker. Bei ihm, der zugleich eine Professur für Volkskunde an der Moskauer Universität innehat und Vorsitzen der der „Kaiserlich Russischen Gesellschaft der Freunde der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie sowie seiner geographischen Zweig164 stelle“ ist, erwirbt Hermann Consten Basiskenntnisse des Mongolischen und Kirgisischen. Geographie, Kartographie und Völkerkunde belegt er bei einer anderen Koryphäe des Instituts, dem besonders durch seine Forschungsarbeiten über Ainu und Japaner wie auch über Schädel- und Rassenkunde international bekannten Anthropologen Professor Dmitri N. 165 Anučin. Millers und Anučins Forschungstätigkeit baute auf einer bereits im 18. Jahrhundert einsetzenden, seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts intensiv betriebenen Tradition asiatischer Forschungen in Russland auf, mit wichtigen Zentren nicht nur in St. Petersburg und Moskau, sondern auch in Kazan’, Kiev, Vilnius und Charkov. Die Beschäftigung mit den Völkern, Sprachen und Kulturen des Ostens stand in einem engen Zusammenhang mit dem Ausgreifen des Zarenreiches nach Sibirien und, darüber hinaus, in die Steppengebiete Zentralasiens und die Gebirgsregionen des Kaukasus. Der Vortrieb des Eisenbahnbaus, die Ausweitung der Agrarflächen, die Suche nach Bodenschätzen, deren Sicherung, Erschließung und industrielle Verarbeitung Reichtum und Wohlstand versprachen, verschaffte zum Ende des 19. Jahrhunderts dann vor allem der geologischen und der wirtschaftsgeographischen Asienforschung Auftrieb. Diese Orientierung nach Osten brachte Russland in Kontakt – und bald auch in Konflikt – mit den angrenzenden Herrschaftsbereichen Chinas, Koreas und Japans. Sie gab den Anstoß für intensive Handelsbeziehungen mit den Völkern des Ostens entlang den alten Routen der Seidenstraße und den neueren Routen durch Südsibirien und die Mongolei. Doch waren zugleich auch Gelüste erwacht, die in zahlreichen Expeditionen erkundeten Gebiete militärisch zu besetzen und dem russischen Imperium einzuverleiben. Nicht wenige der russischen Geographen und Forschungsreisenden bekleideten zugleich einen militärischen Rang. Oberst Nikolaj M. Prževalskij (1839–1888) – um nur den prominentesten unter ihnen zu nennen – unternahm zwischen 1870 und 1888 mit militärischer Eskorte mehrere Forschungsreisen in die Mongolei und 119
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
gelangte „auf Schleichwegen“ durch bisher unbekannte Regionen bis in das 166 für Ausländer verschlossene Tibet. Prževalskij hatte seine Forscherkarriere als Angehöriger der russischen Armee mit Vermessungsarbeiten im Flussgebiet von Amur und Ussuri an der Grenze zu China begonnen; er verfasste im Anschluss eine militärische und statistische Übersicht über das Amur-Gebiet. Später ließ er sich nach Irkutsk am Baikalsee und Nikolaevsk in Ost-Sibirien versetzen, den Ausgangspunkten seiner Reisen ins Innere Asiens. Während sein Name durch seine Entdeckung der mongolischen Wildpferde und die Benennung zahlreicher Pflanzenarten, Vögel und Säugetiere der Nachwelt erhalten blieb, während seine Reiseberichte in viele Sprachen übersetzt wurden, sind seine militärstrategischen Denkschriften, wie die über „Die derzeitige Lage OstTurkestans“ – das heutige Xinjiang, schon damals ein Unruhegebiet – allenfalls noch in russischen Archiven und Bibliotheken zu finden. Prževalskijs Schüler Petr K. Kozlov (1863–1935) gewann durch Ausgrabungen im Gebiet der legendären Oasenstadt Kara Khoto (Char Chot) in der heutigen 167 mongolischen Region Gobi Altaj (Gov' Altaj) internationale Berühmtheit. Reisen von Militärtopographen ins Pamir-Gebiet, von Geologen in die Tsaidam-Senke und ihre Randgebirge, wo sie Erdöl- und Goldvorkommen fanden, rückten Zentralasien in den Fokus politischer und militärstrategischer 168 Interessen. Die Ausdehnung des russischen Herrschaftsbereichs auf die Siedlungsgebiete der Kalmücken an der unteren Volga und der Burjaten in Transbaikalien hatte bereits im 17. Jahrhundert Buddhisten zu Untertanen der Zaren gemacht. So lag es nahe, dass russische Asienforscher sich am Wettlauf um die Bergung von Kultgegenständen und heiligen Schriften aus den buddhistischen Höhlenklöstern in den Wüsten-Oasen der Taklamakan beteiligten. Russische Universitäten, allen voran St. Petersburg, entwickelten sich zu bedeutenden Zentren der Erforschung des tibetischen Buddhismus. Je fester mit dem Vordringen der Forscher und Entdecker auch der militärisch-politische Zugriff Russlands auf die entlegenen Gebiete wurde, desto entschiedener gebärdete sich das Zarenreich dort als „Schutzmacht“ gegenüber territorialen Übergriffen anderer Mächte, wie etwa Chinas – oder auch Großbritanniens, das schließlich glaubte, sein „Kronjuwel“ Indien mit einem „Sicherheitsgürtel“ von Persien und Afghanistan bis in den Himala120
1. Von Ostafrika zum Studium nach Moskau
ya und das Tibetische Hochland gegen den russischen „Drang nach Süden“ schützen zu müssen. Auch die Militärexpedition Younghusbands nach Tibet (1903/04) gehörte in diesen Kontext. Die Flucht des XIII. Dalai Lama aus dem von den ausländischen Truppen eingenommenen Lhasa ins mongolische Exil hatte wiederum zur Folge, dass sich der engste außenpolitische Berater Seiner Heiligkeit, der burjatische Lama Agvan Doržiev (1854– 169 1938), ein russischer Untertan also, im Namen des Dalai Lama hilfesuchend an Russland wandte. Er war nicht als einziger der Überzeugung, der „Cagaan Chaan“, der „Weiße Khan“ Zar Nikolaus II., sei ein Freund des Buddhismus und werde helfen, die Engländer wieder aus Tibet hinaus zu komplimentieren. Dieser Plan hatte einflussreiche Befürworter am Zarenhof, unter ihnen Fürst Esper E. Uchtomski (1861–1921), den großen Kenner asiatischer 170 Kunst und des Buddhismus. Doch hatte der tiefgläubig-orthodoxe, der „Allerchristlichste Zar“ mit dem fatalen Krieg gegen Japan und dessen Folgen längst andere Sorgen als die Gelegenheit, die sich Russland durch das mongolische Exil des Dalai Lama bot, beim Schopf zu packen. In den Wintermonaten 1906/07 widmet sich Hermann Consten derweil in Moskau eifrig seinem Studium. Neben der Beschäftigung mit Sprache und Schrift der Turkvölker und Mongolen vertieft er sich in die einschlägige Reiseliteratur, in russische Generalstabskarten mit ihren vielen weißen Flecken, die noch niemand bereist hat, wie auch in die zahlreichen Forschungsberichte über geologische und morphologische Beschaffenheit der Gewässer und Gebirgszüge, der Steppen und Wüsten, über Flora, Fauna und Besiedlung Zentralasiens. Er lernt den Umgang mit Barometer und Höhenmesser kennen und macht sich mit den Anfangsgründen der Typenlehre anhand von Schädelmessungen vertraut – einem in jener Zeit zentralen Forschungszweig der europäischen Anthropologie. Neben den Vorlesungen und Übungen besucht er Vortragsabende der „Gesellschaft der Freunde“, knüpft Kontakte zu Gelehrten und Gönnern. Er pflegt aber weiter auch private Vergnügungen wie Kneipabende und Tanzereien, genießt russisch-deutsche Warmherzigkeit und Ungezwungenheit, schmeichelt schönen Frauen und gibt in fröhlicher Runde bereitwillig seine afrikanischen Abenteuer zum Besten. Aus Hermann Joseph Theodor Consten wird German’ Germanovič Konsten’, ein eleganter glattrasierter Stutzer im 121
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
dunklen, pelzgefütterten Wollmantel und mit schräg über die dunklen Locken gestülpter Fellkappe. Bei seinen Streifzügen durch die russische Metropole lässt er sich gern von zwei 171 großen gelben Doggen eskortieren – ein ihm wohl adäquat erscheinender Ersatz für Löwe, Panther und auch den angeleinten Hundsaffen samt „Boys“, mit denen sich der Protagonist seiner Afrika-Erzählung „Ngombe“ als reich gewordener Großwildjäger im Kolonialstädtchen Tanga in Szene setzte. Doch wie bei seinem nun schon bald zehn Jahre zurückliegenden Architektur-Studium oder dem der tropischen Landwirtschaft in Witzenhausen fehlt Consten auch für das Studium der orientalischen Sprachen, der Abb. 7: H. Consten in Moskau, um 1906 Anthropologie und Geographie Zentralasiens letztlich die Geduld zu Vertiefung und Gründlichkeit. Längere Sesshaftigkeit, die stickige Luft von Studierstuben und Bibliotheken sind Constens Sache nun einmal nicht. So sehr ihm die Annehmlichkeiten des Moskauer Großstadtlebens auch behagen mögen, er will so schnell wie möglich wieder unterwegs sein. Der geheimnisvolle Sog, ihm noch unbekannte Gebiete jenseits des Urals in Augenschein zu nehmen, wird immer stärker. Schon im April 1907 bietet sich eine Gelegenheit, die für ihn offenbar dennoch überraschend kommt. Eines Tages fragte mich Professor Anutschin, der größte Geograph und Anthropologe Russlands: „Sie haben doch in Afrika schon Expeditionen unternommen. Wollen Sie nicht für mich eine kleine Expedition in die Mongolei machen?“ „Mongolei?“ fragte ich – und muss wohl ein sehr dummes Gesicht gemacht haben, denn der alte Herr lachte. Er holte also eine große russische Generalstabskarte hervor, und stundenlang saßen wir darüber gebeugt. Als ich ihn so zwischendurch fragte, was ich denn 122
1. Von Ostafrika zum Studium nach Moskau
in der Mongolei für ihn tun sollte, sagte er in aller Seelenruhe: „Menschenköpfe sammeln, von den verschiedenen Stämmen, je ein weibliches und ein männliches Exemplar.“ Mein Gesicht muss nicht gerade von Intelligenz geglänzt haben. „Aber zum Teufel, wo soll ich denn die Köpfe herbekommen?“ „Sie geben Acht, wenn die Toten zum Leichenacker transportiert werden und folgen den riesigen schwarzen Hunden. Denn die Mongolen beerdigen ihre Toten nicht, sondern legen sie auf das Leichenfeld – den Hunden zum Fraß. Wenn der Tote schnell von den Hunden verzehrt wird, so war er ein braver und ehrlicher Erdenbürger und hat Aussicht auf eine baldige Wiedergeburt. Wenn ihn die Hunde nicht anrühren, so war er ein Lump, und ein qualvolles Dasein erwartet ihn.“ 172 So dozierte der weißhaarige Gelehrte.
Egal, ob sich der – ein halbes Jahrhundert später erst notierte – Dialog zwischen Anučin und Consten genau so zugetragen hat, dieser Vorschlag muss Consten jedenfalls wie gerufen gekommen sein. Die Frage, ob ein solches Vorgehen nicht etwa mongolische religiöse Tabus oder politische Empfindlichkeiten berühren könnte, stellte er dem Herrn Professor offenbar nicht. Trophäenjagd war Consten seit seinen afrikanischen Jahren vertraut. Auch unter deutschen Anthropologen gehörte das Sammeln von Köpfen zu rasse173 kundlichen Zwecken schon seit Jahrzehnten zum Alltagsgeschäft. Consten stürzt sich jedenfalls gleich in die Vorbereitungen für seine Expedition. Dabei spielt die erwähnte große russische Generalstabskarte ebenfalls eine wichtige Rolle. Consten soll nämlich während seiner Reise durch das Land der Mongolen ganz nebenbei für die Kaiserlich Geographische Gesellschaft durch regelmäßige Vermessungen prüfen, ob das vorhandene Kartenmaterial korrekt ist und eventuell noch bestehende „weiße Flecken“ beseitigen helfen. So gesellen sich zu seiner Ausrüstung neben Jagdutensilien, Kompass, Kisten für die Köpfesammlung, Kameras und Filmmaterial auch noch Höhen- und Temperaturmesser, Theodolit und Messlatte. Ob seine erste Mongolei-Reise tatsächlich auf der Basis eines quasi-offiziellen russischen Auftrags erfolgte, bedarf noch weiterer Nachforschungen. Belegt findet sich in den Akten des deutschen Generalkonsulats Moskau unter dem 22. April 1907 ein Ersuchen Hermann Constens an Generalkonsul Dr. Kohlhaas, ihm bei der Beschaffung von Munition für seine ihm „durch Verfügung des Polizeipräsidiums in St. Petersburg erlaubten drei 123
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente 174
Feuerwaffen“ mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung zu helfen. Denn für den Kauf einer größeren Menge Munition benötigt Consten eine amtliche Erlaubnis der Moskauer Polizeibehörde. Angefügt ist der handschriftliche Entwurf eines Schreibens des Generalkonsuls an den Polizeipräsidenten. Kohlhaas unterstützt darin das Gesuch Constens mit der Begründung: Consten, der mir persönlich als zuverlässig bekannt ist, beabsichtigt, in einiger Zeit eine Reise zu wissenschaftlichen Zwecken nach dem Ural 175 und Sibirien zu unternehmen.
Von der Mongolei ist in diesem Schreiben nicht die Rede. Hat Consten selbst da ein entscheidendes Detail verschwiegen? Oder war es der Generalkonsul? Die „kleine Expedition“ ins Land der Mongolen jedenfalls umweht von Anfang an ein Hauch von Geheimnis.
2. Mongolei zum Ersten: „Köpfe sammeln“ für Russland Also: ich reiste mit der Bahn durch Sibirien und zu Pferd nach der mon176 golischen Hauptstadt Urga, dem heutigen Ulan batre.
Als Hermann Consten diesen Satz in seinem Todesjahr 1957 für den Westdeutschen Rundfunk niederschreibt, da ahnt er noch nicht, dass das Reisen mit der Transsibirischen Eisenbahn nur wenige Jahre darauf zum touristischen Geheimtipp für die neuerwachte Fernreiselust der Deutschen nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs wird. Er selbst tritt, 50 Jahre, bevor er diesen Satz so salopp formuliert, die erste von vielen Reisen mit der schon seinerzeit legendären Eisenbahn an. Ruhig und gleichmäßig rollen wir dem fernen Endziel entgegen. Die russischen Wagen mit ihrer breiteren Spurweite laufen viel ruhiger und gleichmäßiger, sie sind auch in jeder Beziehung bequemer, wenn auch lange nicht so sauber wie unsere deutschen Wagen. Einstweilen hält die russische Regierung daran fest, dass die Eisenbahnen dazu da sind, die Reisenden – auch die Passagiere dritter Klasse – möglichst bequem und billig zu befördern. Der Reisende ist Gott sei Dank hier in Russland nicht für die Eisenbahnen da, sondern die Eisenbahnen für die Reisenden. Kann man doch für etwa zweihundert Mark bequem von Moskau nach 177 Wladiwostok reisen. 124
2. Mongolei zum Ersten: „Köpfe sammeln“ für Russland
Auch wenn die Abteile in den für höhere Beamte und Ausländer reservierten Waggons der ersten Klasse überaus komfortabel zu nennen sind, steht Consten ein langes, ein mühseliges Reiseabenteuer mit ungewissem Ausgang bevor. Ein Reiseabenteuer, das dort, wo er die Eisenbahn verlassen und zu Pferd weiterreisen wird, eigentlich erst beginnt. Und eigentlich lässt es sich nicht in einem einzigen Satz zusammenfassen, wie er es gegen Ende seines Lebens dennoch fertigbringt. Was nun, ein halbes Jahrhundert vor diesem Satz anhebt, das könnte man im Rückblick als Constens „Lebensroman“ bezeichnen. Mit seiner Abreise aus Moskau an einem Sommertag des Jahres 1907, 178 mit dem dritten Glockenton, der den Zug vom Kazaner Bahnhof aus auf seine insgesamt über 9.000 Kilometer lange Reise schickt, verblassen die farbigen afrikanischen Jahre endgültig. Beim Aufzeichnen der eigenen Vita werden sie später allenfalls noch mit einem einzigen, manchmal sogar nur mit einem Halbsatz gestreift. Die neue, von Professor Anučin angestoßene Geschichte eines Abenteurer- und Forscherlebens wird länger dauern, bewegter sein, tiefere Spuren hinterlassen. Dieser Abschnitt seiner Lebensgeschichte wird viele Kapitel voller Höhen und Tiefen enthalten; er wird voller Abenteuer, Phantastereien, Euphorien, Abgründe und persönlicher Katastrophen sein. Das Herzland Asiens aber, die Mongolei, soll zum Land seines Herzens werden. Als Consten an jenem Sommertag des Jahres 1907 also mit seiner zum großen Teil noch aus Afrika stammenden Expeditionsausrüstung – ein halbes Dutzend dieser herrlich bequemen russischen Leinenkittel mit kleinem Stehkragen, seitlicher Knöpfung und Ärmeln ohne Manschetten, hat er allerdings hinzu erworben – in den Zug Richtung Ural und Sibirien steigt, ist ihm wohl nicht bewusst, dass er damit den Faden aufnimmt, der ihn durch das Labyrinth seines Lebens leiten wird. Der ihm „Orientierung“ im Sinne des Wortes wird, indem er ihm die Ausrichtung nach Osten als den Weg weist, den er zu gehen hat. Von dieser ersten Reise Hermann Constens in das Land der Mongolen ließen sich seltsamerweise weder im Nachlass noch in Archiven bisher Aufzeichnungen von seiner Hand oder andere Dokumente finden, die Aufschluss über ihre Dauer, ihren Verlauf oder ihre Finanzierung geben könnten. Auch scheint er sie, von der zitierten, eher anekdotischen Reminiszenz aus dem Jahr 1957 einmal abgesehen, weder wissenschaftlich noch sonst125
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
wie publizistisch direkt verwertet zu haben. Allenfalls in den Landschaftsund Charakterschilderungen seiner drei Mongolei-Romane aus den zwanziger Jahren – „Mysterien“, „Der Kampf um Buddhas Thron“ und „Der rote 179 Lama“ – dürften sich Spuren davon niedergeschlagen haben. Auch wo er sich im Ural und in Sibirien jeweils aufgehalten hat, welchen „wissenschaftlichen Zwecken“ – und für wen – er dort nachging, welche Resultate er heim nach Moskau brachte, ist unbekannt. Und dennoch muss gerade der Aufenthalt in der Mongolei von entscheidender Bedeutung für sein weiteres Leben gewesen sein: Zumindest hat er die Weichen für die nachfolgenden, besser dokumentierten Mongolei-Reisen gestellt. Einzelheiten dieses ersten Aufenthaltes lassen sich durch Rückschlüsse aus seinen späteren Veröffentlichungen immerhin lückenhaft rekonstruieren. Als erstes stellt sich die Frage, ob Consten nicht 1907 schon mehr als nur den Auftrag seines russischen Professors hatte. Schließlich war das Gebiet, in das er aufbrach, nicht nur für Russland, sondern auch für das Deut sche Reich, das sich 1897 mit Jiaozhou (Kiautschou) ein Stück vom chinesischen Kuchen genommen hatte und 1900/01 an der blutigen Niederschlagung des Boxer-Aufstands beteiligt gewesen war, von einigem Belang. Zwar war das deutsche Interesse an der Chinas Suzeränität unterstehenden Mongolei mäßig, allenfalls wirtschaftlicher Natur; deutsche Firmen waren in den transmongolischen Handel zwischen China und Europa involviert, einige wenige hatten sogar Niederlassungen auf mongolischem Territorium oder betrieben dort ein Unternehmen. Ungeachtet dessen war die Reichsregierung in Berlin bestrebt, möglichst aus erster Hand informiert zu sein, wie sich nach dem Ende des Russisch-Japanischen Krieges die politischen Kräfteverhältnisse in Ost- und Zentralasien verschoben bzw. neu formierten. Der Hauptrivale des Deutschen Reiches auf dem asiatischen Festland hieß bekanntlich Japan. Von dem fernöstlichen Inselreich, weniger vom schwachen China, ging die von Wilhelm II. beschworene „Gelbe Gefahr“ aus. Jeder deutsche Staatsbürger, der in die Region reiste, konnte da ein nützlicher Informant sein. Und Constens enger Kontakt zum Generalkonsulat in Moskau spricht dafür, dass er sich einer entsprechenden Bitte wohl 180 nicht verschlossen hat. Mehr noch als das deutsche wappnete sich das russische Reich, das sich im Krieg gegen die Japaner bereits eine blutige Nase geholt hatte, gegen die 126
2. Mongolei zum Ersten: „Köpfe sammeln“ für Russland
„Gelbe Gefahr“ aus dem Osten. Japans Präsenz auf dem asiatischen Festland war nach zwei Siegen – 1895 gegen China und 1905 gegen Russland – nicht mehr rückgängig zu machen. Nicht nur auf Korea und die Mandschurei, auch auf das mongolische Gebiet hatte Japan längst ein begehrliches Auge geworfen. Nippon trat damit in Konkurrenz zu den ebenfalls an der Mongolei interessierten Russen. Anfang 1907 setzte der führende russische 181 Sinologe Aleksej M. Pozdneev den Generalstab davon in Kenntnis, dass in Tokyo eine Gesellschaft gegründet worden sei, die sich zum Ziel gesetzt hätte, den Einfluss des japanischen, hauptsächlich vom Zen geprägten Buddhismus auf die tibetisch-lamaistische Glaubensrichtung der Mongolen zu intensivieren. Der militärische Geheimdienst Russlands hatte überdies herausgefunden, dass unmittelbar nach dem Russisch-Japanischen Krieg japanische Agenten in der Äußeren Mongolei besonders intensiv die Routen nach Transbaikalien erkundeten. So kamen schließlich die beiden Kontrahenten in einem 1907 geschlossenen Geheimvertrag überein, ihre jeweiligen Einflusssphären in der Region abzustecken, um einem neuerlichen mi182 litärischen Konflikt zuvorzukommen. Weitere Geheimverträge sollten später folgen. Zusätzliche Besorgnis löste die wachsende Schar chinesischer Siedler in den fernöstlichen Grenzregionen aus, mit denen die Regierung in Peking versuchte, ihre gefährdete Vorherrschaft in den von Mandschuren und Mongolen bewohnten Randgebieten des Reichs der Mitte zu stabilisieren. Die Siedlungspolitik war Teil eines umfassenden Sinisierungs-, Militarisierungs- und Reformprogramms, durch das Pekings Behörden versuchten, ihren Zugriff auf die Innere und Äußere Mongolei zu festigen und ausländischen Einfluss zurückzudrängen. 1906 veranlasste der russische General183 stab daher eine geheime militärische Untersuchung der Ost-Mongolei, 184 um gegebenenfalls einen raschen Aufmarsch organisieren zu können. So gab es gerade in jener Zeit strategische wie auch wirtschaftliche Gründe für eine erhöhte Aufmerksamkeit der Russen angesichts der politischen Vorgänge in der Mongolei. Die Deutschen wiederum beäugten genau, welche Ambitionen ihre europäischen Rivalen auf dem chinesischen Festland und den angrenzenden Regionen verfolgten. Wirtschaftlich waren die mongolischen Gebiete noch immer von Chinas reichen Handelshäusern beherrscht. Ihre Bewohner, vom hohen Würden127
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
träger bis zum einfachen Viehzüchter und Mönch, waren bei den chinesischen Händlern oft tief verschuldet. Es war auch die Zeit, in der sich unter den mongolischen Fürsten leiser Widerstand gegen die bedrückende Abhängigkeit von den Behörden der Qing-Dynastie, gegen die korrupte Beamtenschaft und die hohen Steuern regte. Diese ersten Anzeichen eines gegen China gerichteten mongolischen Nationalismus versuchten Russland wie auch Japan für ihre jeweiligen Eigeninteressen zu nutzen – mit der Folge, dass China die Zügel noch straffer anzog. 1907 ließ das chinesische Amt 185 für die Außengebiete (Lifan Yuan) in Peking hunderte detaillierter Landund Katasterkarten der Weidegebiete der mongolischen Fürsten bzw. großer mongolischer Klöster anlegen, mit der offiziellen Begründung der Überprü186 fung der Distrikts-, Bundes- und Bannergrenzen. Doch wenig später wurden anhand dieser Karten – zunächst in der Inneren, später auch in der Äußeren Mongolei – als überflüssig angesehene Weidegebiete der Nomaden konfisziert und als Ackerland an chinesische Bauern gegeben. Wo Eisenbahnschienen verlegt und Bodenschätze abgebaut wurden, siedelte man zehntausende chinesischer Arbeiter an und verdrängte die mongolischen Vieh187 züchter allmählich auch dort von ihren angestammten Weideplätzen. So spitzte sich die innere und äußere Konfliktsituation gerade in der Zeit zu, als Hermann Consten zu seiner ersten Mongolei-Expedition aufbrach. Es ist leicht sich vorzustellen, dass Consten mit all seinem aufgestauten Bewegungsdrang dennoch erst einmal auf die Jagd gegangen ist, um sich den Staub seines Moskauer Studienjahres aus den Kleidern zu schütteln und die erfrischende Luft der Tannenwälder des südlichen Ural zu atmen. Auch geschäftliche Gründe mag es gegeben haben, die Region aufzusu188 chen. Schließlich war sie mit Bodenschätzen, Edel- und Halbedelsteinen gesegnet und gehörte damals zu den aufblühenden Wirtschaftsgebieten des großen russischen Reiches. Hermann Consten scheint es jedenfalls nicht übermäßig eilig gehabt zu haben, den Mongolei-Auftrag seines Moskauer Professors umgehend zu erledigen. Dort traf er erst Monate nach seiner Abreise aus Moskau ein, als in den hochgelegenen Steppengebieten längst die Frostperiode eingesetzt hatte, vermutlich also im Spätherbst oder Frühwinter 1907. Er dürfte sich die Zeit genommen haben, seine Reise im Ural und in Sibirien gelegentlich zu unterbrechen, um die Orte entlang der Transsibirischen Bahn näher in Augenschein zu nehmen, persönliche Kon128
2. Mongolei zum Ersten: „Köpfe sammeln“ für Russland
takte zu knüpfen und auf der Pirsch nach Bären und Wölfen, vielleicht auch nur nach Hasen und Schnepfen, mit dem Jagdgewehr im Gebirge, in Steppe und Tundra umherzustreifen. Consten hat eine solche Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn, die er fünf Jahre später, im Jahr 1912 unternahm, im ersten Band seiner „Weideplätze der Mongolen“ ausführlich beschrieben. Seine Eindrücke vermitteln ein lebendiges Bild Sibiriens und des Bahnreisens in Russland vor hundert Jahren. Steigen wir also unterwegs zu und fahren ein Stück mit Consten. Nachdem der Zug am dritten Abend die Stadt Ufa hinter sich gelassen und die Grenzmarke zwischen Europa und Asien, „einen kleinen weißen pyra189 midenartigen Stein, geschmückt mit dem russischen Doppeladler“ passiert hat, beginnt also das sagenhafte Sibirien. Am Morgen des vierten Reisetages erreicht die Bahn Tscheljabinsk, Constens erste Etappe auf dem Weg in die Mongolei. Er steigt aus, deponiert sein schweres Gepäck am Bahnhof und macht sich auf den Weg in die Stadt, die ihn allerdings etwas enttäuscht. Die Stadt selbst, die ziemlich weit vom Bahnhof entfernt liegt, ist mit ihren breiten ungepflasterten Straßen das Bild einer typischen russischen Provinzstadt. Holzhäuser, mit einem aus Bohlen hergestellten Bürgersteig, damit man nicht bei Regenwetter im Schmutz versinkt, hier und da der protzenhafte Steinbau einer Moskauer Firma, einige große im russischen Stil ausgeführte Kirchen mit zwiebelförmigen blau, grün und goldenen Kuppeln, geschmückt mit vergoldeten Kettenkreuzen, einige Tingeltangel mit französischen und deutschen Chansonetten sechster Güte, 190 das ist Tscheljabinsk!
Aber er wollte ja auch eine Gelegenheit zur Jagd wahrnehmen und kann immerhin einen herrlichen Tag im Gebirge verbringen, der ihn für die sechstklassigen Chansonetten entschädigt. Zur nächsten Abfahrt der Transsib wenige Tage später findet er sich wieder am Bahnhof ein. Das Publikum, so kann man aus seinen Beobachtungen am Bahnsteig von Tscheljabinsk entnehmen, ist auch jenseits des Ural ein internationales Gemisch: Kleine Japaner in europäischer Kleidung, made in Berlin, Friedrichstraße, lang aufgeschossene Engländer und Amerikaner, Schanghai-englisch 191 zugestutzte Deutsche. 129
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Was immer er damit meinte, das war wohl nicht als Kompliment vonseiten des afro-russisch zugestutzten Deutschen namens German Germanovič Konsten’ gedacht, der sich – kaum größer gewachsen als die kleinen Japaner – mit seinem Südwester aus Deutsch-Ostafrika gegen die kräftige Morgensonne des Südural schützte. An einem Kiosk, der Brot, Wurst und Früchte feilbietet, erwirbt er noch Verpflegung für unterwegs und einige der typischen Ural-Souvenirs. Am besten gefällt ihm eine Zigarettenspitze aus Mammutknochen. Er lässt sich mit einigen falschen Edelsteinen übers Ohr hauen, das merkt er aber erst später im Zug. Er vergewissert sich, dass sein Gepäck im richtigen Abteil verstaut ist und steigt beim Klang der Abfahrtsglocke wieder ein. Ruhig, kaum merklich, gleiten wir an dem weißen Bahnhofsgebäude, dem großen prächtigen Gendarm in grüner Bluse mit silbernen Fangschnüren, Mauserpistole und großem Säbel, dem Laden für Wurst, Brot und uralischen Tand vorbei. Die Schaffner in hellgelben langen Leinenkitteln – einer trägt sogar chinesische Rohseide – in hohen Stiefeln und Pumphosen, springen auf den schon fahrenden Zug. Am letzten Wagen streckt einer von ihnen krampfhaft eine kleine grüne Fahne heraus. Weiter und weiter, durch Tundern und Steppen trägt uns unser Dampfross 192 immer tiefer in das herrliche Sibirien, ein zukünftiges Kanada, hinein.
Anders als sein Landsmann Alfons Paquet, der in jenen Jahren als Russland-Korrespondent für die Frankfurter Zeitung arbeitete und dem die Transsib durch mehrere große Reisen vertraut war, empfindet Consten Sibirien ganz und gar nicht als „geographisches Nirwana“ und „Stillen Ozean 193 des asiatischen Zarenreiches“, sondern als aufregendes Pionierland, als das künftige Fundament russischer Wirtschaftskraft, die gerade in den Jahren unmittelbar nach dem Ende des Russisch-Japanischen Krieges einen 194 ungeahnten Aufschwung nahm. Mittlerweile passiert der Zug die Gorkaja, die „bittere Steppe“, ein Sumpfgebiet, dessen Wasser wegen seines hohen Schwefelgehalts als ungenießbar gilt. „Ich liebe diese Sumpf- und Moorlandschaften“, schreibt Consten. Doch: Wehe dem Unkundigen, der um Becassinen zu schießen, da hineingerät. Mit eisernen Klammern hält ihn der elastische Sumpf und Moorboden
130
2. Mongolei zum Ersten: „Köpfe sammeln“ für Russland
fest, bis sein letzter Schrei von gurgelndem, schwarzen, salzigen Wasser 195 erstickt wird.
Die Gorkaja trägt ihren Namen aber auch noch aus einem anderen Grund zu Recht. Consten erwähnt ihn, als der Zug bald darauf in der Handelsstadt Kurgan hält. Der Ort war früher berüchtigt als „Verteilungsort politischer und gemeiner Verbrecher, die zur Zwangsansiedlung oder Zwangsarbeit verurteilt werden“. Das ist Sibiriens finstere Seite. Ohne hunderttausende Zwangsarbeiter, die zwischen 1894 und 1904, also innerhalb eines einzigen Jahrzehnts, unter härtesten Bedingungen und in schwierigstem Gelände vom Ural bis an die Küste des Pazifik Gleise verlegen, Tunnel, Viadukte und Flussbrücken bauen mussten, würde auch die Transsibirische Eisenbahn nicht fahren. Sie hält derweil in Omsk, am Fluss Irtysch gelegen, ein Handelszentrum mit großem innersibirischen Einzugsgebiet. Deutsche und Dänen machen hier mit Molkereien und Maschinen gute Geschäfte. Und nach einem weiteren Reisetag läuft der Zug schließlich über die mit sieben mächtigen Bögen den Ob überspannende Eisenbahnbrücke in Novo-Nikolaevsk ein; heute heißt die Stadt Novosibirsk und ist mit rund 1,4 Millionen Einwohnern Sibiriens größte Stadt. „Wie hat sich dieses Novo verändert, seit ich es zum ersten Male sah!“ schreibt Consten in seiner Rückschau. Wie muss es also um 1907 dort ausgesehen haben, sechs Jahre nach der Gründung des Ortes? Erst eine kleine Station, Ob genannt, in der Nachbarschaft ein kleines Fischerdorf. Nach einigen Jahren waren die Bauern und Fischer nach der 196 Stanzi Ob übergesiedelt, die sich schnell zu einer Stadt auswuchs, und 197 nun Novo-Nikolaevsk genannt wurde. Durch seine vorzügliche Lage an der Eisenbahn und dem Ob wurde es alsbald ein neues Handelszentrum Sibiriens und macht der alten Kapitale Tomsk schwere Konkurrenz. Herrliche Zeiten brachen für Novo während des russisch-japanischen Krieges an, das Geld hatte anscheinend keinen Wert mehr. Im BahnhofRestaurant, wo sich die Honoratioren, meistens Beamte, Offiziere und Groß-Kaufleute trafen, wurde gejeut nach allen Regeln der Kunst. Teegläser voll mit Gold wurden ungezählt auf eine Karte gesetzt. Der Aufschwung der neuen Stadt kannte scheinbar keine Grenze, innerhalb zehn Jahren hatte sie vierzigtausend und schließlich fünfundsechzigtausend 131
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Einwohner. Aus allen Teilen Sibiriens und Russlands strömten die Menschen herbei. Rings in den hellen Birkenwäldern wuchsen regellos die Blockhäuser mit ihren von hohen Holzzäunen umgebenen großen Höfen empor. Erst allmählich wurde nach einem einheitlichen Plan gebaut. Die Kriminalität als Nachwehen der Revolution [von 1905; D.G.] und dem Zusammenfluss der verschiedensten Elemente nahm erschreckend zu, durchschnittlich täglich ein Raubmord, bis endlich eine neuer Polizeimeister mit eiserner Faust auf Grund des verstärkten Schutzes Ordnung schaffte. Dann brannten etwa 700 dieser Häuser und Gehöfte nieder und wurden wieder in kurzer Zeit nach einem einheitlichen Plan aufgebaut. Die Höfe sind sauberer, die Häuser solider, die Straßen aber in demsel198 ben scheußlichen Zustand geblieben, wie seit der Gründung.“
An dieser Stelle sollten wir Hermann Consten erst einmal Lebewohl sagen und allein weiter reisen lassen. Sollte er in Novo-Nikolaevsk die Transsib auf seiner Reise 1907 verlassen haben, um per Schiff auf dem breiten Strom Ob bis Biisk und von dort zu Pferd nach Koš-Agač weiterzureisen, wie er dies auf seinen späteren Reisen getan hat? Wohl kaum. Wahrscheinlicher ist, dass er 1907 noch gut 2.000 Kilometer mit der Bahn weiterfuhr, über Irkutsk, am Südufer des Baikalsees entlang bis nach Werchne-Udinsk in 199 Transbaikalien. Denn dieses mehrheitlich von buddhistischen Burjaten bewohnte Provinzstädtchen war der beste Ort, sich für den mongolischen Winter einzukleiden. Seit dem 18. Jahrhundert bereits war die einstige Kosakenfestung am Zusammenfluss von Uda und Selenge – heute heißt die Stadt Ulan-Ude – Messe- und Umschlagplatz für Pelze aller Art. Über Werchne-Udinsk gelangten Tee, Brokatstoffe und Seide aus China wie auch Schlachtvieh und Pferde aus den Steppengebieten der Mongolei auf den sibirischen Markt, die begehrten Luxusgüter sogar bis ins europäische Russland und weiter nach Paris und London. Es waren vor allem die ethnisch mit den Mongolen verwandten Burjaten, die den Viehhandel beherrschten. Durch den Zuzug russischer Händler, Siedler und Industriearbeiter waren sie zwar gegen Ende des 19. Jahrhunderts im eigenen Gebiet in die Minderheit geraten, aber ihr Zusammenleben mit den Russen gestaltete sich trotz religiöser und kultureller Verschiedenheit weitgehend friedlich. Zu Constens Zeit gab es von Russland aus eigentlich nur zwei Routen 132
2. Mongolei zum Ersten: „Köpfe sammeln“ für Russland
in Richtung Mongolei. Die eine führte über Bijsk durch den erst 1902 als Fahrstraße eröffneten Čuijskij-Trakt in den Altaj hinauf bis zur westmongolischen Grenze; die andere Route verlief von Werchne-Udinsk in südlicher Richtung über die Grenzstadt Kjachta durch die nördliche Mongolei. Letztere, die alte Karawanenstraße nach China, stellte die direkte und kürzeste Verbindung nach Urga oder – wie die Mongolen ihre Hauptstadt da200 mals nannten – nach Ich Chüree (Großkloster) dar. Von Werchne-Udinsk nach Kjachta verkehrten im Sommer gelegentlich kleine Flussschiffe auf der Selenge, zum Herbst und Winter hin, wenn der Fluss zufror, blieb jedoch nur die Möglichkeit, per tarantás, mit den unbequemen, von berittenen ulačiny gezogenen Reisekarren mit Halbverdeck zu reisen – oder sich eben selbst aufs Pferd zu schwingen. Kjachta, Grenzfestung seit dem Vertrag von Nerčinsk (1689), war seit 1727 ein offener Handelsplatz für Waren aus China, eine von Palisadenzäunen umgebene kleine Kaufmannsrepublik mit eigener Verwaltung, eigener Steuer- und Abgabenordnung und einem Ältestenrat der Kaufmannschaft, der die Geschicke des Ortes lenkte. Breite Straßen, prächtige Häuser aus Stein und Holz, mächtige Wirtschaftsgebäude mit Karawanenhöfen und Gärten prägten das Stadtbild. Während die Russen den Großhandel beherrschten, lag der Kleinhandel in mongolisch-chinesischer Hand. Kjachtas auf chinesischer Seite liegende Schwesterstadt, die durch eine 50 Meter 201 breite neutrale Zone getrennte Maimaicheng, die „Handelsstadt“, war der Hauptstapel- und Umschlagplatz für den berühmten Karawanentee, der in gepresster Ziegelform unbegrenzt haltbar und leicht zu transportieren war. Alljährlich im Dezember fand eine große Messe in Kjachta statt, auf der Tee, Seide und Baumwollstoffe aus China gegen russische Tuche, Pelz- und Lederwaren getauscht wurden. Und nicht zu vergessen: Kjachta war immer auch ein Umschlagplatz für Waffen. Nach der Fertigstellung des Ostabschnitts der Transsibirischen Bahn 1898 und bedingt durch den schnelleren und kostengünstigeren Seetransport via Suez-Kanal, aber auch wegen der politischen Turbulenzen in China während des Boxeraufstands, waren die Einfuhren über den Karawanenweg zu Beginn des 20. Jahrhunderts merklich zurückgegangen. Dafür hatte Kjachta Bedeutung als Post- und Telegrafenstation für die Draht-Verbindung nach Peking über Urga und Kalgan 202 gewonnen. 133
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
320 Werst, etwa 340 Kilometer lang, ist der Weg von Kjachta nach Ich Chüree/Urga. Auch mit guten und schnellen Pferden bedeutet dies viele Tagereisen in schwierigem Gelände, viele Pferdewechsel an den örtöö (Urto), den Relais- und Poststationen auf mongolischer Seite. Consten kommt auch deshalb nicht schnell voran, weil er dort manchmal auf frische Pferde, oft auch auf die gemächlicher nachreisende Karren-Karawane mit seinem Expeditionsgepäck warten muss, die er in Kjachta gemietet hat. Dies wiederum lässt ihm genügend Zeit, seine Karten zu studieren, seine Messungen und geologischen Untersuchungen vorzunehmen, Aufzeichnungen zu machen, zu fotografieren und vor allem – im Gebirge zu jagen. Erst führt der Weg über bewaldete Höhen, „ohne schroffen Felsen u. Klippen, flache, grasbewachsene Hänge“. Sie erinnern Consten an den Thüringer Wald. Er durchquert reißende Bäche und, als die Landschaft sanfter und ebener wird, registriert er breite Flusstäler und hochgelegene Grassteppen, die nach Wermut, Lauch und Wildbohnen duften. Dahinziehende Herden, ab und an auch mal einzelne Rundzelte aus weißem Filz – von den Mongolen ger, von Russen wie Deutschen Jurten genannt – bringen ihm zu Bewusstsein, dass er sich in einem anderen Kulturkreis bewegt. Am dritten Reisetag erreicht er den Fluss Eröö (Iro), an dessen Ufer ein im Sand steckengebliebenes, halb zugewehtes Lokomobil auf die in der Nähe gelegenen Goldminen der Gesellschaft Mongolor verweist. Sie soll einem baltischen Baron mit russischem Pass gehören. Consten ahnt an jenem kalten Spätherbsttag des Jahres 1907 wohl noch nicht, dass ihn „l’or mongole“, und ganz besonders die Minen von Mongolor wenige Jahre später brennend interessieren werden. Jetzt reitet er erst einmal anderen Zielen entgegen. Vorsorglich hält er in der Steppe schon mal nach Schädeln Ausschau, die er Professor Anučin nach Moskau schicken könnte. Doch sieht er nur Schädel verendeter Tiere. In Richtung Westen und Osten nimmt er „größere Höhen a.d. nördlichen Ufer des Iro“ wahr, Berge, über 2.000 Meter hoch. Jenseits des Iro-Tals wird der Weg enger und steiler. Dabei herrscht auf der unbefestigten Fahrstraße reger Verkehr. Hoch beladene Ochsenwagen und Kamelkarawanen schwanken dem allein reisenden Deutschen mit dem in diesen Breiten fremdartig wirkenden Kolonialtruppenhut entgegen. „Die Strecke gehört zu der zentralasiatischen Übergangszone, das ganze bietet das Bild einer typi134
2. Mongolei zum Ersten: „Köpfe sammeln“ für Russland
schen Gebirgssteppe. In den Flusstäler[n] hier u. da Pappel- u. Weidenbe203 stände, dichter Graswuchs“, notiert er, Sandsteppen und Waldgebiete im endlos scheinenden Wechsel. Consten, der sich längst an die zähen kleinen Mongolenpferde gewöhnt hat, die an den örtöö für Reisende bereitgehalten 204 werden, überwindet hohe, von ovoo (obo) – Steinsetzungen für die Ortsgeister – gekrönte Pässe, steigt in die Täler hinab, registriert am Narst Davaa (Fichtenpass) Raubbau an den Fichtenwäldern durch breitflächige Abholzungen, bemerkt weiter in Richtung Urga Ackerflächen und kleine Häuser. Dort wohnen chinesische Kolonisten, erzählt man ihm im nächsten örtöö; Mongolen hätten mit Ackerbau nichts im Sinn. Auch die Arbeiter in den Goldminen sollen Chinesen sein. Alle Arbeiten, bei denen der Boden aufgerissen, verletzt wird, halten Mongolen mit ihren religiösen Vorstellungen für nicht vereinbar. Schamanenglaube, denken andere verächtlich, die längst einen begehrlichen Blick auf die unter dem Steppenboden und im Felsgestein verborgenen Reichtümer des Landes geworfen haben. Schließlich gelangt Consten zum örtöö Chunzal, wo er ein letztes Mal sein Pferd wechselt. Von da geht der Weg über langgestreckte Pässe hinab in das Tal der Tuul bis nach Urga. Kurz vor dieser größten Ansiedlung im weiten Land der Mongolen stößt er, von Norden kommend, auf die breite Ost-West-Achse, die ihn in östlicher Richtung in die Stadt führt. Nun liegt am jenseitigen Ufer der Tuul zur Rechten der an seiner Nordseite dicht bewaldete Bogd Uul, der bekannteste der Urga einschließenden vier heiligen Berge, der schon seit dem 18. Jahrhundert unter Naturschutz steht. Dort darf weder gejagt noch Holz 205 geschlagen werden. Eine alte chinesische Festung markiert die Stadtgrenze. Ein mongolischer Wachtposten fragt nach dem Woher und Wohin. Längs des Tuul-Flusses und auf einigen der umliegenden Hänge tauchen Hütten und größere Ansammlungen von Jurten auf. Neugierige in dick wattierten Mantelkleidern, deel genannt, drängen sich am Wegrand, den Fremden im Winterpelz und seine Karrenkarawane zu beäugen. Der scheucht Kinder, streunende Hunde aus dem Weg, registriert Unrat, Gestank, Pfützen, weite leere Plätze – das sind Hermann Constens erste Eindrücke, als er in die Hauptstadt der Mongolen einreitet. Sie wirkt nicht gerade einladend, scheint aber viel größer, weitläufiger zu sein als die sibirischen Städte, die er auf dem Wege hierher kennengelernt hat. Zur Linken 135
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Abb. 8: Consten zu Pferd in der mongolischen Steppe, um 1907
erblickt er nun auf einem Hügel über der Stadt eine große Klosteranlage. Das muss das Gandan-Kloster sein. Ganz in der Nähe dieses Klosters soll sich das Totenfeld befinden, von dem sich sein Moskauer Professor eine reiche Schädelausbeute verspricht. Ein weiter Platz öffnet sich, und dann liegt sie vor ihm in der frostigen Spätnachmittagssonne: Ich Chüree, die gewaltige Klosterstadt, größtes Heiligtum der Mongolen, verborgen hinter hohen braunroten Palisadenwänden. Nur einige geschwungene Dächer seiner Tempel und Paläste, ein Gerüst, von dem Mönche mit Muschelhörnern zu den Andachten rufen und ein vergoldeter Tschörten kragen darüber hinaus. Den Eingangsbereich zu diesem heiligen Bezirk markiert ein gewaltiges hölzernes Tor im chinesischen Stil. Tief im Hintergrund, hinter weiteren Tempelbauten und Palisadenwänden, wölbt sich auf einem zweistöckigen Holzbau tibetischen Stils das kupferne Dach des erhabenen Majdar-Tempels. Es sieht aus wie eine mit Grünspan überzogene, mit weißroten Zierdecken geschmückte Palastjurte – sesshaft gewordene Erinnerung daran, dass weit bis ins 18. Jahrhundert hinein die buddhistischen Klöster der Mongolei Wanderklöster waren. Mit ihren Weidegebieten, ihren Herden und ihren großen Mönchsgemeinden nomadisierten die Jebtsundampa Chutagts, die höchsten geistlichen 136
2. Mongolei zum Ersten: „Köpfe sammeln“ für Russland
Verkörperungen des Buddha Maitreya (Majdar) bei den Mongolen, genauso wie die Fürsten der einzelnen Stämme und Clans, bis hinunter zu den einfachen Hirtenfamilien. Die Stelle, wo sich bei den Jurten normalerweise die Rauchöffnung befindet, ist hier bekrönt von einem vergoldeten Tschörten, 206 der in der schräg stehenden Sonne blitzt. Müde und verschmutzt von der langen Reise, macht sich Hermann Consten erst einmal auf die Suche nach einer Unterkunft. Er findet sie in der Russenstadt, einer Ansiedlung aus niedrigen sibirischen Holzhäusern außerhalb des eigentlichen Tempelbezirks. Ein Russe betreibt dort eines der wenigen Hotels von Urga. Eine Luxus-Unterkunft ist dies gewiss nicht. Die folgenden Tage sind ausgefüllt mit Streifzügen durch die Stadt, mit Tempelbesuchen, Kontaktnahmen, Gesprächen. Neben der Mongolenstadt, dem 1778 gegründeten Herzstück Urgas rund um das Hauptkloster, in der um 1907 schätzungsweise 30.000 Menschen leben, davon allein etwa 20.000 Lamas, gibt es die Russensiedlung. Sie beherbergt etwa 3.000 Menschen. Durch den weitläufigen Marktplatz davon getrennt liegt die Chinesenstadt mit nochmals einigen zehntausend Bewohnern. Viele der dort lebenden Chinesen sind Verwaltungsbeamte des Amban, des von der Qing-Regierung in Peking entsandten Großwürdenträgers und Administrators. Gestärkt werden die Interessen des chinesischen Kaiserhauses in Urga durch die Präsenz einer großen Garnison. Auch viele chinesische Kaufleute haben sich in Kulong, so der chinesische Name der Stadt, niedergelassen. Da ihnen nicht erlaubt war, ihre Familien in die Mongolei nachkommen zu lassen, besteht der mongolische Bevölkerungsanteil in der Chinesenstadt im wesentlichen aus Frauen und den von ihnen geborenen Kindern. Nach Osten zu schließt sich, umgeben von einem Ring mongolischer Jurtensiedlungen, der Handelsplatz für den Güterumschlag der Karawanen an. Wie der bei Kjachta heißt er nüchtern Maimaichen. In seinen engen Geschäftsstraßen, auf Märkten und in den Karawansereien bietet Maimaichen jedoch das reichste und vielfältigste Warenangebot der ganzen Mongolei. Dieses weitflächig auseinander gezogene Gemeinwesen mit seinen vielen Namen und seinen ethnisch wie kulturell grundverschiedenen Bewohnern lässt sich, zumal die ungepflasterten Wege voller Stolperfallen und Unrat sind, schlecht zu Fuß oder in einem Fuhrwerk erkunden. Am besten geht es immer zu Pferd. Der umtriebige Hermann Consten hat auf seinen 137
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Ritten durch die Stadt schnell spitz bekommen, dass er – politisch gesehen – in einer ausgesprochen spannenden Zeit nach Urga gekommen ist. Doch erst will er sich seiner Anthropologen-Pflicht entledigen. An einem eisigen 207 Morgen macht er sich durch den „verrufensten Teil der Stadt“, ein dicht bevölkertes Armenviertel aus Jurten und Hütten, auf den Weg hinauf zum Gandan-Kloster, der weitläufigen Tempelanlage auf einem Hügel am westlichen Stadtrand. Für die Mongolen ist das Gandan-Kloster, nach den berühmten KlosterUniversitäten Tibets, das bedeutendste religiöse Zentrum für die Erforschung und das Studium der lamaistischen Wissenschaften: der heiligen Bücher, die die Lehren Buddhas und ihre Auslegung durch gelehrte Mönche enthalten, ferner der klassischen buddhistischen Werke der Astronomie, Astrologie und der tibetischen Medizin. Errichtet in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, beherbergt das Kloster-Areal zu Constens Zeit etwa 80 Tempel und Klosterbauten, darunter – neben dem hölzernen Haupttempel Gandantegchenling – den bereits 1840 in Ziegelbauweise errichteten Vajradhara-Tempel, dessen Altar eine vergoldete Skulptur der Tara aus dem späten 17. Jahrhundert ziert. Angeblich stammt sie von Zanabazar, dem ersten Jebtsundampa Chutagt und größten Meister mongolischer religiöser Kunst, dessen Selbstporträt im Haupttempel verehrt wird. Der dem Vajradhara-Tempel gegenüber liegende zweistöckige Dedanpovran war 1904/05 Zufluchtsort und Bleibe des XIII. Dalai Lama. Das Nachbargebäude, einst Aufbewahrungsort der Reliquien verstorbener Bogd Lamas, birgt heute die kostbare Klosterbibliothek mit etwa 50.000 in seidene Tücher eingeschlagenen Bänden, meist Loseblattsammlungen von Blockdrucken in Tibetisch, der lingua franca der lamaistischen Welt, gehalten von reich verzierten Holzdeckeln. Auch zahlreiche alte Handschriften werden in diesem 208 Tempelgebäude verwahrt. Nach der obligaten Umrundung des Haupttempels, dem Drehen der Gebetsmühlen, die wie ein metallener Gürtel um das ehrwürdige Gebäude gelegt sind, und einem Blick in das dämmrige Innere, wo Mönche mit tiefen Stimmen ihre Sutrentexte rezitieren, entflieht Consten dem seinem unmusikalischen Ohr misstönend klingenden Gesang, dem stickigen Duft der Weihrauchstäbchen und Butterlampen. Hinter einigen Tschörten, die als Banngrenze den heiligen Bezirk des Gandan-Klosters vom profanen Raum tren138
2. Mongolei zum Ersten: „Köpfe sammeln“ für Russland
nen, entdeckt er auf einer leeren Schneefläche schließlich, was er sucht: Eine Gruppe von Menschen bewegt sich langsamen Schrittes hinter einem Ochsenkarren her, auf dem ein in weißen Stoff eingehülltes Bündel liegt. Ein Rudel großer schwarzer Hunde folgt der Trauergemeinde in gebührendem Abstand. Aus der Ferne schaut Consten zu, wie das Bündel von dem zweirädrigen Karren gehoben und an einer bestimmten Stelle des Schneefelds abgelegt wird. Ein paar Steine werden als Markierung rund um den Kopf des Verstorbenen drapiert. Mit einem Opferfeuer werden einige Stücke Hammelfleisch und getrockneter Quark für die Ortsgottheit dargebracht. Nach einer Weile verlässt die Gruppe mit dem Ochsenkarren den Platz und überlässt das Feld den Hunden, die sich wie auf Kommando auf den toten Körper stürzen. In kurzer Zeit sind von der Leiche nur noch einige Eingeweide- und Fleischreste und die Knochen übrig. Das weiße Tuch, das den nackten Körper bedeckt hatte, liegt blutig und zerfetzt im schmutzigen Schnee. Ein gutes Zeichen, wie Consten von Professor Anučin weiß. Die Seele konnte sich vom Körper lösen, dem Verstorbenen ist eine günsti209 ge Wiedergeburt wohl gewiss. Nachdem sich die Hunde sattgefressen verzogen haben, wagt er das Totenfeld zu betreten und näher in Augenschein zu nehmen. Er sieht Leichenteile in unterschiedlichsten Stadien ihrer Verwesung, gebleichte Knochen, Menschenschädel, einige mit Resten von Haut und Haaren. Dass dies ein tabuierter Ort ist, stört Consten wenig. Sein Forscherdrang ist erwacht. Er eilt in seine Unterkunft und kehrt mit einer seiner mit Blech ausgeschlagenen Holzkisten und seiner Kamera wieder. Er fotografiert die herumliegenden sterblichen Überreste und sammelt dann bei 30 Grad Kälte einige der Schädel ein. In den nächsten Tagen wiederholt er seine Gänge auf das Totenfeld zu Zeiten, da er sicher sein kann, dass ihm dort weder trauernde Hinterbliebene noch hungrige Hunde begegnen, die an seinem Tun wenig Gefallen finden könnten. Als er genügend Schädel beisammen hat, schickt er mehrere Kisten, in der Annahme, sie würden angesichts der winterlichen Jahreszeit noch in gut gekühltem Zustand in Moskau ankommen, mit der nächsten Richtung Kjachta ziehenden Handelskarawane als Frachtsendung an seinen Moskauer Lehrer, Professor Anučin.
139
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
3. Begegnung mit dem tibetischen Buddhismus Während am 30. August 1904 vor Ljaujang zwischen Russen und Japanern um die Entscheidung gerungen wurde, die den Atem der Welt stocken ließ, durchzog eine fliehende Karawane Central-Asien in der Richtung nach Urga. Wo diese Karawane auftauchte, verwandelte sich die Wüste Gobi, das ganze mongolische Grasland in ein Heerlager; dabei war es ganz gleichgültig, ob die Karawane durch haushohen, glühenden Sand stob oder der Boden der Kiesgobi mit scharfen Steinen die Hufe der Rennpferde und die Füße der schnellen Reitkamele zerschnitt. […] Festlich geschmückt, mit Opfergaben in Gold und Silber reichlich versehen, verließen die Nomaden ihre Herden, um die lebende Inkarnation des 210 Avalokiteçvara, den Dalai Lama anzubeten. 211
In einem Artikel für den Kulturpionier, einst dankbarer Abnehmer seiner frühen afrikanischen Schreibversuche, schildert Hermann Consten 20 Jahre nach der Flucht des XIII. Dalai Lama vor dem Einmarsch der Engländer in Tibet die Exiljahre seiner Heiligkeit bei den Mongolen. Er beschreibt darin die geheimen Kontakte zwischen Tibet und dem Zarenreich als der ersehnten Schutzmacht, vor dem Zugriff sowohl Englands wie auch Chinas, und das Scheitern dieser Hoffnung. Auf dem Wege in die Mongolei hatte der Dalai Lama von der russischen Niederlage erfahren; er reiste dennoch weiter nach Urga. Dort wollte er mit seinem ihm vorausgeeilten geistigen Mentor und vertrauten Berater in außenpolitischen Fragen, Agvan Doržiev, zusammentreffen. Dem burjatischen Mönch mit russischem Pass war dank seines mongolischen Aussehens vor Jahren der Eintritt in das Kloster Drepung bei Lhasa gelungen. Dort hatte er durch das Studium der buddhistischen Schriften einen hohen theologischen Rang erworben. Er war zum geistlichen Lehrer des jungen Dalai Lama berufen worden und hatte das Vertrauen des von den weltlichen Angelegenheiten sorgfältig abgeschirmten Gottkönigs gewonnen. Agvan Doržiev galt als die treibende Kraft hinter dem beharrlichen Werben des Dalai Lama um die Gunst des „Cagaan Chaan“, Zar Nikolaus II. Denn zugleich soll der Burjate, so jedenfalls urteilte Charles 212 Bell, ein „glühender Russe“ gewesen sein. Drei Monate nach seiner Flucht aus Lhasa traf der Dalai Lama Ende November 1904 schließlich in 140
3. Begegnung mit dem tibetischen Buddhismus
Urga ein, wo selbst die chinesischen Behörden, trotz seiner durch Peking ausgesprochenen Absetzung als weltliches Oberhaupt Tibets, dem höchsten geistlichen Würdenträger des tibetischen Buddhismus den Respekt nicht versagten. Mit einem Schlage war Urga mit seinen Klöstern und Tempeln der Sitz und das Haupt der lamaistischen Kirche geworden. Die Klosterstadt konnte die Gläubigen nicht mehr fassen, weit hinaus in die Steppe standen Jurte an Jurte, Zelt an Zelt. Man hörte sämtliche Sprachen des asiatischen Kontinents, waren doch sogar die Astrachan-Kalmücken auf die Nachricht, dass der Dalai Lama nach Urga zöge, herbeigeeilt. Zu Fuß, zu Ross, mit Kamelen und Yaks zogen die Völker herbei, und man schätzt die zur Pilgerfahrt in Urga eingetroffenen Lamaisten auf rund eine Mill213 ion.
Glaubt man Constens Schilderung, so muss der Empfang für den XIII. Dalai Lama bei seinem Einzug in Urga am 27. November 1904 geradezu überwältigend gewesen sein. Ich selbst hatte 1991 in Ulaanbaatar, wie die Hauptstadt der Mongolei heute heißt, Gelegenheit, den ersten offiziellen Besuch seines Nachfolgers nach dem Ende des Sozialismus in der Mongolei mitzuerleben. Wahrscheinlich verlief dieses Ereignis wohl kaum anders als im Jahre 1904 – mit dem Unterschied allenfalls, dass die höchste Inkarnation des Buddha Avalokiteśvara nicht in einem Gewand aus gelber Brokatseide und in einer auf den Schultern von acht Trägern gehaltenen goldenen Thronsänfte hoch über den gebeugten Nacken der Gläubigen vorüberschwebte. Auch sorgten nicht martialische Tempelwächter mit langen Lederpeitschen in dem Gedränge für Ordnung. Doch auch der Empfang des XIV. Dalai Lama durch die Mongolen bald 90 Jahre nach jenem ersten Großereignis war überwältigend. Kaum hatte sich die Kunde von der bevorstehenden Ankunft im Lande verbreitet – ich hatte davon vier Tage zuvor mitten in der mongolischen Steppe, im Kloster Erdene Zuu, erfahren und erlebte dort die Mönche bei ihrem Aufbruch –, da kamen die Menschen in ihren besten Kleidern von überall her. Da waren Alte und Junge, Kranke und Gesunde auch noch aus den fernsten Winkeln der Mongolei tagelang unterwegs gewesen, zu Fuß, zu Pferd, auf Lastwagen und Motorrädern. Sie wollten dabei sein, wenn Seine Heiligkeit sich zeigte auf einem ei141
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
gens errichteten Podest oberhalb der hohen Umfassungsmauer des GandanKlosters, sie wollten Almosen spenden und seinen Segen empfangen. Im Gandan-Kloster hatte auch sein Vorgänger, der „Große Dreizehnte“, wie der britische Kolonialbeamte und politische Beauftragte für die Königreiche des Himalaya, Sir Charles Bell, Thubten Gyatso, den XIII. Dalai Lama, in seinen Erinnerungen an seine persönlichen Begegnungen und Gespräche nannte, während des knappen Jahrs seines Aufenthaltes in Urga seinen Wohnsitz genommen. Dadurch blieb Seine Heiligkeit in klarer räumlicher Distanz zum VIII. Jebtsundampa Chutagt, dem geistlichen Oberhaupt der Chalch-Mongolen, der in der Hierarchie der „Gelben Kirche“ nach dem Dalai Lama und dem Panchen Lama an dritter Stelle stand. Dieser hatte seinen Palast beim Majdar-Tempel unten in der großen Klosterstadt. Er hielt sich aber auch gern jenseits der Tuul in seinem zweistöckigen, in europäischem Stil eingerichteten sogenannten „Winterpalast“, einem Geschenk des Zaren auf. Da es den alten Majdar-Tempel und die ihn umgebende riesige Kloster214 und Palastanlage im heutigen Ulaanbaatar nicht mehr gibt, versammelten sich 1991 Zehntausende am Tag nach der Ankunft des XIV. Dalai Lama im Naadam-Stadion, wo alljährlich im Juli die großen Wettkämpfe der Ringer und Bogenschützen zum mongolischen Nationalfeiertag stattfinden. Menschenmassen füllten schon seit dem frühen Morgen die Ränge, lagerten auf dem blanken Boden, um der Lehrrede Seiner Heiligkeit zu lauschen. Der Dalai Lama erläuterte der Menge – ganz einfachen Menschen, denen in 70 Jahren Sozialismus der buddhistische Glaube ausgetrieben und vorenthalten worden war – den Unterschied zwischen der grobstofflichen und der feinstofflichen Seele. Es war ein Ereignis, das sich, der spirituellen Komplexität der Materie angemessen, über viele Stunden hinzog, zumal da sein Tibetisch auch noch ins Mongolische übersetzt werden musste. Doch gerieten diese Stunden zum Momentum einer Wiederkehr des Buddhismus in der Mongolei, zum Brückenschlag über ein Jahrhundert mongolischer Geschichte, in der der Lamaismus – ob direkt oder indirekt, denn auch sei ne Unterdrücker mussten sich ja mit ihm auseinandersetzen – immer auch eine politische Rolle gespielt hat. Darüber hinaus verband sich die Parallelität der Schicksale der Dalai Lamas des 20. Jahrhunderts, die beide viele Jah-
142
3. Begegnung mit dem tibetischen Buddhismus
re fern von Lhasa im politischen Exil zubrachten, ein weiteres Mal mit dem nationalen Schicksal der Mongolen. Um auf Hermann Consten zurück zu kommen: in dem erwähnten Artikel über das Exil des XIII. Dalai Lama bei den Mongolen bekundete er Unverständnis darüber, dass Zar Nikolaus II. die Gelegenheit, seine schützende Hand über den geflohenen Gottkönig vom Dach der Welt zu halten und, anstelle Lhasas, Urga zur neuen Hochburg des tibetischen Buddhismus zu machen, womit er zugleich auch den politischen Einfluss Russlands in der Mongolei zementiert hätte, ungenutzt verstreichen ließ. Consten selbst bot sich bei seinem ersten Aufenthalt in der Mongolei, in den Wintermonaten 1907/1908, die unverhoffte Gelegenheit, Einzelheiten der Flucht des Dalai Lama und dessen – sich zu jener Zeit schon über drei Jahre hinziehender – Wanderung durch Steppen und Wüsten, mit wechselnden Aufenthalten in bedeutenden Lamaklöstern der Mongolei, Chinas und Nordost-Tibets, aus erster Hand zu erfahren. Eines Tages machte er nämlich, vermutlich im russischen Konsulat, die Bekanntschaft Agvan Doržievs, jenes geheimnisvollen Mannes, der es geschafft hatte, selbst Londoner Regierungskreise hochgradig nervös zu machen. Agvan Doržiev (1854–1938) war zweifellos eine der ungewöhnlichsten buddhistischen Persönlichkeiten seiner Zeit. Ein Mann von kräftiger Statur, dem man die nomadische Herkunft ansah. Ein brillanter, eigenwilliger Kopf, mit starker Ausstrahlung, bei dem sich Gelehrsamkeit und Spiritualität mit Weltläufigkeit und politischem Instinkt paarten. Dem sprachbegabten Burjaten, der seine Kindheit und Jugend in Khara-Shibir, nahe Werchne-Udinsk, verbracht hatte, der als 14-Jähriger in die Mönchsgemeinde des Gandan-Klosters in Urga aufgenommen worden war, eilte der Ruf voraus, ein kluger, aber gerissener Unterhändler und Organisator der außenpolitischen Angelegenheiten des Dalai Lama zu sein. Da er in seinem schlichten Mönchsgewand schon mehrmals vom Zaren empfangen worden war, da er im russischen Konsulat in Urga ein und aus ging, da seine Aktivitäten in Lhasa in konservativen Mönchs- und Adelskreisen Tibets Argwohn weckten, geriet Agvan Doržiev in den Verdacht, ein russischer Spion und Waffenschieber zu sein, ein gefährlicher Doppelagent im Mönchsgewand. Gewiss leistete er durch seine auffallend häufige Reisetätigkeit zwischen Asi215 en, Russland und Westeuropa der üblen Fama Vorschub. Doch scheint 143
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
der Eindruck derjenigen, die ihm persönlich begegnet sind, das abschätzige Urteil zu widerlegen. W.W. Rockhill, damaliger US-Gesandter in China und selbst Tibetologe, den Agvan Doržiev im Oktober 1908 am Rande des Besuchs des Dalai Lama in Peking aufsuchte, schilderte ihn in einer Depesche an Präsident Theodore Roosevelt als einen „ruhigen, wohlerzogenen Mann, eindrucksvoll wie alle Mongolen und offensichtlich, wenn auch ein bisschen weniger unvertraut mit der Politik und der Welt im allgemeinen als 216 die Tibeter“ – mit anderen Worten als einen sympathischen, politisch aber eher naiven Menschen. Der britische Offizier und Handelsagent in Gyantse, W.F.T. O’Connor, der etwa um dieselbe Zeit in Peking mit Agvan Doržiev zusammentraf, erinnerte sich an einen „fröhlich aussehenden, re217 degewandten Mönch – eindeutig ein Mann von Intellekt und Charakter“ – was uns Heutige wiederum an den XIV. Dalai Lama denken lässt, der hundert Jahre später von seinem indischen Exil aus die Sache Tibets gegenüber China wie auch der gesamten Weltöffentlichkeit immer noch unbeirrt, aber mit Humor und Herzenswärme vertritt. Sah Consten, als er ihm in Urga erstmals begegnete, in Agvan Doržiev zunächst auch nur den Doppelagenten, den „Erz-Intriganten“ und „Abenteurer“? Eher, so ist zu vermuten, imponierte ihm Agvan Doržiev – zum einen, weil er ihn für einen eingefleischten Briten-Feind hielt, wie er selbst einer war, zum anderen aber auch, weil ihm hier sanft aber bestimmt ein Buddhist entgegentrat, der kein „pazifistischer Schwächling“, sondern bei aller Gelehrsamkeit kämpferisch war. Wie auch immer, beide scheinen einander sympathisch gefunden zu haben, man sah sich fortan häufiger. 218 Durch seinen Kontakt mit dem russischen Konsul Viktor F. Ljuba, der die Ziele Agvan Doržievs unterstützt und seinerseits alles unternommen hat, die Politik der russischen Regierung in die gewünschte Richtung zu lenken, ist Consten über das Zögern des Zaren informiert. Er sieht die Chance ge kommen, seinen eigenen Monarchen, Kaiser Wilhelm II., als potentiellen Schutzpatron der Tibeter ins Spiel zu bringen. Der gerade 30 Jahre alt gewordene Hermann Consten fühlt sich berufen, „für Deutschlands Größe 219 und Ehre dort auf eigene Faust zu wirken“. Gegenüber Agvan Doržiev kann er sich immerhin seines direkten Drahts zum deutschen Generalkonsul in Moskau rühmen, gegenüber Ljuba jedoch, den er als deutschfeindlich 220 einschätzt, wird er seine Intentionen wohlweislich verbergen. 144
3. Begegnung mit dem tibetischen Buddhismus
Nun erfährt Consten aus erster Hand, wie sehr der Aufenthalt des Dalai Lama in Urga zu Spannungen mit dem VIII. Jebtsundampa Chutagt geführt hatte. Die tiefe Verehrung durch die Gläubigen, auch die immensen Kosten, welche die Anwesenheit zweier höchster Würdenträger samt ihrer Entourage am selben Ort verursacht hatten, waren nicht die einzigen Gründe dafür. Der Chutagt von Urga war seiner Herkunft nach zwar ebenfalls Tibe221 ter, in seiner persönlichen Lebensführung verstieß der dem Alkohol, den Frauen und dem Luxus verfallene „Erleuchtete“ jedoch gegen elementare Regeln mönchischen Lebens und erregte die Missbilligung des Dalai Lama. Den Chutagt wiederum plagten Neid und Eifersucht auf den geradezu heiligmäßig lebenden Exilanten. Er machte auch kaum ein Hehl daraus, dass er Seiner Heiligkeit die reichen Geschenke, die Spenden seiner frommen mongolischen Untertanen missgönnte, auf die er selbst Anspruch zu haben glaubte. In dieser Situation tat der Dalai Lama das wohl Klügste, nämlich weiter zu ziehen. Zwischen September 1905 und dem Sommer 1906 weilte 222 er mehrere hundert Kilometer weiter westlich, im Kloster Erdene Zuu. Derweil verständigten sich – nachdem Younghusband aus Lhasa wieder abgezogen war, ohne dass auch nur eine der dort vermuteten russischen Waffen gefunden wurde – China und Großbritannien in Peking über den künftigen Status Tibets. Umso mehr setzte der Dalai Lama, der durch Agvan Doržiev über die chinesisch-britischen Verhandlungen informiert war, seine Hoffnung auf Russland. Nur kurz kehrte er noch einmal nach Urga zurück. Empört über das Verhalten und den sittenlosen Lebenswandel des Chutagt, verließ er die Stadt und zog mit einer reich beladenen Kamel-Karawane durch die Zentralmongolei und die Gobi und traf schließlich zum Jahresende 1906 im Kloster Kumbum ein. Die gewaltige Klosterburg aus dem 16. Jahrhundert, in der Provinz Amdo (heute Qinghai) im Osten des Tibetischen Hochlands gelegen, ist das Stammkloster Tsongkapas, des großen Reformators und Gründers der Gelbmützen-Schule des tibetischen Buddhismus. Bis heute ist Kumbum ein Ort buddhistischer Gelehrsamkeit, Disputation und Kontemplation. Auch dorthin strömten die Gläubigen in Scharen, als sie von der Anwesenheit Seiner Heiligkeit erfuhren. Unter ihnen befanden sich sogar einige ausländische Besucher. So gelang es zum Beispiel dem deutschen Arzt und Tibetforscher Albert Tafel anlässlich einer 223 Audienz, einige Worte mit dem Dalai Lama zu wechseln. 145
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Nachdem er viele Monate in Kumbum verbracht hatte, brach der Dalai Lama im Frühjahr 1908 erneut auf und wandte sich wieder nach Norden. Auf dem in der Provinz Shanxi gelegenen Tempelberg Wutaishan, einem berühmten, schon seit der Tang-Zeit bestehenden Wallfahrtsort chinesischer wie mongolischer Buddhisten, mit hunderten Klöstern, kleinen Eremitagen und Pilgerherbergen, fand er vorerst eine Bleibe und einen Ort inneren Friedens. Die Hoffnung, Unterstützung in Russland zu finden, hatte sich mittlerweile zerschlagen. Im August 1907 hatte die Zarenregierung im britisch-russischen Abkommen über Persien, Afghanistan und Tibet gegenüber London verbindlich zugesagt, sich aus den innertibetischen Angele224 genheiten herauszuhalten. Letztlich war das Interesse beider Großmächte an Tibet eher marginal. Die Regierungen in St. Petersburg und London hatten dem Kaiser von China das Feld also endgültig überlassen. In Lhasa wurde ein chinesischer Statthalter eingesetzt. Chinas Kaiser hatte den Dalai Lama mehrfach aufgefordert, in Peking zu erscheinen, um sich ihm als Vasall zu unterwerfen. Aber Seine Heiligkeit zögerte noch. Agvan Doržiev nämlich gab so schnell nicht auf. Seine Bemühungen, Tibet dem direkten Zugriff Chinas zu entreißen, genossen die Sympathie der Chalch-Fürsten und des hohen mongolischen Klerus. Schließlich befanden sie sich in einer ähnlich schwierigen Lage und suchten nach Wegen aus der Abhängigkeit der mongolischen Gebiete von Peking. Agvan Doržiev schwebte schon seit längerem eine Lösung vor, die er auch den mongolischen Fürsten schmackhaft zu machen suchte: die Gründung einer autonomen pan-mongolischen, pan-buddhistischen Union – unter der Schirmherrschaft Russlands zwar, aber nicht als Teil russischen Territoriums. Er wünschte sich Tibeter, Mongolen, Burjaten und Kalmücken mit ihren gemeinsamen religiösen und kulturellen Wurzeln unter einem eigenen staatlichen Dach. Er erhoffte dadurch auch, mehr Freiraum für Burjaten und Kalmücken, mehr Rechte und Respekt für die buddhistischen Minderheiten im Zarenreich zu gewinnen. Dieses Ziel, dieser Traum, sein Reich Shambala, war der eigentliche Hintergrund, der Motor all seiner Aktivitäten, seiner Reisen und seiner vielen Gespräche mit Mönchen und 225 Monarchen – ein Traum, der erst durch den Stalinismus sein brutales Ende finden sollte. Zwischen 1907 und 1913 hält sich der „Reisediplomat“ Agvan Doržiev 146
3. Begegnung mit dem tibetischen Buddhismus
mehr als einmal für längere Zeit in Urga auf. Zwar wurde die mongolische Kloster-Metropole nicht neue Hauptstadt des tibetischen Buddhismus, wohl aber Dreh- und Angelpunkt seiner politischen Aktivitäten. Dies versucht Hermann Consten, wie gesagt, für sich zu nutzen. Aber wie? In Ermangelung der verschollenen Reisetagebücher aus jener Zeit hilft nur die Konstruktion einer Indizienkette, die mit aller gebotenen Vorsicht zu bewerten ist. Was nun geschieht, könnte sich folgendermaßen zugetragen haben: Consten beginnt, Agvan Doržiev die Kontaktnahme mit der Reichsregierung in Berlin schmackhaft zu machen – offensichtlich mit einigem Erfolg, zumindest für sich selbst. Denn er sieht sich ermuntert, die Idee dem Dalai Lama persönlich vorzutragen. Consten verlässt Urga im Frühjahr 1908 und begibt sich an der Seite Agvan Doržievs auf eine „Pilgerreise“ zu den heiligen Stätten des tibetischen Buddhismus in China. Während der langen Ritte, der kurzen Zwischenaufenthalte in örtöö und Klöstern entlang der südöstlichen Karawanenroute weiht ihn sein Reisegefährte, mit dem er sich fließend auf Russisch unterhalten kann, in die Anfangsgründe des Buddhismus, der tibetischen Sprache und Schrift ein. Er gewährt ihm Einblick in die Geschichte, die komplexe Hierarchie, die politische und wirtschaftliche Macht des Lamaismus in Tibet und der Mongolei, in die Lehren des Tantra und der geheimen Riten, in die Bedeutung des tibetischen Buddhismus für 226 Russland. Er bringt ihn in Kontakt mit Chuvilgaanen, Äbten und anderen hohen Lamas, er lässt ihn teilhaben an vertraulichen Unterredungen über die ungewisse Zukunft Tibets und der Mongolei. Auch von seinen Reisen nach St. Petersburg, wo er einen buddhistischen Tempel errichten will, erzählt er ihm, vom Empfang durch den Zaren, von seinen Besuchen in Kalkutta, Nagasaki, London und Paris, von der herrlichen Sammlung tibetischer Kunst im Musée Guimet, von seiner Begegnung mit „Aleksandra“, jener ungewöhnlichen Frau David-Néel, die sich mit Tibet bestens aus227 kennt. Consten wiederum rühmt die Stärke des Deutschen Kaiserreiches, seine industrielle und militärische Macht, seine modernen, schlagkräftigen Waffen, die Tatkraft seines Monarchen. Er gibt Agvan Doržiev den dringenden Rat, bei seiner nächsten Europareise unbedingt auch in Berlin vorzusprechen. Agvan Doržiev, so stellt sich heraus, kennt Berlin bereits, wenn auch nur das dortige Völkerkundemuseum. 147
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Er sieht sich in seiner roten Lamakleidung auf dem Bahnhof der großen Stadt der Deutschen. Von innerem Drang getrieben, war er von Petersburg, der Stadt Cagaan Khans, des „Weißen Zaren“, land- und stadtfremd, ohne die Sprache zu ahnen, ein Stummer, zu ihr hingefahren. Hastige, erstaunte Blicke streiften ihn, als er sich damals mit seinem Bündel in einer Ecke des Bahnhofes, der kommenden Dinge harrend niederhockte. Er wurde beobachtet und dann zu einem Mann mit einer roten Mütze geführt. Der versuchte mit ihm zu reden. Vergebens! Dann am Fernsprecher, den er von Petersburg kannte, Anruf und Antwort hin und her. Fremde Herren erschienen, musterten ihn scharf. Sie versuchten ebenfalls mit ihm zu sprechen. Der eine sprach sogar Russisch, von dem er damals kaum einige Brocken wusste. Das Wort „Lama“ wiederholten sie, auf ihn deutend, immer wieder. Er nickte. Wiederum rasselten die Klingeln am Fernsprecher. Nach einiger Zeit erschien ein hochgewachse228 ner Herr, der ihn in seiner Muttersprache, so wie man sie schreibt, nicht so wie das Volk sie spricht, anredete. Wie freute er sich da! Man gab ihm zu essen und zu trinken! Später führte man ihn in einen großen Palast, der mit allen möglichen Sachen sämtlicher Völker der Welt angefüllt war. In großen mächtigen Sälen fand er Asiens ihm wohlvertraute Kunst, Religion und gewöhnliche Gegenstände des Haushaltes aufgespeichert. Noch nie sah er im fernen Innerasien solch ungeheure Mengen von altertümlichen Kultgegenständen und Büchern. Zahlreiche Tempel und Klöster hätte man damit einrichten können. Bei dieser Gelegenheit war er, der Vielgereiste, plötzlich der Erklärer für die Männer, die ihn umstanden und seinen langsam und deutlich ausgesprochenen Worten horchten. Fast alle hatten sie in Gang, Gestalt und Gesicht etwas von dem Bruder Abt, wie Brüder einer großen Familie, Kämpfer der Wissenschaft! Soldaten und Gelehrte in einer Person! […] Ja, damals hatte er zum ersten Male gesehen, dass es außerhalb des Landes der Russen noch etwas Mächtigeres gab! Soldaten unter deren Gleichschritt die Erde zitterte. Stolz und siegesgewiss, zum Sterben bereit, wie jene, die auf der Walstatt bei Liegnitz die unübersehbaren Heerscharen 229 des Großkhan Ugudai, bis auf den letzten Mann fallend, aufhielten. Er sah Maschinen, die rastlos arbeiteten und nie stillstanden. Handel, der die Welt beherrschte, bis in die ferne Gobi hinein. Arbeiter, Kaufleute, 148
3. Begegnung mit dem tibetischen Buddhismus
Gelehrte, alle waren sie Soldaten des Friedens, Soldaten des Krieges. Überwältigend war der Eindruck, der ihn umklammerte und nicht mehr los ließ. Der Instinkt, das Unterbewusstsein seiner kriegerischen Vorfahren und seiner Rasse loderten in ihm hell auf, und er wurde, was er heute war, ein kämpfender Wanderlama, der für die Völker Asiens litt und 230 stritt.
Der rote Lama, Held seines 1928 erschienenen gleichnamigen Romans, trägt neben jenen weiterer buddhistischer Kampfgestalten, denen Consten während seiner Reisen durch die Mongolei in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg begegnet ist, unzweifelhaft auch die Züge Agvan Doržievs. Dass Consten als Autor zugleich jedoch sein eigenes Geschichtsverständnis, seine eigenen politischen Überzeugungen und sein deutschnationales Pathos auf Agvan Doržiev projizierte, steht auf einem anderen Blatt. Fahren wir also fort in der Verfolgung der Indizienkette: Als die Reisegruppe um Agvan Doržiev nach mehreren Wochen schließlich das über tausend Jahre alte, tief in den Bergen Shanxis gelegene Heiligtum, den Wutaishan, erreicht, fühlt sich Consten bereits als ein kleiner, geheimer Drahtzieher der Machtspiele der Großen, des Great Game in Zentralasien. Ein deutscher Arzt besuchte Seine Heiligkeit und präsentierte ihm ein illustriertes Buch mit den todbringenden Waffen deutscher Arsenale. Er wollte zeigen, dass auch eine andere mächtige Nation ihm gegen den britischen Feind beistehen würde. Der Dalai Lama nahm das Buch entgegen, denn ein Geschenk zurückzuweisen, wäre eine Unhöflichkeit. Doch er unternahm weiter nichts in dieser Angelegenheit. Er hatte den Eindruck, dass Deutschland zu weit entfernt sei, um ihn unterstützen zu 231 können.
Charles Bell, der diese Episode in seinen Erinnerungen an den XIII. Dalai Lama für berichtenswert hielt, möglicherweise sogar Seine Heiligkeit selbst, mögen nicht präzise im Gedächtnis behalten haben, wer von den beiden Deutschen, die er in jener Zeit zu Gesicht bekam, sein Anliegen so ungeschminkt vorgebracht hat – ob Albert Tafel in Kumbum, der tatsächlich von Beruf Arzt war, den aber nur quasi-touristische Neugierde trieb, oder ob es der Reisende und selbsternannte Unterhändler des Deutschen Reiches, Hermann Consten, gewesen ist, der in einem Lamakloster auf dem 149
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Wutaishan im Angesicht Seiner Heiligkeit das Hohelied deutscher Waffenschmieden anstimmte. Viel spricht für Letzteres. Denn auch in späteren Jahren entwickelte Consten, gerade wenn es um die Propagierung deutscher Waffen ging, eine auffallende Betriebsamkeit. Nach der Audienz beim Dalai Lama dürfte Hermann Consten allein weitergezogen sein. Während verbürgt ist, dass Agvan Doržiev auf dem di232 rekten Wege über Urga nach St. Petersburg zurückkehrte, dürfte sich Consten für die Rückreise mehr Zeit genommen haben. Zwei mögliche Routen kommen in Frage: Entweder reiste er nach Kumbum, um über Nagchukha und die Tsaidam-Senke in die Mongolei und von dort nach Russland zurück zu kehren, oder er wählte einen nördlichen Weg durch die Provinz Gansu, die Innere Mongolei und entlang der ostmongolisch-mandschurischen Grenze nach Sibirien. Erst im Herbst 1908 ist Consten wieder in Moskau. Dort erlebt er eine böse Überraschung. Prof. Anučin, den er gleich aufsucht, überschüttet ihn mit Vorwürfen. Die Kisten mit den eingesammelten Menschenköpfen waren erst bei größter Sommerhitze in Moskau eingetroffen. Wegen des beißenden Gestanks hatte sie der Zoll geöffnet und den grausigen Fund der Polizei übergeben. Prof. Anučin wurde verhört, das unbrauchbar gewordene Forschungsmaterial vernichtet. Anučin beruhigt sich erst, als sein Schüler ihm versichert, er werde bald wieder in die Mongolei reisen und dann seine Aufgabe besser erfüllen. Dem Kambo Lama Agvan Doržiev sollte Consten im Laufe der nächsten Jahre noch mehrmals begegnen. Zuletzt trafen sich die beiden 1913 in Moskau nach dessen Rückkehr von einer weite233 ren Europareise, die ihn unter anderem auch nach Berlin geführt hatte. Über Agvan Doržievs Schicksal nach der Oktoberrevolution war Consten allerdings nichts mehr bekannt. Er vermutete, der burjatische Mönch hätte die revolutionären Ereignisse in Russland nicht überlebt. Doch waren diesem noch weitere 20 Jahre Lebenszeit vergönnt. Agvan Doržiev starb 1938 an den Folgen langjähriger Lagerhaft.
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs Im Frühsommer 1909 zieht es Hermann Consten wieder hinaus. Diesmal wählt er die Route über Barnaul in den Altaj. In Novo-Nikolaevsk, wohin ihn die Transsibirische Eisenbahn wieder einmal getragen hat, wechselt er 150
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
aufs Schiff und reist den Ob flussaufwärts. In Barnaul, der letzten größeren Stadt Südsibiriens, verbringt er einige Tage, vervollständigt seine Ausrüstung. Nach weiteren Reisetagen auf dem Ob erreicht Consten den Ort Bijsk unweit des Zusammenflusses von Bija und Katun, den beiden Quellflüssen des Ob. Dort mietet er Pferde, Karren und Kutscher, denn ab Bijsk beginnt der weitaus mühseligere Aufstieg ins Gebirge. Der steinige Karrenweg führt den im Altaj entspringenden Katun entlang flussaufwärts bis zur Einmündung der Čuja, von dort geht es zunächst auf der 1902 verbreiterten Fahrstraße, dem Čuijskij-Trakt voran und schließlich auf schmalen Pfaden hinauf in die Kurai-Alpen direkt auf die westmongolische Grenze zu. In den rauhen Bergen des russisch-mongolischen Grenzgebiets will Consten Wildschafe, Argali jagen. Mit einem russischen Händler, der in dieser Gegend auf etwa 3000 Meter Höhe eine Jagdhütte besitzt, verbringt er einige angenehme Tage bei der Jagd auf das wegen seines mächtigen Gehörns begehrte Wild. Doch hat es sich Consten längst zur Gewohnheit gemacht, täglich morgens und abends Höhe, Temperatur und sonstige Wetterdaten zu messen und in seinem Reisejournal festzuhalten. Auch für dieses Gebiet, das Dreiländereck Russland-China-Mongolei, hat er den Auftrag, kartographische Vermessungen vorzunehmen – eine Aufgabe, der er, wie seine Reisetagebücher belegen, gewissenhaft nachkommt. Schwer bepackt mit seinen Jagdtrophäen kehrt Consten nach vielen Wochen zurück nach Moskau, vervollständigt seine Mongolei-Sammlung und wertet für Prof. Anučin seine topografischen und anthropologischen Notizen aus. Im darauffolgenden Jahr ist er erneut unterwegs, diesmal im tiefsten Winter. Mit drei hochbeladenen Troikas jagt er Anfang 1910, eingehüllt in einen weiten Pelzmantel aus Antilopenfellen, bei eisigem Schneesturm über den zugefrorenen Ob. „Diese Kälte, die die Erde klingen und die Bäume bersten lässt!“ notiert er in sein Tagebuch, nachdem er mit seinen Gefährten, dem gefürchteten vjuga, glücklich entronnen, in einer Blockhütte Zuflucht gefunden hat. Auch diesmal scheint Consten der Sinn ausschließlich nach Argali-Schafen und Dseren-Antilopen zu stehen, doch entgeht ihm nicht, dass sich die politische Atmosphäre verändert, das Verhältnis zwischen Mongolen und Chinesen sich merklich verschlechtert hat. Es gärt im Reich der Chalcha, wie ihm bald bestätigt wird. Vor allem unter dem hohen mongolischen Klerus und den Fürsten, die durch eine Reihe neuer chinesi151
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
scher Gesetze, durch Militär- und Verwaltungsreformen und das neue Siedlerprogramm ihre quasi-autonomen Privilegien gefährdet sehen, hat sich die antichinesische Stimmung breit gemacht. Da auch die Überschuldung der Mongolen bei den chinesischen Händlern mittlerweile katastrophale Formen angenommen hat, kursieren unter den Fürsten und hohen Lamas ernsthafte Erwägungen, sich – notfalls mit Waffengewalt – der chinesischen Suzeränität zu entledigen und einen eigenen nationalen Weg einzuschlagen. Helfen dabei soll Russland, mit Waffen und mit Geld. Diese Entwicklungen, die im Frühjahr 1910 in einem offenen Konflikt des VIII. Jebtsundampa Chutagt mit dem chinesischen Statthalter (Amban) in Ich Chüree und der Forderung der Fürsten nach Entlassung des Amban 234 gipfeln, sind Grund genug für Consten, seine Beobachtungen und Informationen über die politischen Vorgänge im Land mit dem gleichen Eifer zu notieren wie die täglichen Wetterdaten oder seine persönlichen Ausgaben für Karawanenleute und Kamelfutter. Längst hat er sich angewöhnt, „wiederholt Berichte über Zustände und Vorgänge in der Mongolei“ an das Deutsche Generalkonsulat in Moskau zu schicken. Konsul Kohlhaas lernt Consten mit der Zeit als einen Informanten schätzen, von dem er bei Bedarf „jederzeit zuverlässige Mitteilungen über mongolische Angelegenhei235 ten erhalten kann.“ Wichtig für Consten ist in diesem Zusammenhang seine Bekanntschaft mit dem führenden politischen Kopf des mongolischen Widerstands gegen 236 die Mandschu-Herrschaft, Gung Chajsan. Der innermongolische Fürst, ein Abkömmling der von Chubilaj Chaan begründeten Yüan-Dynastie, hatte Jahre zuvor eine Rebellion gegen chinesische Neusiedler in seinem ostmongolischen Heimatbanner angeführt und sich nach ihrem Scheitern ins russische Konsulat in Harbin geflüchtet, wo man ihm eine Beschäftigung als Dolmetscher gab. Seit 1909 lebt er in Ich Chüree und gehört seither zum engsten politischen Beraterkreis des Jebtsundampa Chutagt. Durch den Fürsten, der neben Mongolisch, Chinesisch und Mandschurisch auch fließend Russisch spricht, erhält Consten Informationen aus erster Hand, welche Pläne im hinter Palisadenwänden verborgenen „Gelben Palast“ und in geheimen Fürstenversammlungen geschmiedet werden. In Gung Chajsan hat Consten einen Gesprächspartner gefunden, der, obwohl ein glühender Vertreter der mongolischen Sache, in politischen Zusammenhängen zu den152
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
ken und die unterschiedlichen Interessen anderer Länder nüchtern und sachlich einzuschätzen vermag. Auch gegenüber Gung Chajsan – in seinem Buch nennt er ihn bei sei237 nem chinesischen Beinamen Ming Bao – bringt Consten die nach seiner Ansicht viel moderneren deutschen Waffen ins Gespräch, stellt bei einer gewünschten Kontaktaufnahme mit Rüstungsunternehmen wie Mauser und Krupp seine Vermittlerdienste in Aussicht. Doch zunächst einmal setzt Gung Chajsan seine Hoffnung auf Russland, und falls von dort keine Hilfe kommt, auf Japan. Wie dem XIII. Dalai Lama zwei Jahre zuvor, so erscheint auch dem mongolischen Fürsten Deutschland räumlich zu weit entfernt und aus der asiatischen Perspektive wohl auch zu klein und unbedeutend, als dass es den eigenen Zielen hilfreich sein könnte. Im zweiten Band seiner „Weideplätze“ berichtet Consten eine Episode aus dem Jahr 1912, die für diese Einschätzung von mongolischer Seite bezeichnend ist. Consten ist in Gung Chajsans Haus in Maimaicheng zu Gast und trifft dort auf dessen Freundeskreis. Er berichtet über seine Reise, seine Jagderlebnisse, und schließlich wendet sich das Gespräch der Kriegslage auf dem Balkan und ihrer Rückwirkung auf die mongolischen Verhältnisse zu – eine in dieser mongolischen Männerrunde bemerkenswerte Diskussion. Einer der Herren rückte, als die Sprache auf Deutschland kam, mit einer Art chinesisch-geographischen Handbuchs heraus, „Made in England“. Die Landkarten waren noch eine Portion schlechter als die russischen Generalstabskarten und Deutschland war auf der Karte zu einem ganz kleinen Provinzchen zusammengeschrumpft, wogegen Frankreich, Russland und England dementsprechend vergrößert waren. Ich erlaubte mir, den Herren eine skizzenhafte Karte von Europa auf chinesischem Papier mit Pinsel und Tusche vorzuzeichnen. […] Selten hatte ich aufmerksamere Zuhörer. Ich konnte den aufhorchenden Chajlar-Mongolen so ziemlich mit statistischen Zahlen über die wirklichen Machtverhältnisse, Indus238 trie, Handel und Gewerbe in Europa dienen.
So kehrt Consten im Sommer 1910 zwar mit einer Fülle neuer Informationen über die Mongolei und die politischen Ambitionen ihrer führenden Köpfe nach Russland zurück; seinen Versuch, selbst mit ihnen ins Geschäft zu kommen, muss er jedoch als vorerst gescheitert ansehen. 153
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Im Jahre 1911 fuhr ich der Abwechslung halber einmal dritter Klasse durch Sibirien. […] Ich zähle eine solche Fahrt mit zu dem interessantesten Teil der Reise. Bis Tula hatte ich damals beinahe einen ganzen Wagen allein, dann wurde er aber mit Sibiriaken, Kindern und Handgepäck vollgepfropft. Kein hastendes, nervöses, rücksichtsloses Drängen, jeder hilft bereitwilligst dem ihm völlig Unbekannten beim Unterbringen des massenhaften Handgepäcks. Innerhalb zehn Minuten ist das Eis gebrochen, und die Leute sitzen in den einzelnen Abteilen so gemütlich russisch zusammen, als wären sie schon jahrelang miteinander bekannt. […] Welch prachtvolle Volksstudien kann man in so einem Wagen machen. Es sind Charakterköpfe, diese Sibiriaken. Vielen sieht man die Mischung mit mongolisch-kirgisischem Blute an. Hier und da bemerkte ich einen Altgläubigen mit rund abgeschnittenem Haupthaar und langem Bart. Dazwischen russische Beamte niedrigen Ranges mit ihren Familien. […] Doch, ich traute meinen Ohren kaum, da stand auch ein echt rheinischer Bauer und sorgte sich um seine zwei kleinen Mädels im unverfälschten Platt. Ich ging auf ihn zu und begrüßte meinen engeren Landsmann. Bald waren wir im vollen Erzählen. […] Die Familie meines Landsmannes Wings lebt schon in der vierten Generation in Sibirien. Er gehört der Herrnhuter Gemeinde an, ist Mühlenbesitzer am Irtysch und hat es zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Er gibt mir wertvolle Aufschlüsse über das Leben der deutschen Kolonisten, die fest an ihrem Deutschtum 239 hängen, aber trotzdem zu den treuesten Untertanen des Zaren gehören.
Wieder ist es Sommer, ein sehr heißer sibirischer Sommer. Bis weit hinter Omsk sind Wiesen und Felder verdorrt; im Gouvernement Samara droht, wie Consten notiert, eine Hungersnot. In Bijsk macht er die Bekanntschaft des russischen Konsuls A.A. Walter, des „Vertreters einer im ersten Glied 240 durch ihn russisch gewordenen reichsdeutschen Familie“. Der Konsul befindet sich auf dem Weg nach Uliastaj, um im dortigen Konsulat seinen Posten anzutreten. Walter bittet, sich Consten anschließen zu dürfen, denn er reist das erste Mal in die Mongolei und hat gehört, die Wege seien unsicher. Obwohl beide einander nicht unbedingt sympathisch sind, reisen sie, eskortiert durch drei Kosaken, fortan gemeinsam. Im Gren241 zort Koš-Agač, der eigentlich schon auf mongolischem Gebiet liegt, macht die Reisegesellschaft mehrere Tage Pause. Constens zwischen Sar154
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
kasmus und depressiven Anwandlungen schwankende Stimmung jener Reisetage spiegelt sich in einem Brief an ein befreundetes Moskauer Ehepaar, dem er seine Reiseerlebnisse schildert: Kosch-Agatsch, den 3. August 1911 Mein lieber Strauss, meine liebe gnädige Frau Strauss! So bin ich denn endlich oder schon in Kosch-Agatsch eingetroffen, wie ich Ihnen schon schrieb, reise ich in Begleitung des russ. Generalkonsul für Uliastaj A.A. Walter. Von Bijsk bis hierher brauchten wir fünf Tage bei einer Durchschnittleistung von hundert und einigen Werst pro Tag. – Doch seit der Abfahrt von Bijsk verfolgt uns das Pesch [sic!], in Bijsk selber wurde ich beinah von einen herabsausendem [sic!] Firmschild erschlagen. Zum Glück war das Häuschen nicht hoch, das Schild nur ein Quadratmeter, mein Buckel ziemlich breit, so kam ich unter diesen günstigen Bedingungen mit einem tüchtigen Stoss ins Genick davon. Aus Bijsk, wo sogar eine echte Wiener Damenkapelle in meinem „Hotel“ spielte, kamen wir endlich heraus und in rasender Fahrt ging es in unseren bequemen Tarantas, durch Bijsk über den Katun u. den Bija mittelst einer Fähre und dann nach Smolensk, wo eine kurze Rast bei einem mir bekannten Dänen gemacht wurde. […] Für mich gestaltete sich die Fahrt nach und nach immer unangenehmer. In Bijsk hatte ich einige kleine Geschwürchen auf dem Teil wo sich der Mensch gewöhnlich setzt, die sich nach und nach zu ganz ordentlichen Karbunkeln auswuchsen. „Zwiefach ist der Stich der Gabel, wenn sie zwiefach zugespitzt“, singt Busch recht lyrisch; bei mir war sie fünffach zugespitzt. Jeder Galoppsprung, jeder Stein, über den wir hopsten, und Steine gab es zu Milliarden auf dem Weg, versetzte mir einen fünffachen Stich, dass unter diesen Umständen die 515 Werst bis Kosch-Agatsch eine Marterfahrt war, und ich hierbei für alle begangenen und noch zu begehenden Sünden im voraus schon Busse getan habe, davon bin ich fest überzeugt. Aber der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert und ob es noch je einmal zum Sündigen kommen wird ist wohl noch sehr die Frage. – Ich sehe schon Ihr ganz malitiosen [sic!] Lächeln meine gnädige Frau, und kann Ihnen Ihre Gedanken von der Stirne ablesen, „als ob der Schlingel in seinem bewegten Wanderleben noch nicht genug gesündigt hätte.“ Sie haben recht und doch unrecht, wir sind doch allzumal Sünder und was der eine für eine Sünde hält, hält der andere für das größte Glück. Ich halte es ab155
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
solut für keine Sünde einer schönen Frau einmal recht tief in ihre dunklen Augen zu schauen, und glänzen diese klare bedeutsame einer edlen Frauenseele feucht, wenn ich ihr die Hand zum Abschied vielleicht für immer drücke, so ist auch mir in meinem unsteten freudlosen Wanderleben ein Glück widerfahren, an dem ich den ganzen langen Weg zehre. Einsam wandernden ewigen Juden gleich treibt es mich immer wieder hinaus, es ist vielleicht ein Fluch oder ein Dämon der in meiner Seele haust und mich nie des ruhigen stillen Glücks teilhaftig werden lässt. Ein wildes verwegenes Wander- und Jägerleben, immer nur weiter rastlos in Eil, nie lang verweilen, von niemand gebannt, von niemand geliebt dass [sic!] ist mein Schicksal, von dem mich nur eine schöne Fee erlösen könnte, aber ich fürchte die Feenhändchen, denn sie haben manchmal recht scharfe Krallen. – Ich habe meine Gedanken so ganz gedankenlos zu Papier gebracht, mein lieber Strauss und bitte um Entschuldigung. – Von Ongodai brachen wir morgens recht früh auf um über den 1150 Meter hohen Chikataman zu kommen, hinter dem Dorf Charbarokosk scheuten unsere Pferde und hoch im Bogen flogen der Konsul und ich und der Tarantas einen Abhang hinunter, zum Glück lief noch alles verhältnismässig leicht ab, der Konsul kam mit einem gehörigen Schrecken davon, der Tarantas war gründlich verbogen und als ich mit Hülfe 242 des Jamschik, den Tarantas aufrichtete, bemerkte ich erst, dass ich aus einer Kopfwunde blutete, der Tarantas hatte mir doch einen ordentlichen Knax versetzt. Mir persönlich kam die Situation anfangs mehr als lächerlich vor, nachdem mein erster Blick mich davon überzeugt hatte[,]dass meine Apparate heil geblieben waren. Der Konsul stand schreckensbleich da, es ist ihm ja nicht zu verdenken, er ist kaum ein Jahr verheiratet und hat seine junge Frau in Petersburg zurücklassen müssen, mein Student war herangelaufen gekommen 243 und hielt krampfhaft seinen Kinschal umfasst, als wollte er den Tarantas oder den Jamschik totstechen oder den Bauch aufschlitzen. Die beiden anderen Fuhrleute wussten auch im ersten Moment nichts anderes zu thun als Nase und Maul aufzusperren bis einige kräftige Flüche meinerseits in der ganzen Gesellschaft Leben brachte. In einer Viertelstunde waren die wildgewordenen Pferde vor dem aufgerichteten Tarantas gespannt, und die Fahrt konnte weitergehen. Vor dem Chikataman flog die Bagage um, dann ging es weiter über die Passschwelle nach oben, während des dortigen Aufenthalts wurde eifrig photographiert. 156
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
Ein Wahrzeichen auf dem Chikataman vermisste ich sofort, dass mächtige russ. Kreuz, dass ich im vorigen Jahr auf der höchsten Spitze sah, es war alt und wurmstichig geworden – wie so manches in der Religion der es als Wahrzeichen für ihre egoistischen Bestrebungen dient – ein kräftiger Sturm hatte es in die Tiefe geschleudert. Während die Wagen die langen Serpentinen hinunterzogen, kletterte ich über die steilen Felsen zu dem abgestürzten Kreuz hin. Ein eigentümliches Gefühl zog mir durch die Brust, als ich vor diesem von den Naturgewalten in die Tiefe geschleuderten Wahrzeichen unserer sogenannten christlichen Religion stand. Unwillkürlich zuckte mir die Legende über die 244 Schlacht bei Zülpig durch den Sinn als das Kreuz am Himmel erschien und eine Stimme dem Frankenkönig Chlodewisch – diesem Bluthund, diesem rothaarigen Scheusal zurief – „in diesem Zeichen solst du siegen“. – Als echter Alpinist versuchte ich dem gestürzten Kreuz eine würdige Lage zu geben, das untere Ende des mächtigen Kreuzes brach mir in den Händen entzwei, aber endlich lag es so wie ich es für eines Alpenkreuzes würdig hielt, es hatte Arbeit und Schweiss gekostet, und befriedigt kletterte ich mit mir selbst zufrieden zu Thal. – Zweimal setzten wir Nachts mit einer Fähre über den Katun, zweimal übernachteten wir in dem Trakt, dann kamen wir nach Zibith wo mich beinahe das Verhängnis ereilte. Als wir aus dem Hofe hinausfuhren, scheuten die Pferde – es war dies das dritte Mal – […] ich wollte aus dem Tarantas springen um den Pferden in die Zügel zu fallen, da rasten die Kanaillien [sic!] auch schon zum Thor hinaus, mein linker Fuss wurde zwischen Tarantas und Thorpfosten gequetscht, ein rasender Schmerz, ich glaubte der Fuss sei ganz gequetscht, und wir waren draussen; doch der Stoss war durch meine Wickelgamaschen gelindert worden. Während unsere Pferde weiterjagden untersuchte ich im Tarantas auf dem Rücken liegend meinen Fuss, jeder Hopser und Stoss verursachte mir rasende Schmerzen, so dass ich ernstlich fürchtete der Fuss sei ganz gebrochen. In Burutal nach etwa zwanzig Werst legte ich mir den ersten Notverband an, dann ging es weiter in sausender Fahrt unserem Endziel KoschAgatsch entgegen. Die hundert Werst mussten noch gemacht werden, was ich aber gelitten habe, kann ich gar nicht niederschreiben. Wollte ich meinen Fuss schützen, so schmerzten mich meine Karbunkel, schützte ich meine Karbunkel so schmerzte mich der Fuss. Es war zum rasend werden. Aber alles hat ein Ende. Vor uns lag Kosch-Agatsch, die Berge rings mit Schnee bedeckt, noch 157
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
einmal fuhren wir halb schwimmend durch den Tschuifluss und wir waren in Kosch-Agatsch, wo wir von einer Kosaken-Abtheilung empfangen wurden. Der Feldscher untersuchte mein [sic] Fuss, konstatierte eine kräftige Quetschung aber keinen Bruch. Mir fiel eine Centnerlast vom Herzen, hätte ich mindestens hier fünf Wochen liegen müssen und was wäre aus unsere Schneeschuhpartien geworden, wenn der Fuss ganz zum Teufel gewesen wäre! Doch genug für heute, morgen geht es unter Kosakeneskorde [sic] nach Kobdo und Uliastaj. Vielleicht gelingt es mir Ihnen von dort aus noch einmal eine Nachricht zu schicken. Mit herzlichem Gruss für Sie mein lieber Strauss und die Kleinen und einen Handkuss für Sie meine Gnädigste, Ihr sehr ergebener Hermann Consten jr. P.S. Die Fettflecken kommen von unserer ausgelaufenen Butter. Denn unsere ganze Bagage ist zertrümmert, Mehl, Wurst, Butter, Reis, alles bildet ein fried245 liches Gemenge.
Die Reisegefährten bleiben auch jenseits der Grenze vom Missgeschick verfolgt. Wie gespannt die politische Lage im äußersten Westen der Mongolei tatsächlich ist, erleben Hermann Consten und Konsul Walter bei ihrer Ankunft in Chovd (Kobdo) am 10. August 1911. Weil ein Russe beim Reinigen seines Gewehrs aus Versehen einen chinesischen Kaufmann erschoss, kommt es zu Attacken auf die in Chovd lebenden Russen, die den Delinquenten vorsorglich in Schutzhaft genommen haben. Dies steigert nur die Erregung der Chinesen über den Zwischenfall. Das dortige russische Konsulat befindet sich praktisch im Belagerungszustand. Bemühungen Konsul Walters, unter Berufung auf den russisch-chinesischen Vertrag von Ili 246 (1881) den Schuldigen der russischen Justiz zu überantworten und nach Uliastaj zu überstellen, scheitern ebenso wie der Versuch, einen Boten ins 450 Werst entfernte Koš Agač, die nächste Telegrafenstation, zu senden, um von dort Anordnungen aus St. Petersburg und militärische Verstärkung anzufordern. Consten entwickelt den Plan, dass er selbst heimlich losreitet, um die Telegramme des Konsuls Walter an das Außenministerium in St. Petersburg und den russischen Gesandten in Peking aufzugeben. Ich bat nun den Konsul, die Telegramme unchiffriert zu schreiben, damit
158
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
ich im Notfall den Inhalt durchlesen und sie dann vernichten könne. 247 Nach einigem Zögern willigte er ein.
Vom Anwesen des russischen Kaufmanns Asanov, der am Stadtrand von Chovd eine Wollwäscherei betreibt, reitet Consten, „die Depeschen in leeren Mauserpatronen, die sich nicht einmal durch ihr Gewicht von den an248 deren unterscheiden“, im Schutz der Dunkelheit mit einem Begleiter los. Er wird bald schon von chinesischen Soldaten verfolgt, schafft es aber, ihnen in einem abenteuerlichen Ritt durch das Hochgebirge in Sturm und Hagelschauern zu entkommen und die Telegrafenstation an der russisch-chinesischen Demarkationslinie zu erreichen; er bewältigt die Strecke angeblich in nur 36 Stunden. Vier Tage lang wartet er allerdings, bis die Antworttelegramme aus St. Petersburg und Peking eingetroffen sind – vier Tage, in denen Hermann Consten keineswegs müßig ist. Konsulat Moskau an Bethmann Hollweg, 16.8.1911 Durch sichere Gelegenheit. Vor etwa drei Wochen suchte mich der hiesige deutsche Forscher Hermann Consten jr. auf, um einen ihm durch Vermittelung der Kaiserl. Botschaft in St. Petersburg ausgestellten chinesischen Pass zum Zwecke einer Studienreise nach der Mongolei entgegenzunehmen. Herr Consten, der dem Konsulat von früher her als durchaus vertrauenswürdig genau bekannt ist und die Verhältnisse in der Mongolei sehr gut aus eigener Anschauung kennt, stellte mir bei Darlegung der von ihm verfolgten Ziele – ethnographischer, sprachlicher und topographischer Forschungen in der Mongolei – Berichte über die von ihm gemachten Beobachtungen in Aussicht. Einem gestern hierher gerichteten, aus Bijsk datierten Schreiben des genannten Herrn entnehme ich, dass er auf der Dampferfahrt von Novo-Nikolajewsk nach Bijsk Gelegenheit hatte, von den Offizieren einer an Bord befindlichen Remontekommission zu erfahren, für den 15. August russischen Stils (28. August) sei in Altaj eine große militärische Demonstration geplant, von der die Zeitungen bisher nicht zu berichten wussten. In Bijsk werden die Reservisten einberufen und Kontrollversammlungen veranstaltet. Es ist die Abhaltung eines in großem Stil abgehaltenen Manövers in Altaj und an der mongolischen Grenze geplant, zu dem Truppen aus Tomsk, Omsk und zum Teil aus Taschkent herangezogen werden. Die Annahme liegt nahe, dass Russ159
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
land auch durch diese Maßnahmen die chinesische Regierung in der Richtung einer für Russland günstigen Revision des Vertrages von Ili vom 12. Februar 1881 zu bestimmen sucht, dessen Artikel 15 eine Abänderung der Handelsbestimmungen dieses Abkommens nach Verlauf von 10 Jahren vorsieht. […] Die Vermutung ist daher nicht von der Hand zu weisen, dass die geplanten Manöver einen weiteren, von der hiesigen Presse längst geforderten energischen Schritt in der angedeuteten Richtung einleiten, der möglicherweise einen ernsthaften Charakter annehmen könnte. Die Hoffnung auf ein kriegsmäßiges Vorgehen gegen China „je eher desto besser“, teilen nach der Versicherung meines Gewährsmannes, alle Offiziere, mit denen er gesprochen hat. […] In Zusammenhang mit der geplanten Demonstration dürfte auch der Umstand von Interesse sein, dass der für Uliastaj in der Mongolei (zwischen dem 48. und 47. Breitengrad und dem 97. Längengrad östlich v. Greenwich) neuernannte russische Generalkonsul Walter Weisung hat, bis zum 7. d. Mts russ. Stils (20. d. M.) unbedingt daselbst eingetroffen zu sein. Abschrift dieser Meldung geht der Kaiserl. Botschaft in St. Petersburg durch den Oberleutnant von Pressentin-Rautter zu. 249 i.V. Hauschild
Trotz seines persönlichen Missgeschicks, trotz Kokettierens mit seinem „unsteten freudlosen Wanderleben“ und mit seiner Angst vor den Frauen, trotz Offenbarung seines gebrochenen Verhältnisses zum Christentum – Hermann Consten hat Augen und Ohren offen gehalten. Die eigentlich nicht geplante Rückkehr zur Grenze und die dortige Zwangspause kamen ihm offensichtlich wie gerufen. Anhand seiner während der Reise gemachten Notizen, für die er immer kleine schwarze Kladden verwendete, konnte er unbeobachtet einen vertraulichen Bericht für das Deutsche Generalkonsulat in Moskau verfassen und absetzen. Dem Konsulat wiederum erschien Constens Bericht wichtig genug, um Reichskanzler von Bethmann Hollweg in Berlin umgehend von den geplanten russischen Manövern im Grenzgebiet zu der von China kontrollierten Westmongolei zu unterrichten. Mit den Antworten auf die gesendeten Telegramme Konsul Walters „und beladen mit der ganzen russischen Post für Kobdo und Uliastaj“ macht sich Hermann Consten anschließend auf den Rückweg auf die mongolische Seite. Mit Hilfe kalmückischer Grenzwächter umgeht er die chine160
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
sischen Wachtposten und wählt dann wieder den Weg durchs Gebirge. Es gelingt ihm, unbeobachtet nach Chovd zu kommen. Derweil ist Konsul Walter bereits nach Uliastaj aufgebrochen, und Consten reitet „auf einem 250 251 noch nie beschriebenen Wege längs des Chara-ussu zum Dsaptschin“ hinterher. Er durchschwimmt zwei Flüsse, die das Gewässer speisen. „Tausende von Wildenten und Wildgänsen bevölkern die Flüsse und sind so zahm, dass ich sie beim Durchschwimmen mit dem Peitschenstiel zum Ent252 setzen der Mongolen totschlagen kann“ – eine Szene, die in ihrer Grausamkeit an das Abknallen der Affen im zentralafrikanischen Urwald erinnert, die Consten in seiner Afrika-Erzählung „Bibi Faida“ geschildert hat. Hat er wohl je zu ergründen versucht, warum sich der „Dämon“, der in seiner Seele haust, ausgerechnet an solch wehrlosen Opfern meint austoben zu müssen? Nach einem Parforceritt über den „geheimen Kaufmannsweg der Russen“ trifft Hermann Consten schließlich Ende August 1911 in Uliastaj ein. Die Festungs- und Handelsstadt mit ihren etwa 3000 Einwohnern ist Kreuzungspunkt der alten Postwege vom Baikal- und Chövsgöl-See nach Kalgan und Peking wie auch von den zentralasiatischen Oasenstädten Hami und Urumqi über Chovd nach Ich Chüree (Urga). Nach Constens Beschreibung ist Uliastaj ein schmutziges Nest voller Unrat in den engen Gassen. Bemerkenswert ist allerdings die nördlich vor der Stadt gelegene hölzerne Festung mit ihren Wachtürmen und hohen Palisadenwänden. Consten händigt Konsul Walter die mitgebrachten Depeschen und Briefe aus und erfährt beiläufig, was sich in der Zwischenzeit im Land politisch getan hat. 253 Im Juli, so Walter, hätten die Fürsten der vier Chalch-Aimags mit dem Jebtsundampa Chutagt und dem hohen lamaistischen Klerus, an einem geheim gehaltenen Ort in den Bogd-Uul-Bergen bei Ich Chüree getagt. Diese „Fürstenversammlung“ habe beschlossen, ein mongolisches Kaiserreich mit dem VIII. Jebtsundampa Chutagt als Staatsoberhaupt zu gründen und unverzüglich eine Abordnung nach St. Petersburg zu entsenden, um Zar Nikolaus II. um finanzielle Unterstützung und politisch-militärischen Beistand für ihren Plan zu bitten. Der in die streng geheime Angelegenheit eingeweihte russische Konsul habe die nötigen Reisepapiere ausgestellt, und die Gruppe habe am 29. Juli Ich Chüree heimlich in Richtung Russland verlassen. Ihr Anliegen sei, so hört Consten weiter, in St. Petersburg auf 161
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
zustimmende Resonanz gestoßen. Es hätten Gespräche mit dem stellvertretenden Außenminister Neratov, dem Finanz- und dem Verteidigungsminister stattgefunden; selbst Ministerpräsident Stolypin habe die mongolischen Emissäre empfangen, und man habe abschließend eine schriftliche Vereinbarung unterzeichnet. Gerade vor wenigen Tagen habe der russische Gesandte in Peking, Korostovec, der chinesischen Regierung eine Note überreicht, in der Russland erkläre, es werde einer Bedrohung des status quo in 254 der Mongolei nicht gleichgültig zuschauen. 255 Consten erfährt ferner, dass neben Da Lama Cerenčimed und Fürst 256 Čin Van Chanddorž auch Gung Chajsan zur Abordnung gehöre – ein Indiz dafür, dass ein gesamtmongolischer Staat angestrebt werde, der die Stämme der Inneren Mongolei wie auch der östlichen und westlichen Gebiete mit einbeziehen wolle. Das werde Russland wohl nicht unterstützen können, denn eine solche Lösung tangiere seine Geheimabkommen mit Japan und könne leicht auch zu einem militärischen Konflikt mit China führen, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt wenig opportun sei. Natürlich, erfährt Consten weiter, sei das Gerücht über die heimliche Abreise der Emissäre dem chinesischen Amban von Ich Chüree zu Ohren gekommen; dessen Aufforderung, der Jebtsundampa Chutagt möge sie unverzüglich zurückbeordern, sei ignoriert worden. Daraufhin habe der Amban die eigenmächtigen Mongolen durch ein chinesisches Gericht in Abwesenheit zum Tode verurteilen lassen. Ein Trupp chinesischer Soldaten sei nach Kjachta in Marsch gesetzt worden, um sie bei ihrer Rückkehr gleich an der Grenze gefangen zu nehmen. Die Gruppe befinde sich derzeit auf getrennten Wegen abseits der Karawanenstraßen auf dem Heimweg, wolle vorerst aber an geheimen Orten im Herrschaftsbereich Čin Van Chanddoržs die weitere Ent257 wicklung abwarten. Kein Zweifel, die Situation ist hochbrisant, dies erkennt Consten sofort. Ein militärischer Konflikt zwischen Russland und China wegen der westlichen Mongolei, wie er ihn in seinem Bericht an das Deutsche Generalkonsulat in Moskau schon angedeutet hatte, ist immer weniger auszuschließen! Er muss, will er nah am weiteren Geschehen dran bleiben, so schnell wie möglich nach Ich Chüree reisen. Viel hält Consten ohnehin nicht in Uliastaj. Obwohl er im russischen Konsulat fast täglich ein und aus geht und trotz seiner unbestrittenen Verdienste als „Sonderkurier“ Konsul Walters, 162
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
spürt er Vorbehalte seiner Person gegenüber. Irgendwann kommt ihm zu Ohren, man verdächtige ihn, ein deutscher Spion zu sein. Konsulatssekretär Xionin habe sogar den Kommandanten der Transbaikal-Kosaken in Irkutsk über diesen Verdacht informiert und vor Consten gewarnt. Das macht ihn wütend, vielleicht gerade, weil etwas „dran“ ist. Wohl fühlt er sich dagegen immer noch bei den Mongolen und einigen in der Stadt ansässigen chinesischen Kaufleuten, bei denen er eine Kamelkarawane für seine Weiterreise ausrüstet. Er macht die Bekanntschaft des chinesischen Großkaufmanns Li Ninfa, eines feinen, gebildeten Mannes, mit dem er sich mühelos auf Russisch unterhalten kann. Auch kommt er in Kontakt mit einem Fürsten des Uliastaj-Gebiets, dem jungen Sartuul Cecen Van, auch Cecen Bejs ge258 nannt. Den tiefsten Eindruck aber hinterlässt seine eher zufällige Begegnung mit Žalchanc Chutagt, einer der höchsten buddhistischen Reinkarnationen und als Stütze der theokratischen Monarchie des Bogd Chan zugleich eine der politisch einflussreichsten Persönlichkeiten der Mongolei in den ersten 259 beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Consten berichtet über „DsalChen-Sen-Gegen“, wie er den Namen des Chutagt schreibt, ausführlich im ersten Band seiner „Weideplätze“. Den Deckel der Originalausgabe von 1919 ziert sogar ein von Consten selbst aufgenommenes, handkoloriertes und von Žalchanc mit Goldschrift in Altmongolisch und Tibetisch signiertes Porträtfoto. Es zeigt einen Mann mittleren Alters mit einem schmalen, markanten Gesicht, langer Nase, einem sorgfältig gestutzten Schnauzbart, kräftigen Augenbrauen und für einen Mongolen ungewöhnlich großen, ausdrucksvollen Augen. Dieser Dsal-Chen-Sen-Gegen ist eine der merkwürdigsten Persönlichkeiten, denen ich in meiner fünfzehnjährigen Wanderzeit begegnet bin. Dsal-Chen-Sen-Gegen ist die zweite Verkörperung des Buddhas in der Mongolei. Sein Einfluss ist beinahe gleich dem des Je-Tsun-Dampa-Chutagt, des neuen mongolischen Herrschers und Kaisers. Er ist berühmt als Arzt und Wettermacher, und das Volk wallfahrt zu seinem Kloster, um Heilung und Trost dort zu suchen. Wer einmal in die wundervoll glänzenden Rehaugen des Gegen geschaut hat, wird sie so schnell nicht wie260 der vergessen. […] Alles, was aus Europa kommt, interessiert ihn und seine Leute. Auch die von mir mitgebrachten Photographien meiner frü163
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
heren Reisen in Afrika und Indien musterte er lange und eingehend, und das Fragen und Erklären wollte kein Ende nehmen. Auch die Bilder mancher von mir auf früheren Reisen in [Zentral-]Asien photographierten La261 mas und Klöster erkannte er sofort.
Dieser hohe Lama war es wohl auch, der Consten prophezeite, er werde bei seiner Rückkehr nach Deutschland an der Grenze vom Tod seines Vaters 262 erfahren. Spätestens Mitte September 1911 ist Consten auf dem Weg in Richtung Osten. Die Entwicklungen in Ich Chüree scheinen ihm nach dem, was er in Uliastaj von russischer, chinesischer und mongolischer Seite erfahren hat, von eminenter Bedeutung zu sein. Er rechnet fest mit einer Zuspitzung der Lage. Da er vorsichtig geworden ist, wählt er nicht den stark frequentierten Postweg von Uliastaj nach Ich Chüree, sondern zieht über Schleichpfade, die nur den Mongolen bekannt sind: durch den an seinen Nordhängen bewaldeten Changai und das Orchontal, Herzland des einstigen mongolischen Weltreiches mit Karakorum, der von Čingis Chaan gegründeten, von seinem Sohn Ögedej Chaan 1235 erbauten und 1388 von chinesischen Truppen wieder zerstörten Hauptstadt. Consten ist nicht der einzige, der gute Gründe zu haben scheint, auf Nebenwegen in die heutige mongolische Hauptstadt zu gelangen, die zu seiner Zeit bei den Mongolen Ich Chüree hieß, nach der Inthronisation des Bogd Chan 1911 in Nijslel Chüree umgetauft wurde, von den Russen – so auch von Consten – Urga genannt wurde und die seit 1924 Ulaanbaatar heißt. Etwa 250 Kilometer südwestlich kommt es zu einer folgenreichen Begegnung mit einem Boten der geheimen Russland-Delegation: Der Zufall wollte es, dass ich am 19. September 1911 am Urton Aribschisch, in der Nähe des Sees Tuchmin-Nor, ihren mongolischen Kurier Tschamsran vor den ihn verfolgenden Chinesen unter meinen Karawanenleuten verstecken und retten konnte. Er brachte später unter meinem Schutz die Nachricht, dass die Fürsten aus Petersburg glücklich zurückgekehrt seien, nebst einem ausführlichen Bericht über den Erfolg ihrer 263 Reise nach Urga.
Mit dieser Hilfeleistung hat Hermann Consten wohl die Sympathien der politischen Akteure jener entscheidenden Umbruchphase in der jüngeren 164
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
mongolischen Geschichte gewonnen. Die historische Bedeutung seines geistesgegenwärtigen Verhaltens am Iche Tuchum-nor – so ist der Name des Sees auf Constens eigener Landkarte verzeichnet, mongolisch lautet er Töchömijn nuur – vor nunmehr einem Jahrhundert erschließt sich aus der Rückschau auf die Ereignisse, die dem gelungenen diplomatischen Coup der geheimen Russland-Mission folgten. Wäre der Kurier an jenem 19. September 1911 nämlich in die Hände des chinesischen Fahndungskommandos gefallen, dann wäre das Schicksal der Verfechter einer Loslösung der Mongolei von China besiegelt gewesen; der Traum von einem eigenen, unabhängigen Staat wäre – dem Schicksal Tibets vergleichbar – in weite Ferne gerückt. Auch wenn er sich in dem Moment über die Tragweite seines Handelns vermutlich nicht klar gewesen ist: der deutsche Forschungsreisende Hermann Consten hat damit zweifellos entscheidenden Anteil an der Entstehung der modernen Mongolei. Als Consten schließlich mit seiner Karawane und dem als Kameltreiber verkleideten Geheimkurier der abtrünnigen Fürsten in Ich Chüree eintrifft, ahnen beide wohl nicht, dass sich im fernen Peking derweil die Ereignisse überstürzen. Die Macht der Mandschu, die seit 1644 über das „Reich der Mitte“ geherrscht haben, droht an ihrer eigenen inneren Schwäche endgültig zu zerbrechen. Der 10. Oktober 1911 schließlich markiert den Sturz der Qing-Dynastie und die Geburt einer chinesischen Republik. Die Nachricht vom Ende der Kaiserherrschaft in China macht in Ich Chüree rasch die Runde und beschleunigt die Entscheidung der Chalch-Fürsten und des hohen Klerus, ein selbständiges mongolisches Reich mit einem eigenen höchsten Herrscher, dem Bogd Chan, auszurufen. Der Statthalter der gestürzten Qing, Amban Sandō, wird Anfang November aufgefordert, Ich Chüree innerhalb von drei Tagen zu verlassen; er flüchtet sich ins russische Konsulat und erhält schließlich Geleitschutz durch eine Kosaken-Eskorte, die ihn nach Kjachta bringt. Von dort aus reist der verjagte Amban mit der Bahn über Chajlar nach Peking zurück. In Ich Chüree etabliert sich derweil eine bereits im Sommer insgeheim bestimmte provisorische Regierung. Am 1. Dezember 1911 wird die Wiederherstellung eines unabhängigen Staates Mongolei proklamiert und das Datum für die feierliche Einführung des VIII. Jebtsundampa Chutagt als neues Staatsoberhaupt auf den 16. Dezember – nach unserem Kalender der 29. 165
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente 264
Dezember – festgelegt. Die erste nationale Revolution der Mongolen hat ihr Ziel erreicht. Constens Fazit in einem Satz: Es ist ein Witz der Weltgeschichte, dass gerade ein Tibetaner das ausfüh265 ren musste, was der kluge weitblickende chinesische Kaiser Kang-hi von einem mongolischen Chutagt fürchtete, nämlich dass dieser eines 266 Tages die Mongolei von China wieder losreißen könnte.
Während dieser historischen Phase zwischen der Vertreibung des Amban und der Inthronisation des neuen mongolischen Herrschers ist Hermann Consten nicht nur unmittelbarer Zeitzeuge des Abzugs der Chinesen, der Regierungsbildung und schließlich der Thronbesteigung des Bogd Chan. Auch ihm selbst muss in diesen Wochen eine unerwartete Ehrung widerfahren sein, als Dank für seine kühne Rettungstat vom Töchömijn nuur. Laut Information von Klaus Strölin, der Consten noch persönlich gekannt, dessen Mutter einen Teil von Constens Nachlass über Jahrzehnte gehütet hat, verlieh man ihm den Rang eines „Gun“ – vergleichbar etwa unserem 267 Grafen oder Herzog – mit allen Insignien. Damit würde Hermann Consten zu den insgesamt nur fünf Ausländern gehören, die während der bis 1924 dauernden Herrschaftszeit des Bogd Chan mit einem mongolischen 268 Fürstentitel geehrt worden sind. „Gun Dschi Djian“, dies ist der Name, unter dem Hermann Consten jedenfalls von nun an unter den Mongolen bekannt ist. Wie bei so manchem anderen Wendepunkt in Hermann Constens Vita jedoch, überkamen die Biografin auch bei der Beschäftigung mit diesem denkwürdigen Moment seines Lebens immer wieder Zweifel, ob die Geschichte von der Verleihung des Adelsprädikats überhaupt stimmen kann. Nichts Schriftliches darüber hat sich bislang gefunden. Nicht einmal in dem großen Werk über seine mongolischen Reisen und Abenteuer, den „Weideplätzen der Mongolen“, ist die Ehrung und die mit ihr verbundene, sicher sehr farbige und feierliche Zeremonie erwähnt. Auch ist kein Brief, kein Tagebucheintrag von seiner Hand erhalten, der voller Stolz davon berichtet hätte. Das ist schon recht merkwürdig, denn ein Mann von dem übergroßen Geltungsbedürfnis Hermann Constens hätte sich doch mit Sicherheit gebrüstet angesichts eines solchen Titels – so war meine Überlegung. Vielleicht ließ er sie aber auch lieber deshalb unerwähnt, weil diese Ge166
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
schichte einfach zu phantastisch klang, um wahr zu sein – sie aber eben doch stimmte! Auffallend knapp ist in den „Weideplätzen“ die Rettung des Geheimkuriers geschildert, die Constens Ruhm bei den Mongolen begründete. Andererseits ist allenthalben in seinen weiteren Schilderungen doch zu spüren, dass er von den befreundeten mongolischen Fürsten wie Ihresgleichen behandelt wurde – ganz abgesehen davon, dass dieser „Gun Dschi Djian“ unter den einfachen Nomaden bekannt gewesen zu sein scheint wie ein bunter Hund, dass man ihm in den Weiten der mongolischen Steppe mit Ehrfurcht und Scheu begegnete. Außerdem gibt es ja mehrere Beweisstücke: prächtige Gewänder aus Brokatseide, die eines „Gun“ ohne Zweifel würdig sind, finden sich in Constens Nachlass. In einem Prunkgewand aus blauer Seide mit drei aufgestickten goldenen Drachen, hat sich Hermann Consten – entweder nach einem nicht mehr existierenden Foto oder in einer nachgestellten Inszenierung – Anfang der zwanziger Jahre von dem Hannovera269 ner Maler Heinz Munz großformatig porträtieren lassen. Da sitzt er unter einem Baldachin auf einem kunstvoll geschnitzten Thron mit vier verschiedenfarbenen Polsterauflagen aus Seide, die seinen Rang markieren. Seinen dunklen Lockenschopf schmückt ein Zeremonialhut mit roter Glaskugel und einer Pfauenfeder. Und zu seiner Rechten sieht man auf einem niedrigen Tisch in chinesischem Stil zwei weitere wichtige Attribute: den goldverzierten Helm des Heerführers, wie man ihn von einem der chinesischen Herrscherporträts Castigliones aus dem 18. Jahrhundert kennt, und ein von zwei hölzernen Deckeln gehaltenes Buch, vermutlich religiösen Inhalts. Aus dem dämmrigen Hintergrund schimmert in der Höhe seines Kopfes zu seiner Rechten die vergoldete Bronzefigur des Buddha Gautama hervor und zur Linken – mehr zu erahnen als zu erkennen – das mit Schnüren verhängte Gesicht eines Schamanen. Das ganze Arrangement hat etwas Archetypisches. Wären da nicht Constens eindeutig europäisches Aussehen, der „Schmiss“ auf der linken Wange und seine runde westliche „Gelehrtenbrille“, man könnte tatsächlich meinen, hier habe sich ein mongolischer oder mandschurischer Fürst für die Nachwelt verewigen lassen. Doch ist damit verbürgt, dass er tatsächlich einen mongolischen Adelstitel verliehen bekam? Irgendwann, beim Abwägen von Legende und Wahrheit, kam mir der 167
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Gedanke, dass „Gun Dschi Djian“ eigentlich nur die phonetische Wiedergabe von „Con-s-ten“ sein kann, die Silbe „Gun“ also Bestandteil des Namens ist und keinen mongolischen Titel oder Rang wie „Van“, „Bejl“, „Bejs“ oder „Gun“ bezeichnet. Wie Europäer es gern tun, die sich länger im Fernen Osten aufhalten, hat sich auch Hermann Consten während seiner Zeit in China ein Namenssiegel schneiden lassen, das noch im Nachlass existiert. Dieses quadratische Siegel aus grünlicher Jade, das den Namen Consten sogar fünffach – mongolisch, mandschurisch, tibetisch, chinesisch und deutsch – wiedergibt, stützt die These von der phonetischen Namenswiedergabe. So werden beispielsweise die drei chinesischen Schrift- bzw. Silbenzeichen kan-sı-ting gelesen. Die Bedeutung der Zeichen allerdings, so könnte das Gegenargument wiederum lauten, spielt auch eine Rolle. Deren Auswahl geschieht allgemein mit großer Sorgfalt und unter Konsultation des „I Qing“ oder eines anderen Orakelbuchs. Denn die Schriftzeichen müssen „glückbringend“ sein und die gesellschaftliche Stellung des Namensträgers unterstreichen. Die für Hermann Consten ausgewählten Zeichen verweisen in der Tat auf einen besonderen Anlass. Frei übersetzt könnten sie nämlich 270 lauten: Anerkennung (im) Kaiserlichen Audienzsaal (bringt) Frieden. Endgültige Klarheit, dies zeichnete sich im Verlauf der Recherchen zur Biografie Hermann Constens ab, könnte einzig die mit dem Staatssiegel des Bogd Chan versehene Verleihungsurkunde bringen, die sich noch im Mongolischen Staatsarchiv befinden müsste. Im Sommer 2008 und erneut 2010 verbrachte ich jeweils mehrere Wochen in Ulaanbaatar, um, unterstützt durch den jungen Historiker R. Tördalaj, der die in Altmongolisch verfassten handschriftlichen Urkunden noch zu lesen vermag, die Suche aufzunehmen. Eines wurde bei den mühseligen Recherchen immerhin evident: bei dem Seidengewand auf dem Consten-Porträt handelt es sich in der Tat um das für einen „Gun“ vorgeschriebene Sommergewand, auch sein Hutschmuck ist der eines „Gun“. Das Wintergewand ist gemeinhin aus goldfarbenem Brokat und mit Zobelfellen gefüttert, heißt es in einer Vorschrift aus der Herrschaftszeit des Jebtsundampa Chutagt. Auch ein golddurchwirktes, pelzgefüttertes Gewand befindet sich in Constens Hinterlassenschaft. In Anbetracht der frostigen Temperaturen des mongolischen Winters dürfte er, falls die feierliche Ernennung zum „Gun“ damals stattgefunden hat, wohl dieses warme Gewand und nicht das blaue getragen haben. Und noch 168
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
ein Fund war immerhin ein kleiner Trost und Hoffnungsschimmer: Etliche der von Consten in den Jahren 1911 und 1912 gemachten Fotoaufnahmen von den wichtigsten Akteuren und Ereignissen der staatlichen Unabhängigkeit existieren in eigenhändig von ihm angefertigten, seinerzeit großzügig an seine mongolischen Freunde verschenkten Abzügen auch heute noch in der umfangreichen Bildsammlung des Mongolischen Staatsarchivs. Nur ist dort nirgends vermerkt, wer der Fotograf gewesen ist. Kurz nach dem Jahreswechsel 1912 macht sich Hermann Consten auf den Heimweg nach Moskau. Am Eröö fällt ihm der Exodus der chinesischen Goldschürfer auf. Er hat schon gehört, Baron von Groth trage sich mit dem Gedanken, sein Bergbau-Unternehmen Mongolor angesichts der chinesenfeindlichen Stimmung und der Abwanderung seiner Arbeiter zu verkaufen. Ein verlockender Gedanke schießt ihm durch den Kopf, der während der langen Rückreise zum Plan reift: bei Mongolor könnte er doch einsteigen – vorausgesetzt er findet einen deutschen Geldgeber. Der eigene Vater kommt wohl nicht in Frage. Die Erinnerung an dessen einstige Weigerung, ihm die nötigen Mittel für den Kauf einer Farm in Afrika zu geben, schmerzt noch immer. Am letzten Januartag 1912 erreicht Hermann Consten die mongolisch-russische Grenze. In Kjachta liegt für ihn ein Telegramm – aus Aachen. Darin teilt ihm Bruder Franz mit, er möge umgehend nach Hause kommen, der Vater sei am 29. Januar verstorben. Die Prophezeiung des Chutagt hat sich also erfüllt. War seine erste Regung beim Erhalt der Todesnachricht Erleichterung – oder doch ein wenig Trauer? Ein leises Bedauern vielleicht, dass er sich mit dem Vater nicht mehr ausgesöhnt hatte? Mehr als sieben Jahre liegt sein letzter Besuch in Aachen mittlerweile zurück. Seine Familie, die ihm immer irgendwie fremd war, hat ihn in diesen sieben Jahren kaum beschäftigt – allenfalls wenn er mal wieder Geld benötigte. Der Vater, dies wird dem bald 34-Jährigen nun klar, ist nicht einmal 60 Jahre alt geworden. In Moskau wird sich Hermann Consten diesmal nicht lange aufgehalten haben; auf der Rückreise nach Deutschland macht er aber noch Zwischenstation in St. Petersburg und Berlin, er spricht in der Kaiserlich Deutschen Gesandtschaft und im Auswärtigen Amt vor. Gegenstand seiner Unterredungen mit den Diplomaten von Lucius und von Maltzahn dürfte der Wunsch des Bogd Chan nach Anerkennung des frischgebackenen Staates 169
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Mongolei gewesen sein; Consten dürfte in diesem Zusammenhang die strategische Bedeutung und das noch unerschlossene wirtschaftliches Potential besonders hervorgehoben haben. In der zweiten Februarhälfte 1912 ist Consten in Aachen. Es gibt Erbschaftsdinge zu regeln. Auch wenn er als Ältester der acht Consten-Söhne nie Interesse gezeigt hat, das Geschäft zu übernehmen, bei den Entscheidungen über die Zukunft der väterlichen Brauerei will er ein Wort mitreden, hängt doch seine persönliche Existenz ganz wesentlich mit von dem Ertrag des Brennerei- und Braubetriebs ab. Er muss feststellen, dass praktisch schon alles geregelt ist. Der Vater hatte in seinem Testament offenbar verfügt, dass das Consten’sche Vermögen beisammen bleibt. Dennoch scheint es harte Auseinandersetzungen gegeben zu haben. Hermann Constens Aufenthalt in Aachen zieht sich jedenfalls länger hin als er ursprünglich geplant hatte. Dies ist seinem Schriftverkehr mit dem Deutschen Generalkonsulat in Moskau zu entnehmen. Dort geht am 13. März 1912 ein in Aachen aufgegebenes Handschreiben Constens an Dr. Kohlhaas ein, in dem dieser mit Datum 9. März auf weißem Büttenpapier mit Trauerrand mitteilt: Sehr geehrter Herr Konsul. Ich möchte Sie höflichst bitten, mir bei der russischen Regierung die Einfuhrerlaubnis für einen sogenannten Drilling (zwei Schrotläufe und ein Kugellauf) sowie für einen Browning Nr.105148 nebst je hundert Kugelpatronen zu erwirken, da ich diese Waffen sowie die Munition für meine Expedition in die Mongolei notwendig brauche. Nach Moskau würde ich Mitte März zurückkehren. Herrn Botschaftsrat v. Lucius sowie Herrn Botschaftssekretär v. Maltzahn habe ich gesprochen; letzteren suchte ich in Berlin auf. – In der Erwartung, dass es Ihnen, sehr geehrter Herr Konsul noch gelingen wird, bis Mitte März alten Stils mir die gewünschte Erlaubnis noch herauszuholen, bin ich mit allen guten Wünschen 271 Ihr ganz ergebener Hermann Consten.
Konsul Kohlhaas antwortet Consten, er habe die deutsche Gesandtschaft in St. Petersburg gleichen Tags gebeten, die Einfuhrerlaubnis für Waffen und Munition bei der russischen Regierung zu beantragen. Erfahrungsgemäß dauere die Genehmigung aber zwei bis drei Monate. Er könne die Waffen 170
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
also nicht in seinem Reisegepäck mit sich führen, sondern müsse sie per Fracht schicken und könne sie sich erst nach Erhalt der Genehmigung beim Moskauer Zoll abholen. Außerdem bittet er Consten um Angabe des Kali272 bers der Drillingswaffe. Kohlhaas hört über zwei Monate lang nichts mehr von Consten. Erst am 23. Mai 1912 meldet er sich wieder, immer noch aus Aachen. Er entschuldigt sich für die späte Beantwortung des Schreibens, das ihm „durch ein Versehen“ erst am selbigen Tag „zu Händen“ ge273 kommen sei und liefert die gewünschten Angaben zu seinen Waffen. In der zweiten Juli-Woche schließlich meldet sich Consten im Moskauer Generalkonsulat zurück. Aus den wenigen Tagen, die er in Aachen verbringen wollte, waren fünf Monate geworden. Hauptgrund für sein langes Fernbleiben war sicher die familiäre Auseinandersetzung um die Zukunft des väterlichen Unternehmens. Sie endete damit, dass es, wie dem Aachener Handelsregister zu entnehmen ist, als GmbH von der Familie weitergeführt wurde. Am 20. Juni 1912 wurde ein entsprechender Gesellschaftervertrag unterzeichnet und notariell beglaubigt. Die Witwe Hermann Josef Sebastians wurde als Geschäftsführerin auf Lebenszeit bestellt, Hermanns jüngerer Bruder Franz als zweiter Geschäftsführer zunächst für fünf Jahre eingesetzt. Das gesamte vom Vater hinterlassene Vermögen „einschließlich der zu beiden Ehen gehörenden Vermögensmassen mit Aktiven und Passiven“, insgesamt 480.000 Reichsmark – heute entspräche diese Summe etwa sieben Millionen Euro –, bildete das Stamm274 kapital der neuen GmbH. Hermann Consten war, wie auch seine übrigen Geschwister, als Gesellschafter an dem Unternehmen beteiligt. Er war also nicht ganz unvermögend. Doch da er außer der zu erwartenden jährlichen Ausschüttung seines Gewinnanteils keine sonstigen regelmäßigen Einnahmen hatte, besaß er auch weiterhin wenig liquide Mittel. Offenbar gab es aber noch einen zweiten Grund für den Aufschub seiner Rückkehr nach Russland. Und der hing mit seinen eigenen Zukunftsplänen in der Mongolei zusammen. Hermann Consten suchte die Brüder Reinhard und Max Mannesmann auf, die – neben ihren weltberühmten Röhrenwerken in Remscheid und Komotau und der Produktion von Gasglühlampen, neben großen Ländereien und Bergwerken in Marokko – eine Motoren- und Lastwagenfabrik in Aachen betrieben. Es gelang ihm, sie für seine Geschäftsidee zu interessieren, die Bodenschätze der Mongolei mit 171
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
deutschem Know-how und deutschem Geld zu einer einträglichen Rohstoffbasis für die Industrie- und Handelsunternehmen des Deutschen Reiches zu machen. Bei seiner Rückkehr nach Moskau im Juli 1912 unterbreitete er Vizekonsul Hauschild, der Konsul Kohlhaas während dessen zweiter 275 Zentralasienreise vertrat, in einem vertraulichen Gespräch, über das Projekt. Dieser informierte umgehend Reichskanzler Bethmann Hollweg und teilte diesem unter dem 12. Juli 1912 mit: Eurer Exzellenz beehre ich mich gehorsamst zu melden, dass nach mir gemachten Mitteilungen ein deutsches Konsortium, an dessen Spitze eine große deutsche Interessengruppe steht, beabsichtigt, in der Mongolei Goldminen und Handelsrechte zu erwerben und die Ausbeutung auf dem Wege über China zu betreiben. Die Mitteilung ist mir von einer mit den zentralasiatischen Verhältnissen genau vertrauten Persönlichkeit gemacht worden, die mit den Unterhandlungen betraut ist und die Gebiete unter dem Deckmantel [sic] wissenschaftlicher Studien bereist. Ich habe die Angaben mit der ausdrücklichen dringenden Bitte erhalten, davon keinen Gebrauch zu machen, sie nur als persönliche Orientierung aufzufassen, glaube aber nicht verfehlen zu dürfen, Eurer Exzellenz wegen der Bedeutung der Angelegenheit Meldung erstatten zu sollen. Doch darf ich Eure Exzellenz gehorsamst bitten, die mir gemachte Mitteilung als streng vertraulich behandeln zu wollen, da mein Gewährsmann von einem Bekanntwerden der geplanten Unternehmung nicht nur deren Scheitern und erhebliche materielle Verluste, sondern auch eine Gefährdung seiner persönlichen Sicherheit in der Mongolei von russischer Seite glaubt erwarten zu müssen. Ich habe ihm erklärt, dass die Unternehmung ganz allein auf sein Risiko geschehen müsse, dass ich die mir gemachten Angaben lediglich zur Kenntnis genommen habe und ihm die Wahrung der von ihm 276 vertretenen Interessen ausschließlich selbst überlassen müsse.
Die Nachricht scheint in der Berliner Reichskanzlei mit einiger Verwunderung zur Kenntnis genommen worden zu sein. Man forderte nähere Einzelheiten an. Unter dem 29. Juli informierte Hauschild in einem ausführlichen Schreiben unter dem Betreff „Deutsche Unternehmungen in der Mongolei. Projekt einer Ausbeutung der Bodenschätze u. Exportartikel. Vorschläge des deutschen Forschers Consten für die Fa. Mannesmann“ und mit dem 172
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
Geheimkurier-Vermerk „Durch sichere Gelegenheit“ Bethmann Hollweg darüber, um was es im Einzelnen ging. Der Bericht gibt Aufschluss, wie viele Informationen über Mongolor Hermann Consten bereits in Erfahrung gebracht hatte. Dazu teilte Hauschild dem Reichskanzler u.a. folgendes mit: Eurer Exzellenz beehre ich mich gehorsamst zu melden, dass der Unternehmung […] ein Projekt zugrunde liegt, für das der deutsche Forscher, Herr Hermann Consten, hier das Interesse der Gebrüder Mannesmann gewonnen hat. […] An der Verwertung der Bodenerzeugnisse des Landes sowie an Grund und Boden selbst haben sich speziell die Chinesen einen erheblichen Anteil zu sichern gewusst. Sie sind aber in ihrer günstigen wirtschaftlichen Stellung seit dem Erfolge der mongolischen Selbständigkeitsbestrebungen stark geschädigt oder mindestens bedroht. Namentlich 277 der ehemalige chinesische Gouverneur der Mongolei, von Groth, ein Mann deutsch-russischer Abstammung, besitzt noch aus früherer Zeit her große wirtschaftliche Gerechtsamen in der Mongolei. […] Hauptsächlich in Betracht kommt in dieser Hinsicht eine etwa 80 Werst südlich von Kiachta bei Iro [Eröö] auf mongolischem Gebiete gelegene Goldmine, die 278 noch in Betrieb ist und sehr gut geht.
Derzeit seien, so Hauschild, etwa 30-40 claims in Betrieb, die in der genannten Gegend verstreut lägen. Das Gold komme in sogenannten Nestern im Sande vor. Amerikanische Unternehmer hätten bereits vor einigen Jahren gemeinsam mit Groth die rationelle Ausbeutung der Minen durch sogenannte Draga-Maschinen erprobt. Sie seien aber nicht auf ihre Rechnung gekommen und von Groth ausgezahlt worden. Hauschild fuhr fort: Für die Annahme, dass letzterer voraussichtlich zum Verkauf seiner Minenrechte geneigt sein wird, spricht die Erwägung, dass er […] seine Position in der Mongolei nicht für besonders stark, seinen Rechtstitel für anfechtbar halten und namentlich den immer mehr Boden gewinnenden Russen gegenüber mit einem etwaigen Angebote zum Ankauf seiner Minen wenig Anklang finden wird, da man ihm entgegenhalten kann, dass die Mongolei mit ihren Bodenschätzen ja doch über kurz oder lang Russland wie eine reife Frucht in den Schoß fallen müsse, wobei dann seine Rechte schwerlich als wohlerworben in vollem Umfange geschützt würden. Eine Einigung mit Groth, eventuell auf der Basis seiner nominellen 173
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Mitbeteiligung, erscheint somit nicht unwahrscheinlich. Auch wird eine Unterstützung durch den Chutagt in Urga, der sich beständig in Geld279 schwierigkeiten befindet, angestrebt.
Consten hatte aber, wie aus dem Bericht Hauschilds an Bethmann Hollweg weiter hervorgeht, den Brüdern Mannesmann noch ein weiteres Projekt in Aussicht gestellt, offenbar in der Absicht, nach der Ausschaltung der Chinesen ein künftiges russisches Handelsmonopol in der Mongolei zu verhindern und dem zu gründenden deutschen Firmenkonsortium einen beträchtlichen Anteil am Handel zu sichern: Hand in Hand mit diesen Absichten geht der Plan, eine großangelegte Exploitierung der Exportartikel des Landes in die Wege zu leiten. In Betracht kommen dafür hauptsächlich: Häute, Fleisch (besonders Hammelfleisch), Pferde, Kamele, Kamelwolle und Yaks. Die Vorarbeiten sind hier jedenfalls bei weitem schwieriger, wenn ein Gewinn für das Unternehmen sichergestellt werden soll. Geplant ist die Aufstellung von Stores [Lagerhäusern], wobei beabsichtigt wird, die bereits im Lande befindlichen, den ausgewiesenen Chinesen gehörigen Anlagen dieser Art zu benutzen, überhaupt eine Vereinbarung mit diesen früheren Eigentümern zu treffen, eventuell Land von ihnen zu erwerben und die Niederlagen deutsch-chinesischen Aufsehern, eventuell aus dem Kiautschau-Gebiete zu unterstellen. Denn die Ausfuhr der gewonnenen Handelsartikel würde – abgesehen von dem von Russland stets gerne genommenen Golde – voraussichtlich wegen des zu erwartenden Widerstandes von russischer Seite […] über Kalgan zu erfolgen haben. Der Transport könnte, da der Boden (meist Löss) sich dazu eignet, während eines Zeitraumes von neun 280 Monaten durch Automobile vermittelt werden.
Consten habe, so Hauschild weiter, mit den Gebrüdern Mannesmann über die Aussichten des geplanten Unternehmens verhandelt. Er gehe auf eigene Rechnung in den nächsten Tagen wieder in die Mongolei, um die praktischen Voraussetzungen zu prüfen. Er werde Goldproben mitbringen, sich über die Ausdehnung, Art und Stärke der Mongolor-Mine und die Arbeiterverhältnisse informieren sowie Viehbestand, Regenmenge, Ackerland und Fruchtbarkeit des Abbaugebiets studieren, „um einen Anhalt für die Besiedelungsfähigkeit der Minengegend zu gewinnen“. Die Verlegung des 174
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
Hauptumschlagplatzes von Urga nach „einem dem russischen Einflusse weiter entrückten, neuen Punkte“ mache „Feststellungen über die Art und Menge der Waren, die Preise, den Zahlungsmodus, die Transportkosten bis Tientsin“ erforderlich. Außerdem solle „an Ort und Stelle der Plan einer Organisation entworfen werden“. Zunächst also gehe es, wie Hauschild dem Reichskanzler in seinem Bericht über Constens Pläne erläuterte, nur darum, die Realisierbarkeit eines solchen Vorhabens zu sondieren. Consten sei zwar selbst am Zustandekommen des Projekts „materiell interessiert“, doch würden die praktischen Schwierigkeiten von beiden Seiten keineswegs unterschätzt. Deshalb, wie auch noch aus einem anderen Grund, gebe es derzeit noch keine bindenden Abmachungen zwischen Mannesmann und ihm. Ein Eingehen der Gebrüder Mannesmann auf seine Vorschläge wird, wie mir Herr Consten selbst sagte, außer von diesen an und für sich, davon abhängen, dass die deutschen Unternehmer, wie sich diese selbst ausge281 drückt haben sollen, „Luft in Marokko“ bekommen. Für den Fall eines Zustandekommens des Unternehmens beabsichtigen die Gebrüder Mannesmann, sich selbst mit 60% an dem Unternehmen zu beteiligen und den Rest anderweit aufzubringen. Die zur Realisierung der Projekte nötigen Summen, die sich bis jetzt auch nicht annähernd angeben lassen, 282 werden jedenfalls Millionen betragen müssen. […]
Der Bericht des Vizekonsuls muss in der Reichskanzlei nicht gerade Begeisterung hervorgerufen haben, in jedem Fall zeigte sich das ebenfalls vertraulich instruierte Auswärtige Amt alarmiert. Unter den Dokumenten im Politischen Archiv des AA befindet sich der handschriftliche Entwurf einer Antwort auf Hauschilds Bericht, die zu großer Vorsicht riet: Ew. pp. ersuche ich die weitere Entscheidung des im untenbezeichneten Bericht behandelten Unternehmens nach Möglichkeit im Auge zu behalten und über etwaige Wahrnehmungen zu berichten. Dabei bitte ich jedoch aus der höher zu beobachteten Zurückhaltung nicht herauszutreten und alles zu vermeiden, was den Eindruck amtlichen Interesses verraten könnte. Sollten Sie unauffällige Gelegenheit zu einer nochmaligen Unterredung mit den Beteiligten finden, so wollen Sie, ohne einen Auftrag erkennen zu lassen, Ihrer persönlichen Auffassung dabei Ausdruck geben, 175
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
dass Sie als Kenner russischer Verhältnisse nur dazu raten könnten, zwecks glücklicher Erreichung künftiger Beziehungen russische Interessenten für das Projekt zu gewinnen und demnächst das Unternehmen selbst tunlichst unter russischer Flagge zu begrüßen. 283 gez. v. Langwerth, Graf Mirbach
Die Reichsregierung befürchtete also, ein wirtschaftlicher Einstieg zulasten Russlands durch ein deutsches Konsortium in der Mongolei, einem noch von keinem anderen Land anerkannten Staat, könnte negative Reaktionen von russischer Seite zur Folge haben. Nicht erwähnt ist in dem Antwortentwurf, dass auch handelsvertragliche Bindungen mit China einem direkten deutschen Engagement in der Mongolei entgegenstanden. Der durch die Präsenz des Mannesmann-Konzerns in Marokko mitverursachte langjährige Streit mit Frankreich, der fast zu einem Krieg geführt hätte, könnte ein dritter Grund für die auffallende Scheu der Berliner Außenpolitiker gewesen sein, dem geplanten Mongolei-Projekt staatliche Rückendeckung zuzusichern. Man wollte sich nicht noch einmal die Finger verbrennen. Hermann Consten aber ist entschlossen, den Auftrag der Brüder Mannesmann in jedem Fall zu erledigen, der im Erfolgsfall auch bei ihm finanziell zu Buche schlagen würde. Einen weiteren Geheimauftrag gibt ihm Vizekonsul Hauschild mit auf den Weg. Consten soll in Urga Nachforschungen zu einem mysteriösen Mordfall anstellen, bei dem um den Jahreswechsel 1911/12 der deutsche Braumeister Xaver Dittenhofer sein Leben verlor. Gemeinsam mit seinem österreichischen Kompagnon Bruno Heinrich hatte Dittenhofer in der mongolischen Hauptstadt eine Bierbrauerei betrieben, die erste des Landes überhaupt. Ausgerechnet in den denkwürdigen Tagen der Euphorie der Mongolen über den Sturz der Qing und ihre praktisch ohne Blutvergießen errungene Unabhängigkeit, nur wenige Tage nach der feierlichen Inthronisation des Bogd Chan, war dieser brutale Mord geschehen. Der Täter hatte Dittenhofer, während dieser sich in der Küche seines Hauses sein Abendessen zubereitete von hinten mit einer Axt erschlagen. Man fand ihn anderentags, in seinem Blute liegend, in der Hand noch die Gabel haltend, mit der er sich gerade Bratkartoffeln aus einer Pfanne auf dem Herd auf seinen Teller schieben wollte. Die mongolischen Ermittler hatten einen Raubmord vermutet; man hatte einen Chinesen als Täter festgenommen und in dem 176
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
grauenvollen Stadtgefängnis zu Tode gebracht. Verdacht war auch auf den Partner Bruno Heinrich gefallen, der jedoch nicht verhaftet wurde. Für die Mongolen war damit der Fall erledigt, für die Behörden im fernen Deutschland jedoch nicht. Der russische Konsul Ljuba hatte pflichtgemäß der Gesandtschaft des Zarenreiches in Peking über den Mordfall berichtet. Xaver Dittenhofer sei auf dem russischen Friedhof in Urga beigesetzt worden, teilte er in seiner Depesche mit. Über dessen Nachlass bestehe ein mit Bruno Heinrich geschlossener Vertrag, der im Falle, dass einer von ihnen sterbe, den jeweils anderen als Alleinerben des Brauereiunternehmens bestimme. Der russische Gesandte in Peking unterrichtete entsprechend seine Kollegen des deutschen und des österreichisch-ungarischen Kaiserreiches und ersuchte um die Erteilung von Vollmachten zur Erbschaftsregelung durch den russischen Konsul in Ich Chüree. Dies schien jedoch nicht so einfach zu sein. Schließlich hinterließ Dittenhofer, der aus der Gegend von Nürnberg stammte, Familie in Deutschland. Es musste also geklärt werden, ob dort eventuelle Erbansprüche bestanden. Die Regierung des Königreichs Bayern und die Reichskanzlei in Berlin wurden eingeschaltet. Das Auswärtige Amt in Berlin wies seine Konsulate in Moskau, Odessa und Tientsin an, weitere Erkundigungen einzuholen, neue Erkenntnisse ließen aber auf sich war284 ten. Nun also sollte Consten, der beide Braumeister übrigens gut kannte, an Ort und Stelle herausfinden, was sich tatsächlich abgespielt hatte. Nachdem endlich die Waffen aus Aachen eingetroffen und vom Moskauer Zoll freigegeben worden sind, nachdem schließlich auch noch sein Reisepass bis Ende 1913 verlängert wurde, bricht Consten um den 7. August 1912 ein weiteres Mal gemeinsam mit dem russischen Konsul Walter in die Mongolei auf. Der Konsul ist diesmal in Begleitung seiner jungen Ehefrau, was Consten Gelegenheit gibt, in manchen gefährlichen Momenten der beschwerlichen Reise, den Ritter zu spielen. Wieder reist man über Bijsk und Koš-Agač. In Chovd (Kobdo) hat sich die Lage gefährlich zugespitzt, wie die Gruppe an der Grenze erfährt. Da die Fürsten der WestMongolei sich einem Anschluss ihrer Gebiete an das neugegründete mongolische Staatsgebilde mit dem Jebtsundampa Chutagt als Bogd Chan hartnäckig widersetzen, ist es im Raum Chovd zu einem militärischen Schlagabtausch gekommen. Die Stadt fiel am 6. August in die Hände der 177
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Chalch-Mongolen. Sie ist nahezu vollständig zerstört, tausende Einwohner sind auf der Flucht oder tot. Die deutsch-russische Reisegruppe droht also erneut in den Wirbel der Ereignisse zu geraten. Da ihm der Weg über Chovd zu riskant erscheint, zieht Konsul Walter es vor, auf dem nördlichen Weg direkt nach Uliastaj zu reisen. Consten schließt sich zwar an, nimmt sich aber insgeheim vor, bei passender Gelegenheit nach Chovd abzubiegen, um die zerstörte Stadt selbst in Augenschein zu nehmen. Am Chovd gol (Kobdo-Fluss) kommt es zu einem überraschenden Wiedersehen mit Gung Chajsan (Ming Bao), der eine Abteilung Chajlar-Mongolen gegen den chinesischen Gegner ins Feld geführt hat: War das ein frohes Wiedersehen! Wir begeben uns zu seinem Prunkzelt, wo ich auf das kostbarste bewirtet werde. Dann brechen wir auf. Dicht am Flusse lassen Ming Bao und ich die mit Beute beladenen Mongolen an uns vorüberziehen. Manch freudiger Zuruf begrüßt uns. […] Ich traf darunter auch manchen alten Bekannten von meinen früheren Reisen in der Mongolei her. […] Ein langer Händedruck für mich und die Bitte, nur ja nicht die Mauserpistolen zu vergessen, dann jagen sie hinter ihren Truppen her. Traumverloren sehe ich den mongolischen Soldaten nach, so müssen die Hunnen, die Mongolen Tschengis-Chans und Kubilais und die des Timur-Lan ausgesehen haben. […] Ming Bao, der flüchtige Prinz aus dem Geschlechte des Tschengis-Chan, wendet langsam seinen Schimmel, ein spöttisches Lächeln um die Lippen. „Komm, Gun-Dschi-Djan, was schaust du ihnen so nach, die Wölfe sind satt, sie beißen einstweilen nicht mehr, und die Zeiten, wo sie unter Führung meiner Familien Asien eroberten, sind unwiderruflich dahin.“ […] Ich verspreche ihm, so schnell wie möglich nach Uliastaj zu kommen, um mich dann ganz offen auf 285 Seiten der Mongolen zu stellen. Dies zu tun, hat Consten gute Gründe, über die er sich allerdings nicht näher auslässt. Nach der Begegnung mit Gung Chajsan, der ebenfalls nach Uliastaj ziehen will, verzichtet er einstweilen auf den Besuch des zerstörten und ausgeplünderten Chovd und schließt wieder zu Konsul Walter und seiner Kosaken-Eskorte auf. Nach einem offenen Streit ist das Verhältnis gespannt, fast feindselig. 178
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
In Uliastaj findet Consten Unterkunft bei dem chinesischen Großkaufmann Li Ninfa und beginnt, Wirtschaftsdaten über die Mongolei für Mannesmann zu sammeln. Was ihm früher eher nebensächlich erschien, wird ihm nun zur Obsession. Systematisch wertet er den soeben erschienenen Bericht einer Handelsexpedition führender Moskauer Kaufleute aus, die 1910 das Land be286 reist hatte. Er notiert sich die Orte, wo es russische Handelsniederlassungen gibt, schreibt ganze Listen von Waren und ihren Preisen ab, vergleicht die statistischen Angaben mehrerer Jahre. Er studiert das Konsumverhalten der Mongolen, fotografiert die stattli- Abb. 9: Als Gast beim chinesischen chen Anwesen russischer und chi- Großkaufmann Lininfa, 1912 nesischer Handelsherren, die ärmlichen Behausungen der Mongolen und ihre Bewohner. Mit dem kundigen Li Ninfa, der, bevor er nach Uliastaj kam, einige Jahre in Irkutsk, Nižni Novgorod und Moskau gelebt hatte, unterhält er sich an langen Abenden, die sie gemeinsam beim Essen oder auf dem Kang, dem gemauerten Schlafplatz seiner elegant eingerichteten Wohnstube verbringen, eingehend über die russische Konkurrenz, die prekäre Finanzlage der mongolischen Fürsten, über Warentransporte und Handelswege, über Gebiete mit noch unerschlossenen Goldvorkommen. Lininfa erzählte mir von den Goldfunden der Chinesen in der Mongolei, die die Chinesen aber verheimlicht haben, um nicht die Gier ihrer eigenen Beamten sowie der Russen zu wecken. An Lininfa fieberte alles. Er wollte erst nicht mit der Sprache heraus, er hatte wohl einen heißen Schnaps mehr getrunken als sonst, denn sein Gesicht war brennend 287 rot. 179
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Auch an Uliastaj ist die mongolische Revolution von 1911 nicht spurlos vorübergegangen, denn auch hier hatten die Fürsten und hohen Lamas gezögert, sich der neuen Regierung des Bogd Chan anzuschließen, der chinesische Militärstatthalter war zunächst im Amt geblieben. Doch die Regierung in Ich Chüree setzte im Januar 1912 Soldaten ein, die Festung Uliastaj wurde eingeschlossen. Der Militärstatthalter gab die Festung kampflos auf und flüchtete sich unter den Schutz des russischen Konsulats. Konsul Walter ließ ihn, seinen Stab und weitere chinesische Bewohner unter Kosakengeleit über Koš-Agač nach Russland bringen, von wo aus sie mit der Transsibirischen Eisenbahn nach China zurückkehrten. In Constens Augen war dies alles ein von Russland sorgfältig eingefädeltes Spiel, um sich die Äußere Mongolei definitiv als Einflusssphäre zu sichern. Wenn er sich nun, wie er gegenüber Gung Chajsan geäußert hatte, offen auf die Seite der Mongolen stellte, so konnte das eigentlich nur bedeuten, dass er sie in Zukunft noch eindringlicher vor den Russen warnen und ihnen den „dritten Part288 ner“, nämlich das Deutsche Reich umso nachdrücklicher ans Herz zu legen gedachte. Desto wichtiger wurde es für ihn herauszufinden, was genau die Russen im Schilde führten, um ihnen da, wo sie bereits am Werk waren, zuvorzukommen. Immerhin, Uliastaj blieb weitgehend unzerstört. Doch sind Spuren der Verwüstung unübersehbar, die Behausungen der chinesischen Bauern sind abgebrannt oder niedergerissen, ihre Felder und Gärten geplündert, Umzäunungen beseitigt und Bewässerungsgräben zugeschüttet. Und oberhalb der Festung residiert jetzt der neue mongolische Generalgouverneur von Uliastaj und Chovd, Sartuul Cecen Van, vom Volk Cecen Bejs, „der weise Fürst“ genannt. Consten hält ihn für zu jung und unerfahren, um die Lage wirklich zu beherrschen. In seinen Augen ist er Wachs in den Händen der russischen Konsulatsvertreter, besonders seines Intimfeindes Xionin, dem als Erstem Constens Aktivitäten verdächtig vorgekommen waren. Mit veralteten Mauser-Karabinern aus Erfurt und französischen Bajonetten bewaffnet, sorgen mongolische Soldaten für die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Stadt, was sie aber nicht hindert, sich gelegentlich selbst an Plünderungen zu beteiligen. Die noch in Uliastaj verbliebenen Chinesen, unter ihnen etliche Kaufleute, können sich keineswegs sicher fühlen. Angesichts rapide schwinden180
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
Abb. 10: Gruppenfoto mit Hermann Consten (2. v.l.), dem russischen Konsul Walter, seiner Gattin und Konsulatsmitarbeitern. Rechts Konsulatssekretär Xionin, der Consten als Spion verdächtigte. Uliastaj 1912
der Vorräte bangen sie um ihre Existenz. Mehrere Karawanen mit Warennachschub aus China wurden ausgeplündert, ihre Tiere wurden geraubt. Gezielte Gerüchte und bürokratische Schikanen seitens der Russen tragen zur Verunsicherung bei. Sie sehen sich immer wieder genötigt, ihre Waren unter Preis an russische Händler abzugeben. Doch sind die Karawanenwege zu gefährlich geworden als dass sie es wagen könnten, die Stadt zu verlassen. Erst als Gung Chajsan mit seinen engsten Getreuen in Uliastaj eintrifft, bessert sich die Lage ein wenig. Notfalls greift der elegant gekleidete Kriegsherr, der seine Browning-Pistole an einer um den Hals gelegten gelben Seidenschnur trägt, auch persönlich ein. Allerdings fürchtet man neues Ungemach bei der bevorstehenden Rückkehr der Armee des mongolischen 289 Oberkommandierenden Manlaj Baatar Damdinsüren aus Chovd. Auch Russen sind im Anmarsch. Am 17. September 1912 – die Nächte sind bereits frostig – beziehen 120 Kosaken unter Führung von Fürst Uchtomski in Uliastaj Quartier. Wenig später trifft – von Chovd kommend, wo er als Sonderbeauftragter des Bogd Chan für die Befriedung der West-Mon181
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
golei die Kämpfe beobachtet hatte – Žalchanc Chutagt ein. „Dieser 17. September kann für die mongolische Geschichte ein denkwürdiger schwarzer Tag werden, denn es ist viel leichter eine noch so erbärmliche Festung zu 290 verschenken als sie später zurück zu bekommen“, notiert Consten. Mit einigem Unbehagen erlebt er anderentags den feierlichen Besuch der mongolischen Würdenträger im russischen Konsulat und im Anschluss daran die Parade der frisch eingetroffenen Kosaken vor dem Konsul und seinen hohen mongolischen Gästen. Es war damit eine kleine Verbrüderungsfeier, die mehr schon einer verkappten Annexion glich, verbunden. Ich sah mich veranlasst, diesen historischen Augenblick mit meinem Kinoapparat festzuhalten. […] Später wurden die Kasaken von den russischen Händlern im neuen Konsulatsgebäude bewirtet. Während ich meine photographischen Platten entwickelte, schallten die fröhlichen Hurras der Russen zu meiner Wohnung herüber. Die Reden, die gehalten wurden, sollen, nachdem sich die Mongolen kurz nach der Parade zurückgezogen hatten, ganz anders geklungen haben. Die Chinesen, die überall herumlungerten und spionierten, meinten, es wäre von einer Verbrüderung mit den Mongolen dabei ganz 291 und gar nicht die Rede gewesen, eher vom Gegenteil.
Während Consten noch mit dem Entwickeln seiner Fotos beschäftigt ist, er292 scheint Ming Bao und teilt ihm mit, der Gegeen Žalchanc Chutagt (in Constens Verschriftung: Dsal-Chen-Sen-Gegen) wünsche ihn zu sehen. Sie reiten gemeinsam zu seinem Lager vor der Stadt. Es liegt „etwas abseits von den Jurten der höheren mongolischen Offiziere, gleichsam als wolle er betonen, dass er mit ihrem blutigen Gewerbe nichts gemeinsam haben wol293 le“. In der Prachtjurte des hohen buddhistischen Würdenträgers findet Consten auch Militärgouverneur Sartuul Cecen Van (in Constens Verschriftung: Zezen-Beese) vor. Ich machte dem Gegen meine stumme Verbeugung, während Ming Bao den vorgeschriebenen Kotau vollführte. Hierauf erhob sich Dsal-ChenSen-Gegen, kam mir einige Schritte entgegen, begrüßte mich als seinen alten Freund und lud mich ein, zu seiner Rechten auf einem gelben Kissen an seiner Seite Platz zu nehmen, während Ming Bao ihm zur Linken unterhalb des Zezen-Beese, der auf einem blauen Kissen hockte, auf ei182
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs 294
nem roten Platz nahm. Sofort erkundigte sich der Gegen nach dem Ergebnis meiner letzten Reise und ließ sich nochmals die Einzelheiten meines Ritts Kobdo – Kosch-Agatsch und meiner Verfolgung durch die Chinesen, sowie meinen darauffolgenden Rückmarsch quer durch das von den Chinesen besetzte Gebiet Kosch-Agatsch – Kobdo – Uliastaj erzählen. Dann erkundigte sich der Gegen ganz unvermittelt nach Kaiser Wilhelm, wie viel Söhne er habe, ob er nicht bald in den Krieg gegen Russland ziehen würde, wie stark unsere Armee sei und ob alle unsere Soldaten so gute Mauserbüchsen und Pistolen hätten wie die von den Mongolen geführten Mauserkarabiner. Als ich meine Mauser, Modell 1910, herbeiholen ließ, wurde ihm der Unterschied zwischen ihren alten Karabinern und meiner Waffe sofort klar. Ich erzählte ihm nun, dass solche Schusswaffen, wie sie sie jetzt führten, für unsere Armeen schon nicht mehr gut genug wären usw. […] Ich hatte die seltene Ehre, von Dsal295 Chen-Sen-Gegen aufgefordert zu werden, mit ihm zu speisen.
Was folgt, ist eine ausführliche Beschreibung dieses sich über Stunden hinziehenden Mahls, der es begleitenden Gespräche und der Besiegelung dieser Freundschaft, indem Consten seine geliebte Shag-Pfeife dem Žalchanc Chutagt als Geschenk überlässt. Von nun an soll der Deutsche täglich bei ihm vorsprechen. Und auch das Verhältnis zu Cecen Bejs, dem Militärgouverneur, ist nun durch eine Vertrautheit geprägt, die es Consten ermöglicht, seine eigenen Ziele konsequent anzusteuern. Als ihn dieser nach dem gemeinsamen Mahl auffordert, ihn noch in seine eigene Staatsjurte zu begleiten, kommt Consten zur Sache. Hier fiel selbstverständlich jeder chinesisch-mongolische Etiquettenzwang weg, rauchend und plaudernd unterhielten wir uns auch hier von dem einzigen Thema, das uns am Herzen lag: „Was wird nun werden? Wird es gelingen, die Mongolei von jedem fremden Einfluss frei zu machen? Werden die Chinesen nochmals einen Versuch unternehmen, nach Kobdo und Uliastaj vorzudringen? Wird Russland durch den Balkankrieg nach Westen abgelenkt, hier im Fernen Osten den Chinesen, die im Stillen damit rechnen, im Westen werde sich ein allgemeiner europäischer Krieg entwickeln, energisch entgegentreten, oder die Mongolen im Stich lassen?“ Zezen Beese meinte zwar, wenn es wirklich schlimm kom183
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
men sollte, so wären ja Chutagt und Dsal-Chen-Sen-Gegen da, die durch ihre Gebete und ihre Wunderkraft schon den Mongolen zum Siege verhelfen würden. Ich konnte es nicht unterlassen, Zezen-Beese darauf aufmerksam zu machen, dass es viel praktischer und auch sicherer wäre, die Mongolen verließen sich weniger auf Gebete als auf ihre Tapferkeit und sorgten für die Ausbildung einer kleinen, gut bewaffneten Armee, denn der Herrgott wäre auch hier, wie in meinem Vaterlande, gewöhnlich mit 296 den stärksten und tapfersten Bataillonen.
Consten scheint bei seinen Bemühungen, den „dritten Partner“ ins Spiel zu bringen, ein gewisser Erfolg beschieden zu sein. Mit einer charmanten Mischung aus munterem Geplauder, aufregenden Foto-Sessions, Kinoabenden mit Frauen, Kind und Kegel, dann wiederum ernsthaften Gesprächen mit den in Uliastaj versammelten mongolischen Führern, ist es ihm offenbar gelungen, den Keim des Zweifels über die Zuverlässigkeit der russischen Partner und ihre wahren Absichten in die Herzen seiner politisch noch wenig erfahrenen mongolischen Freunde zu senken, ihr Begehren nach den „modernen Mordwaffen“ (Zitat Consten) der deutschen Rüstungsindustrie noch zu steigern. An einem der Abende, als er vor den versammelten Würdenträgern samt ihren Frauen und Kindern mit einem halb defekten Kinder-Kinoapparat simple Filmchen aus Deutschland auf ein weißes Leintuch wirft, das man unter dem breiten Eingang zur Prunkjurte des Žalchanc Chutagt aufgespannt hat, macht Consten die Bekanntschaft eines weiteren, noch recht jungen buddhistischen Mönchs, der ihn tief beeindruckt. Er be297 gegnet Diluv Chutagt, der als Reinkarnation eines hohen Lamas im Kloster Narobančin etwa 350 Kilometer südlich von Uliastaj nahe der Grenze zu China lebt und findet, er sei „ein äußerst sympathischer, angenehmer 298 Mensch“. Von nun an sieht man sich häufiger. Im Lager des Žalchanc Chutagt oberhalb von Uliastaj nimmt Consten nun fast regelmäßig an den gemeinsamen Beratungen über die militärische Lage in der West-Mongolei und die weiteren Entwicklungen in Ich Chüree teil. Bald gesellt sich noch eine weitere Schlüsselfigur des mongolischen Selbstbehauptungswillens dazu: der Oberkommandierende der mongolischen Streitkräfte und „Befreier“ von Chovd, Manlaj Baatar Damdinsüren. Wie Gung Chajsan stammt der Kriegsherr Damdinsüren aus der Inneren Mongolei, hatte sich dort als entschiedener Gegner der chinesischen Sied184
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
lungspolitik die Gunst der QingDynastie verscherzt, und sich 1910 den Unabhängigkeitsbestrebungen der zentralmongolischen Fürsten angeschlossen. Nun dient er dem Bogd Chan als Oberkommandierender einer erst im Entstehen begriffenen mongolischen Armee, die soeben vor Chovd ihre erste Bewährungsprobe erfolgreich bestanden hat. Nach der Vertreibung der Chinesen aus der westlichen Mongolei ist er mit seinen Truppen nach Uliastaj abgezogen, um dort zu überwintern. Consten scheint ihn bereits aus Chovd zu kennen. Auch mit ihm drehen sich die Gespräche hauptsächlich um Waffen. Bei den beiden hohen Geistlichen registriert Consten derweil eine gewisse Kriegsmüdigkeit. Sie sehnen sich nach der Stille ihrer Klöster. Deshalb beobachten sie mit Sorge, dass sich im Altaj-Bezirk einer der dort herrschenden Abb. 11: Gung Chajsan (Ming Bao). Uliastaj 1912 Fürsten, Herzog Palta (Polta 299 Van), weiterhin zu China bekennt und von dort mit Waffen und Ehrungen überhäuft wird und dass der mit den Chalch-Mongolen verbündete Žal Lama dabei ist, eigene Wege zu gehen. Wohl wissend, dass der Einfluss der Chalch-Mongolen in der Geschichte der Mongolei eigentlich nie bis in den fernen Westen, die Dsungarei, gereicht hat, wo andere Mongolenstämme ihre Weidegründe haben, scheut die in Uliastaj versammelte Runde einen weiteren Kriegszug. Auch gelten die Sympathien des Diluv Chutagt, der sich – so Constens Beobachtung – bei den Diskussionen in der Jurte des Žalchanc auffallend zurückhält, insgeheim wohl den Chinesen, „deshalb ist 185
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente 300
er der Regierung in Urga sowieso schon stark verdächtig“. Consten, der dank Li Ninfa über Informationen verfügt, wonach chinesische Truppen aus Urumqi und Guqen bei Cagaan Tungee zusammengezogen werden, um von dort aus erneut auf Chovd und Uliastaj vorzurücken, vermag sie immerhin davon zu überzeugen, „dass einstweilen ein starker Beobachtungs301 posten gegen Cagaan Tungee geschickt werden sollte“. Consten selbst soll auf Wunsch des Žalchanc Chutagt in östliche Richtung aufbrechen, als Geheimkurier die schriftlich festgehaltenen Beschlüsse der Runde samt einer Einschätzung der Lage in der West-Mongolei nach Nijslel Chüree bringen und sie dem Innenminister und Regierungschef, Sajn Noyon Chan, persönlich aushändigen. Allerdings soll er sich für seine Reise Zeit nehmen und unterwegs Vorsicht walten lassen. Denn in der Zwischenzeit haben in Nijslel Chüree offizielle russisch-mongolische Ver302 handlungen begonnen. Der Diplomat Ivan Jakovlevič Korostovec, als ehemaliger Gesandter in Peking einer der besten und erfahrensten Kenner des Fernen Ostens, soll als Bevollmächtigter der Zarenregierung mit den Mongolen einen Vertrag aushandeln, der den russischen Interessen nützt und der Mongolei nicht schadet. Letztlich geht es darum, den Mongolenführern schmackhaft zu machen, dass mit Rücksicht auf anderweitige vertragliche Verpflichtungen gegenüber China und Japan an eine staatliche Anerkennung nicht zu denken ist, wohl aber an die Anerkennung der Autonomie der „Äußeren Mongolei“, auch durch China, an Finanzhilfen und an eine Vertiefung der Handelsbeziehungen. Consten soll erst dann in Nijslel Chüree eintreffen, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind und ein Vertrag unterzeichnet wurde. Natürlich soll der russische Unterhändler nicht erfahren, dass er mit einem Auftrag des Žalchanc Chutagt in die Hauptstadt reist. Ihm selbst kommt die gewünschte Verzögerung insofern entgegen, als er Zeit für einige Abstecher in Gebiete gewinnt, wo große Goldfunde vermutet werden. Sorge bereitet ihm allerdings der unmittelbar bevorstehende Winter. Während sich dieser schon in der zweiten Septemberhälfte mit Schnee und Frost ankündigt, bereitet Consten seinen Abschied von Uliastaj vor. Er mietet Pferde, Kamele und Yaks, kauft Lebensmittelvorräte, Futter und Verpackungsmaterial ein, stellt gemeinsam mit seinem bereits auf früheren Reisen bewährten Karawanenführer Cend Aijuž (Zendé Aijusch) die Kara186
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
wane zusammen und packt seine Sachen. Besondere Sorgfalt verwendet er auf seine Fotoausrüstung. Die bereits entwickelten fotografischen Glasplatten mit hunderten von Aufnahmen aus Uliastaj samt seiner mongolischen, chinesischen und russischen Prominenz werden in Filz eingenäht und in wasserdichtes Segeltuch eingeschlagen. Auch Constens Gastgeber Li Ninfa ist dabei, Uliastaj zu verlassen. 120 weitere chinesische Händler wollen sich dem Großkaufmann anschließen. Ausgestattet mit einem durch Consten vermittelten Schreiben des Žalchanc Chutagt, das ihnen sicheres Geleit garantieren soll, wollen sie über Südsibirien nach China zurückkehren. Consten gibt Li Ninfa ein Schreiben an die Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft in Peking mit und schärft ihm ein, den Brief „nur, auch wenn es sein Leben koste, in die richtigen Hände gelangen 303 zu lassen“. Es ist anzunehmen, dass es sich um einen der vertraulichen Berichte zur Lage in der Mongolei handelte, die Consten über die deutschen diplomatischen Vertretungen in Russland und China der Reichsregierung in Berlin zukommen ließ. Ob der hier erwähnte Bericht die Pekinger Gesandtschaft je erreicht hat, ist nicht bekannt. Unter den China-Dokumenten im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes ließ sich für den fraglichen Zeitraum ein solcher Bericht von Constens Hand jedenfalls nicht identifizieren. Bevor Consten selbst am 19. Oktober 1912 endgültig aufbricht, wird er von den mongolischen Führern noch für seine Beraterdienste mit Geschenken überhäuft. Manlaj Baatar Damdinsüren lässt ihm 20 Meter der besten schwarzen chinesischen Seide überbringen. Consten gibt als Gegengeschenk „zwei Dutzend Bromsilberkarten mit Photographien von Dsal304 Chen-Sen-Gegen, Delobin und seiner Person“. Die Fotos gefielen Damdinsüren dermaßen, dass er von denen, die ihn selbst darstellten, gleich 35 weitere Abzüge bestellte. Assistiert von Li Ninfa, entwickelte Consten während ihrer letzten gemeinsamen Tage eine rege Tätigkeit als Fotolaborant, um alle Wünsche, die an ihn herangetragen wurden, zu befriedigen. Žalchanc Chutagt überreichte ihm zum Abschied neben bestickten Tabaksbeuteln und Pfeifenbehältern einen kostbaren alten chinesischen Armreif aus Nephrit mit eingeschnittenen Schriftzeichen, der Consten von nun an als Amulett durch sein weiteres bewegtes Leben begleiten wird und sich heute in seinem Nachlass befindet. 187
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Abb. 12: Žalchanc Chutagt und Diluv Chutagt (v. r.) beim gemeinsamen Festmahl. Uliastaj 1912
Um dieses Armband hat die Zeit eine Menge Legenden gewoben; so soll, wie der Gegen erzählte, noch jeder Träger des Armbandes eines unnatürlichen Todes durch sein Pferd gestorben sein. Jetzt sei jedoch der Fluch, der dem Armreifen anhafte, gebrochen, da das Stück seit etwa 500 Jahren in seinem Kloster oder in dem Kloster seiner Vorgänger aufbewahrt ge305 wesen sei.
Auch von den Angehörigen des russischen Konsulats in Uliastaj nimmt Hermann Consten Abschied. Mit Konsul Walter gerät er noch in ein Streitgespräch über die Bewertung des Balkankrieges. In dem Urteil über die durch den Krieg im fernen Europa mit bedingte, prekär werdende Lage der Russen in der Mongolei stimmen sie aber überein. Der Grund ist jedoch weniger eine eventuell von China als vielmehr von Japan ausgehende Gefahr für Russlands Zentralasien-Ambitionen. Denn die Russen in Uliastaj haben den Besuch der angeblichen japanischen Hauptleute Isome und Katsura im Jahre 1911 noch nicht vergessen. Damals konnte ich den beiden Japanern bei einer geheimen Besprechung 188
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
ins Gesicht sagen, dass ich in dem Einen einen General und in dem anderen den Sohn eines damaligen Führers der japanischen Opposition wieder erkannt hätte. Beide leugneten ganz und gar nicht und erklärten mir, dass sie im Interesse des japanischen Handels ihr Hauptaugenmerk auf die Dsungarei, die Innere Mongolei und das Chajlar-Gebiet richten wür306 den.
Konsul Walter zeigt sich in dem Abschiedsgespräch entschlossen, im Falle des Vormarschs chinesischer Truppen das Konsulat in Uliastaj aufzugeben und die Stadt zu verlassen; Consten sieht durch die drohende Gefahr eines umfassenden Kriegs in Europa Chancen sowohl für die noch ungefestigte mongolische Monarchie als auch für die junge Republik China und ihren neuen starken Mann: Yuan Shikai. Es beginnt eine lange und mühselige Reise. Schon am zweiten Tag wird Constens Karawane, der sich noch ein pilgernder Lama angeschlossen hat, mitten in den Bergen, an einem knapp 3000 Meter hohen Pass östlich von Uliastaj, von einem Zuud, einem heftigen Schneesturm überrascht, der vor allem für die Lasttiere zur Qual wird. Sie versinken förmlich im Schnee; mehrere Kamele brechen zusammen und müssen zunächst einmal mit ihren bewaffneten Treibern zurückgelassen werden. Einige mit Kisten beladene Yaks weigern sich weiterzugehen. Consten selbst fliegt von seinem stolpernden Reitkamel in eine Schneewehe. Nach Stunden schließlich, in denen man kaum die Hand vor Augen gesehen hat, erreicht die reichlich zerschundene Karawane eine Jurte, in der es heißes Wasser und Tee und auch einen Platz zum Schlafen gibt. Ähnlich schlimm sehen die nächsten Tage aus. Erst am 23. Oktober legt sich der Sturm, die Sonne kommt heraus und scheint bei Temperaturen von -20° auf eine geradezu märchenhafte Winterlandschaft. Für die Tiere bedeutet dies aber Hunger. Sie können kein Futter suchen; die in Uliastaj gekauften Vorräte an Heu und Hafer schwinden schon in den ersten Reisetagen. Nachts, bei -40°, heulen die Wölfe um das Lager. In einer einzigen Nacht verliert Consten fünf seiner Kamele, drei weitere legen sich wenig später zum Sterben nieder. Ihre strohgefüllten Rückenpolsterungen werden an die überlebenden Yaks und Pferde verfüttert, die auch das Gepäck übernehmen müssen; die Kadaver sind rasche Beute der umherstreifenden Wölfe. Erst allmählich klingt die extreme Kälte ab, bei der Ankunft der Karawane im nur noch leicht verschneiten örtöö 189
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Ar-Žirgalantu wird das volle Ausmaß des Tierverlustes sichtbar. Außer den Reittieren sind nur noch drei Kamele, vier Lastpferde und die Yaks übriggeblieben. Doch kann Consten frische Pferde und Kamele mieten und die Reise fortsetzen. „Vor sechs Tagen zog ich mit einer sterbenden Karawane durch Eis und Schnee. Jetzt fliegen wir, mit den besten Pferden verse307 hen, durch die sternklare Nacht!“ notiert er in seine kleine schwarze Tagebuchkladde. Beim nächsten örtöö begegnet er einem russischen Goldgräber namens Čumukov. Consten beschließt, die Karawane mit Cend Aijuž auf der Poststraße weiterreisen zu lassen, während er mit einem mongolischen Begleiter und zwei Kamelen in südöstlicher Richtung zu Čumukovs Lager am 308 Fluss Bajdrag und weiter in die Gobi ziehen will, „um dort Argali und Wildpferde zu schießen und um, während die Verhandlungen in Urga den Höhepunkt erreicht haben, auf Anraten des Dsal-Chen-Sen-Gegen für eine 309 Zeitlang zu verschwinden“. Seine Entscheidung wird durch den Erhalt einer zweiten Warnung von Žalchanc Chutagt bekräftigt, „einstweilen nicht nach Urga zu reisen und zwar – wegen der Russen“. Welches Risiko es bedeutet, die Karawane allein weiterziehen zu lassen, wird ihm bei der Begegnung mit einer Gruppe versprengter Soldaten klar, die als Räuberbande den Postweg entlang zieht und dort Angst und Schrecken verbreitet. Deren Hauptmann, Baatar Donoj ist allerdings krank und muss sich bei Consten in ärztliche Behandlung begeben – eine Szene, die er 310 in den Weideplätzen lebendig und farbig zu beschreiben weiß. Die Goldlagerstätten erreicht Consten am letzten Oktobertag. Das Wetter ist wärmer geworden, der Schnee ist verschwunden. Der weiche Ufersand des Bajdrag ist durchwühlt, Kiesgerölle und Schwemmerde sind nach Gold umgegraben. Schließlich bietet sich Consten und seinem Begleiter ein überraschender Anblick. Die Sonne steht schon tief über den schwarzblauen Gipfeln des Gebirges, als wir an eine Stelle kommen, wo der Baidarik sich ein mächtiges Tor in die ihm in seinem Lauf sich entgegenstemmende Gebirgskette gerissen hat. Hier gehen wir über den stellenweise zugefrorenen Fluss. Als wir das rechte Ufer erreicht haben und um einen der mächtigen Felsen herumbiegen, steigt hinter einer Hügelkette Rauch auf. Dort liegt die Jurte der russischen Goldgräber. Die Leute haben ihre Jurte inmitten einer jahrhunderte190
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
alten Gräberstadt aufgeschlagen. Ringsherum liegen die typischen Bestattungsstätten der Mongolen, Iriksur genannt. Es sind dies kreisrunde Steinhügel, die sich unter ganz bestimmten Gesetzen um einen großen Haupthügel herumgruppieren. Seltener kommen quadratisch von Steinen eingefasste Gräber vor. Etwa 200 m hinter der Jurte qualmt ein Feuer, wo311 mit die Goldsucher die gefrorene goldhaltige Erde aufzutauen versuchen.
Von einem der dort tätigen Männer, einem „echt sibirischen Hünen“, erfährt Consten, dass die Goldgräber „für Rechnung des russischen Großkaufmanns Sinizin aus Kiachta“ arbeiten. Mit dem Vorarbeiter Peter Orlov, der vorher in den Goldminen des Barons von Groth am Eröö-Fluss gearbeitet hatte, freundet er sich rasch an. Schon am nächsten Morgen gehen sie gemeinsam auf Argali-Pirsch. Sehr ergiebig scheint die Goldsuche am Bajdrag bis dahin nicht gewesen zu sein. Umso mehr wird Constens Neugierde für die Grabanlagen geweckt, als Orlov ihm erzählt, er habe am Rande eines der Iriksur ein Bronzeschwert gefunden. Es sei ihm allerdings kurz darauf gestohlen worden. So ganz glaubt ihm Consten wohl beide Geschichten nicht. Er möchte selbst herausfinden, was es mit dem Gold und den Gräbern auf sich hat. In einer schroffen Gegend voll mächtiger kahler Felsen wird ihm blitzartig klar, dass er es im Sinne des Wortes mit „Blend werk“ zu tun hat. Ringsherum liegt verwittertes Gestein, das, wenn es zufällig von einem vorüberhuschenden Strahl der untergehenden Sonne getroffen wird, sich plötzlich in Gold verwandelt. Das ist ein Blitzen und Glitzern ringsumher! Im Nu verstehe ich die Erzählungen der Mongolen über die blinkenden goldenen Gipfel der Berge am Baidarik. Aber alles ist nur Trug und 312 Schaumgold, das im Gestein eingesprengt hier herumliegt.
Nicht einmal das Jagdglück scheint ihm diesmal hold zu sein. Das begehrte Wild zeigt sich nicht. Beschämt und erschöpft kehren Consten und Orlov nach Tagen vergeblichen Umherkletterns im schroffen Felsgestein des südlichen Changai ins Lager der Goldgräber zurück und schlürfen ihre dünne Suppe – ohne Wildeinlage. Doch Orlov hat noch eine Geschichte auf Lager, die Constens Lebensgeister wieder weckt, die Geschichte über die Entdeckung einer Höhle, „deren ethnographischer Inhalt hochinteressant sein soll“. 191
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Soviel ich feststellen konnte, liegt der mir von Orlov beschriebene Platz in der Gobi, und ist von Tanzan-gol in einigen Tagemärschen zu erreichen. Mit der Höhle hat es nach seiner Erzählung folgende Bewandtnis. Bekanntlich ist es den Mongolen streng untersagt, den Boden zu durchwühlen, nicht einmal beackern darf der Mongole seine Heimaterde. Das hält ihn aber nicht ab, einzeln oder in Trupps, soweit es ihm seine Faulheit gestattet, trotz aller angedrohten Strafen die Erde nach Gold zu durchsuchen. Wird er dabei erwischt, so ergeht es ihm schlecht. So hatten denn auch eines Tages zehn Mongolen gegenüber dem Bogdo-ul die Erde nach Gold durchforscht und waren durch Zufall oder durch eine alte Überlieferung geleitet, auf eine Höhle gestoßen, deren Eingang sie freilegten. Der Eingang befand sich genau gegenüber dem auf dem Bogdo-ul befindlichen Obo in einer Talschlucht. Vom Eingang der Höhle, den Orlov behauptet selber gesehen zu haben, führt ein Stollen von etwa 20-30 m Länge in die Erde und erweitert sich hier zu einem großen geräumigen Raum, in dem die Mongolen eine Menge alter Silbersachen und angeblich auch altes Pelzwerk und seidene Gewänder fanden. Die Mongolen ließen sich in der Höhle häuslich nieder und versuchten die große steinerne Türe, die, wie sie wohl richtig annahmen, in die eigentliche Grabkammer mit den reichen Totengaben führte, zu öffnen. Aber, wie die Schatzgräber nachher behaupteten, gelang ihnen dies nicht, wie sehr sie sich auch anstrengten. Die Türe einfach zu öffnen ging deshalb nicht an, weil als Abschluss über der Türe ein mächtiger Felsblock lagerte, der sofort herunterstürzen und die Türe von Neuem zu versperren drohte, sobald man den Versuch machte, dieselbe zu öffnen. Vergebens versuchten die Mongolen links, rechts und unter der Türe durchzukommen. Hier stießen sie immer auf festen gewachsenen Fels, durch den sie mit ihren erbärmlichen Werkzeugen nicht durchkonnten. Mitten in dieser Wühlarbeit wurden sie überrascht und festgenommen. Sajn Noyon Chan, ein Nachkomme Dschingis Chans und der angesehenste Fürst in der Mongolei, war nämlich plötzlich erkrankt und die Lamas hatten aus ihren Büchern als den Grund dieser Erkrankung festgestellt, dass in seinem Aimak irgendwo in der Erde gewühlt und gearbeitet würde. Sofort wurden nun überall reitende Boten ausgeschickt, um festzustellen, wo die Übeltäter hausten. Da nun nirgendwo die Fama so 192
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
schnell arbeitet wie in der Mongolei, so war bald der Aufenthaltsort der Höhlenentdecker den Häschern bekannt, die dann auch die ganze Gesellschaft in der Höhle aushoben. Der zu der Höhle hineinführende Stollen musste von den Leuten bis weit über die Hälfte zugeschüttet werden. Die Übeltäter wurden dann fürchterlich gestraft. […] Ich hatte später Gelegenheit, Sajn Noyon Chan darüber zu befragen. Sajn Noyon Chan bestätigte mir das Vorhandensein der Höhle, wich aber allen näheren Fragen mit der diplomatischen Antwort aus: „Wenn du ein Interesse daran hast, gehe hin und untersuche die Höhle, nimm dir aber nur russische Arbeiter mit, denn die Mongolen werden schwerlich dort noch einmal arbeiten wollen.“ Orlov erzählte mir, dass Sajn Noyon Chan die in der Höhle gefangenen Mongolen fürchterlich martern ließ und nachher alle hinrichtete. Sobald die Hinrichtung vollzogen war, soll Sajn Noyon Chan gesund 313 geworden sein.
Diese Geschichte ist nicht nur wegen des plötzlich wieder erwachten ethnographischen Interesses Hermann Constens von Belang. Sie nimmt auch schon seine spätere direkte Begegnung mit dem mächtigen Innenminister der Bogd-Khan-Regierung, Sajn Noyon Chan vorweg, dem er die Schreiben von Žalchanc Chutagt zu übergeben hat. Und sie enthält den entscheidenden Hinweis auf ein Vorhaben, das ihn über mehr als 15 Jahre wie eine fixe Idee begleiten und ihn Ende der zwanziger Jahre ein weiteres Mal in die Mongolei führen wird. Er will, er muss diese Höhle erkunden. Und schließlich scheint ihm auch das Jagdglück wieder hold zu sein, auch wenn er es reichlich unwaidmännisch herbeizuzwingen versucht. Er bekommt einen mächtigen Argali-Widder vor die Flinte, verfehlt ihn mehrere Male und tötet schließlich das bereits schwer verwundete Tier, das „mit zerrissenen Rückgratnerven im Feuer“ zusammenbricht und mit brechenden Augen an eine Felswand geschmiegt den Mann erwartet, der ihn zur Strecke gebracht hat. Schnell reiße ich den Browning heraus, um ihn von seiner Qual zu erlösen. […] Mich hatte der Jagdteufel wieder einmal mitgerissen und die 314 Freude an der schönen starken Trophäe war mir gründlich verleidet.
Dafür rücken die politischen Ereignisse wieder in sein Blickfeld. Ein Bote bringt ihm die Aufforderung, nach Nijslel Chüree aufzubrechen. Am 6. No193
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
vember verlässt Consten das Lager der Goldgräber und macht sich auf den Weg. Unterwegs erfährt er von einem durchreisenden Kosaken, dass außer dem Bevollmächtigten der russischen Regierung, Korostovec, ein ganzes Kosakenregiment in der mongolischen Hauptstadt eingerückt sei. „Arme Mongolen! Das ist also das von mir so oft prophezeite Ende des Freiheits315 kampfes“, notiert Consten. Am 10. November stößt er auf einen Trupp Chajlar-Mongolen, die zum Stab Damdinsürens gehören und ihm, als sie ihn erkennen, den Ehrenplatz in ihrer Jurte anbieten. Als sie sehen, dass ich aus einer einfachen Holzschale Tee trinke, nimmt ihr Führer seine schöne, mit Silber ausgelegte Holzschale, putzt sie säuberlich mit einem Seidenlappen aus und lässt sie mir kniend von einem seiner Leute reichen. Er bittet mich dann höflichst, die Schale als ein Andenken an unser Zusammentreffen zu behalten. Nach dem von der Etiquette gebotenen Sträuben nehme ich die Schale dankbar an und verehre ihm eine noch viel größere Seltenheit in der Mongolei, nämlich 20 gute 316 Patronen für seine Mauserpistole.
Wohlbehalten findet Consten am darauffolgenden Tag seine Karawane vor. Er kann nach Wochen erstmals wieder heiß baden und in einen seiner seidenen Pyjamas schlüpfen. Dann hüllt er sich in sein schwarzseidenes, mit weißem Lammfell gefüttertes chinesisches Gewand – ein Geschenk Li Ninfas – und empfängt Besucher. Am 13. November trifft er den Ältesten der russischen Kaufmannschaft von Uliastaj, Ignatjev, wieder, der ebenfalls auf dem Weg nach Nijslel Chüree ist; gemeinsam reist man weiter. „Selbstverständlich dreht sich unsere Unterhaltung um die jüngsten Ereignisse in 317 Urga und um die kommenden.“ Und am späten Abend des 13. November 1912 erreicht man schließlich die mongolische Hauptstadt. „Woran denken Sie jetzt so intensiv?“ – fragte mich Ignatieff. – „An ein 318 gutes Beefsteak und eine Flasche Bier“ – antwortete ich ihm trocken.
Am nächsten Morgen meldet er sich bei Sajn Noyon Chan und übergibt die Briefe von Žalchanc Chutagt. Constens Ankunft in der mongolischen Hauptstadt wird von den Russen aufmerksam registriert. Als erster meldet sich bei ihm der Korrespondent der Novoe Vremja, ein Mann namens Konšin, den die Entwicklungen in der West-Mongolei und Constens Ein194
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
schätzung der Lage dort interessieren. Schon am selben Tag ist er im russischen Konsulat bei Konsul V. Ljuba; der Kommandierende der in Urga stationierten Kosakenbrigade, General Tomaševskij, der sein Hauptquartier in der Zentrale des Goldabbau-Unternehmens Mongolor gleich nebenan aufgeschlagen hat, bittet ihn gleich herüber und kommt direkt zur Sache. Seine erste Frage war selbstverständlich, ob ich im Dienste irgendeiner Macht stände. Lachend antwortete ich ihm, dass die internationale Macht, in deren Dienste ich zur Zeit stände, die Jagd sei. Ob er es ge319 glaubt hat, weiß ich nicht.
Consten gibt dem Führungsstab der Kosakenbrigade, die plant, in Richtung Uliastaj aufzubrechen, einen allgemeinen Überblick über die Lage in Uliastaj und Chovd und erbietet sich, ihnen anhand seiner im Hotel liegenden Karten und Aufzeichnungen mitzuteilen, welche Schwierigkeiten sie hinsichtlich des Geländes, der Versorgung der Pferde und der winterlichen Wetterverhältnisse erwarten. Abends sind die russischen Stabsoffiziere seine Gäste, und bei einem Glas Bier aus der soeben erst wiedereröffneten Brauerei des vor Jahresfrist ermordeten Xaver Dittenhofer und seines Kompagnons Bruno Heinrich gibt er den Herren die gewünschten Daten. Und auch die Bekanntschaft mit Ivan Jakovlevič Korostovec, dem Bevollmächtigten der russischen Regierung, der die streckenweise schwierigen Verhandlungen mit den Mongolen über ihren künftigen internationalen Status geleitet hat und nach Unterzeichnung des Vertrages über Schutz und Handel am 21. Oktober vorerst nicht geneigt zu sein scheint, seine Zelte in Urga abzubrechen, lässt nicht lange auf sich warten. Consten trifft ihn, mehr zufällig, erstmals am 14. November bei seinem Antrittsbesuch im russischen Konsulat – eine Begegnung, die beide Gesprächspartner in ihren Erinnerungen festgehalten haben. Traf heute bei Ljuba den deutschen Reisenden Consten. Er kam aus der West-Mongolei, wo er Jagd auf Argali gemacht hatte. Er erklärte, er interessiere sich nicht für Politik, sondern widme sich ausschließlich dem Sport. Nebenbei teilte er mit, dass Kuzminski und Walter (die beiden Konsuln in Kobdo [Chovd] und Uliastaj) mit Ungeduld die Ankunft unserer (Kosaken)-Abteilung erwarten; anderenfalls fürchten sie, dass uns die Chinesen zuvorkommen. Nach seinen Worten ist Kobdo bis auf die 195
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Grundmauern zerstört, die Einwohner sind entweder geflohen oder schlagen sich kümmerlich durch. Außer dem Konsul und 25 Kosaken sind nicht mehr als 30 Einwohner noch dort. In Uljasutaj stehe ein Konvoi von 150 Mann. Anfang November sei Rittmeister Saranov mit 20 Kosaken zu einem Erkundungsritt nach Kobdo aufgebrochen. Die Haltung der Chinesen, denen Consten begegnete, ist feindselig. Alle sagen, sie würden eine Einnahme Kobdos nicht hinnehmen. Er weiß nicht genau, wie viele chinesische Soldaten aus Guchen heranrücken, aber er meint, dass es nicht mehr als 200 sind. Auf den Gebirgspässen des Altaj und 200 Werst vor Uliastaj liege dichter Schnee.
Dies notiert Korostovec am Abend in sein Tagebuch. Und seinen persönlichen Eindruck von dem gesprächigen Deutschen fügt er noch an: Consten, dessen Russisch nicht übel ist, wohnt in Moskau, und sein Bruder kümmert sich um die Geschäfte in Aachen, Deutschland. Auf meine Frage, warum er in Russland lebe und nicht in seiner Heimat, antwortete Consten man könne in Russland freier und leichter leben, es gebe keinen Militarismus und keine Disziplin, für Ausländer sei das ein gelobtes Land. Ganz nebenbei erwähnte er, dass er für die Hilfe, die er unserem Konsulat in Kobdo erwiesen habe, gerne einen russischen Orden erhalten 320 würde. Unsere Militärs denken, er ist ein Spion. Vielleicht stimmt das.
Doch erscheint Korostovec dieser Verdacht eher übertrieben. In seinem 1926 auch in Deutsch erschienenem Mongolei-Buch „Von Cinggis Khan zur Sowjetrepublik“ relativiert er jedenfalls: Obgleich sich Consten vollständig korrekt verhielt, beschlossen unsere Krieger, dass er ein deutscher Spion sei, der den Auftrag habe, zu erkunden, ob wir für einen Krieg mit China bereit seien. Möglich, dass dem so war, obgleich es nichts auszukundschaften gab, da wir aus unsern Vorbe321 reitungen kein Geheimnis machten.
Auf Consten selbst wirkt der 50-jährige selbstsichere Diplomat, der nach einem Gesellschaftsskandal seinen Gesandtenposten in Peking fluchtartig hatte räumen müssen und seither im Ruf eines Schwerenöters stand, wie ein eher unelegant gekleideter „gerissener kleinrussischer Landedelmann“. Doch sei er sich „seiner wunderbaren Unterhaltungsgabe voll bewusst“, no196
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
tiert er über ihre erste Begegnung. Denn schon bald sind der Russe und der Deutsche „in ein für beide Teile hochinteressantes politisches Gespräch“ verwickelt. Es umfasst die ganze Bandbreite der aktuellen internationalen Entwicklungen, angefangen vom Balkankrieg und seinen Auswirkungen auf die „mongolische Frage“, die Einschätzung der Rolle Chinas nach dem Sturz des Qing-Kaisers bis hin zu möglichen Reaktionen der Japaner im Falle eines neuen Krieges in Asien. Während Korostovec klar Position gegen eine „Kolonisation“ der Äußeren Mongolei durch China bezieht, versucht Consten ihn davon zu überzeugen, dass ein Krieg um die Mongolei für Russland ein zu großes Risiko darstellen würde, da negative Auswirkungen auf Sibirien unausweichlich wären. Und schließlich, nach mehr als zwei Stunden eines lebhaften Meinungsaustausches fragt ihn der Gesandte: „Glauben Sie, dass die Chalcha-Mongolen zu einer eigenen Verwaltung fähig sind?“ Leider muss ich dies verneinen. Ohne fremde Hilfe in der inneren und äußeren Verwaltung würde es wohl schwerlich gehen, wie schon jetzt ein großer Teil der Verwaltung in die Hände der Flüchtlinge 322 aus der Großmongolei […] geraten sei.
Die beiden von Erscheinung, Temperament und Intellekt so verschiedenen Männer teilen, wie sich herausstellt, zwar eine tiefe Sympathie für die Mongolen und ihr politisches Anliegen, sie teilen aber auch die nüchterne Einschätzung der Überlebenschancen der Mongolei als eigenständiger Staat – der Eine aus dem übergeordneten Interesse des offiziellen Vertreters einer benachbarten Großmacht heraus, der Andere aus der intimen Kenntnis der begrenzten Fähigkeiten und inneren Schwäche der Führer des jungen Staatswesens. Jedenfalls dürfte Korostovec bei dieser über zwei Stunden dauernden tour d’horizon klar geworden sein, dass Constens Behauptung, Politik interessiere ihn nicht, wohl ein Scherz gewesen war. Amüsiert registriert Korostovec am Rande Constens Leidenschaft für das Fotografieren der mongolischen Prominenz. So notiert er am 20. November in sein Tagebuch: „Heute fotografierte Consten die Fürsten und die Mitglieder der Regie323 rung. Offensichtlich hatten die Fürsten ihren Spaß daran.“
Auf einer großformatigen Aufnahme, die das gesamte mongolische Kabinett und die russischen Verhandlungspartner zeigt, posiert er allerdings 197
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Abb. 13: Offizielles Gruppenfoto von den mongolisch-russischen Verhandlungen in Urga Okt./Nov. 1912
auch selbst leicht schmunzelnd, an seiner Seite voller Ernst dreinblickend Regierungschef Sajn Noyon Chan (Abb. 13 vorne, 3. u. 4. v.l.). Wenig später, an einem klaren Frosttag mit -30° C, notiert Korostovec: „Consten kam vorbei und bat darum, die Erlaubnis zu erwirken, den Chutagt und seinen Hofstaat mit dem Kinematographen aufzunehmen. Bis jetzt wisse man in Europa und sogar in Russland wenig über Urga und den Chutagt. Und der Kinematograph eigne sich am besten für die 324 Popularisierung dieser exotischen Regierung.“
Dass die Erlaubnis gnädigst erteilt wurde und Consten den Bogd Chan sehen konnte, geht aus Korostovec’ bereits erwähntem Buch hervor. Die Filmrollen wie auch ein Großteil der in der Mongolei aufgenommenen Glasplatten sind leider verschollen. Immerhin, Constens Original-Abzüge gibt es noch – in Ulaanbaatar, dazu die in ihrer technischen Qualität ebenfalls ausgezeichneten Abbildungen in seinem antiquarisch gelegentlich noch erhältlichen Werk „Weideplätze der Mongolen“. In Nijslel Chüree, wörtlich: „Hauptstadtkloster“, wie die mongolische 198
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
Metropole seit der Thronbesteigung des Bogd Chan genannt wird, entfaltet Consten seine gewohnte Betriebsamkeit. Er durchstreift die weitläufige Stadt, trifft Freunde und Bekannte, sucht die Mitglieder der Regierung auf, fotografiert Sehenswürdigkeiten und Menschen, sammelt fleißig Informationen – auch solche, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. So erstaunt es doch ein wenig, dass er in seinem Kapitel über Russ325 lands Vordringen in die Mongolei im zweiten Band der „Weideplätze“ eine Reihe von Vertragstexten und anderen russischen Dokumenten in Übersetzung veröffentlicht hat, ohne die Quelle zu nennen: so den russischchinesischen Ili-Vertrag von 1881, die Antwort der Chinesen auf das russische Ultimatum zur Neuverhandlung dieses Vertrages vom 11. März 1912 und die darauf folgende Erklärung des Leiters der Ostasien-Abteilung im Russischen Außenministerium, G.A. Kazakov. Ferner ein russisches Kommuniqué über die Ziele seiner Mongolei-Politik vom 13. April 1912 und schließlich ein kaiserliches Dekret der Anerkennung des von Korostovec ausgehandelten Vertrages durch die Regierung in St. Petersburg, das die Punkte der Vereinbarung im Einzelnen anführt. Wie sind all diese Dokumente in Constens Hände gelangt? Er selbst gibt darüber keine Auskunft, es sei denn, die Antwort findet sich in der folgenden von ihm geschilderten Szene aus der Audienz-Jurte Sajn Noyon Chans: Diese Jurte ist zugleich Archiv und Schreibstube. Eifrig schreibend sitzen hier einige mongolische Beamte, um die nötigen Schriftstücke, deren Inhalt Sain-Noyon-Chan kurz skizziert hat, zu stilisieren. Nachdem die Sache durch einen Sekretär ausgearbeitet worden ist, geht er damit in die Hauptjurte, um das Schriftstück nochmals dem Fürsten vorzulegen, der dann seine letzten Anweisungen gibt. Von einer Geheimhaltung der Schriftstücke ist keine Rede. So erlebte ich heute, dass bei der Ausarbeitung eines wichtigen Schriftstückes, das an einen höheren Chochun-Be326 amten, einen Feind Bintu-Wans gerichtet war, der Leibdiener und Gefährte Bintu-Wans dieses Schriftstück uns allen mit den nötigen Glossen 327 unter dem Gelächter der Zuhörer vorlas.
Da er stets auch eine Spionagekamera am Körper bei sich trug, mit der er 328 aus seinem Gürtel heraus Aufnahmen machen konnte, ist durchaus vorstellbar, dass Consten Zeit und Gelegenheit hatte, wichtige russische Doku199
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
mente zu fotografieren, entweder bei den mongolischen Stellen, vielleicht sogar im russischen Konsulat, möglicherweise aber auch im deutschen Konsulat in Moskau. Das eine oder andere Dokument mag auch in russischen Bulletins veröffentlicht worden sein. Anzunehmen ist jedenfalls, dass er dies weniger für die deutschen diplomatischen Vertretungen tun musste, die ja durch die dafür üblichen Kanäle ohnehin über wichtige Verträge, soweit es sich nicht um Geheimverträge handelte, informiert wurden und eigene, offizielle Übersetzungen anfertigten. Bleibt also die Vermutung, dass er solche wichtigen Dokumente als Hintergrundinformationen zu Zentralasien für die Brüder Mannesmann gesammelt hat. Dass er sie später in seinen „Weideplätzen“ einschließlich einer Reihe von politischen Analysen und Wirtschaftsdaten über die Mongolei veröffentlichte, hängt wohl damit zusammen, dass – unter anderem bedingt durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs und die deutsche Niederlage 1918 – aus dem gemeinsamen Projekt der Ausbeutung von Bodenschätzen und der wirtschaftlichen Erschließung der Mongolei nichts geworden ist. Consten nahm sich daher die Freiheit, diese Dinge anderweitig zu verwerten. Noch ist er allerdings in Nijslel Chüree. Am 5. Dezember 1912 (18.12. nach dem gregorianischen Kalender) erlebt er bei grimmiger Kälte die Feierlichkeiten zum ersten Jahr der Thronbesteigung des Bogd Chan, die eigentliche Krönungsfeier des VIII. Jebtsundampa Chutagt zum weltlichen Herrscher über die Mongolei. Auf dem Platz vor dem alten Majdar-Tempel harren seit dem Morgen Zehntausende aus. Gegen elf Uhr marschiert Militär auf, die 200 Mann starke Leibgarde des Mongolenherrschers zuerst. Alle sind in bunte schwere chinesische Seide gekleidet. Sogar die kreuzweise über der Brust getragenen Patronengürtel sind aus gold- und silberdurchwirkter Seide verfertigt. Sie sind ganz vorzüglich bewaffnet. Etwas später rücken die unter den Russen ausgebildeten Mongolen unter Führung ihrer niederen russischen Instrukteure an. Welch ein Gegensatz, dort Seide und Silber, hier schmutzige Pelze und zerrissene zerlump329 te Kleider. Aber sie reiten in guter Ordnung in ihre Stellung.
Schließlich, nach stundenlangem Warten der Menge in eisiger Kälte, die Ankunft dessen, „der erhoben ist über alle“ – so die von Consten nicht 330 ganz korrekt wiedergegebene Regierungsdevise des Bogd Chan. 200
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
Das Volk wirft sich auf das Angesicht. Der Gottkaiser fährt in einer dick vergoldeten Karosse aus Spiegelglas, von sechs weißen Pferden am 331 Damnur gezogen, zum Majdar. Voraus Einzelreiter als Bannerträger. Dann ein Teil der Fürsten und zuletzt er selbst. Hinter ihm fährt als Lama verkleidet, ebenfalls im vergoldeten Wagen von sechs weißen Pferden am Damnur gezogen, seine frühere Geliebte, die jetzt zu seiner Frau erhoben werden soll, da die Lamas aus den alten wahrsagenden Büchern festgestellt haben wollen, gerade dieser achte Chutagt werde verheiratet 332 sein, einen Sohn haben und das Land von den Chinesen befreien.
Während Consten bei den sich bis in den Abend ziehenden Krönungsfeierlichkeiten offenbar ungehindert fotografieren und filmen kann, gerät er in Schwierigkeiten, als er wenige Tage später die Trauerfeier für den verstorbenen Leibarzt des Chutagt ebenfalls aufnehmen will. Er löst das Problem auf eine Weise, die auf Tabu-Fragen wenig Rücksicht nimmt. Als ich angeritten kam und Vorbereitungen traf, um zu photographieren, versuchte mich einer der Lamas daran zu hindern. Er kam, als ich mich gar nicht darum kümmerte, direkt auf mich zu und drohte handgreiflich zu werden. In demselben Moment blitzte ihm mein kleiner Browning vor den Augen. Ich sagte ihm ebenso ruhig wie energisch, wenn er mich mit seinen Totengräberfingern berühre, dann könnten seine Freunde auch für ihn die Totenmesse lesen lassen. Der Halunke wusste die Sache sofort ins Lustige herumzudeuten, nachdem ihm Zendé schnell einige Worte ins Ohr geflüstert hatte. Dann nahm, während ich meine Kinoaufnahme 333 machte, die Beerdigungsfeierlichkeit ihren Fortgang.
Es gibt ein Wiedersehen mit Kambo Lama Agvan Doržiev, der mit einem Sonderauftrag des Dalai Lama aus Lhasa angereist ist und sich ebenfalls seit November in der Stadt aufhält. Im Auftrag Seiner Heiligkeit handelt Agvan Doržiev mit der mongolischen Regierung einen Vertrag über Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe „zum Wohl des Buddhismus“ sowie „bei äußeren und inneren Gefahren“ aus. Am 29. Dezember 1912 (bzw. 11.1.1913) wird dieses erste bilaterale Abkommen zweier von China wegstrebender Länder, Tibets und der Mongolei, unterzeichnet. Es löst in Peking mehr Wirbel aus als der wenige Wochen zuvor unterzeichnete mongolisch-russische Vertrag; seine Legalität, gar seine Existenz wird interna201
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
tional in Zweifel gezogen. Dennoch wird über denkbare Folgen dieses von zwei nicht-europäischen Mächten in Eigenregie geschlossenen Vertrages vor allem in deutschen Diplomatenkreisen viel spekuliert. Anders als Wilhelm Filchner, sein „Kollege“ und Rivale in zentralasiatischen Angelegenheiten, beteiligt sich Hermann Consten an diesen Spekulationen nicht. Im Gegenteil: Er warnt die deutschen diplomatischen Stellen mehrfach vor Filchners Hauptinformant Cerenpil, ebenfalls Burjate und buddhistischer Lama mit Tibet-Erfahrung. Im russischen Konsulat in Nijslel Chüree arbeitet Cerenpil nebenbei als Dolmetscher und Begleiter der mongolischen Re334 gierungsdelegationen bei ihren Russlandreisen. Den Weihnachtsabend 1912 verbringt Consten mit einem befreundeten Russen bei Bruno Heinrich, dem Kompagnon des ermordeten Bierbrauers Xaver Dittenhofer. Beim Anblick des Weihnachtsbaums und dem Erklingen der bekannten Melodien wird er richtig sentimental. Aber immerhin erfährt er auch en détail, was sich ein Jahr zuvor an jenem schrecklichen Abend zugetragen hat, wie weit die Ermittlungen in dem Mordfall gediehen sind. Vor allem beteuert ihm Bruno Heinrich seine Bereitschaft zum Verzicht auf das ihm zugedachte Erbe zugunsten der Verwandten seines einstigen Partners im fernen Deutschland. Seinen Bericht über den Fall Dittenhofer liefert Consten allerdings erst nach seiner Rückkehr im Juni 1913 335 im Deutschen Generalkonsulat in Moskau ab. Um den Jahreswechsel 1912/13 verlässt Hermann Consten die mongolische Hauptstadt. Bei Minusgraden macht er sich auf den Rückweg in Richtung Westen. Doch wählt er auch diesmal nicht den direkten Postweg nach Uliastaj, sondern strebt noch einmal zurück zum Bajdrag, in das Gebiet, wo er Goldvorkommen vermutet und wo ein noch ungeöffnetes Fürstengrab und eine noch nicht erkundete Totenstadt seiner harren. Er trifft Peter Orlov mit seinen Goldschürfern wieder und nimmt ihn mit zu einer Erkundungsreise in die Gobi, um die genaue Lage eines größeren Goldfeldes – vermutlich handelt es sich um das, welches ihm Li Ninfa verraten hat – genauer in Augenschein zu nehmen. Je näher sie der Wüste kommen, desto zahlreicher werden die Goldfundstellen. Schließlich stoßen sie in einer Schlucht auf goldführendes Granit- und Schiefergestein, wo die Erzadern teilweise nach außen getreten sind. Mit dem Geologenhammer löst Consten ein größeres Stück Gold aus dem schwarzen Schiefer. Auch der Sand ei202
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
nes Bachlaufs in der Nähe enthält eine so große Menge feinen Goldstaubs, dass reichere Vorkommen angenommen werden können. Und tatsächlich erfährt er von einer nur wenige Kilometer entfernten Stelle mit goldhaltigem Gestein. Da dieses Gebiet zum Herrschaftsbereich des Togtoch Gun 336 (Tüšeet Gün), eines ehemaligen hohen Lamas gehört, der trotz Verheiratung nach wie vor enge Kontakte zu den Chutagts Žalchanc und Diluv unterhält, sucht er diesen auf. Er wird mit allen Ehren empfangen und erhält 337 tatsächlich eine Schürflizenz für das Gebiet. Natürlich preist er auch ihm gegenüber das Deutsche Kaiserreich als „dritten Partner“ der Mongolei an. Aufmerksam lauscht er, als ich ihm von meiner fernen Heimat, von unserer mächtigen Handels- und Kriegsflotte, von den unzähligen Reitern mit Lanzen, Säbeln und Karabiner, von unserem mächtigen Fußvolk, von unseren Festungen, Kanonen, Maschinengewehren erzähle. – „Ja, die Deutschen sind mächtig“, sagt er dann unvermittelt, „sie haben den alten Buddha“ – gemeint war die alte chinesische Kaiserin – „bekriegt und besiegt, als diese den deutschen Gesandten ermorden ließ.“ Ich war ganz erstaunt, dass hier in die Gobi sogar die Kenntnis von unserer Strafexpedition gegen China wegen der Ermordung unseres Gesandten Ketteler gedrungen war. Jedenfalls war die Nachricht durch Chalchafürsten, die während der Boxerkämpfe in Peking waren, hierher gebracht worden.
Das Gebiet, für das Hermann Consten Schürfrechte erhalten hat, hat er selbst nie wieder betreten. Die schöne Urkunde mit der Schürflizenz des Tüšeet Gün mag er sich später eingerahmt an die Wand gehängt haben. Dennoch: es waren deutsche Geologen, die in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts die Goldvorkommen der Mongolei, gerade auch die Region zwischen dem Südhang des Changaj-Gebirges und der Gobi-Senke am Unterlauf des Bajdrag systematisch untersucht und die technischen Voraussetzungen für die Goldgewinnung geprüft haben. Die DDR-Geologen konstatierten dort den Typ der „alten Goldquarzgänge“, außerdem große Vorkommen sogenannter Goldseifen – Constens „Schaumgold“. Aufgrund von Steinwerkzeug-Funden stellten sie Anzeichen eines prähistorischen Goldbergbaus fest. Also in jedem Fall eine hochinteressante Region. 1973 schlossen die DDR und die Mongolische Volksrepublik sogar ein Regierungsabkommen zur gemeinsamen Erschließung der Goldlagerstätten der 203
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente 338
Mongolei. Doch wo Consten sich schon vor hundert Jahren für ein deutsches Konsortium am Werke sah, schürfen heute kanadische, US-amerikanische und australische Großkonzerne. Bisher blieb die Mongolei jedoch, was sie immer war: ein armes Land „auf einem Topf voll Gold“. Zur Zeit des chinesischen Neujahrsfestes 1913 trifft Consten wieder in Uliastaj ein. Konsul Walter behandelt ihn mit überraschender Zuvorkommenheit. Unter den wenigen noch anwesenden Chinesen und seinen mongolischen Freunden wird er herumgereicht und zu üppigen Essen eingeladen. Am 21. Februar verlässt er Uliastaj in Richtung Chovd, wo er sich erstmals persönlich ein Bild über das ganze Ausmaß der Zerstörungen vom August 1912 macht. Er kommt in eine tote, ausgestorbene Stadt, in der nur noch wenige Menschen ausharren, unter ihnen der russische Konsul Rasdolski. Er fotografiert die zerstörten Umwallungen, Häuser und Tempel der Chinesen, das verwüstete Archiv. Er registriert die verheerenden Folgen der Gemetzel und Plünderungen in den Straßen, klettert in den Ruinen herum und lässt sich von Rasdolski und anderen Bewohnern erzählen, was sich in jenen grauenvollen Augusttagen im einzelnen abgespielt hat; Details aus der Sicht der mongolischen Eroberer hatte er schon vorher von Gung Chajsan, Damdinsüren, Žalchanc Chutagt und anderen erfahren und sich eifrig notiert. In den „Weideplätzen“ versteht er es geschickt, ein Gesamtbild der Gräuel im besten Reportagestil so wiederzugeben, als wäre er 339 bei der Zerstörung Chovds selbst dabei gewesen. Er erfährt, dass einer der Kriegsherren von damals noch immer Angst und Schrecken verbreitet: Žal Lama, auch Dambijžancan oder „Choir Tämäte Lama“ (Chojor Temeet Lam) – der „Lama mit den zwei Kamelen“ genannt. Nach dem Fall Chovds hat er mit seinen Truppen in der Region ein wahres Schreckensregiment aufgerichtet. Ein aus der Gegend von Astrachan stammender Kalmücke, ehemaliger Kettensträfling und religiöser Fanatiker, der sich für eine Wiedergeburt des Amursana, eines Dsungarenhäuptlings aus dem 18. Jahrhundert hält, hat Žal Lama rituelle Menschenopfer des archaischen Tantra der Rotmützen-Schule des tibetischen Buddhismus wiedereingeführt. Dieser charismatische Sadist, dem magische Kräfte nachgesagt werden, hat sein Lager am Olan-daba (Olon Davaa) aufgeschlagen und terrorisiert dort als Herr über Leben und Tod seine Untergebenen. Diesen Mann muss Consten, da sich seine mongolischen Freunde 204
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
nicht trauen, unbedingt in die Schranken weisen. Am 9. März 1913 bricht er auf zum Olon Davaa, mit zwei Kamelen und einigen bewaffneten Leuten, um dem „Lama mit den zwei Kamelen“, der mit seinem Terrorregiment die Grenze des Erlaubten überschritten hat, wenigstens symbolträchtig entgegenzutreten. Vor der Stadt besucht er zunächst das Schlachtfeld am Bajantu-Fluss (Bujant gol), wo noch Monate nach dem Ende der Kämpfe Leichenreste und Pferdekadaver herumliegen. Dann geht es weiter in südlicher Richtung. Am Olon Davaa findet er freundliche Aufnahme in dem überraschend sauberen Lager; man stellt ihm sogar eine Prunkjurte hin. Doch hat sich Žal Lama plötzlich mit einigen kirgisischen Begleitern im Morgengrauen des nächsten Tages heimlich davongemacht. Da Consten ein Schreiben des russischen Konsuls mit sich führt, das er übergeben soll, muss er sich also gedulden; niemand kann ihm sagen, wohin Žal Lama mit einigen Getreuen verschwunden ist und wann er zurückkehrt. Er vermutet, dass etwas mit den Chinesen im Gange ist und die Situation gefährlich werden könnte. Es gibt aber auch Gerüchte, Žal Lama habe sich von den Mongolen losgesagt und wolle ein eigenes unabhängiges westmongolisches Reich gründen. Consten vertreibt sich die Zeit mit Fotografieren, man veranstaltet für ihn ein Fest mit mongolischen Ringkämpfen, die er auf seinem Filmapparat festhält, und als es brenzlig wird, übernimmt er sogar das Kommando über das Lager. Er lässt eine Barrikade aus Munitionskisten errichten. Zum Schlagabtausch scheint es aber nicht gekommen zu sein. Es ist also fraglich, ob er Žal Lama bei dieser Gelegenheit überhaupt gesehen hat. Sehr wohl gibt es in den „Weideplätzen“ ein bemerkenswertes Foto, das diese lebende Legende mit einem alten Gewehr im Anschlag zeigt. Und in seinem Roman „Der rote Lama“ hat ihm Hermann Consten ein schaurigschönes Denkmal gesetzt. Bei seiner Rückkehr nach Russland durch das winterliche Altaj-Gebirge gerät Consten an Gruppen von Kirgisen, die vor Žal Lama flüchten. Ausgiebig frönt er noch einmal der Jagd auf Argalischafe. In Bijsk wird er Zeuge sogenannter Probemobilisationen. Sie erinnern ihn daran, dass auch außerhalb der Mongolei die Zeiten alles andere als friedlich sind. Es ist also an der Zeit zurückzukehren, erst nach Moskau – und dann, vielleicht, nach Deutschland. Mitte Mai meldet sich Consten im Deutschen Generalkonsu205
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
lat zurück und erstattet Generalkonsul Kohlhaas ausführlich Bericht über die jüngsten militärischen Vorgänge in der Mongolei. Dieser lässt Constens Ausführungen mitstenografieren und leitet den Lagebericht des nach neun Monaten mongolischer Strapazen erstaunlich wenig erschöpften Forschungsreisenden umgehend an Reichskanzler Bethmann Hollweg weiter. Nach Constens Darstellung haben sich die Russen mit Truppen aller drei Waffengattungen in den drei städtischen Zentren Urga, Uliastaj und Chovd festgesetzt und treffen Vorbereitungen für einen Krieg mit China im Altajgebiet wie auch in Transbaikalien. Die Einberufung von Reservisten und zwei Rekrutenjahrgängen sei ein Indiz für seine Einschätzung. Um die Kampfmoral dieser Kosakenbrigaden sei es allerdings schlecht bestellt. Die Mongolen, die bei Chovd und im Süden chinesische Truppen besiegt hätten, seien keine Mongolen aus der Chalchaj, sondern stammten aus der Gegend von Chajlar und Qiqihar. Sie seien von den Russen über Kjachta eingeschleust worden. Chalch-Mongolen hingegen seien unkriegerisch und außerdem durch Alkohol und Syphilis degeneriert. Negativ ist auch Constens Urteil über den Wert der in Grenznähe zur Mongolei stationierten chinesischen Truppen, die er gegenüber Kohlhaas allerdings wesentlich höher beziffert als gegenüber Korostovec. Dennoch meint er, die chinesische Regierung werde einen Krieg gegen die Äußere Mongolei und Russland vermeiden wollen. Die eigentliche Kriegsgefahr geht seiner Meinung nach von Russland aus. Denn die drohende staatliche Zersplitterung der an Südsibirien grenzenden Gebiete aufgrund der tödlichen Feindschaft zwischen Chalch-Mongolen und den westmongolischen Stämmen, die Pläne Žal Lamas zur Wiederaufrichtung des alten dsungarischen Reiches, stehe russischen Wünschen diametral entgegen. Die russische Politik ist, wie Korostowez in Urga offen erklärt hat, im Grunde nur darauf gerichtet, Sibirien gegen China zu schützen und die Truppen in Sibirien durch Schaffung des mongolischen Pufferstaats vom Grenzschutz zu entlasten, damit das sibirische Heer gegen Osten (Japan) oder eventuell auch gegen Westen frei sei.
So die Analyse Constens. Den angeblich defensiven Charakter ihrer Maßnahmen nimmt er den Russen insofern nicht ab, als er selbst wohl insgeheim einen militärischen Schlagabtausch in Zentralasien herbeiwünscht. 206
4. Mongolei zum Zweiten: Mit Geheimaufträgen unterwegs
Dieser würde nämlich russische Truppen in der Region binden, die sonst zum Kriegsschauplatz auf dem Balkan verlegt würden. Consten schildert ferner die unzufriedene Stimmung in der mongolischen Bevölkerung, deren Versorgungslage sich rapide verschlechtert habe. Das Land sei wirtschaftlich ruiniert. Was seine persönlichen geschäftlichen Ambitionen betrifft, so scheint er, trotz der Schürflizenz für die Ausbeutung der Goldvorkommen am Rande der Gobi, eher ernüchtert zurückgekehrt zu sein. Die neu aufgefundenen Goldvorkommen in der Mongolei seien, so äußert er jedenfalls gegenüber Kohlhaas, „wegen ihrer Lage und Beschaffenheit nicht lohnend“. Darüber, ob er in Sachen Mongolor und einer eventuellen Übernahme des Unternehmens durch ein deutsches Konsortium unter den Brüdern Mannesmann direkten Kontakt mit Baron von Groth oder seinem Geschäftsführer Pokrovskij in Nijslel Chüree aufgenommen hat, verliert er kein Wort. Dass er dennoch sein Vorhaben nicht an den Nagel gehängt und auch seine Versprechungen gegenüber seinen mongolischen Freunden nicht vergessen hat, beweisen die Zeilen, die Konsul Kohlhaas an das Ende seines ausführlichen Berichts nach Berlin setzt: Consten wird einige Zeit hier bleiben. Er wäre, wie er mir sagt, bereit, auf einen etwaigen Wink nach Berlin zu kommen und persönlich näheren Bericht zu erstatten, falls er die Gewissheit habe, dass man sich in Deutschland nicht bloß platonisch für die Mongolei interessiere. Auch wäre er bereit, eventuell wiederum nach der Mongolei zu reisen, falls z.B. eine Anzahl deutscher Interessenten sich zusammentun würde, um ihn finanziell zu unterstützen und die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Landes durch eine Expedition zu untersuchen. Von russischer Seite fürchtet er in dieser Hinsicht keine Schwierigkeiten, da er mit den Russen gut steht und ihnen manche Dienste geleistet hat. Den Russen liege offenbar daran, Kapital nach der Mongolei zu ziehen, und da russisches nicht zu haben sei, wären sie auch mit fremdem Kapital einverstanden, wenn es nur „unter russischer Flagge“ arbeite. Als Unternehmungen käme einmal die Übernahme der fünf Millionen Lan betragenden Außenstände der vertriebenen chinesischen Kaufleute aus Kalgan und Tientsin und damit die Übernahme ihrer Kundschaft in der Mongolei in Betracht, außerdem aber auch die Einrichtung einer Straßen- und Postbetriebsgesellschaft für Automobilbetrieb, etwa nach dem Muster der 207
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Dshulfa-Täbris- und der Enseli-Teheran-Gesellschaft, ta, Urga, Uljasutai und Kobdo.
340
zwischen Kjach-
Und schließlich fügt der Generalkonsul noch seinen ganz persönlichen Kommentar an: Ich gebe die gesamten Ausführungen Constens mit dem erforderlichen Vorbehalt wieder. Dass er ein guter Kenner der Mongolei ist und gute Beziehungen zu Herrn Korostowez und den russischen Konsuln in der Mongolei einerseits, wie zu einflussreichen Mongolen andererseits besitzt, unterliegt für mich keinem Zweifel. In dieser Hinsicht jedenfalls könnte er deutschen Interessenten zweifellos sehr nützlich sein. Ob er selbst die geeignete Persönlichkeit wäre, um solche Unternehmungen mit deutschem Kapital zu gründen und zu leiten, erscheint mir noch immer fraglich; in dieser Hinsicht glaube ich bei meinem im vorigen Jahre aus341 gesprochen Urteil bleiben zu müssen. gez. Kohlhaas
5. Wegbereiter mongolisch-deutscher Staatsbeziehungen Urga, 25.12.1912 Sehr geehrter Herr Generalkonsul, gestern verließ der mongolische Minister, Fürst Tschan-sching-schuon, kurz Chan-du-wan [Fürst Čin Van Chanddorž; D.G.] genannt, Urga, um mit 12 Begleitern nach Petersburg zu reisen. Er soll dort im Namen des Bogdo-chan den Dank des neuen Gottkönigs der russischen Regierung für das bewiesene Wohlwollen aussprechen. Fürst Chan-du-wan bat mich nun, ihm, wenn möglich, behülflich zu sein, dass er Berlin sehen und die Krupp’schen Werke besichtigen könne. Ich erlaubte mir, Herrn Chan-du-wan einen Brief an Herrn Botschaftsrat v. Lucius mitzugeben, nachdem ich darüber mit Exzellenz Korostowetz, [dem] außerordentlichen Bevollmächtigten seiner Majestät des Kaisers von Russland in Urga, Rücksprache genommen hatte. Ich bat Herrn Botschaftsrat v. Lucius, in Hinblick auf unsere letzte Unterredung, Fürst Chan-du-wan, wenn auch nur privat, zu empfangen. Es würde jedenfalls nicht ohne Interesse sein, wenn auch nur privat mit einem Vertreter der neuen Regierung Fühlung zu nehmen, indem man Chan-du-wan deutlich zu fühlen und zu verstehen geben würde, dass auch das Wohlwollen der Deutschen Regierung 208
5. Wegbereiter mongolisch-deutscher Staatsbeziehungen
etwas wert ist. Jedenfalls würde es keinesfalls schaden, sondern nur dazu beitragen, dass hier die mongolischen Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die mongolischen Minister haben bisher von Politik, Machtverteilung und dergl. keine Ahnung, sie sind darin so erfahren und wissend wie kleine Kinder. Von Deutschland wissen Sie nur eines, dass dort Mauserpistolen und Gewehre fabriziert werden, und es ist zur Zeit ihr höchstes Bestreben, in den Besitz solcher, hier zur Zeit sehr notwendiger Dinge zu kommen. Sollte Chan-du-wan in der Deutschen Botschaft etwas von oben herab behandelt werden, so würde dies keineswegs schaden und nur dem Herrn imponieren […]. 342 Hochachtungsvoll Ihr ergebener Hermann Consten jr.
Dieses Schreiben Hermann Constens an das Deutsche Generalkonsulat in Moskau, das Konsul Kohlhaas Mitte Januar 1913 an Reichskanzler von Bethmann Hollweg weiterleitete, zeigt: er betätigte sich in der mongolischen Hauptstadt nicht nur als Dokumentarfilmer einer neuen Epoche. Consten war ernsthaft entschlossen, konkrete Schritte zur „Popularisierung dieser exotischen Regierung“, wie er sich gegenüber Korostovec ausgedrückt hatte, zu unternehmen. Diese zweite Delegationsreise mongolischer 343 Regierungsvertreter nach Russland war eine gute Gelegenheit, der Mongolei die Wege für die Aufnahme direkter Kontakte mit den deutschen diplomatischen Vertretungen in Russland, eventuell sogar für eine Reise nach Berlin und Essen zu ebnen. Dass sich die deutsche Seite damit schwer tat, dürfte ihn, als er Mitte Mai 1913 nach Moskau zurückkehrte und im Konsulat vorsprach, nicht verwundert haben. Consten kannte die Vorbehalte seines Landes, das in dem Abfall der mongolischen Fürsten von China seine wirtschaftlichen Interessen in der Region gefährdet sah. Er versuchte dennoch einen Weg zu finden, wie er den Mongolen nützlich sein und möglichst auch sein eigenes Schäfchen ins Trockene bringen konnte. Im Verlauf des Sommer 1913 reiste Consten zunächst nach Aachen, wo er den Brüdern Mannesmann seine Evaluierungsstudie zum Goldabbau und zur Wirtschaftssituation in der Mongolei vorlegte. Im Aachener Kunstgewerbemuseum präsentierte er im Oktober seine ethnographische und künstlerische Mongolei-Sammlung. Er hielt Vorträge, zeigte seine Fotos und Filme und publizierte mehrere Artikel zur politischen Lage in dem zen344 tralasiatischen Land. Als er sich im Spätherbst 1913 auf den Rückweg 209
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
nach Russland machte, unterbrach er seine Reise in Berlin. Er sprach beim Auswärtigen Amt vor, um dem zuständigen Referenten, Graf Montgelas, das mongolische Ansinnen noch einmal zu verdeutlichen. Er erreichte nichts; von einer staatlichen Anerkennung der Mongolei war man in Berlin, wie nachfolgende Aktennotiz vom 18. November 1913 über Hermann Constens Besuch im Auswärtigen Amt zeigt, noch weit entfernt. Der Forschungsreisende Hermann Consten, Gewährsmann des Kais. Generalkonsulats in Moskau für Verhältnisse in der Mongolei, hat im Ausw. Amt vorgesprochen und […] mitgeteilt, dass die z. Zt. in Petersburg weilende mongolische Mission auch nach Berlin zu kommen beabsichtige. Herr Consten, der mit den leitenden Persönlichkeiten der Mission angeblich persönlich bekannt ist und dieser Tage nach Petersburg reist, bat um Mitteilung, ob hier Geneigtheit bestehe, die Mission oder einzelne Mitglieder derselben zu empfangen. Sollte dies nicht der Fall sein, so dürfte es sich empfehlen, den Mongolen in Petersburg unter der Hand zu verstehen zu geben, dass ihre Reise nach Berlin im gegenwärtigen Augenblick nicht opportun erscheine. Herr Consten deutete ferner an, dass der Zweck der Reise der Mongolen nach Petersburg u.a. auch der sei, dort Geld zu bekommen. […] Er, Consten, sei in der Lage, den Mongolen Geld von deutschen Großindustriellen, die sich für die Mongolei interessierten, gegen Landkonzessionen in der Mongolei zu verschaffen, doch halte er dazu vorläufig den Moment noch nicht für gekommen. Aus früheren Andeutungen Constens geht hervor, dass zu diesen deutschen Großindustriellen insbesondere die Gebrüder Mannesmann zu gehören scheinen. Da uns bisher weder von russischer noch von chinesischer Seite eine amtliche Notifikation über das Abkommen zwischen Russland und China betr. die Mongolei zugegangen ist, auch der Inhalt des Abkommens bisher lediglich aus Pressberichten bekannt ist, dürfte es im gegenwärtigen Augenblick kaum angezeigt erscheinen, die Mongolen, falls sie einen dahingehenden Wunsch zu erkennen geben, zu ermutigen, nach Berlin zu kommen. Herr Consten bemerkte ferner, die Russen würden es voraussichtlich nicht an Bemühungen fehlen lassen, den Mongolen die Idee ei345 ner Reise nach Deutschland auszureden. […]
210
5. Wegbereiter mongolisch-deutscher Staatsbeziehungen
Sollte Consten mit einer solchen Bemerkung etwa den Versuch unternommen haben, gerade weil es die Russen ärgern könnte, das Auswärtige Amt zu einer Einladung an die mongolische Delegation zu ermuntern? Immerhin, es ist seinen Bemühungen zu verdanken, dass die – mittlerweile dritte – mongolische Delegation, die sich unter der Leitung von Ministerpräsident Sajn Noyon Chan seit Oktober 1913 in St. Petersburg aufhielt, in der Deutschen Gesandtschaft vorsprechen konnte, um dem Gesandten, Graf Pourtalès, den Wunsch ihrer Regierung nach deutschen Waffenlieferungen vorzutragen. Sie wurde am 12. Januar 1914 empfangen und, wenn auch höflich, mit unverbindlichen Floskeln abgespeist. Am nächsten Tag sandte Pourtalès folgende Depesche über dieses erste Treffen mongolischer und deutscher offizieller Vertreter an Bethmann Hollweg: Zwei Mitglieder der mongolischen Mission haben sich gestern vor ihrer heutigen Rückreise nach der Mongolei auf der Kaiserlichen Botschaft vorgestellt, um „der Bewunderung ihrer Regierung für das deutsche Reich“ Ausdruck zu geben. Als neues Staatsgebilde habe die Mongolei „das Wohlwollen des mächtigen Deutschlands“ nötig u.s.w. Die Erklärungen beschränkten sich auf allgemeine Höflichkeitsbezeugungen, die entsprechend erwidert wurden. Von der Absicht einer Reise nach Berlin war nicht die Rede. Nach einer Pressnotiz betrachten die Mongolen ihre Mission als nicht hinreichend geglückt und äußern ihr Bedauern, in Pe346 tersburg nicht das Verständnis gefunden zu haben, das sie erwarteten.
Pourtalès leitete auch die ihm in der französischen Version überreichte Stellungnahme der mongolischen Regierung zum russisch-chinesischen Vertrag 347 vom 23. Oktober (5. Nov.) 1913 an die Reichskanzlei weiter. Sein Begleitschreiben zu dem mit dem mongolischen Staatssiegel versehenen Dokument, das sich im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin befindet, weist an den Seitenrändern eine Fülle von abgezeichneten Kenntnisnahmen auf. Immerhin scheint also die mongolische Stellungnahme in Berlin mit großer Aufmerksamkeit studiert worden zu sein, denn der russischchinesische Vertrag über die Anerkennung des Status quo der Äußeren Mongolei vom November 1913 berührte auch deutsche Interessen. Da die Berliner Presse über den russisch-chinesischen Vertrag und dessen möglicherweise negative Folgen für die deutschen Handelsinteressen in China, 211
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
vor allem für die Firmen, die auf der Basis des deutsch-chinesischen Handelsvertrages von 1881 Geschäfte in der Mongolei betrieben, bereits in extenso berichtete, war das mongolische Memorandum durchaus von einigem Belang. Der nationalliberale Reichstagsabgeordnete Ernst Bassermann richtete in diesem Zusammenhang am 4. Dezember 1913 die folgende Anfrage an den Reichskanzler und das Auswärtige Amt; am 9. Dezember wurde sie in der Vollversammlung des Reichstags behandelt: Kann der Herr Reichskanzler Auskunft geben, ob bei dem Abkommen zwischen Russland und China vom 5. November 1913, durch welches einerseits die Suzeränität Chinas über die Äußere Mongolei, andererseits die Autonomie der letzteren anerkannt wurde, die dem Deutschen Reiche kraft Vertrags mit China von 1881 zustehende Meistbegünstigung gewahrt ist?
Die Antwort lautete: Der Kaiserlichen Regierung ist der Inhalt der am 5. November d. J. in Peking von Russland und China gezeichneten Deklaration über die Mongolei aus den Berichten ihrer diplomatischen Vertreter in St. Petersburg und Peking bekannt. Hiernach hat einerseits Russland die Souzeränität Chinas über die Äußere Mongolei, andererseits China die Autonomie der Äußeren Mongolei und deren Recht anerkannt, Fragen auf dem Gebiete des Handels und der Industrie selbständig zu regeln. Eine amtliche Notifikation des Abkommens ist der kaiserlichen Regierung bisher weder von Seiten der russischen noch von Seiten der chinesischen Regierung zugegangen. Da Deutschland auf Grund der ihm im Artikel 40 des deutsch-chinesischen Handelsvertrags vom 2. September 1861 eingeräumten unbeschränkten Meistbegünstigung Anspruch auf alle Privilegien, Freiheiten und Vorteile erheben kann, die von Seiten Chinas der Regierung oder den Angehörigen irgendeiner anderen Macht gewährt worden sind oder in Zukunft gewährt werden, so würde nach den bestehenden Grundsätzen unser Handelsvertrag mit China – und mithin auch die Meistbegünstigung – auf die Mongolei auch dann weiter Anwendung finden, wenn in dem russischchinesischen Abkommen die Souzeränität Chinas über die Äußere Mongolei nicht ausdrücklich anerkannt wäre. 212
5. Wegbereiter mongolisch-deutscher Staatsbeziehungen
Die Kaiserliche Regierung hat überdies schon vor einiger Zeit Veranlassung genommen, der russischen Regierung zum Ausdruck zu bringen, dass sie als Anhängerin und Förderin des Prinzips der Gleichberechtigung für den Handel und die Stellung der Angehörigen aller Nationen in China zwar nicht in der Lage sei, ganz allgemein Sonderrechte einer anderen Macht in bestimmten Teilen des chinesischen Reichs anzuerkennen, dass sie aber in Anbetracht der besonderen Lage Russlands als Nachbarstaat Chinas gern bereit sei, solche Rechte Russlands anzuerkennen, die sich auf besondere Verträge und Abmachungen zwischen Russland und der chinesischen Zentralregierung gründeten, in soweit diese Verträge und Abmachungen amtlich zur Kenntnis der Kaiserlichen Regierung gebracht würden und die aus ihnen in Anspruch genommenen 348 Rechte dem Grundsatz der Gleichberechtigung nicht widersprächen.
Die deutsche Reichsregierung war, so ist dieser Auskunft zu entnehmen, verschnupft, weil sie weder von China noch von Russland bis dato offiziell über den Vertragsabschluss unterrichtet worden war. In diesem Fall war vermutlich sogar die mongolische Regierungsdelegation die Erste gewesen, die die Reichsregierung über die deutsche diplomatische Vertretung in St. Petersburg quasi offiziell unterrichtet hatte – was der Regierung in Nijslel Chüree aber letztlich nichts einbrachte. Dafür kümmerte sich Hermann Consten persönlich darum, dass die Delegation wenigstens in Moskau noch einige Handelskontakte zu russischen und deutschen Unternehmern knüpfen konnte, bevor sie wieder in die Mongolei zurückkehrte. Er verschaffte ihnen ein Entree bei Stepan Rjabušinskij, dem damaligen Vorsitzenden des 349 Moskauer Börsenvereins und begleitete sie zu ihren Gesprächsterminen. Über deren Inhalt unterrichtete er den deutschen Generalkonsul, der die Informationen nach Berlin weitergab. Die mongolische Gesandtschaft unter der Führung von Sain Noyon Chan und Udai Wan hat sich, nachdem sie St. Petersburg verlassen hatte, fast 14 Tage in Moskau aufgehalten. Sie ist vom Moskauer Börsenkomité und von zahlreichen industriellen Unternehmungen wie der Morosow’schen Manufaktur in Bogorodek, der Kattunfabrik Emil Zündel A.-G. und der Militäreffekten-Fabrik Postaschtschik (vormals K. Thiel & Co) äußerst liebenswürdig aufgenommen und gefeiert worden. Trotzdem scheinen die 213
II. Wechsel des Klimas und der Kontinente
Mongolen Moskau sehr enttäuscht und verstimmt verlassen zu haben. Sie hatten, nachdem ihnen die russische Regierung die gewünschte Anleihe nur in dem beschränkten Umfang von 3 Millionen Rubel und nur unter äußerst drückenden und demütigenden Bedingungen bewilligt hatte, anscheinend darauf gehofft, in Moskau, sei es bei der am Handel mit der Mongolei interessierten Industrie, sei es bei den Banken weiteres Geld zu bekommen, und zwar im Gegensatz zu der von der Regierung in Aussicht gestellten Anleihe zu freier, keiner der Kontrolle der Russischen Regierung unterliegenden Verfügung. Darin haben sie sich schwer getäuscht. Die Moskauer Industriellen dachten natürlich gar nicht daran, den Mongolen bares Geld zu leihen, und die Moskauer Banken, bei denen sie anklopften – sie hätten gern 10 Millionen Rubel gegen Verpfändung von Wäldern und Zoll-Einkünften aufgenommen – konnten ihrem Wunsch, selbst wenn sie sonst dazu geneigt gewesen wären, nicht willfahren, da sie einen Wink vom Finanzministerium erhalten hatten, den Mongolen nichts zu leihen. Diese betrübenden Erfahrungen gaben den Leitern der Gesandtschaft sogar zu Erwägungen darüber Anlass, ob sie nicht doch noch nach Deutschland reisen sollten, um es dort zu versuchen. Schließlich ließen sie aber diesen Gedanken, zu dessen Ausführung sie sich mit mir hatten in Verbindung setzen wollen, [durchgestrichen: „auf Anraten des von mir entsprechend instruierten bekannten Gewährsmannes“ – d.h. Constens; D.G.] wieder fallen. Wahrscheinlich werden aber die anscheinend schon seit längerer Zeit von Urga aus gemachten Versuche, unter Umgehung von Russland im Ausland Geld für die mon350 golische Regierung zu bekommen, fortgesetzt werden. […]
In diesen ersten Wochen des Jahres 1914 schien es Hermann Consten allmählich an der Zeit, dass sich die deutsche Regierung für all die nützlichen Informationen über die Mongolei, die er ihr schon seit mehreren Jahren lieferte, endlich erkenntlich zeigte. Er fand, er hätte längst einen Orden verdient. Offenbar hatte er sein Glück schon in Berlin versucht, nun wandte er sich an Generalkonsul Kohlhaas. Dieser wurde tatsächlich tätig, allerdings zunächst nur in einem privaten Handschreiben an den zuständigen Minister und unter Hinweis auf die Anordnung durch das AA, „die wertvoll erscheinende Verbindung mit Consten zu pflegen“. Kohlhaas stellte anheim, für Consten den Preußischen Kronen-Orden IV. Klasse zu beantragen, da 214
5. Wegbereiter mongolisch-deutscher Staatsbeziehungen
dieser Informant auch in Zukunft noch von Nutzen sein könne. Leicht ironisch fügte er an: Er selbst scheint auf eine solche Anerkennung erheblichen Wert zu legen; eine Gefährdung seiner Position den Russen gegenüber befürchtet er dar351 um nicht.
Hermann Consten plante, im Mai 1914 ein weiteres Mal in die Mongolei aufzubrechen, u.a. wohl „um die dort von ihm gefundene [Gräber-]Stadt systematisch nach alten mongolischen Kult- und ethnographischen Gegen352 ständen zu durchforschen“. Dazu scheint es nicht mehr gekommen zu sein. Die Lage in Europa spitzte sich zu, offenbar rechnete er damit, dass es zwischen Russland und dem Deutschen Reich doch zum Krieg kommen könnte. Es schien ihm daher wohl ratsam zu sein, seine Zelte in Moskau besser abzubrechen und vorerst nach Aachen zurückzukehren, um dort die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein so ganz reines Gewissen gegenüber den Russen scheint er also nicht gehabt zu haben.
215
III. Codes und Camouflagen 1914–1918 1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gerät Hermann Consten ins Zwielicht. Anders als die meisten wehrfähigen Männer des Kaiserreiches, meldet er sich nicht zur Armee. Dort würde er – ein Gedanke, der ihm sicher nicht behagte – als einfacher Landsturmmann im Massenheer der „Feldgrauen“ schlicht untergehen. Dies bedeutet aber nicht etwa, dass sich der wegen seiner „afrikanischen Kopfwunde“ angeblich wehruntaugliche Consten seiner patriotischen Pflicht entzogen hätte. Im Gegenteil. Angetan mit einer Rotkreuzbinde am Ärmel, ausgestattet mit einem Auto samt Chauffeur und Rotkreuz-Stander, hat es Consten nur vorgezogen, sich im Windschatten der deutschen Truppen, die in den Morgenstunden des 4. August 1914 die Grenzpfähle bei Aachen überrennen und nach Belgien einfallen, in der Grauzone von Spionage und Gegenspionage zu tummeln. Dummerweise fällt er dabei unangenehm auf. In der allgemeinen Hysterie der ersten Kriegswochen jedenfalls gerät er selbst unter Spionageverdacht, und dies nicht etwa nur im „feindlichen Ausland“. Auch Aachens Polizei und die dort eingerichtete Kommandantur des Heeres verfolgen sein Treiben zu beiden Seiten der gewaltsam verletzten Grenze mit Argwohn. Kritische Bemerkungen Constens über untragbare Zustände in den deutschen Kriegslazaretten werden als „sämtlich aus der Luft gegriffene“ Behauptun353 gen zurückgewiesen. Die Hintergründe der reichlich verworrenen Geschichte über Constens „Kriegseinsatz“ in den ersten Augusttagen des Jahres 1914 lassen sich auch heute noch nicht eindeutig klären. Was sich an Dokumenten fand, bleibt widersprüchlich. So lässt sich nicht ausschließen, dass sein Verhalten beim deutschen Überfall auf das neutrale Belgien ihn sowohl als Urheber wie auch als Opfer gezielter Desinformationen der Kriegspropaganda geradezu prädestiniert hatte. Was war zum Beispiel dran an dem Bericht, den die Pariser Zeitung Le Matin am 22. September 1914 unter der Überschrift „Le témoin de l’Empereur“ (Zeuge des Kaisers) veröffentlichte, der gleichentags auch in der Westminster Gazette, der London Daily Chronicle und tags darauf sogar in der New York Times erschien? Dort war zu lesen, im Anhang zum Weißbuch der deutschen Reichsregierung zum Einmarsch in Bel216
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
gien und zur Rechtfertigung der Gewaltakte deutscher Truppen gegen die belgische Zivilbevölkerung habe Reichskanzler von Bethmann Hollweg „die Zeugenaussage eines Hermann Consten, der als schweizerischer Untersuchungsbeauftragter im Dienst des Roten Kreuzes in Lüttich war“, aufgeführt, wonach belgische Frauen und Kinder arglosen deutschen Soldaten die Kehle durchschnitten hätten. Le Matin veröffentlichte dazu ferner unter der Schlagzeile „L’espion de l’Empereur“ (Spion des Kaisers) eine Erklärung des Basler Polizeipräsidenten, wonach Consten mitnichten Bürger der Schweiz sei, „sondern ein Deutscher, dessen Antrag auf Naturalisierung als Schweizer abgelehnt wurde“. Consten sei in der Schweiz polizeibekannt; nach Ermittlungen in einer Betrugsserie sei am 10. September 1914 seine Ausweisung verfügt worden. Er habe niemals dem Roten Kreuz angehört, sondern werde bereits seit zwei Jahren von der Polizei observiert. Seit Kriegsausbruch habe er die Schweiz nur zwischen dem 9. und dem 14. August verlassen. Es sei daher absolut unmöglich, dass er sich während der 354 Belagerung von Lüttich dort aufgehalten haben könnte. Der Artikel schließt mit den Sätzen: Aufgrund des Ausweisungsbefehls verließ Hermann Consten schließlich die Schweiz. Es hat den Anschein, dass er vor einigen Jahren ein Infor355 mationsbüro in Basel eröffnet hat.
Der angesehene britische Publizist Emil Joseph Dillon kommentierte diese Meldung in seinem Buch „A Scrap of Paper“ (Ein Fetzen Papier). Er schrieb, nicht ohne Ironie: Der Kanzler stützt sich auf die Zeugenaussage eines Hermann Consten, Schweizer Bürger und Mitglied des schweizerischen Roten Kreuzes, also eines gentleman, dessen politisches Unbeteiligtsein seiner Stimme Gewicht verleiht und dessen Anwesenheit in Lüttich während der Belagerung ein angemessener Ausweis für diese exzellente Informationsquelle ist. Aber die Untersuchung hat ergeben, dass die Schilderung dieses von dem ehrenwerten Herrn Reichskanzler genannten Zeugen absolut unwahr ist. Der Polizeipräsident von Basel konnte bezeugen, dass Consten Deutscher ist, dass er in Basel ein deutsches Büro betrieb – vermutlich handelte es sich um einen Spionagering – und dass er nach einer gerichtlichen Ermittlung wegen Betrugs am 10. September aus der Schweiz aus217
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
gewiesen wurde, dass er seit zwei Jahren unter Polizeibeobachtung stand, weder schweizerischer Bürger noch Mitglied des Roten Kreuzes war und dass er sich während der gesamten Belagerung Lüttichs in der Schweiz aufhielt; er kann also keines der von ihm angegebenen Greuel gesehen 356 haben.
Doch nicht nur die internationale Presse interessierte sich für diese Agentenstory, auch die Militärgeheimdienste und die Aachener Polizei legten Akten über Hermann Consten an. So konnte noch 1918 das Budapester Heereskommando dem k.u.k. Armee-Oberkommando (AOK) streng vertraulich über Hermann Consten mitteilen: Bei Ausbruch des Krieges war er in Belgien zur Beschaffung von Schiffsnachrichten tätig. Seine Artikel im Berliner Lokalanzeiger über die Greueltaten der belgischen Franc-Tireurs verursachten gegen ihn eine große französische Zeitungskampagne. Besonderes Aufsehen erregten im Matin die Artikel „Le témoin de l’Empereur“ und L’espion de L’Em357 pereur“.
Und ein Polizei-Informant aus Aachen erteilte dem Chef des k.u.k. Militär358 geheimdienstes, Oberst Max Ronge, auf entsprechende Anfrage folgende Auskunft: Vor dem Kriege weilte Hermann Consten in der Schweiz[,] angeblich um noch weitere Studien zu machen; es stellte sich jedoch heraus, dass er Spionage betrieb und er wurde deshalb aus der Schweiz ausgewiesen. Es 359 gelang ihm zu flüchten, sonst wäre er verhaftet worden.
Nimmt man Hermann Constens bisherigen „Lebensgang“ in den Blick, werfen Berichte wie diese eine Reihe von Fragen auf. Mindestens eine der Angaben scheint schlicht und ergreifend nicht zu stimmen: seine angeblichen Aufenthalte und Aktivitäten in der Schweiz. Wie konnte ein Mann, der seit 1904 in Moskau lebte und sich im seither verflossenen Jahrzehnt überwiegend in der Mongolei aufgehalten hatte, der 1914 sogar – hätte ihn nicht die Kriegsgefahr daran gehindert – ein weiteres Mal dorthin aufbrechen wollte, gleichzeitig in der Schweiz ein Agentenbüro unterhalten und dort bereits seit zwei Jahren, also seit 1912, observiert werden? Das Einzige, was im Nachhinein ein wenig stutzig macht, ist die Tatsache, dass Consten 218
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
1912 immerhin mehrere Monate lang weder in Moskau noch in der Mongolei war, sondern, soweit bekannt, in Aachen. Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass er ein dringendes, an ihn nach Aachen adressiertes Schreiben des deutschen Generalkonsuls aus Moskau „durch ein Versehen“ erst mit erheblicher Verspätung erhalten haben will. Er muss also zumindest zeitweise abwesend von Aachen gewesen sein. Kommt hinzu, dass er ursprünglich bereits Mitte März 1912 wieder in Moskau sein wollte, aber erst im Juli dort aufgetaucht ist. Theoretisch ist also denkbar, dass sich Hermann Consten zwischen März und Mai 1912 unter anderem auch in Basel aufgehalten hat – wobei noch völlig offen wäre, was er dort angestellt haben könnte, dass er die Aufmerksamkeit der Basler Polizei auf sich zog – und in wessen Auftrag er dort war. Gewichtiger ist jedoch die Tatsache, dass sich weder im Basler Staatsarchiv noch im Schweizerischen Bundesarchiv in Bern in den einschlägigen Akten der schweizerischen Fremdenpolizei irgendwelche Hinweise auf die Anwesenheit eines Hermann Consten in der Schweiz zwischen 1912 und 1914 finden ließen – es sei denn, er hätte sich dort unter anderem Namen betätigt. Sein Klarname war den schweizerischen Behörden angeblich aber bekannt. Dann die zweite Frage: Welcher Artikel Hermann Constens im Berliner Lokalanzeiger könnte der Auslöser der – im übrigen ziemlich verspäteten – französischen Pressekampagne gewesen sein? Unter den vielen Meldungen und Erlebnisberichten über den deutschen Einmarsch in Belgien und die behaupteten Verbrechen an deutschen Soldaten fand sich in der genannten Zeitung keiner, der mit dem Namen Hermann Consten gezeichnet war. Doch fiel bei der Durchsicht ein längerer Beitrag auf der Titelseite der Abendausgabe vom 14. August 1914, mit Datumszeile Aachen 12. August besonders auf. Unter der Schlagzeile „Vom deutsch-belgischen Kriegsschauplatz – Stimmungsbild von Nanny Lambrecht“ unterschied sich dieser, offenbar von einer Frau verfasste Beitrag in Stil und Diktion auffallend vom Gros der Kriegsberichte. Vor allem aber brachte er die belgischen Greuel in einen unmittelbaren Zusammenhang mit angeblich längst in der Schublade liegenden französischen Plänen, die belgische Bevölkerung in eine Art Guerillakrieg gegen das deutsche Kaiserreich zu treiben. Das heißt, die Verfasserin (oder war es doch ein Verfasser?) bezichtigte die Franzosen nicht 360 nur, selbst die Verletzung der belgischen Neutralität geplant zu haben, 219
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
sondern auch, die geistigen Anstifter der behaupteten Bluttaten belgischer Zivilisten an deutschen Soldaten gewesen zu sein. Dort hieß es u.a.: Die französische Parole war ja schon dem Einzug in Belgien vorausgeeilt: „In acht Tagen sind wir in Lüttich, in 14 Tagen in Aachen, und dann pflastern wir Aachen mit Weiberköpfen.“ Pardon messieurs, in vier Tagen waren u n s e r e Truppen in Lüttich. Das ist ein Schlag! Man kann seine Wirkung an der Wut ermessen, die jetzt die Zivilbevölkerung an unseren Soldaten austobt. Was jetzt in Belgien vor sich geht, spricht allem Völkerrecht Hohn. […] Schuss auf Schuss fällt aus den Häusern, aus Kirchen, aus Büschen auf unsere einrückenden Truppen. Selbst Weiber und Kinder werden zu Meuchelmördern. Ein Offizier zieht in ein Haus ein, verlangt zu trinken, nur Frauen sind anwesend, er trinkt, da prallt ihm ein Schuss in den Rücken. Ein Knabe bietet lächelnd einem Soldaten eine Zigarette an, der Soldat nimmt sie an, erfreut über die Höflichkeit des Kindes, da versetzt ihm die Kinderhand einen Messerstich. Auf einem Kirchturm ist die weiße Fahne gehisst. Ehrt das Gotteshaus! Und heimtückisch aus den Mauerluken flammen die Schüsse. Ich sprach mit den Mannschaften, die Chauffeurdienste tun und in wichtiger Mission die Todesfahrt bis ins Feindesland hinein tun müssen. Sie alle sind in zorniger Empörung über die Hinterlist und Verschlagenheit der belgischen Bevölkerung. […] Und wem die Schuld an dieser grausamen Fanatisierung der Menge? Vor mir liegen die Annales Politiques aus dem Jahr 1913. Der französische Oberstleutnant Rousset bespricht darin den Fall 361 der Neutralitätsverletzung Belgiens durch Deutschland und erinnert schwungvoll daran, was ein belgischer Offizier gefordert habe: dass die gesamte waffenfähige Bevölkerung von Belgisch-Luxemburg militärisch ausgebildet werden müsse, um den Feind aufzuhalten. So könnten die regulären belgischen Truppen wirksam unterstützt werden, da die Eingeborenen [sic] in dem schluchtenreichen Lande mit den Deutschen eine Art Guerillakrieg führen würden. Braucht man nun noch eine weitere Erklärung für die wahnsinnigen Ausschreitungen der belgischen verhetzten Bevölkerung zu suchen? […]
Soweit der demagogische Schuldvorwurf an die Adresse der Franzosen. Und dann folgte ein Aachener Stimmungsbild im „Consten-Stil“: 220
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
Wir stehen auf dem Türmchen des Hauses. Marsch, marsch! In schweigender Nacht ziehen Deutschlands Heere über die Grenze hinüber. Wir lauschen bang, aber die Nacht antwortet nicht. Drüben in der dumpfen Finsternis der Hertogenwald auf dem Grenzstrich. Welche Mär aus dem Rauschen seiner Wipfel dringt zu uns herüber? Schüsse in der Abendluft. Ab und zu fernes, dumpfes, gewitterdrohendes Rollen. Die Schlünde unserer Kanonen brechen auf. Sie haben Tod und Verderben gespien. […] Die alte Kaiserstadt Aachen ist zu einem Feldlager geworden. Auf den Plätzen, auf den Straßen, im Feld lagern sie, Waffenlärm, Waffenputzen, Felddienstübungen, Soldatenspäße, Siegesrausch und Begeisterung. Ein Geist beseelt die Truppen wie ihn die Weltgeschichte nie erlebt hat. Sie ziehen zum Kampf hinaus wie zu Freudenfesten. Eine heiße, kühne 362 Kampfgier jagt sie, eine herausgeknirschte Sehnsucht: „Ins Feuer!“
Auf dem Dach des Consten-Anwesens am Aachener Kölntor gab es übrigens sogar zwei solcher Türmchen. Eines saß genau auf dem Eckdach, das andere über dem Treppenhaus des Eingangs Heinrichsallee, wo sich die Privaträume der Familie Consten befanden. Diese Türmchen hatten begehbare Plattformen für den freien Rundblick, holzgeschnitzte Brüstungen und 363 neobarocke Hauben mit metallenen Kugelaufsätzen. Könnte also der Verfassername dieses propagandistischen Machwerks ein Pseudonym gewesen sein? Die unbefangene Leserin denkt spontan: so schreibt keine Frau. Tatsächlich genügt schon ein Vergleich mit den anderen Frauen-Artikeln zum Thema Krieg in derselben Zeitung, in denen vor allem bange Sorge um die Männer im Felde und um die Zukunft der Kinder artikuliert wird, für berechtigte Zweifel an einer weiblichen Autorschaft. Dieser Stil, bestimmte Phrasen und rhetorische Tricks deuten durchaus auf Hermann Consten als Autor. Auch die Verquickung von Historie, Ortskenntnis und eigenem Erleben, Naturschilderung als Folie für Emotionen etc. finden sich oft in seinen Texten, seien es die Briefe und Erzählungen aus Afrika, seien es die nach dem Krieg erst erscheinenden Mongolei-Romane. Ein Beweis für Constens Autorschaft ist dies alles dennoch nicht. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass es Nanny Lambrecht gegeben hat. Sie war eine Lehrerin und Schriftstellerin aus Malmedy, die sogar recht bekannt war. Etliche Jahre, unter anderem auch während des Ersten Weltkriegs, hat 221
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
sie in Aachen gelebt; sie kannte sich mit den örtlichen Verhältnissen also 364 gut aus. Dass Consten unter dem Namen einer überregional bekannten Zeitgenossin diesen Artikel publiziert haben könnte, wäre dann doch der Dreistigkeit zuviel gewesen. Zwar kannte er wenig Skrupel, aber die als recht emanzipiert bekannte Nanny Lambrecht hätte sich sicher zu wehren gewusst. Vor dieser Sorte Frauen hatte Hermann Consten Respekt. Wie auch immer, ein wenig Licht lässt sich schon in das Dunkel bringen, in das Constens Aktivitäten in den ersten Kriegstagen getaucht sind. Er selbst beteuerte, er habe bis zum 29. Juli 1914, dem Tag nach der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien, am ersten Band seiner „Weide365 plätze“ geschrieben. Doch scheint er sich nach seiner Rückkehr aus Moskau keineswegs nur im stillen Kämmerlein aufgehalten zu haben, um seine mongolischen Reiseerlebnisse zu Papier zu bringen. Nachweislich hielt er engen Kontakt mit höchsten Regierungsstellen in Berlin und mit den Brüdern Mannesmann. Auch trug er sich in den heißen Tagen der Juli-Krise, ungeachtet der drohenden Kriegsgefahr, offensichtlich mit neuen Expeditionsplänen. Als schließlich im September die angeblich von Consten ausgestreuten Greuelgeschichten, die breite Spur der Zerstörungen von Lüttich bis Dinant, die in die Tausende gehende Zahl belgischer ziviler Opfer für Empörung in der internationalen Presse sorgten, als dann auch noch die wahre Identität des „schweizerischen Rotkreuz-Vertreters“ Hermann Consten aufgedeckt wurde, da war dieser schon längst wieder über alle Berge. Der Gefahr, in die er geraten war, entkommt Consten, dank potenter Gönner in Berlin. Der Mann, der seine schützende Hand über ihn hält, ist zwar nicht gerade der Herr Reichskanzler persönlich, aber es ist niemand geringerer als Reinhard Mannesmann. In enger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt sorgt der einflussreiche Großunternehmer und Erfinder dafür, dass Hermann Consten in wichtiger Mission nach Berlin reisen kann. Denn dort werden Pläne für ein deutsch-türkisches Sonderunternehmen geschmiedet, für das man den Forschungsreisenden mit seinen Zentralasien-Kenntnissen braucht. Als nächstes veranlassen Reinhards Brüder Carl und Max Mannesmann das Auswärtige Amt, ein Telegramm an den Aa366 chener Vaterländischen Frauenverein zu schicken, mit der Maßgabe, man möge Consten ein Rotkreuz-Automobil für die Reise nach Berlin zur Verfü367 gung stellen. Wegen des gegen ihn vorliegenden Spionageverdachts – 222
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
vielleicht auch nur wegen der verlangten Freistellung des Kraftfahrzeugs, das hinter der Front sicher dringender gebraucht wird – zögert die Kommandantur Aachen, ihm den dazu erforderlichen Passierschein auszustel368 len. So sorgt wiederum Reinhard Mannesmann dafür, dass Constens angeschlagene Reputation in seiner Heimatstadt „repariert“ wird. In einem Telegramm an seinen Bruder Max teilt er diesem mit, das Auswärtige Amt habe den Aachener Polizeipräsidenten davon in Kenntnis gesetzt, dass Consten seit 8 Tagen zur Verfügung Auswärtigen Amtes steht, daher Spionageverdacht Irrtum / erbittet Präsidium ungerechtfertigte Eh369 renkränkung geeigneter Weise reparieren.
Am 20. August 1914 ist Hermann Consten in Berlin. Bei der ersten Beratungsrunde im Auswärtigen Amt begegnet der einstige Kaffeepflanzer ausgerechnet dem Mann, der 20 Jahre zuvor die Idee gehabt hatte, auf einem Fleckchen Urwald im ostafrikanischen Handëi-Gebirge die Plantage anlegen zu lassen, auf der er als „Crashkurs-Absolvent“ der Kolonialschule Witzenhausen seine bislang einzige feste Arbeitsstelle fand: Max Freiherr von Oppenheim. Erst im vorangegangenen Herbst ist Oppenheim aus der syrischen Wüste zurückgekehrt und hat Wohnsitz in Berlin genommen. Mit Kriegsbeginn hat er seine Dienste dem Auswärtigen Amt wieder zur Verfügung gestellt, dem er schon zu Jahrhundertbeginn als „Ministerresident“ in Kairo gedient hatte. Nun ist er involviert in ein Programm, von dem die deutsche Öffentlichkeit nichts erfahren darf. Es nennt sich „Unternehmungen und Aufwiegelungen gegen unsere Feinde“. Dem Programm zugrunde lagen mehrere Denkschriften Oppenheims. Deren wichtigste mit dem Titel „Die Revolutionierung der islamischen Ge370 biete unserer Feinde“ war gerade in Arbeit. Sie hatte nichts geringeres zum Inhalt als in den von Großbritannien, Russland und Frankreich kontrollierten Regionen des Nahen und Mittleren Ostens wie auch Nordafrikas mit Hilfe von Propagandaschriften, Waffen und viel Geld, vor allem aber durch die Ausrufung eines „Heiligen Krieges“, Feuer an die Lunte islamistischen Aufruhrs von Kairo bis Kalkutta zu legen und Stimmung für die 371 deutschen „Befreier“ vom kolonialen Joch zu machen. Die Denkschrift fiel, als sie im Oktober 1914 erschien, bei Kaiser Wilhelm und Unterstaatssekretär Arthur Zimmermann auf fruchtbaren Boden. Gemeinsam mit dem 223
III. Codes und Camouflagen 1914–1918 372
Publizisten und Orientkenner Ernst Jäckh gründete Oppenheim in Berlin daraufhin als Organisations- und Propagandazentrum die „Nachrichtenstelle für den Orient“; sogenannte „Nachrichtensäle“ in der islamischen Welt sollten später folgen. Und so mancher ehrwürdige Berliner Universitätsprofessor war sich nicht zu schade, sich in patriotischem Überschwang mit seinen orientalischen Landes- und Sprachkenntnissen für die Ausarbeitung bzw. Übersetzung solcher Propagandaschriften herzugeben. Max von Oppenheim, der berühmte Orientreisende und Ausgräber der antiken Tempelanlage von Tell Halaf, ist eine imposante Erscheinung. Als er Consten jovial mit Handschlag begrüßt, befällt den ihm gerade bis zur Brust reichenden „Mann von Mannesmann“ ungewohnte Schüchternheit beim Anblick der raumgreifenden Gesten des rheinischen Freiherrn. Seine beiden Assistentenjahre in Ngambo und Kwamkuju fallen ihm wieder ein. Die Demütigung, die er empfand, als man seine Dienste auf der Plantage plötzlich nicht mehr benötigte, schmerzt auf einmal wieder – wie früher gelegentlich seine afrikanische Kopfwunde. Aber Consten lässt sich nichts anmerken und fängt sich bald. Der angehende „Expeditionsführer“ scheint wenig Neigung zu verspüren, das Gespräch auf gemeinsame Erinnerungen an Ngambo und Kwamkuju zu lenken. Es wäre ihm nachgerade peinlich gewesen, von Oppenheim auf die wirklichen Gründe für seinen Aufenthalt in Deutsch-Ostafrika in den Jahren 1901/02 angesprochen zu werden. In seiner Bewerbung auf den neuen Posten verpasst sich Hermann Consten lieber eine lückenlose Vita als Forschungsreisender, was einige der künftigen Expeditionsteilnehmer zu der fälschlichen Annahme verleitet, Consten besitze gar einen Doktortitel. Ich bereiste Deutsch-Ostafrika 1901-1902. 1903 ging ich nach Russland, woselbst ich im Lasareff’schen Institut auf Veranlassung des Generalkonsuls Dr. Kohlhaas orientalische Sprachen studierte. Von Moskau habe ich dann in den Jahren 1903 bis 1914 Algier, Tunis, Arabien, Ägypten, Zentralasien, Mongolei, Afghanistan und Indien bereist und in geographischem, ethnologischem, handelspolitischem und politischem Interesse 373 eine ganze Anzahl von Expeditionen geführt.
Und um die Herren noch mehr zu beeindrucken, fügt er an: Ich glaube einer der besten Kenner für russische Verhältnisse zu sein, 224
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
und zwar sowohl der inneren Verhältnisse Russlands als auch seiner äußeren Beziehungen, da ich ständig enge Fühlung mit russischen Diplomaten, sowie gleichzeitig mit den verschiedensten Volksschichten unter374 hielt. Ich bin z.B. mit dem jetzigen russischen Gesandten Korostovetz, mit dem ich über handelspolitische Verhältnisse der Mongolei lange verhandelt habe, eng befreundet. Dies wird der jetzige Vizekonsul Dr. Hau375 schild, der an die Stelle des verstorbenen Dr. Kohlhaas getreten ist, jederzeit bestätigen, ebenso der Staatsminister a.D. von Hentig, sowie die Herren Reinhard und Max Mannesmann.
Dass Consten in diesem Schriftstück seine Spezialkenntnisse und bisherigen Verdienste als Informant des Auswärtigen Amtes besonders herausstreicht, dass er beiläufig auch auf den immer noch ausstehenden Ver376 dienstorden verweist, wer könnte ihm dies verdenken. Auch dass er zu den vielen Reisen, die er bereits unternommen hat, noch einige gerade passend erscheinende Länder hinzufügt, von denen er während seiner Schiffsreisen allenfalls die Hafenstädte kurz betreten haben dürfte, mag man ihm nachsehen. Bedenklicher ist schon, dass er es mit den Jahreszahlen nicht so genau nimmt und wohlweislich verschweigt, dass er bei den von ihm „geführten“ Expeditionen fast immer sein einziges Mitglied gewesen ist. Als es schließlich darum geht, zu konkretisieren, wie er sich seine neue Aufgabe denn vorstellt, bleibt Consten dagegen eine befriedigende Antwort schuldig. Er schreibt: Nach meinen Erfahrungen sind häufig weit im Innern Variationen des ursprünglich festgelegten Planes nötig, ohne dass man zuvor Rückfragen zu stellen in der Lage ist. Auch im Interesse der Sicherheit, des Lebens und der Gesundheit etwaiger anderer Expeditionsteilnehmer, aber nicht so landeskundige[r] Herren, scheint es absolut nötig, dass die Expeditionsleitung einheitlich ist. Ich schlage ergebenst vor, dass das Ziel und der Zweck der Expedition als Auftrag gegeben wird, das „wie“ und „auf welchem Wege“ nach den Umständen aber dem Expeditionsführer überlassen wird.
Möglicherweise hatte Hermann Consten durchaus einen Plan entwickelt, zog es aber vor, das Vorbereitungskomitee mit einer wolkigen Erklärung abzuspeisen. Vielleicht wollte sich auch sein Mentor Reinhard Mannes225
III. Codes und Camouflagen 1914–1918 377
mann nicht in die Karten schauen lassen und hatte Consten zur Verschwiegenheit verdonnert. Die Zurückhaltung des Auswärtigen Amtes gegenüber dem mit den Mannesmann-Brüdern konzipierten Mongolei-Projekt von 1912 war mit Sicherheit nicht vergessen. Dass sich aber das Auswärtige Amt mit einer so windigen Auskunft zufriedengab, verwundert denn doch. Ganz offensichtlich vertraute man dort darauf, dass die federführenden Türken längst konkrete Pläne in der Tasche hatten. Enver Pascha hatte man diesbezüglich jedoch keine Fragen gestellt. Jedenfalls geht Consten mit größter Selbstverständlichkeit davon aus, dass ihm die Gesamtführung der Expedition zufallen wird, denn er schreibt: Ich möchte mich, da es sich um vorwiegend mohammedanische Gebiet[e] handelt, der türkischen Regierung als Expeditionsleiter mit türkischem Offiziersrang, im Einverständnis mit dem Auswärtigen Amt zur Verfü378 gung stellen.
Richtig verstanden kann dies nichts anderes bedeuten, als dass Consten hier versucht, mit amtlichem deutschem Segen einen „Flaggenwechsel“ vorzunehmen. Als Angehöriger der türkischen Seite nämlich, gar noch ausgestattet mit türkischem Offiziersrang, könnte er bei dem von Kriegsminister Enver Pascha initiierten Geheimkommando in jedem Fall an der Spitze stehen. Er hat wohl blitzschnell begriffen, was es für ihn bedeuten würde, wenn Enver Pascha lediglich die Entsendung einiger deutscher Offiziere 379 zur Verstärkung einer türkischen Militär-Expedition wünscht. Dem ungedienten Zivilisten Hermann Consten erscheint die Aussicht, in einem deutschen Kontingent, das den Türken lediglich attachiert ist, mit einer Gruppe standesbewusster deutscher Offiziere konkurrieren zu müssen, wohl wenig attraktiv. Als türkischer Offizier mit Leitungsfunktion hingegen könnte er diesen Herren sogar Befehle erteilen. Und dass er sich mit den Türken verstehen wird, das ist für ihn sowieso klar. Schließlich ist er ja auch mit den Mongolen gut ausgekommen. Dennoch scheint ihn zu diesem frühen Zeitpunkt bereits eine leise Ahnung gestreift zu haben, dass die geheime Afghanistan-Expedition eines noch fernen Tages nicht als die „Expedition Consten“ in die Geschichte des Ersten Weltkriegs eingehen und ihm ewigen Ruhm sichern würde. Dass die Entwicklung einen ganz anderen Verlauf nahm als den gewünschten, sollte 226
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
ihm später noch viel Verdruss bereiten. Den übrigen Beteiligten allerdings auch. Nicht jeder der verantwortlichen Herren in Berlin dürfte das großspurige Verhalten des kleingewachsenen, quirligen Consten goutiert haben. Doch empfiehlt es sich, den tieferen Ursachen für sein anspruchsvolles Auftreten in der Reichshauptstadt nachzugehen, um festzustellen, dass seine Forderungen nicht ganz unbegründet waren. Dazu muss an dieser Stelle weiter ausgeholt werden: Pläne, die islamische Welt in den Kampf gegen die europäischen Feinde des Deutschen Kaiserreichs zum eigenen Vorteil einzuspannen, waren unter deutschen „Geostrategen“ jeglicher Provenienz schon länger virulent. In Gelehrten-, Industrie- und Bankenkreisen, vor allem im annexionistisch gesinnten Alldeutschen Verband, aber auch unter den moderateren Befürwortern einer „nur“ wirschaftsexpansionistischen Politik, kursierten bereits seit den 1890er Jahren Vorstellungen, die Völker des Vorderen und Mittleren Orients wie auch Nordafrikas würden nur darauf warten, „durch deutschen Fleiß, deutsches Wissen unter einer starken deutschen Regierung“ zu neuer Macht und Blüte zu gelangen. Schon um die Jahrhundertwende war im Zusammenhang mit dem Bau der BagdadBahn eine Reihe von Schriften erschienen, in denen sich die Autoren für eine Besiedlung und Ausbeutung Mesopotamiens durch deutsche Kolonisten einsetzten. Nach dem Misslingen des Marokko-Plans und den Balkankriegen wurden verstärkt Ideen über einen Großwirtschaftsraum von der Nordsee bis zum Persischen Golf entwickelt. Die Brüder Mannesmann waren daran nicht unbeteiligt. Neben dem Alldeutschen Verband, der die Errichtung eines vom Deutschen Reich dominierten Staatenbundes von der Nordsee bis Mesopotamien propagierte, neben Friedrich Naumann und den Publizisten Paul Rohrbach und Ernst Jäckh, die Vorstellungen eines mehr wirtschaftlich als militärisch geprägten „mitteleuropäisch-vorderasiatischen Gemeinschaftsgebiets“ unter 380 deutscher Vorherrschaft vertraten, gehörten der Bremer Kaffee-König 381 Ludwig Roselius und Reinhard Mannesmann zu den fleißigsten Verfassern politischer Denkschriften dieser Art. Beide hatten großes Interesse an der Ausbeutung agrarischer Rohstoffe und Bodenschätze für den deutschen Bedarf, an der industriellen Erschließung Südosteuropas und dem Bau von Bahnen in der Türkei sowie an der weiträumigen militärischen Absiche227
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
rung des noch zu schaffenden Wirtschaftsraumes gegen Begehrlichkeiten anderer Großmächte. Roselius war außerdem ein leidenschaftlicher Befürworter deutscher Propaganda in den Balkan-Staaten, mit dem Ziel, Entente-Einflüsse, ja selbst den Bündnispartner Österreich-Ungarn dort zurückzudrängen. Dem Auswärtigen Amt hatte er deshalb vorgeschlagen, gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaft ein Komitee für Auslandspropaganda zu gründen. Diesem Ziel diente, neben der Eröffnung eines deutschen Korrespondenzbüros in Bukarest und der kostenlosen Belieferung von Cafés und Restaurants mit deutschen Zeitungen u.a. auch, dass er und Reinhard Mannesmann nach Kriegsbeginn in Rumänien und Bulgarien das Vertriebsmonopol für Druckerschwärze erwarben und das Produkt nur an Zeitungen weiterverkauften, die als deutschfreundlich galten. Darüber hinaus war ihre gemeinsame Geschäftsstelle im Haus des 382 Reichs-Kolonialamtes in der Wilhelmstraße 62 Lobbyistenbüro und Deckadresse zugleich für Geheimgeschäfte mit dem Auswärtigen Amt und dem Generalstab, z.B. bei der Vergabe von Lieferaufträgen für Rüstungsgüter an die Mannesmann-Werke oder auch zur Unterstützung konspirativer Bewegungen im Ausland mit Geld, Waffen und anderen Materialien für 383 geplante Attentate, ja sogar für biologische Kriegführung. Die Brüder 384 Mannesmann, die längst auch Pläne zur Modernisierung der Türkei in Auftrag gegeben hatten, waren insofern noch einen Schritt weiter gegangen als andere Memorandenschreiber, als sie insgeheim bereits besagte private „Studien-Expedition“ in den Mittleren Osten vorbereiteten, für die Hermann Consten als Expeditionsleiter fest vorgesehen war. Es kann nicht einmal ganz ausgeschlossen werden, dass Consten selbst einen entsprechenden Vorschlag gemacht hatte, nachdem das gemeinsame Mongolei-Projekt wegen des Kriegsausbruchs erst einmal gestoppt war. Dass sich das Auswärtige Amt, angestoßen durch die Initiative des tür385 kischen Kriegsministers Enver Pascha, des ursprünglichen MannesmannConsten-Plans annahm, ist durch ein Schreiben des Diplomaten, Korvetten386 kapitäns und Forschungsreisenden Alfred Zintgraff belegt, der ebenfalls als Teilnehmer der geheimen Afghanistan-Expedition vorgesehen war, sich dann aber wegen persönlicher und sachlicher Bedenken zurückzog. Nach der Kommissionssitzung vom 3. September schrieb Zintgraff an Unterstaatssekretär Zimmermann über deren Verlauf: 228
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
Es wurde mitgeteilt, dass die Unternehmung ursprünglich als eine rein persönliche der Herren Mannesmann geplant gewesen sei, dass dann aber infolge einer Anregung von Enver Pascha auch die deutschen amtlichen Kreise der Sache näher getreten seien. […] Herr Mannesmann hat ja sicher große Erfahrung in marokkanischen Verhältnissen, ob er aber die persischen und afghanischen ebenso gut kennt, entzieht sich meiner Beurteilung. Ich kann aufgrund meiner Kenntnis ähnlicher Verhältnisse jedenfalls nur wiederholen […], dass mir diese Unternehmung reichlich unbedacht und unvorbereitet ins Leben zu treten scheint und damit die Gefahr eines völligen Misslingens in sich trägt, das gerade jetzt im Osten auf das bestimmteste vermieden werden muss. Man scheint sich in allem auf Enver Pascha zu verlassen, der aber sicher schon jetzt den Kopf mit 387 größeren und wichtigeren Dingen voll hat.
Diese nüchterne Einschätzung traf sicherlich zu. Doch die Zeit drängte. Das Auswärtige Amt griff daher auf ein fertiges Projekt zurück, das man mit nur geringfügigen Änderungen übernehmen zu können glaubte. Enver Pascha wiederum suchte mit dem Vorschlag eines türkisch-deutschen Geheimkommandos und der Aussicht, den Emir von Afghanistan gegen England und Russland in Stellung zu bringen, offenbar nach einem Weg, seinen ungeduldigen Bündnispartner fürs erste ruhig zu stellen. Seit das Deutsche und das Osmanische Reich nämlich am 2. August 1914 einen Allianzvertrag unterschrieben hatten, die Türken aber unmittelbar danach ihre „bewaffnete Neutralität“ erklärten, war Enver unter deutschen Druck geraten. Er sollte Russland möglichst bald den Krieg erklären und Kampfhandlungen im Schwarzen Meer eröffnen. Enver war zwar grundsätzlich zum Krieg bereit, wollte sich aber den richtigen Zeitpunkt zum Losschlagen nicht vom Großen Hauptquartier vorschreiben lassen. Erst brauchte er Rückhalt im eigenen Kabinett und kampffähige Truppen. Die Mobilisierung der türkischen Streitkräfte, die sich zu jenem Zeitpunkt von den Verlusten an Menschen und Material in den beiden Balkankriegen (1912 und 1913) noch gar nicht erholt hatten, erforderte Zeit. Zwar war bereits seit 1913 eine deutsche Militärmission unter Marschall Liman von Sanders in Konstantinopel stationiert, die als Berater und Ausbilder für die Osmanische Armee tätig war. Doch musste nun die Materialausrüstung fast vollständig per Bahn über die Balkanländer aus Deutschland herangeschafft werden. 229
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Das Mittelmeer, damit auch der Zugang zu den Dardanellen, wurde seit Kriegsausbruch praktisch von der Entente kontrolliert. Selbst der Landweg erwies sich angesichts des Misserfolgs Österreich-Ungarns in Serbien und der Transportblockaden seitens Rumäniens als zunehmend schwierig. Im übrigen herrschte allgemeine Kriegsmüdigkeit unter der osmanischen Bevölkerung. Und es gab Gegendruck im Kabinett der Hohen Pforte. Einige Minister hegten sogar offene Sympathien für die Ententemächte. Vor allem aber war der Oberste Kriegsherr des Osmanischen Reiches, Großwesir Said Halim Pascha, ein eher zurückhaltender Mann ägyptischer Herkunft, bei aller zur Schau gestellten Deutschfreundlichkeit von der Notwendigkeit einer direkten Kriegsbeteiligung nicht überzeugt. Nicht zuletzt auch mit Blick darauf, dass Enver vorwiegend türkische nationale Ziele und nicht unbedingt die deutschen Kriegsziele im Auge hatte, war sein Zö388 gern daher verständlich. Envers Überzeugung war, wie Marineattaché Hans Humann gegenüber Admiral Souchon, dem Kommandanten der seit dem 11. August unter türkischer Flagge im Bosporus vor Anker liegenden Kriegsschiffe SMS Goeben und SMS Breslau, gelegentlich feststellte: Wenn das Deutsche Reich die Türkei materiell und finanziell unterstützt, tut es das um des eigenen Vorteils willen; wenn die Türkei die Hilfe akzeptiert, 389 tut sie dies ihrerseits ausschließlich um des eigenen Vorteils willen. Eine solche Konstellation musste früher oder später auch zu Differenzen mit den deutschen Expeditionsteilnehmern führen. Trotz der Tatsache, dass sie unter türkischem Kommando stehen sollten, fühlten sie sich den Wünschen des Auswärtigen Amtes und des Generalstabs natürlich stärker verpflichtet als der türkischen Seite. Aber noch befindet man sich an der Berliner Wilhelmstraße in der Planungsphase. Noch geht Hermann Consten davon aus, dass er der Spitzenmann der Expedition sein wird. Durch die Initiative Enver Paschas und den Einstieg des Auswärtigen Amtes in Projektierung und Organisation des Afghanistan-Unternehmens erhält der Mannesmann-Consten-Plan eine ganz neue Qualität – und noch dazu gleich mehrere neue Väter. Das Auswärtige Amt sieht damit die Chance gegeben, den Kriegseintritt der Türken auf diplomatischem Wege zu beschleunigen. Max von Oppenheim möchte die Expedition als Vehikel für die Umsetzung seiner Jihad-Ideologie benutzen. Und für Kaiser Wilhelm II. gewinnt schon in den ersten Kriegstagen eine 230
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
seiner Lieblingsideen konkrete Gestalt, die er seit seinem Staatsbesuch im Osmanischen Reich 1898 hegte: nämlich als Schutzherr von 300 Millionen Muslimen des Nahen und Mittleren Ostens aufzutreten und diese dazu zu bringen, das Joch ihrer christlichen Feinde abzuschütteln. Selbst der Große Generalstab, der schon länger Wünsche in Bezug auf Persien hegt, meldet 390 sein Interesse an. Mannesmanns und Constens „Studien-Expedition“ – ihrem Charakter nach ursprünglich wohl eher ein öko-politisches Explorationsprojekt – soll nun also Bestandteil deutsch-osmanischer Militärzusam391 menarbeit im Kriege werden. Dennoch behält auch Reinhard Mannesmann die Fäden in der Hand. Er wird mit seinem Kompagnon und Freund Ludwig Roselius für die Beschaffung der nötigen Ausrüstung, Waffen und eventueller Geschenke verantwortlich zeichnen und außerdem alle Abrechnungen mit dem Auswärtigen Amt über sein Büro abwickeln. Um den sicheren Transport der beschafften Güter nach Konstantinopel will sich das 392 AA dann selbst kümmern. Während also in Flandern und Nordfrankreich wie auch an der Grenze zu Russland tausende Soldaten bereits ihr Leben lassen, während der deutsche Vormarsch im Westen schon gegen Ende August in Stocken gerät und sich die gegnerischen Armeen auf den Schlachtfeldern an Marne und Aisne eingraben, tagt in Berlin Woche um Woche eine Gruppe honorig wirkender Herren – Diplomaten, Gelehrte, Unternehmer, Reeder und Geschäftsleute – und bastelt gemeinsam an Strategien für das geheime Kommando zur Eröffnung einer weiteren, nicht deklarierten Kriegsfront jenseits der Grenzen des Osmanischen Reiches. Da ihr Weg die Expedition zwangsläufig durch Persien führen wird, soll gleichzeitig versucht werden, persische Reiterstämme zu bewegen, von der durch den Schah erklärten Neutralität abzurücken und an der Seite der Zentralmächte in den Krieg gegen Russland 393 und England zu ziehen. Kontaktnahmen der Türken in Richtung Afghanistan hat es offenbar bereits gegeben. Enver Pascha jedenfalls versichert der deutschen Seite, der Emir von Afghanistan sei zum Losschlagen be394 reit. Sven Hedin, dessen vermeintlich kompetentes Urteil über die Deutsche Botschaft in Stockholm eingeholt wird, kann die Angabe Envers über die angebliche Kriegslüsternheit des Emirs von Afghanistan nur bestäti395 gen. Eigene Erfahrungen mit der Region hat man bis dahin nicht viele ge231
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
sammelt. Nicht einmal geeignete Landkarten des afghanisch-indischen Grenzgebiets stehen zur Verfügung. Damit kann Sven Hedin allerdings auch nicht dienen. Er hatte sich, wie Botschafter von Reichenau Unterstaatssekretär Zimmermann mitteilt, bei einer seiner frühen Expeditionsreisen nach Belutschistan verpflichten müssen, keine Kartenzeichnungen anzufertigen und sonstige Aufzeichnungen den indischen Behörden zur Kontrolle vorzulegen. Was er sonst an Kartenmaterial besitze, wolle Hedin aber gern zur Verfügung stellen. Um zu unterstreichen, was die Expeditionsteilnehmer erwartet, verweist Reichenau auf Hedins Buch „Zu Land nach Indi396 en“, wo dieser das afghanisch-indische Grenzgebiet als „eine trostlose Wüste ohne Trinkwasser, ohne Vegetation“ beschreibt. Reichenaus persön397 licher Kommentar dazu: „Für Truppenmarsch ganz unmöglich.“ Noch bevor der erste Kriegsmonat zuende geht, kann das Auswärtige Amt dem türkischen Kriegsminister über Botschafter Wangenheim mitteilen lassen, „dass etwa 15 Experten, darunter höhere Offiziere, einige Artilleristen, ein Pionier für Brückenbauten und Sprengungen, ein Waffenschmied und zwei bis drei Ärzte sowie ein des Persischen kundiger Deutscher“ zur Teilnahme an der Geheim-Expedition nach Afghanistan und Indien „oder auch für andere Unternehmungen der Türken mit Stoßrichtung Suez-Kanal oder Arabien“ bereitständen. Schon in wenigen Tagen seien sie marschfähig. Es sei vorgesehen, dass sie „stoßweise“, d.h. in kleinen Gruppen nach Konstantinopel aufbrechen und sich dort bei Enver Pascha melden. Sie werden Landkarten und separat von hier zu versendende Waffen mitbringen. Bitte anfragen, welche Kleidung auf Reise durch asiatische Türkei und Persien sowie in Afghanistan zu tragen, und was zu beschaffen. Ob und welche Geschenke sind für Eingeborene zu besorgen? […] 398 Bitte feststellen, welche Geldmittel für Expedition erforderlich.
Wangenheim antwortet unter dem 30. August 1914, Enver sei mit dem Herkommen der genannten Personen einverstanden und halte die Expedition nach Afghanistan mit ihnen für ausführbar. Eine Verkleidung, etwa als Araber, komme „wegen des allgemeinen Misstrauens der Bevölkerung“ für die europäischen Teilnehmer nicht in Frage. Reitausrüstung und Konserven ließen sich am besten in Deutschland beschaffen, das übrige in Konstanti232
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
nopel. Luxuswaffen, Longines-Uhren mit Sultansnamen oder auch eine elektrische Taschenlampe kämen als Geschenke in Betracht. Die vorläufig veranschlagten Kosten ab Konstantinopel würden mindestens 120.000 Reichsmark betragen – gemessen an den sich später bedenklich addierenden Summen war dies ein vergleichsweise noch bescheidener Betrag. Botschafter von Wangenheim übermittelt aber auch Bedenken an der Durchführbarkeit des Expeditionsplans. Er schreibt in der gleichen Depesche: Mit einschlägigen Verhältnissen vertrauter Generalstabsoffizier äusserte allerdings Zweifel, ob christlichen Reisenden das Betreten des afghanischen Gebiets ohne weiteres gestattet werden wird. Auch wurde von sachverständiger türkischer Seite darauf hingewiesen, dass es in erster Linie darauf ankommt, durch Persönlichkeit diplomatischen Charakters den Emir von Afghanistan über Deutschlands Absicht zu unterrichten und von seiner dem Islam freundlichen Gesinnung zu überzeugen. Trotzdem befürworte ich Herkommen der Expedition, für die schlimmstenfalls 399 auch andere geeignete Arbeitsfelder vorhanden.
Wenige Tage später hat sich die Zahl interessierter Teilnehmer weiter erhöht. Am Ende sind es 27 Personen, die nach Konstantinopel und von dort in ein ungewisses Abenteuer aufbrechen wollen. Unter ihnen finden sich Ingenieure und Chemiker, ehemalige Angehörige der Schutztruppen in Deutsch-Südwest und Ex-Freiwillige, die an der Niederschlagung des Boxer-Aufstandes von 1901 in China teilgenommen haben. Selbst ein Tiermaler namens Peter Paschen ist mit von der Partie. Dass Hermann Consten zumindest als primus inter pares bzw. Sprecher dieser recht bunten Schar weiterhin vorgesehen ist, belegt ein Schreiben des Kommissionsmitglieds Holtzendorff an den zuständigen Vertreter des Auswärtigen Amtes, von Prittwitz, vom 6.9.1914. Darin teilt er u.a. mit: In der gestrigen Kommissionssitzung bei Baron Oppenheim haben wir folgendes vereinbart: Aus den Teilnehmern der Expedition soll eine Kommission gebildet werden, bestehend aus folgenden Herren: 1. Herrn Consten; 2. Herrn Hauptmann Fischer; 3. Herrn Kapitän Höfer; 4. Herrn Schwind; 5. Herrn Konsul Wassmuss und 6. Herrn Stabsarzt Dr. Jungels. Diese Herren sollen für die Expeditionsmitglieder sozusagen die Centrale bilden und diese Herren sollen wieder die einzelnen Ämter verteilen, d.h. 233
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
diejenigen Herren bestimmen, die z.B. speciell für die Pferde, für die Küchen, für das Journal, für die Geldsachen, für die Geschenke etc. verant400 wortlich gemacht werden sollen.
Consten als der Nr. Eins auf der Liste wird die Verantwortung für die Reisekasse – Deckname: „Konto Fritz“ – und den mitgeführten Güterwaggon mit der Ausrüstung der Expeditionsgruppe einschließlich ihrer Waffen übertragen. Zu diesem Zeitpunkt ist die spätere Hauptfigur, der bayerische Oberleutnant Oskar Niedermayer, noch gar nicht zu der Gruppe gestoßen. Er wird erst Mitte September, nachdem die ersten Aspiranten bereits wieder ausgeschieden sind, auf Vorschlag von Dragoman Wilhelm Wassmuss, dem Mann mit den Persisch-Kenntnissen, von der Kriegsfront in Frankreich abberufen. Begeistert von der neuen Aufgabe ist Niedermayer keineswegs. „Ich habe eine ausgezeichnete Stellung im Felde aufgegeben, habe mich schweren Herzens getrennt“, bekennt er kurz darauf aus Konstantino401 pel gegenüber Max von Oppenheim. Niedermayer, der sich in jüngeren Jahren für längere Zeit in Persien aufgehalten und sich der Religionsgemeinschaft der Baha’i angeschlossen hatte, wird später noch seinen Bruder Fritz, von Beruf Arzt, und den bayerischen Orientalisten Prof. Erich Zugmayer ins Boot holen. Consten unterbreitet Max von Oppenheim ebenfalls einen Personalvorschlag. Er möchte, dass sein alter Jagdfreund und Reisegefährte, Hauptmann Ottomar Rausch, mitkommt, der seines Wissens als Ausbilder in Jüterbog südlich von Berlin tätig ist. Rausch, den Max von Oppenheim wegen dessen Afghanistan-Erfahrung umgehend dem stellvertretenden Kriegsminister als „der gegebene Mann für unsere Afghanistan-Indien-Expedition“ 402 ans Herz legt, wird ins Auswärtige Amt einbestellt. Doch stellt sich im Gespräch mit Legationssekretär von Wesendonck heraus, dass auch Rausch kein sonderliches Interesse hat, sich in dieses Abenteuer zu stürzen. Als intimer Kenner Russisch-Turkestans und des afghanisch-indischen Grenzgebiets rät er von deutschen „Aktionen“ in dieser Weltgegend sogar ausdrücklich ab. Dank der geschickten Politik der Russen seien die dortigen Stämme durchaus russenfreundlich, meint Rausch. Außerdem sei nach seiner Einschätzung nur ein Teil der dort stationierten russischen Elitetruppen zum westlichen Kriegsschauplatz abgezogen worden. „Der Rest könnte den Afghanen immer noch unbequem werden.“ Und er fügt an: 234
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
„Eine Agitation kann nur dann von Erfolg begleitet sein, wenn die rus403 sischen Besatzungstruppen gänzlich aus dem Lande herausgezogen 404 werden.“
An eine solche Eventualität ist aber wohl vorerst nicht zu denken. Ungeachtet begründeter Zweifel an Sinn und Zweck des Unternehmens wird in Berlin unter Zeitdruck weiter gearbeitet. In den nächsten Sitzungen drehen sich die Beratungen darum, die logistischen Vorbereitungen zu koordinieren, Kleiderfragen der Teilnehmer zu lösen – „keine Gehröcke, keine Uniformen“ – und das Risiko, das sie eingehen, entsprechend den Bedingungen für die Angehörigen des Feldheeres im Kriegseinsatz abzusichern. Das heißt auch, dass im Falle ihres Todes der Staat für die Hinterbliebenen sorgen soll, „als wenn die Betreffenden vor dem Feinde gefallen wären“. Im Falle „hervorragender Leistungen“ wollen die Teilnehmer „ebenso wie die in der Armee Dienenden allerhöchste Dekorationen, insbesondere auch vorkommendenfalls das Eiserne Kreuz erhalten können“, teilen die Organisatoren in einer Eingabe an Staatssekretär Gottlieb von Jagow mit. Dieser reicht das Anliegen als Eilsache an Reichskanzler von Bethmann Hollweg weiter, der sich mit dem Kaiser im Großen Hauptquartier in Luxemburg aufhält. Um die Ernsthaftigkeit des Anliegens zu unterstreichen, schreibt Jagow u.a.: Nicht ohne Schwierigkeit ist es gelungen, eine Anzahl von tatenlustigen und für ein derartiges Unternehmen geeigneten Persönlichkeiten ausfindig zu machen, die bereit wären, an der Expedition nach Afghanistan teilzunehmen. Es unterliegt weiter nach dem Urteil Sachverständiger keinem Zweifel, dass [im handschriftlichen Entwurf durchgestrichen: sowohl die Durchführung der Reise nach Afghanistan als auch die Mitwirkung der deutschen Expeditionsmitglieder an einem eventuellen Anschlag auf Indien] für dieselben ein Unternehmen auf Leben und Tod be405 deutet.
Wenige Tage später liegt die Einwilligung des Reichskanzlers vor, mit der Einschränkung allerdings, dass eventuelle Kriegsauszeichnungen nur durch Einzelfallentscheidung verliehen werden können. Nicht ohne Grund: Bemerke hierzu vertraulich, dass vermieden werden muss, etwa allzu an235
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
rüchigen oder vorbestraften Elementen Auszeichnungen zu verleihen. 406 Bethmann Hollweg
Dem Reichskanzler war wohl bewusst, dass sich zu so riskanten Unternehmen gern auch zwielichtige Figuren drängten, mit denen man ansonsten niemals gesellschaftlichen Umgang pflegen würde. Dem Einen oder Anderen der zusammengewürfelten Schar dürfte künftiger Kriegsruhm auch noch aus einem anderen Grunde versagt bleiben: mangelnder Schießerfahrung bei schon leicht fortgeschrittenem Alter. Die Berliner Gewehrfabrik Steigleder, bei der Reinhard Mannesmann ein Angebot über vier Schrotflinten und acht Gewehre mit Zielfernrohr nebst Zubehör einholte, hatte dieses „Senioritätsproblem“ erkannt. Sie stellte anheim, wegen der besseren Sehschärfe bei Dämmerung wenigstens zwei Zielfernrohre mit Dreifachvergrößerung zu wählen. Begründung: Sollten in der Expedition Herren sein, die mit dem genauen Schießen noch nicht bewandert sind, dann würde ich diesen Herren gerade die Fernrohre mit der dreimaligen Vergrößerung geben, weil bei diesen Fernrohren etwaige Zielfehler nicht so leicht vorkommen und der weniger geübte Schütze damit leichter fertig wird. Deshalb führen auch besonders ältere Herren, die nicht mehr ruhig zielen können, mit Vorliebe Fernroh407 re mit dieser Vergrößerung.
Obwohl die Expedition unter türkischer Leitung stattfinden soll, stehen die deutschen Teilnehmer – nachdem von höchster Stelle grünes Licht gegeben wurde, trotz eines gewissen haut-goût der ganzen Angelegenheit, unter dem Schutz der Reichsregierung und werden auch von ihr bzw. vom Auswärtigen Amt alimentiert. Jedes Expeditionsmitglied soll rückwirkend ab dem 1. September 1914 monatlich 1.000 Reichsmark erhalten; im Todesfall soll das Gehalt für vier Wochen weitergezahlt werden. Hermann Consten verfügt, dass das ihm zustehende Salär auf das Konto seines Aachener Freundes Theo Dahme überwiesen wird, der mit seiner Cousine Mie ver408 heiratet ist. Bei Constens notorischer Finanznot darf man getrost annehmen, dass er sein Geld dort sicher vor eventuellen Zugriffen seiner Gläubi409 ger wähnte. Die Kosten für Hin- und Rückreise sowie für die persönliche Ausrüstung werden ebenfalls vom Auswärtigen Amt übernommen. Sollte die Expedition wider Erwarten abgebrochen werden oder gar nicht erst 236
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
stattfinden, „so steht es den Mitgliedern frei, in Konstantinopel auszuscheiden und sich dort anderweitig zu betätigen“. Im letzteren Fall würde ihnen die Rückreise allerdings nicht mehr erstattet. Jeder der deutschen Expeditionsteilnehmer muss sich in einer persönlichen Eidesleistung „zu striktester Unterordnung unter die türkische Leitung und peinlichster Geheimhaltung 410 aller die Expedition betreffenden Angelegenheiten“ verpflichten. Wiederholt werden sie ermahnt, in Konstantinopel unauffällig aufzutreten. Denn die Stadt am Bosporus wimmelt nur so von feindlichen Spionen; auch den durch schwüle Harems-Phantasien geschürten erotischen Verlockungen des Orients könnten sie nur allzu leicht erliegen. Viel Kopfzerbrechen bereitet die Frage geeigneter Ehrengaben für den Emir. „In Frage kämen Orden, Ehrensäbel oder Allerhöchstes Bildnis“, schreibt Botschafter Wangenheim. Max von Oppenheim schlägt den Roten Adlerorden I. Klasse mit Brillanten vor, zu überreichen „in einem möglichst schönen, kostbaren Etui, welches im Inneren reich mit Seide usw. ausgestattet ist, aus kostbarem Holz besteht mit Goldbeschlag und dem Namenszug des Kaisers“. Der Ehrensäbel soll „von europäischer Art“ sein, „mit breiter, starker, ausgezeichneter Stahlklinge, reich damasziert, der Griff vielleicht in Korbform, stark vergoldet, mit möglichst viel Zierrat, die Scheide aus blankem Stahl mit goldenen Bändern. Dazu ein Ledergehänge, möglichst mit einer schönen Schnalle.“ Das „Allerhöchste Bildnis“ soll eine eigenhändig unterschriebene, kostbar gerahmte Fotografie Seiner Majestät sein. Oppenheim kann sich auch eine Pracht-Flinte, ein Zeiss-Fernrohr oder eine goldene Uhr als passende Geschenke für den Emir vorstellen. Sogar die Überreichung eines Kinematographen samt Filmen wird erwogen. Vor allem aber lösen Formulierung, kalligraphische Gestaltung und Übersetzung des kaiserlichen Handschreibens ins Persische lebhafte Depeschenwechsel zwischen Konstantinopel, Berlin und dem Großen Hauptquartier aus. „Die Reinschrift könnte auf einem Pergamentblatt vorgenommen werden, mit einem großen Siegel, das ganze in einem schönen oder kostbaren Kästchen aus Leder oder Metall“, schreibt Oppenheim an das Auswärtige Amt. Einleitungs- und Grußformeln sollen „im orientalischen, blütenreichen Stile“ gehalten sein, der Inhalt soll den Emir davon überzeugen, dass ihm mit dem Deutschen und dem Osmanischen Reich zwei mächtige Verbündete gegen Russland und England zur Seite stehen würden, so237
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
bald sich „das rühmlichst bekannte afghanische Volk“ dem „Heiligen Krieg“ anschließen würde. Das Handschreiben endet mit dem Versprechen, die „schon heute bestehende Interessengemeinschaft zwischen dem deutsche Volke und den Muhammedanern“ werde auch nach Beendigung des Krie411 ges weiter bestehen bleiben. Zum Zeitpunkt der Abfassung des endgültigen Entwurfs ging man in Berlin bereits davon aus, dass der zwischenzeitlich zum Konsul ernannte Wilhelm Wassmuss als diplomatischer Vertreter das Schreiben überreichen solle. Doch hatte man im Großen Hauptquartier inzwischen kalte Füße bekommen. Jagow gab zu bedenken, Mitglieder der Expedition könnten auf ihrem weiten Weg nach Afghanistan in die Hände der Engländer fallen und ihre Ausrüstung beschlagnahmt werden. Die kriegerischen Absichten des Kaisers wären dann vor aller Welt bloßgestellt; statt „peinlichster Geheimhaltung“ herrschte dann nur noch Peinlichkeit. Dies erschien den verantwortlichen Herren dann doch zu riskant. „Die Kompromittierung der Allerhöchsten Person muss bei diesem Unternehmen absolut vermieden werden“, so Jagow. So zog man ein unverbindliches Begleitschreiben zu Orden und Ehrensäbel schließlich vor; das eigentliche Anliegen sollte dem Emir dann vom Expeditionsleiter mündlich vorgetragen werden, hieß es. Also war die ganze kreative Mühe umsonst gewesen. Am Ende wurde dem Emir ein völlig nichtssagender Brief des Kaisers zugedacht. Außer Höflichkeitsfloskeln und Freundschaftsbezeugungen enthielt er nichts als leeres 412 Stroh. Der preußische Ehrensäbel erschien einigen besonders vorsichtigen Herren auch noch zu verräterisch und entfiel. Inzwischen ist der September weiter fortgeschritten. Für die Reise von Konstantinopel bis Kabul hatte ein Berliner Expeditionsausstatter Reisekleidung à la Schutzpolizei Deutsch-Südwest, festes Schuhwerk, Hüte, Reitsättel und Feldstecher geliefert. Doch wartet das Büro Mannesmann-Roselius noch immer auf die Anlieferung der bestellten Waffen, Funkgeräte und Antennenmasten. Hermann Consten reist ein letztes Mal für wenige Tage nach Aachen, um persönliche Angelegenheiten zu regeln. Während Botschafter von Wangenheim aus Konstantinopel bereits die Ankunft der ers413 ten Expeditionsteilnehmer nach Berlin durchgibt, trifft Oberleutnant Oskar Niedermayer, vom französischen Schlachtfeld kommend, in der Reichshauptstadt ein, um Einzelheiten seiner Abkommandierung in die Türkei zu 238
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
regeln. Am 19. September schließlich, einen Monat nach dem Beginn der konkreten Planungen für das „top-secret“-Projekt, steigt Consten mit fünf weiteren „tatenlustigen Persönlichkeiten“ am Schlesischen Bahnhof in den Fernschnellzug, der die Gruppe in drei Tagen über Breslau, Budapest und Bukarest in die Hauptstadt des Osmanenreiches, das sagenhafte Konstantinopel, bringen soll. Neben seinem privaten Gepäck führt Consten noch zwei Postsäcke mit diplomatischer Korrespondenz mit sich. Sie wurden ihm, dank seiner einschlägigen Erfahrungen als Geheimkurier in der Mongolei, vom Chiffrierbüro des Auswärtigen Amtes anvertraut und im Bagagewagen untergebracht. Der Güterwaggon mit der als „landwirtschaftliche 414 Maschinenteile“ deklarierten Ausrüstung allerdings war aus unerfindlichen Gründen nicht an den Zug angehängt worden. Und so sieht sich Consten, als dessen Fehlen bemerkt wird, gezwungen, die Reise in Budapest zu unterbrechen. Während seine Gefährten mit dem aus Paris kommenden Orient-Express bis Konstantinopel weiterfahren, kommt es Consten so vor, als sei der erzwungene Zwischenstopp in der ungarischen Hauptstadt so etwas wie ein Wink des Schicksals. Budapest gefällt ihm auf Anhieb. In diese Stadt taucht er ein wie in einen Traum. Hermann Constens „Afghanistan-Abenteuer“ beginnt bereits in der Metropole der Magyaren. Die mythische Herkunft des Reitervolkes aus den Steppen Zentralasiens, das schon im 5. Jahrhundert an den Ufern von Donau, Theiß und Drau sesshaft wurde, das im 10. Jahrhundert von den christlichen Bayern besiegt und getauft wurde, das 1241 den Mongolensturm erlebte, lässt ihn spontan an das Land denken, in dem er sein Herz gelassen hat: an das Reich der 415 Mongolen. Auch die Nibelungensage fällt ihm ein, die Geschichte von Kriemhild, die man dem Hunnenkönig Attila – „Etzel“ – zur Frau gab. Noch ahnt er nicht, dass sein „Afghanistan“ wenige Jahre später in dieser Stadt auch wieder enden, dass er hier zu „Etzel“ werden wird. Erst einmal genießt er den geschenkten Abend. Er bummelt durch Pests elegante Straßen und Budas verschwiegene Gassen. Er bewundert den Lichterglanz an dem grandiosen Parlamentsgebäude, das sich mit seinen Fialen und Türmchen tausendfach in den Fluten der vorbeiziehenden Donau spiegelt. Er wandert an dem milden Spätsommerabend über die Kettenbrücke und steigt hinauf zur Budaer Burg. Er speist in einem Restaurant an der Fischer239
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
bastei zu Abend, aus dessen Fenstern der Blick weit über die am jenseitigen Ufer unter ihm liegende Stadt schweift. Consten bleibt an diesem Abend nicht allein. Er macht die Bekanntschaft eines Mannes, der von sich behauptet, Mitglied der ungarischen Regierung zu sein. Der Mann verwickelt ihn in ein Gespräch über die Kriegsereignisse und ihre nachteiligen Folgen für den Reiseverkehr auf dem Balkan. Später wechselt man in ein gemütliches Weinlokal unterhalb des Burgbergs, und je weiter der Abend fortschreitet, desto vertraulicher werden die Gespräche bei Tokajer und Czárdas-Musik. Bald schon ist der Mann über Constens Mission informiert, gibt ihm wertvolle Tipps für die Weiterreise. Und schließlich lässt sich „Sonderkurier Consten“ wein- und vertrauensselig noch im Fiaker über die nächtliche Elisabethbrücke zurück in sein Hotel begleiten. Am nächsten Morgen eilt er zum Deutschen Generalkonsulat und sorgt erst einmal für Wirbel. Wegen der Nachsendung des „für Konto Fritz bestimmten Waggons, den Herr Consten mitnehmen soll416 te“, gehen gleich mehrere Telegramme nach Berlin ab. Die Berliner Niederlassung der Firma Mannesmann Mulag veranlasst, dass der auf einem Abstellgleis gelandete Waggon durch die Spedition Schenker umgehend auf den Weg gebracht wird und telegrafiert an Schenker Budapest: Sandte Ihnen am 21. einen Waggon landwirtschaftliche Maschinenteile Waggonnummer St. B. 10755, Fahrtnummer 13950 G. Sendet schleunigst diesen Waggon für Hermann Consten nach Konstantinopel via Predeal, 417 Bukarest, Giurgewo, Rustschuk.
Von seinem nächtlichen Gesprächspartner hatte Consten außerdem erfahren, dass die Durchreise des Waggons durch Rumänien unter Umständen Schwierigkeiten bereiten könnte, da die Behörden des neutralen Landes Materiallieferungen der Zentralmächte in Richtung Türkei nicht mehr durchließen, wenn auch nur der geringste Verdacht bestehe, es könnte sich um Kriegslieferungen handeln. Consten scheint auch Warnzeichen anderer Art plötzlich ernster zu nehmen. Am folgenden Tag kabelt er aus Bukarest an Legationssekretär von Wesendonck nach Berlin: Sehr geehrter Herr Baron! Nach mancherlei Schwierigkeiten bin ich hier glücklich in Bukarest eingetroffen. Kurz ehe ich die rumänische Grenze erreichte, fand sich nach und nach 240
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
eine ganz merkwürdige Gesellschaft in meinem Waggon ein, so dass ich, schon vorher gewarnt durch die ungarische Regierung, gezwungen war, meine Postsäcke in meinem Coupé erster Klasse zu befördern, umso mehr da, wie aus [den] Mitteilungen hervorging, auch die Postsäcke im Bagagewagen nicht sicher waren. Ich war daher gezwungen, für mich allein zur Sicherung des mir anvertrauten Transportes ein ganzes Coupé zu nehmen. Da mich das Chiffrierbüro in Berlin gebeten hatte, die Ausgaben für die Postsäcke aus meiner Tasche zu begleichen und mir die Auslagen hier rückerstatten zu lassen, habe ich mir hier 500 Francs auszahlen lassen. […] Da die Gefahr vorhanden ist, dass hier in Rumänien von den russischen Spionen der Versuch gemacht wird, in irgendeiner Weise wichtige Nachrichten zu erlangen, habe ich mich gerade 418 hier entschlossen, nach Rücksprache mit Herrn Konsul und Herrn Roselius, auch von hier aus ein Coupé für mich allein bis Constantinopel zu nehmen, um die Postsäcke und Telegramme beständig unter Aufsicht zu haben. Dies macht noch eine ungefähre Extraausgabe von 350 Francs, die ich bei der Ge419 fährlichkeit des Transportes glaubte, verausgaben zu dürfen.
Consten begründet sein Handeln u.a. auch damit, dass man ihn trotz seines Passierscheins schon an der ungarisch-rumänischen Grenze nicht durchlassen und sogar die Diplomaten-Postsäcke öffnen wollte. „Irgendjemand“ habe wohl der Zollbehörde telegraphiert, er führe größere Mengen Gold bei sich. Nur der Hilfe des ungarischen Bahnhofsvorstehers und dem energischen Eingreifen des deutschen Gesandten in Sinaia, Graf Waldburg, den er telefonisch um Hilfe gebeten habe, verdanke er, dass er „nach vielen Reklamationen und Laufereien“ endlich über die Grenze gelangt sei und weiterreisen konnte. Sollte ihm auch nur einen Moment lang gedämmert haben, dass dieser „Irgendjemand“ sein Gesprächspartner in Budapest hätte sein können, so schweigt er wohlweislich davon gegenüber Wesendonck. Lieber fügt er den kryptisch klingenden Satz an: Ich bitte den [sic!] Herrn Mannesmann ergebenst mitzuteilen, dass Herr Erhardt und sein Tabak aufkaufender Begleiter hier eingetroffen und 420 heute weitergereist sind.
Ganz offensichtlich leitet Consten hier eine verklausulierte Botschaft von Ludwig Roselius an Reinhard Mannesmann weiter. Roselius hielt sich seit August 1914 unter verschiedenen Decknamen (Karl Wimmer, Paul Hilde241
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
brandt u.a.) in Bukarest auf, um „auf Geheimordre“ des Auswärtigen Amtes rumänische Kabinettsmitglieder durch Bestechungsversuche zum Kriegs421 eintritt an der Seite des Deutschen Reiches zu bewegen. Mannesmann und er lancierten in Rumänien und Bulgarien außerdem, teilweise über Mittelsmänner, umfangreiche „Getreideaufkäufe“ für das Deutsche Reich. Dahinter verbargen sich jedoch, wie während der Spurensuche nach dem genauen Charakter der geschäftlichen Beziehungen zwischen Hermann Consten und den Mannesmann-Brüdern ein Zufallsfund im Archiv des Deutschen Museums in München (Firmenarchiv Mannesmann) verriet, gelegentlich auch Geld- und Waffenlieferungen sowie vertrauliche Informationen über die aktuelle Lage an den diversen Kriegsschauplätzen. Bei dem Fund handelte es sich um Durchschläge von zehn Schreibmaschinenseiten mit mehreren Telegrammschlüsseln für den beiderseitigen Depeschenver422 kehr. Blatt eins war mit handschriftlichen Vermerken Reinhard Mannesmanns und diversen Deckadressen versehen, an die die Telegramme jeweils gerichtet werden sollten. Falls Mannesmann über diese Adressen nicht erreichbar war, sollten die Mitteilungen direkt an das Auswärtige Amt gegeben werden. Auch einige entschlüsselte Telegramme, u.a. mit Informationen vom französischen Kriegsschauplatz, fanden sich in den Unterlagen. Consten kannte Ludwig Roselius offenbar schon flüchtig von einem früheren Besuch bei Reinhard Mannesmann. Die nähere persönliche Bekanntschaft erweist sich nun insofern als nützlich, als sich unverhofft Perspektiven für künftige lukrative Zusammenarbeit eröffnen. Die Generosität des Bremer Kaffeefabrikanten und Kunstmäzens, der über schier unbegrenzte Geldmittel zu verfügen scheint, imponiert dem ewig klammen Verwalter von „Konto Fritz“. Beim gemeinsamen Abendessen in einem eleganten Bukarester Restaurant klagt Roselius darüber, dass englische und französische Kommissionäre in Rumänien sämtliches Getreide aufkauften und sämtliche vorhandenen Schiffe charterten. Ob er, Consten, nicht bei Enver Pascha vorstellig werden könne. Enver müsse die „für uns unbedingt notwendige“ Sperrung der Dardanellen verfügen, damit dies aufhöre. Dann würden die horrenden Aufkaufpreise und die hohen Frachtraten wieder sinken, und die deutschen Aufkäufer könnten etliche Millionen Mark einsparen. Consten erkennt seine Chance, von dem Geldsegen ein bisschen abzu242
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
bekommen. Er erzählt Roselius von der geplanten Expedition. Zwar verfüge sie über genügend Mittel, meint er, aber für den Emir von Afghanistan gebe es noch keine Geschenke. Die müssten erst noch in Konstantinopel besorgt werden. So wie er das Land aber kenne, gebrauche er für Afghanistan wenigstens 300.000 Mark für Geschenke. Enver Pascha würde ihm zweifellos recht geben, so Consten weiter, erst nach Regelung der Geschenkfrage werde Enver die Expedition für gesichert halten. Wenn Roselius diese Summe zur Verfügung stellen könnte, dann ließe sich sicherlich 423 auch etwas in der Dardanellen-Frage erreichen. Nach Rücksprache mit einem deutschen Geschäftspartner, der auch findet, dass 300.000 Mark nicht zuviel seien, um eine „derart wichtige Aktion“ in Gang zu setzen, willigt Roselius in den Deal ein. Consten ist hocherfreut, sieht doch das „Konto 424 Fritz“ für Geschenke ganze 2.390 Mark vor. Der Anfangserfolg macht ihm Mut, auf diesem Wege fortzufahren. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia, wo er am folgenden Tag eintrifft, versucht er, sich gleich auf allerhöchster Ebene Gehör zu verschaffen. Wenige Tage später berichtet er darüber nicht ohne Stolz an Reinhard Mannesmann nach Berlin: In Sofia hatte ich dann noch eine wichtige Unterredung mit dem Vertrauensmann des Königs, der ganz offen von dem fürchterlichen Hass des Königs gegen England sprach, aber immer wieder betonte, dass er nicht losschlagen könne, da es an dem Allernötigsten fehle. Ich machte ihn auf meinen seinerzeit gemachten Vorschlag aufmerksam, der, wie mir bekannt, ja jetzt im AA wohlwollend erwogen wird. Dr. Graetzer, der Leibarzt des Königs war über diesen Vorschlag – evtl. Kanonen und Gewehre an die Türken und Bulgaren abzugeben, dermaßen entzückt, dass er den König davon sofort unterrichten wollte. Abends um 9 Uhr wollte mich dann seine Majestät empfangen. Durch einen Platzregen wurde der König daran verhindert, in die Stadt zu kommen und ich selbst musste 425 am Abend noch weiterreisen.
Es war wirklich zu dumm, dass die Aussicht, sich durch den Handschlag des Königs von Bulgarien ein kleines Zubrot für Afghanistan zu verdienen, durch einen Platzregen verhindert wurde! Weiter trägt der Zug den Geheimkurier Hermann Consten in seinem für 243
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
sich und seine Depeschensäcke reservierten Coupé Erster Klasse durch die Nacht, über Südbulgarien auf die Grenze des Osmanenreiches zu. Da er von innen verriegeln und die Vorhänge zuziehen kann, dürften ihm wenigstens einige Stündchen Schlaf vergönnt gewesen sein, ohne um seine kostbare Fracht bangen zu müssen. Neben der üblichen Diplomatenpost führt er wichtige Mitteilungen von Ernst Jäckh für Enver Pascha mit sich, die nicht in fremde Hände gelangen dürfen. Denn diese Briefe sollen ihm, Hermann Consten, das nötige Entree bei dem mächtigen Kriegsminister des Osmanischen Reiches verschaffen. Das braucht er, um von türkischer Seite zum Leiter der geplanten gemeinsamen Geheim-Expedition ernannt zu werden. Gegen Morgen passiert der Zug die thrakische Dreiflüsse-Stadt Adrianopel, das heutige Edirne. Und schließlich zeichnet sich im Frühdunst des 25. September die berühmte Silhouette der Paläste, Moscheen, Medressen und mächtigen Mauern des einstigen Byzanz, des sagenhaften Konstantinopel, am Horizont ab. Der Zug fährt dampfend und fauchend im Bahnhof Sirkeci auf der europäischen Seite des Bosporus ein. Schon in der hohen Empfangshalle mit ihren schlanken Säulen und der Vielzahl farbig verglaster Fenster grüßt den schwer bepackten Ankömmling der Orient. Das Innere des Bahnhofsgebäudes lässt an eine Moschee denken. Als der in altdeutschen Architekturen besser bewanderte Consten nach der Erledigung der Zollformalitäten ins Freie tritt, als ihm Farben, fremde Laute, Lärm und Gerüche dieser so ganz anderen Welt entgegenschlagen, schaut er noch einmal mit prüfendem Kennerblick zurück auf den Endhaltepunkt des berühmten Orient-Express. Für einen flüchtigen Moment erscheint ihm 426 der Stil des Bahnhofsgebäudes als die Verschmelzung von Orient und Okzident in geradezu vollendeter Form. Eine Droschke bringt den Ankömmling über die Neue Brücke über das Hafengebiet des Goldenen Horns hinüber nach Galata. Durch enge Gassen geht es hinauf nach Pera/Beyoglu zum Standquartier der Expeditionsgruppe, dem Vereinsheim Teutonia. Mit großem Hallo wird Consten dort begrüßt. Doch zeichnet sich auf manchen Gesichtern Enttäuschung ab, als die Männer erfahren, dass er mit leeren Händen, das heißt ohne den Waggon mit der persönlichen Ausrüstung gekommen ist. Von Tag zu Tag warteten wir auf die Ankunft Dr. Constens, der alles mitbringen sollte. Als er am 25. Sept. endlich ankam, brachte er nichts 244
1. Kleiner Agent im Großen Krieg: Belgien – Balkan – Türkei
mit, ja wusste nicht einmal, wo sich der Eisenbahnwagen befand, der unsere Sachen enthielt. Ich empfand eine tiefe Verstimmung, dass auch Herr Dr. Consten keine einzige Karte mitgebracht hatte, die wir für die Ausarbeitung des Planes dringend gebrauchten, sondern das gesamte 427 Kartenmaterial im Bahnwagen nachkommen ließ.
Wenige Zeilen aus einem langen Beschwerdebrief über Consten an Reichskanzler v. Bethmann Hollweg, den Dragoman Wassmuss wenig später verfasste. Ihm dürfte die lange Warterei in Konstantinopel wohl am stärksten an den Nerven gezerrt haben. Unter den zur Untätigkeit verurteilten Expeditionsteilnehmern – Consten spürt es sofort – herrscht aber auch noch aus anderen Gründen dicke Luft.
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition Kaum dass er sich ein wenig frisch gemacht und etwas gegessen hat, lässt sich Hermann Consten mit seinen Postsäcken zur Kaiserlichen Botschaft nahe dem Taksim-Platz bringen. Er liefert die Post im Chiffrierbüro ab und meldet Botschafter Hans von Wangenheim seine Ankunft. Den Nachzügler erwarten schlechte Nachrichten. Als erstes konfrontiert ihn Baron Wangenheim mit Beschwerden über einige Mitglieder der Afghanistan-Expedition, die in der Öffentlichkeit unangenehm aufgefallen seien. Der Militär-Attaché habe in Erfahrung gebracht, dass vor allem eine namentlich genannte Person der Gruppe es an Diskretion und Dezenz habe fehlen lassen. Diese Person habe sich als Beauftragter des Auswärtigen Amtes ausgegeben und versucht, sich bei der Filiale der Deutschen Bank auf nicht ganz einwandfreie Weise Geld zu verschaffen. In Bars und Tanzlokalen habe sie sich laut und auffallend benommen, unter der Demi-Monde Konstantinopels von einer geheimen Expedition geschwafelt und den Damen des leichten Gewerbes, zu allgemeinem Amüsement, das für den Emir von Afghanistan bestimmte Kaiserfoto in dem inkrustierten Rahmen gezeigt. Schlimmer noch, durch seinen intimen Verkehr mit einer Russin habe sich das betreffende Expeditionsmitglied den türkischen Behörden als russischer Spion verdächtig gemacht. Kurz, es fehle ihm an Ernst, Verschwiegenheit und Takt. Unter diesen Umständen, so Wangenheim streng, sei seine weitere Verwendung unmöglich; er werde den Mann nach Berlin zurückschicken müssen. Im übrigen prüfe das Auswärtige Amt bereits, wie einige unehren245
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
haft aus der Armee entlassene Offiziere, die in Berlin und Hamburg als „notorische Schuldenmacher und Heiratsschwindler“ polizeibekannt seien, „es schaffen konnten, bei der Expedition mitzumachen“. Die übrigen Delinquenten, so Wangenheim weiter, habe er bereits anderen Expeditionen zugeteilt. Zwei Leute seien schon auf dem Weg in den Kaukasus, drei seien nach Damaskus abgereist, um sich der Ägypten-Expedition anzuschließen. Außerdem seien fünf Teilnehmer der Afghanistan-Expedition bereits nach Aleppo vorausgereist. Consten gibt sich überrascht und empört über Geheimnisverrat, Dummheiten und „Weibergeschichten“ seiner Gefährten. Er beteuert, er habe sich schon in Berlin gegen deren Mitnahme ausgesprochen. Er fordert den Botschafter sogar auf, Max von Oppenheim „in seinem Namen schwere Vor428 würfe zu machen“, dass dieser solche Leute überhaupt empfehlen konnte. Schlimmer trifft ihn allerdings die zweite Mitteilung des Botschafters. Angesichts der geschilderten Vorfälle, Zwietracht unter den Teilnehmern und ungeklärter Zuständigkeiten – daran habe Enver Pascha bereits Anstoß genommen – habe er auf eine entsprechende Empfehlung des Militärattachés, Major von Laffert, entschieden, die alleinige Leitung des deutschen Expeditionskontingents Wilhelm Wassmuss zu übertragen. Gerade an diesem Vormittag habe er das Auswärtige Amt um eine Einverständniserklärung gebeten. Von seiner Sachkenntnis her sei Wassmuss am besten als Verantwortlicher mit Vorgesetztenbefugnis geeignet, für die Dauer der Expedition 429 werde man ihn zum Konsul ernennen, so Wangenheim. Consten protestiert und verweist auf die in Berlin gebildete Fünferkommission. Wassmuss wisse dies doch, da er ihr selbst angehöre. Wangenheim sagt ihm zwar zu, noch einmal Rücksprache mit Berlin zu nehmen, doch vorerst werde es bei der Regelung bleiben. Damit ist der konsternierte Consten erst einmal entlassen. Im weiteren Verlauf seines unerquicklichen Antrittsbesuchs in der Botschaft ereilt Hermann Consten schließlich der härteste Schlag seines Ankunftstages in Konstantinopel: Herr Steinwachs, zuständig für Beschaffung und Logistik im Büro Mannesmann-Roselius in Berlin, hatte am Morgen des 25. September in einem Flur des Auswärtigen Amtes 34 Kisten mit Waffen und Munition entdeckt und mit Entsetzen festgestellt, dass es sich um die komplette, für die Teilnehmer der Afghanistan-Expedition vorgese246
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
hene Bewaffnung handelte. 34 Kisten, die bei der Abholung der Expeditionsausrüstung durch die Spedition schlicht übersehen worden waren! Wie war so etwas möglich? Wer war schuld an dieser Schlamperei? Steinwachs hatte sogleich Alarm geschlagen. Das AA hatte umgehend nach Konstantinopel telegrafiert. Und Consten muss nun im Vorzimmer Wangenheims lesen, was Steinwachs dem AA zu berichten hatte: Herr Consten hatte mir vor 14 Tagen mitgeteilt, die Waffen seien, bis auf die Maschinengewehre und Geschenkwaffen unterwegs. Auch der Botenmeister des Amtes war der Ansicht, die Waffen seien durch das Chiffrier-Büro abgesandt. Wie ich mich heute persönlich überzeugt habe, sind die Gewehre, Patronen und Faschinenmesser enthaltenden Kisten vermutlich zum Transport in Depeschensäcken vorbereitet und mit Siegeln des Auswärtigen Amtes versehen. Es liegen im Flur: 5 Kisten Mauser Infanterie-Gewehre, 2 Kisten mit 90 Mauser Anschlag Pistolen, 3 Kisten mit 20 Faschinenmessern, 20 Kisten mit 30.000 scharfen Gewehrpatronen, 4 Kisten mit 20.000 scharfen Pistolenpatronen, also 34 Kisten im 430 ungefähren Gewicht von 1450 kg.
Irgendjemand im Auswärtigen Amt musste geschlafen haben. Vielleicht hatte auch Consten selbst nicht aufgepasst. Warum, so muss er sich nun fragen, hatte er nicht nachkontrolliert, ob auch wirklich alle Kisten mitgekommen waren? Von Professionalität zeugte das Versäumnis nicht gerade. Als Expeditionsführer, der er sein wollte, hätte ihm dies nicht passieren dürfen. Nun hat Consten jedenfalls richtigen Ärger am Hals und muss ihn auch selbst ausbaden. Eine gute Einführung bei Botschafter von Wangenheim ist dies für ihn keineswegs. Dessen Abneigung wird er noch zu spüren bekommen. Über all dem Ärger hätte Consten das Versprechen, das er Ludwig Roselius in Bukarest gegeben hatte, beinahe vergessen. Für ein Vorstellungsgespräch bei Enver Pascha ist es für heute allerdings zu spät. Wie ein geprügelter Hund schleicht er zurück ins Vereinsheim Teutonia. Die Lust, sich an seinem ersten Abend von einigen seiner Kameraden in das orientalische Nachtleben der osmanischen Hauptstadt einführen zu lassen, ist ihm gründlich vergangen. Als er am folgenden Tag wieder zur Botschaft eilt, liegt dort für ihn bereits ein Telegramm aus Bukarest. Roselius lässt ihm durch Konsul von 247
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
dem Bussche mitteilen, Rumänien habe ein Getreide-Ausfuhrverbot erlassen. Zunächst sei die Eisenbahnverladung verhindert worden. Dagegen würden in Braila und Galatz liegende Schiffe, die unter belgischer und englischer Flagge führen, auf Rechnung der französischen Regierung noch mit Getreide beladen. Sobald diese die Dardanellen passiert hätten, werde Rumänien auch für die Schiffahrt ein Ausfuhrverbot verhängen. Diese Maßnahme richte sich also auch gegen die Türkei. Roselius fordert Consten dringend auf: Unter Bezugnahme auf unsere Unterredung bitte unbedingt dafür sorgen, dass Enver sämtliche Getreidesendungen anhalten soll und für türkische Verwendung requirieren.
Botschafter Wangenheim, den Roselius einleitend über den geplanten Deal mit Enver informiert hat, wird gebeten, Consten in der Angelegenheit nach 431 Möglichkeit zu unterstützen. Erst gegen Abend bietet sich Gelegenheit, Enver Pascha seine Aufwartung zu machen, Jäckhs Briefe zu überreichen. Der Marineattaché, Korvettenkapitän Hans Humann, und Major von Laffert begleiten ihn. Constens Erscheinen sorgt bei dem jugendlich-eleganten Kriegsminister mit dem dunklen, hochgezwirbelten Schnauzbärtchen à la Wilhelm II. für einige Irritation, hat Enver doch soeben erst erfahren, dass Wassmuss zum verantwortlichen Vertreter der Expedition ernannt worden sei. „Nun können Sie sich den Eindruck vorstellen, den es machte“, schreibt Consten wenige Tage später voller Empörung an Reinhard Mannesmann, „als ich, durch Kapitän Humann beim Kriegsminister eingeführt, diesem die Briefe von Dr. Jäckh überreichte. Enver wusste zum Schluss nicht, was er denken sollte – umso mehr als der Herr Major von Laffert […] gegen mich 432 Partei nahm.“ Über den Inhalt der Briefe Jäckhs ist näher nichts bekannt, doch kann man davon ausgehen, dass er den Überbringer darin als GesamtExpeditionsleiter empfahl. Consten hat Enver aber nicht nur die Briefe zu übergeben, sondern hat ja auch noch die Lockspeise einer ansehnlichen Finanzspritze für das Afghanistan-Vorhaben im Falle einer sofortigen Sperrung der Dardanellen in seinem Köcher. Er führt ihn ein wenig abseits, überreicht ihm diskret das Telegramm von Roselius und informiert ihn über die in Bukarest abgesprochenen Details. Gegen den in Aussicht gestellten Geldbetrag für Afghanis248
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
tan hat Enver erwartungsgemäß nichts einzuwenden. Er verspricht, der Bitte von Roselius nachzukommen. Und tatsächlich wird in der Nacht zum 27. September die Passage durch die Dardanellen an ihrer engsten Stelle blockiert. Seeminen sinken herab, ein bereits vorher ausgelegtes, 35 Meter tiefes Unterwassernetz wird gespannt, das Leuchtturmfeuer verlischt, die Durchfahrtssignale werden auf „Stopp“ gedreht. Kein Schiff kann mehr hinein, keines hinaus. Die Maßnahme löst, kaum dass sie am nächsten Morgen bekannt wird, ungläubiges Befremden im gesamten diplomatischen Corps aus. Schließlich befindet sich die Türkei noch nicht im Kriegszustand. US-Botschafter Henry Morgenthau eilt zum Haus des Großwesirs Said Halim Pascha, wo ein offenbar nicht minder überraschtes osmanisches Kabinett wegen der folgenreichen Entscheidung in lautstarken Streit geraten ist. Der im Vorzimmer wartende Morgenthau wird Ohrenzeuge der erregten Auseinandersetzung zwischen Innenminister Talaat, Enver Pascha, Finanzminister Djavid und anderen Mitgliedern des jungtürkischen Kabinetts. Schließlich kommt der Großwesir herausgestürzt, bleich und am ganzen Körper zitternd, wie Morgenthau in seinen Erinnerungen an seine Botschafterjahre in Konstantinopel schreibt. Als ich ihn fragte, ob die Nachricht stimme oder nicht, dass die Dardanellen gesperrt worden seien, stammelte er schließlich: „Sie stimmt.“ – „Sie wissen, dass dies Krieg bedeutet“, sagte ich und protestierte in aller 433 Schärfe im Namen der Vereinigten Staaten.
Auch die Botschafter Frankreichs, Englands, Russlands, Italiens und anderer Länder reichen bei der Hohen Pforte offiziellen Protest gegen die völkerrechtswidrige Blockade der freien Handelsschifffahrt ein und drohen mit Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Morgenthau vermutet sofort die Deutschen hinter der Aktion, denn Botschafter Wangenheim hatte sich schon vorher ihm gegenüber gebrüstet, man sei in der Lage, die Dardanellen innerhalb von 30 Minuten zu schließen. Dass dies nun tatsächlich geschehen war, so vermutete der US-Botschafter zu Recht, hatte natürlich tiefere Gründe. An der Westfront hatte der Stellungskrieg begonnen, an der Ostfront waren die Russen auf dem Vormarsch durch Galizien und bedrohten nach der Einnahme Lembergs bereits Österreich-Ungarn. Der Traum vom Blitzsieg der Mittelmächte hatte sich längst verflüchtigt. „Die Zeit war 249
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
gekommen“, so Morgenthau in seinen Memoiren, „da Deutschland die türkische Armee brauchte. Das äußere Zeichen, dass sich die Lage geändert 434 hatte, war die Schließung der Dardanellen.“ Die offizielle Begründung für die Sperrung einer der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt war natürlich nicht Hermann Constens Bestechungsversuch, sondern ein Zwischenfall – ob auf Anweisung Envers eigens inszeniert oder nicht, sei dahin gestellt. Jedenfalls war zuvor ein türkisches Torpedoboot durch britische Kriegsschiffe daran gehindert worden, in die Ägäis einzufahren. Auf den Funkspruch des Kapitäns hin hatte der deutsche Festungskommandant in der Meerenge, General Weber, dann die Sperrung verfügt. Obwohl sich Roselius vom Auswärtigen Amt später sagen lassen musste, die Schließung der Dardanellen wäre so oder so er435 folgt, belegen die Depeschenwechsel der deutschen Botschaft in Konstantinopel und des Konsulats Bukarest mit Berlin im September und Oktober 1914 einen direkten Zusammenhang mit der versprochenen Geldzahlung an 436 Consten. Doch sollte sich die Beschaffung der 300.000 Mark in Gold schließlich als nicht minder zeitraubend und gefährlich erweisen wie der immer noch blockierte geheime Waffentransport für Afghanistan. In beiden Fällen sollte es an Hermann Consten sein, als Retter in der Not aufzutreten und beides, Waffen wie Geld, persönlich aus Rumänien herbeizuschaffen. Zunächst musste er aber seine Position in Konstantinopel festigen, damit man es nicht noch einmal wagte, ihm die Butter vom Brot zu nehmen. Nach seiner Rückkehr aus dem Kriegsministerium hatten ihm nämlich seine Kameraden berichtet, dass Wassmuss in Konstantinopel „alle Punkte ignorierte, worauf die Herren vom Auswärtigen Amt verpflichtet worden waren“. Consten hatte anderentags Major von Laffert zur Rede gestellt, den er hinter dieser Intrige vermutete. Es war zu einer „sehr energischen Auseinandersetzung“ gekommen. Doch der Militärattaché hatte nur eine Anweisung Wangenheims ausgeführt und fühlte sich unschuldig. Dem überkorrekten, aber recht gehemmten und empfindlichen Wassmuss wurde bei diesem lautstarken Streit sichtlich unwohl in der ihm zugedachten Rolle als Expeditionsleiter. Auch er bekam sein Fett ab. Constens Vorwurf, er hätte in Konstantinopel gegen ihn gearbeitet und ihn aus seiner Stellung verdrängen wollen, kränkte Wassmuss zutiefst. Er war froh, 250
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
Konstantinopel am 28. September mit einem Teil der türkischen Expeditionsteilnehmer in Richtung Aleppo verlassen zu können. „Ich übernahm daraufhin“, schrieb Consten wenige Tage später an Reinhard Mannesmann, „im Auftrage vom Herrn Kriegsminister wieder die Führung und Arbeit hier am Platz.“ Sein Zorn legte sich, nachdem Constens Angaben zur Fünferkommission aus Berlin bestätigt worden waren und sich Laffert bei ihm entschuldigt hatte. Allerdings hatte Kommissionsmitglied Holtzendorff erklärt, die Frage, wer die Expedition denn nun leiten solle, sei bewusst nicht berührt worden. Seines Wissens seien weder Consten noch anderen Teil437 nehmern besondere Zusagen gemacht worden. Consten nimmt nach Wassmuss’ Abreise die Dinge energisch in die Hand und sorgt erst einmal dafür, dass der Emir von Afghanistan ein paar anständige Geschenke erhält. Folgendes Telegramm geht Ende September an Baron Wesendonck ins Auswärtige Amt: Bitte dringend genügende Anzahl Kaiserfilms, Kronprinzenfilms, militärische Films, Lütticher Forts hersenden, da Emir speziell für Kinemato438 graphen Interesse. Consten. Wangenheim.
Nachdem die Bestellung des einschlägigen Propagandamaterials erledigt ist, sucht Consten als nächstes in Begleitung eines türkischen Majors einen berühmten Waffenschmied im Großen Basar auf. Der soll nun einen prächtigen Dolch für den Emir anfertigen. In der Gasse der Kunstschreiner gibt er einen passenden Kasten für das Geschenk in Auftrag. Wenige Tage später zeigt er seine Erwerbungen stolz bei den Kameraden und den Mitarbeitern der Botschaft herum. Diese meldet umgehend nach Berlin: Herr Consten hat einen prachtvollen und kostbaren Dolch anfertigen lassen, reich mit Edelsteinen geschmückt, als Geschenk für den Emir. Da er befürchtet, dass die Türken dieses Geschenk als ihr eigenes ausgeben wollen, ließ er einen großen Ebenholzschrank dazu bauen, der vielleicht kostbarer ist als das Schwert selbst, und zwar innen mit Seide und der Unterschrift des Kaisers Wilhelm eingestickt. Außen ist er mit Edelsteinen und Elfenbein verziert, und zwar in der Mitte ein großes „W“ und an den beiden Seiten die Reichsflagge. Herr Consten bittet, da er doch die ganze Sache quasi ins Leben gerufen hat, dass veranlasst werde, dass er 439 das Schwert persönlich dem Emir überreichen dürfe. 251
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Doch bald schon droht ihm neues Ungemach. Mit der Ankündigung aus Berlin, Oberleutnant Oskar Niedermayer befinde sich nunmehr auf dem Wege nach Konstantinopel, trifft gleichzeitig die Mitteilung ein, Niedermayer und Wassmuss sollten die Expeditionsgruppe künftig gemeinsam leiten, Consten habe lediglich Beraterfunktion. Damit ist für den mit allen Mitteln um die Führungsposition ringenden Consten die Schmerzgrenze erreicht. Gegenüber Reinhard Mannesmann verhehlt er nicht seine tiefe Enttäuschung über den Gang der Dinge. Ich hätte wirklich erwartet, dass Sie und Ihr Herr Bruder es nicht zugelassen hätten, dass ich auf eine solche Art und Weise kalt gestellt worden wäre, umso mehr als Sie doch wissen, welche Arbeit und Mühe ich auf die Ausführung der Expedition und deren Zustandekommen verwendet habe.
Wenigstens kann er nach der Ankunft Niedermayers im Gespräch mit Botschafter Wangenheim und von Laffert noch erreichen, dass man ihn als gleichberechtigten Dritten akzeptiert. Die Entscheidung bedarf allerdings erneut der Absegnung durch das Auswärtige Amt. Nochmals legt Consten Reinhard Mannesmann ans Herz, ihn diesmal nicht im Stich zu lassen. Ich bitte Sie nochmals um eins, in Anbetracht der von mir schon geleisteten Arbeit in Berlin und hier und den mir von Ihnen und Dr. Jäckh gemachten positiven Versprechungen, dafür zu sorgen, dass auch durch das AA nach hier telegraphiert wird, dass ich gleiche Rechte wie Herr Niedermayer – mit dem ich ausgezeichnet stehe – und Herrn Wassmuss habe und dass mir, wie es mir durch Sie und Herrn Dr. Jäckh Dutzend Mal versprochen wurde, die Führung der Karawane mit den beiden Herren zusammen ausdrücklich bestätigt wird – und mir die Leitung der Geschäfte mit den Türken, die ich seit meiner Ankunft tatsächlich täglich 440 führe –, bleibt, und zwar für die ganze Dauer der Expedition.
Um die Dringlichkeit seiner Bitte noch zu unterstreichen, malt Consten an die Wand, sich anderenfalls gezwungen zu sehen, von der Teilnahme an der Expedition zurückzutreten. Enver Pascha habe, so betont er in seinem Schreiben an Mannesmann, „durch meine detaillierte Kenntnis der Einzelheiten der Expedition“ Vertrauen zu ihm gefasst. Nun sitze er täglich mit 252
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
den türkischen Offizieren im Kriegsministerium zusammen. Niedermayer habe er zu den Besprechungen „dazugebeten“. Tatsächlich war Envers „Vertrauen“ in die deutsche Beteiligung durch die vorangegangenen unerquicklichen Vorkommnisse einigermaßen erschüttert worden. Die bunte Zusammensetzung und die große Teilnehmerzahl der deutschen Gruppe entsprachen keineswegs seinen Vorstellungen. So viele „Ungläubige“ auf einmal konnten bei den arabischen und persischen Stämmen, denen man auf dem weiten Weg nach Afghanistan begegnen würde, nur unangenehm auffallen. Enver war nur zu höflich gewesen, dies gegenüber Wangenheim offen auszusprechen. Immerhin war er bemüht gewesen, dem deutschen „Jihad“-Fieber einen Dämpfer zu verpassen. Ihm erschien die Ausrufung des „Heiligen Krieges“ weit weniger dringend als seinen Partnern in Berlin. Er hatte Wangenheim bereits darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Ausrufung eines Jihad durch den höchsten religiösen Vertreter des Osmanischen Reiches zwangsläufig gegen alle „Un441 gläubigen“ richten werde, d.h. auch gegen die Deutschen. In diesem Punkt konnte sich Enver gegen die „Jihadisten“ in Berlin jedoch nicht durchsetzen. Im Gegenteil. Oppenheim, Jäckh und Zimmermann entfalteten im Verlauf der nächsten Wochen einen geradezu konspirativen Eifer bei der Rekrutierung von Persern und Indern im Exil sowie von muslimischen Kriegsgefangenen des sogenannten „Halbmondlagers“ in Wünsdorf südlich Berlins. Gegen Geld und das Versprechen auf Freilassung wollten sie diese Leute als „Wanderzirkus“ sukzessive in Richtung Konstantinopel reisen lassen, damit sie anschließend gemeinsam mit der türkisch-deutschen Truppe in Persien, Afghanistan und Indien unter ihren jeweiligen Landsleuten agitierten. Was in den einzelnen Regionen jeweils geplant oder schon in Vorbereitung war, fasste Oppenheim in seiner Denkschrift „Die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde“ noch 442 einmal zusammen. Mit Constens Vertrauen in die türkische Zuverlässigkeit war es übrigens auch nicht gerade gut bestellt, wie die Bemerkung hinsichtlich der Übergabe des Ehrendolchs schon durchscheinen ließ. Auch war er sich nicht sicher, wofür seine neugewonnenen Freunde im Falle eines verspäteten Eintreffens der Geldsumme diese letztlich verwenden wür443 den, „wenn er mit seiner Expedition weg ist“. Für ihn war es also immer noch „seine“ Expedition. Warum war ihm 253
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
dies so wichtig? Was trieb ihn, um jeden Preis Anführer dieser Expedition zu sein? Mit Sicherheit gehörte Consten nicht zu den preußisch-militanten Eiferern, die aus allzu durchsichtigen Gründen hinter der grünen Fahne des Propheten herliefen, um ihre europäischen Feinde im „Morgenland“ aufs Haupt zu schlagen. Überhaupt scheint Consten kein grundsätzliches religiöses oder auch nur historisches Interesse am Islam gehabt zu haben. Er hat sich auch später – ganz anders als dies beim mongolisch-tibetischen Buddhismus der Fall war – nie eingehend mit dem Islam beschäftigt. Eher schon interessierte ihn das antike Mesopotamien, über das er in den zwanziger Jahren einen Vortrag vor der Deutsch-Persischen Gesellschaft in Ber444 lin halten sollte. Die Art seines Umgangs mit Enver Pascha und den türkischen Offizieren, so fragwürdig sie von Anfang an zu sein schien, zeugte aber von seiner Fähigkeit, sich intuitiv auf die andere Mentalität einzulassen und einen emotionalen Rapport herzustellen, wie es ihm ja auch wenige Jahre zuvor mit den politischen Führern der Mongolei gelungen war. Im übrigen sah er wohl seine persönlichen Interessen bei Enver vorerst besser aufgehoben als in der Botschaft oder gar bei seinen Gönnern in Berlin, die ihn jetzt im Stich zu lassen drohten. Mehr denn je lag ihm daran, als ein türkischer Offizier in Führungsfunktion an der Expedition teilzunehmen. Am Ende sah es sogar so aus, als sei er entschlossen gewesen, dafür seine deutschnationale Seele zu verkaufen und sein Land zu verraten. Doch wie wollte er mitten im Krieg sein Ziel als ein Zivilist erreichen? Dass ausgerechnet ein Hermann Consten Envers Wunschkandidat als Expeditionschef sein würde, mag man füglich bezweifeln. Denn die türkischen Vorstellungen gingen von Anfang an von einer Militärexpedition aus. Der energiegeladene Deutsche mit seinen kurzen Beinen, dem dunklen Kraushaar, den hellen Augen hinter seiner runden Brille und dem Schmiss auf der Wange war nun einmal, anders als etwa Oberleutnant Niedermayer, kein deutscher Offizier, wie ihn der Kriegsminister des Osmanischen Reiches ursprünglich angefordert hatte. Consten war in Envers Augen vermutlich ein nicht ganz unsympathischer, aber trotz seines Schneids völlig un-preußischer Kerl, der nicht einmal Spezialkenntnisse der Zielregion besaß, auch wenn er dies behauptete. Wäre er doch wenigstens eine stattliche Erscheinung gewesen wie viele Deutsche, die in jenen Tagen in Konstantinopel herumliefen, zum Beispiel die Soldaten, die jeden Morgen 254
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
mit lautem Trompetenschall und Marschlieder singend im Gleichschritt aus 445 ihren Kasernen zogen – für türkische Ohren im übrigen ein Greuel. Aber dieser Consten war kaum größer als Enver selbst. Sein einziger Vorzug schien zu sein, dass er gute Kurierdienste leisten und Geld beschaffen konnte. Und dass er, anders als die steifen Herren der Botschaft oder die manchmal recht schroffen Offiziere der Militärmission, kurzweilig war und wilde Geschichten über seine Abenteuer in der Mongolei zu erzählen wusste. Für die Nachfahren eines einst aus Zentralasien nach Westen gewanderten Turkvolkes war dies allemal spannend. Jedenfalls lud Enver Pascha diesen Hermann Consten zu einer vertraulichen Besprechung mit seinem engsten Führungszirkel nach Cospoli, ins Gebäude des türkischen Generalstabs ein. Consten machte dort die Bekanntschaft einiger hoher Offiziere, die für die gemeinsame AfghanistanExpedition vorgesehen waren. Er lernte Envers Onkel Halil Pascha kennen, einen brillanten jungen Mann, der es mit seinen 28 Jahren schon zum Divisionskommandeur gebracht hatte. Und er traf auch Envers Schwager Ismail Hakki Pascha, den Generalintendanten der Türkischen Armee, der außerdem noch für das gesamte Verpflegungswesen der Armee zuständig war – ein mächtiger Mann, der es bisher verstanden hatte, sich jeglichem deutschen Einfluss zu entziehen. Vermutlich war es während dieses Treffens in Cospoli, an dem von deutscher Seite sonst niemand teilnahm, dass Consten mit einer Sondermission betraut wurde, bei der auch die Dienste von Ludwig Roselius ein weiteres Mal gefragt waren. Roselius wurde denn auch als Einziger von Consten ins Vertrauen gezogen. Und Enver Pascha weihte seinen Kindheitsfreund Hans Humann ein, über den die Kontakte laufen sollten. Oskar Niedermayer ging, wie sich sehr bald zeigen sollte, das ganze Problem der türkisch-deutschen Afghanistanpläne völlig anders an als die merkwürdigen Herren in Zivil, nämlich als Militärstratege. Mit seiner Ankunft in Konstantinopel sollte sich der Charakter der Expedition ein weiteres Mal ändern, bevor es überhaupt richtig losging. In einem vertraulichen Schreiben an Max von Oppenheim verwies Niedermayer in aller Offenheit auf die Schwachstellen des Expeditionskonzepts, angefangen von der leidigen Führungsfrage und fehlenden Detail-Absprachen mit den Türken, bis hin zu dem erwarteten schwierigen Durchmarsch durch Persien und der 255
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
unsicheren Logistik. Kurz, die bisherige Behandlung der ganzen Angelegenheit erschien ihm „zu diplomatisch“, jetzt sollte militärisches Denken die Regie übernehmen. Niedermayer schrieb u.a.: Außerdem lege ich besonderen Wert auf die Besprechung unserer Tour vom strategischen Standpunkt aus und zwar mit dem hiesigen Generalstab. Das scheint mir recht vernachlässigt zu sein, aber wichtiger wie manches andere. Nach dem ganzen Gebaren der Türkei wäre auch in unserer Sache jede Überstürzung von großem Nachteil und würde nur schwer wieder gutzumachende Folgen haben. Da nicht zu viele Herren dabei sind, die gerade den in Betracht kommenden Orient gut kennen, halte ich es für meine Pflicht, nach Kräften Dummheiten zu verhindern. Ich kann mich nicht genug bemühen, die Phantasie mancher Herren etwas einzudämmen. Vielleicht wird bald die Zeit kommen, wo Teilexpeditionen unter Führung einiger energischer Leute sich abzweigen müssen, kleine, aber ganz bestimmte Aufträge auszuführen haben, um sich später mit der großen Schar wieder zu vereinigen. An dieser notwendigen Be446 stimmtheit, dem Sinn und der Zucht scheint es mir noch zu fehlen.
Vor allem aber sah Niedermayer bei der derzeitigen Führungskonstellation das militärische Interesse der deutschen Seite an dem ganzen AfghanistanUnternehmen nicht ausreichend geschützt. Hierin lag für ihn wohl auch die größte Gefahr für seinen strategischen Zweck im Sinne der deutschen Kriegsziele. Die Türken beanspruchen natürlich die unbedingte Führung und setzen ihren Willen sehr energisch durch. Wir sind mitgenommen. Wir haben ja wohl das Geld, das Bestimmungsrecht aber die Türken. Es müsste uns von vornherein auch einiges Bestimmungsrecht zugebilligt werden. Gelegenheit und Möglichkeit, die Deutschen kalt zu stellen, ist ja reichlich vorhanden. Wir wollen doch nicht das Werkzeug der türkischen Politik, sondern der deutschen sein. Und dass diese türkische Politik von der deutschen oft in wesentlichen Punkten ziemlich voneinander abweicht, davon konnte ich mich wiederholt überzeugen. Ich werde nicht aus Konstantinopel abreisen, ohne mir vorher schriftliche, genau bestimmte Weisungen betreffs der deutschen Führung etc. von der Botschaft, betreffs unserer
256
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
Stellung zu unseren türkischen Vorgesetzten und betreffs des ganzen 447 Vormarschplans von militärischer Seite geben zu lassen.
Niedermayer bemängelte ferner die ungeklärte rechtliche Stellung der Expeditionsteilnehmer. Ihn störte, dass sie „als geheimnisvolle Zivilisten mit den türkischen Behörden und Truppen verkehren“ mussten. Dies musste ja feindliche Geheimdienste geradezu magisch anziehen. Seiner Meinung nach wäre es von vorneherein klüger gewesen, die Teilnehmer direkt als Offiziere der deutschen Militärmission in Konstantinopel, also General Liman von Sanders und nicht der Botschaft, zu unterstellen. Niedermayer selbst hatte bereits in Berlin seine Teilnahme davon abhängig gemacht, dass die Expedition unter Kriegsgesetzgebung gestellt wird. Da dem zugestimmt worden war, unterstand sie mittlerweile also sowohl dem Auswär448 tigen Amt als auch dem Großen Generalstab. Die in der Tat merkwürdige Zwitterrolle der Afghanistan-Expedition hing aber ursächlich mit ihrer Vorgeschichte als einer von den Brüdern Mannesmann und Hermann Consten initiierten, privaten Unternehmung zusammen – was dem bayerischen Oberleutnant möglicherweise nicht einmal bekannt war, denn er hatte ja die ersten Zusammenkünfte und Planungen in Berlin nicht miterlebt. Niedermayer fiel irgendwann auf, dass es die Türken mit dem Afghanistan-Unternehmen plötzlich gar nicht mehr sonderlich eilig hatten. Der Zusammenhang war für ihn rasch klar: Dahinter steckte nichts anderes als das weitere Hinauszögern eines Eintritts der Türkei in den Krieg. Er fand sogar, man könne dies den Türken nicht einmal verübeln, ziehe man innenpolitische Gründe, die knappen Finanzmittel des Osmanischen Reiches, vor allem aber wohl auch das Ausbleiben bedeutender deutscher Siege über die Russen in Betracht. Aus dieser ungünstigen Gesamtkonstellation folgerte Niedermayer in einem an Legationssekretär von Wesendonck adressierten Bericht über die unterschiedliche Interessenlage beider Seiten nüchtern, was dies für das Afghanistan-Unternehmen bedeutete: Merkwürdigerweise kann ich auch bei der Beurteilung der Aussichten unserer Unternehmung mich der oben erwähnten Befürchtung nicht ganz erwehren. Wir werden auf unserem Vormarsch großen Schwierigkeiten begegnen, denn dass die Engländer durch unser eigenes Verhalten sowie ihren ganz ausgezeichneten Spionagedienst über unsere Pläne ge257
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
nauestens informiert sind und alle möglichen Vorkehrungen zu unserem Aufhalten und Vernichten treffen werden, darüber kann nicht der geringste Zweifel sein. […] Im Anblick solch großer Schwierigkeiten fürchte ich, wird die türkische Oberleitung, der wir ja fast bedingungslos unterstehen, eine abwartende Haltung einnehmen und mit dem eigentlichen Vormarsch zögern, bis genügende Grundlagen für das Fortkommen in 449 Persien und den Erfolg gegeben sind.
Obwohl man vermuten kann, dass alle Beteiligten in jungen Jahren ihren Karl May gelesen hatten, hielt es Niedermayer für erforderlich, zumindest den seiner Meinung nach viel zu blauäugigen Herren im Auswärtigen Amt zu verdeutlichen, was der Gruppe an Strapazen und Entbehrungen alles noch bevorstand, weshalb ein baldiger Aufbruch drängte: Es sind tausende von Kilometern, vielfach im Hochgebirge (Winter) und Wüstenland zurückzulegen. Man muss mit drei Monaten bis zur afghanischen Grenze rechnen, wenn alles glatt geht.
Nach den Hindernissen, die sich bislang bereits aufgetürmt hatten, war für Niedermayer schon in Konstantinopel klar, dass auch in Zukunft nicht alles glatt gehen würde. Vor 1915 jedenfalls würde man Afghanistan nicht mehr erreichen. Als erstes musste im Innern der deutschen Gruppe Ordnung geschaffen werden. Dies immerhin sollte leidlich gelingen. Während Konsul Wassmuss noch meinte, sich von Tarsus aus in einem als „Ganz geheim!“ klassifizierten Schreiben direkt beim Reichskanzler über den von „Herrn Dr. Consten“ in Konstantinopel inszenierten Führungsstreit beschweren zu müssen und langatmig schilderte, was durch Constens Verschulden bis da450 hin schon alles schief gelaufen war, nutzte das Trüppchen der in Konstantinopel verbliebenen Männer die Wartezeit bis zum Eintreffen der Waggons für die Beilegung ihrer Differenzen. Gemeinsam mit der Botschaft erarbeiteten sie neue verbindliche Zuständigkeiten, eine Sonderregelung für den Fall eines militärischen Konflikts und eine Verfahrensordnung bei internen Streitigkeiten. So konnte Wangenheim Mitte Oktober befriedigt nach Berlin melden: Insbesondere hat mir auch Herr Consten erklärt, dass er sich durchaus 451 den getroffenen Anordnungen fügen werde. 258
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
Inzwischen war durchgesickert, dass der Waggon mit der Expeditonsausrüstung an der ungarisch-rumänischen Grenze feststeckte. Der angeblich mit landwirtschaftlichen Maschinenteilen beladene Waggon hatte am 28. September Budapest passiert und war am 1. Oktober vom rumänischen Zoll in Predeal über die Grenze zurückgeschickt worden. Erst in der darauffolgenden Woche genehmigte man nach vielem Hin und Her die Durchfahrt. Vorher hatte es bereits Ärger mit dem österreichisch-ungarischen Verbündeten gegeben. Denn in Berlin hatte man es nicht für nötig befunden, dem Kriegsüberwachungsamt in Wien die Durchfahrt der falsch deklarierten Sendung durch k.u.k.-Territorium wenigstens vertraulich zu annoncieren. Nachdem ihr brisanter Inhalt aber publik geworden war, reagierte das Wiener Außenministerium mit einer geharnischten Verbalnote an Reichskanzler von Bethmann Hollweg und dem Hinweis auf die gefährlichen Folgen, die der Transport leicht explosiver Güter mit der Eisenbahn hätte haben 452 können. Außerdem gab es Probleme bei der Beschaffung der Geldsumme. Die rumänische Banca Generale sah sich außerstande, ihre Filiale in Konstantinopel anzuweisen, einen so großen Betrag in Gold auszuzahlen. Also wandte sich Roselius an das AA mit der Bitte, die Deckung der 300.000 Mark in Gold durch eine Berliner Bank zu veranlassen. Unterstaatssekretär Zimmermann war jedoch unter Hinweis auf den bereits bestehenden Expeditionsfonds dazu nicht bereit. Falls Enver Pascha Geld brauche, müsse er 453 es von dort nehmen, meinte er. Schließlich leistete Wangenheim Aufklärung. Er betonte in einer Depesche an Zimmermann, das Geld werde nicht an Enver direkt ausgezahlt, sondern verbleibe in der Verfügung der deutschen Expeditionsleitung. Die Summe werde dringend benötigt und müsse in bar mitgeführt werden, da Überweisungen später nicht mehr möglich seien. Am Ende leistete der österreichische Gesandte in Bukarest Hilfestellung, damit das Geld fließen konnte. Wangenheim berichtete nach Berlin: 454
Die 300.000 Francs werden auf Anregung Consten und Antrag Roselius vom österreichischen Gesandten Bukarest für Zwecke unserer Afghanistan-Expedition aus österreichischem Fonds hergegeben und sollten jetzt in Gold hergeschafft werden und von Expedition mitgenommen werden. […] Morgen reist Consten selbst Bukarest und wird versuchen, Goldbetrag unter Form Kuriersendung doch herzubekommen, wird anderen259
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
falls von Bukarest Antrag erneuern Orientbank hier auszuzahlen zu ver455 anlassen unter Versprechen baldigster barer Deckung aus Berlin. 456
Wie kam es, dass eine so große Geldsumme, von der niemals auch nur die Rede gewesen wäre, hätte Consten sie nicht ins Spiel gebracht, plötzlich für die Expedition so wichtig wurde? Es konnte eigentlich nur damit zusammenhängen, dass Niedermayer im Verein mit anderen Expeditionsmitgliedern und Botschafter Wangenheim die Chance erkannt hatte, im Falle einer Trennung von den Türken die Expedition mit den deutschen Teilnehmern auch allein durchführen zu können. Dazu brauchten sie natürlich direkten Zugriff auf eigene finanzielle Mittel. Doch Hermann Consten verfolgt insgeheim ebenfalls eigene Pläne hinsichtlich der Verwendung des Geldes. Zunächst einmal überlässt er Oberleutnant Niedermayer in Konstantinopel das Feld und fährt am 11. Oktober mit der Bahn nach Bukarest. Mit Hilfe von Roselius und des Deutschen Konsulats will er die Durchfahrtserlaubnis für den Waggon und weiteres inzwischen in Rumänien stehendes Speditionsgut erwirken und alles zusammen mit dem versprochenen Geldbetrag persönlich nach Konstantinopel schaffen. Er quartiert sich im Grand Hotel im Stadtzentrum der rumänischen Hauptstadt ein, die durch rege Bautätigkeit in den letzten beiden Jahrzehnten zum „Paris des Ostens“ aufgestiegen ist. Auch Ludwig Roselius ist im Grand Hotel abgestiegen, diesmal unter dem Namen Paul Hildebrandt. Und so begießen die beiden Herren bei einem opulenten Diner erst einmal ihr Wiedersehen und den gemeinsamen Erfolg: die Sperrung der Dardanellen. Dann beraten sie ihr weiteres Vorgehen. Wie kann es gelingen, den Türken die Entscheidung zum Kriegseintritt weiter zu „erleichtern“? Das Naheliegendste ist, der osmanischen Flotte unter die Arme zu greifen. Denn was nützen die beiden deutschen Kreuzer, die seit August unter türkischer Flagge im Bosporus auf Reede liegen, wenn die Schiffe nicht ins Schwarze Meer auslaufen dürfen? Consten berichtet von dem Sonderauftrag Enver Paschas, der vielleicht zur Lösung des Problems beitragen kann. Die Geldfrage kann dank der Hilfestellung des österreichischen Konsuls ziemlich rasch gelöst werden, Consten kann 300.000 Francs in Gold entgegen nehmen. Doch das Problem mit dem Ausrüstungstransport für die Expedition bereitet weiter Schwierigkeiten. Zwar kann das Konsulat Bukarest 260
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
bereits am 14. Oktober nach Berlin telegrafieren, insgesamt 16 Waggons für die Afghanistan-Expedition ständen 60 Kilometer nördlich von Bukarest abfahrtbereit in Plojesti; der Güterverkehr sei nur „infolge Tod des 457 Königs“ für einige Tage gesperrt. Doch dauert es eine weitere Woche, bis 458 sie sich tatsächlich in Bewegung setzen. Was also tun in der Wartezeit – und wohin derweil mit dem vielen Geld? Zur Sicherheit gibt Consten den Geldkoffer – nicht ohne vorher einen gewissen Betrag für eventuell notwendige Ausgaben entnommen zu haben – im Tresorraum des Deutschen Konsulats in Verwahrung. Das Beste wäre natürlich, das Geld in dem mit Roselius besprochenen Sinne „arbeiten“ zu lassen und sogar noch einen Zugewinn einzustreichen. Botschafter von Wangenheim und Constens Kameraden in Konstantinopel warten derweil mit wachsender Ungeduld darauf, dass er sich endlich zurückmeldet. Doch er hält sie in Ungewissheit über den Stand der Dinge und das Datum seiner Rückkehr. Allmählich schöpft Wangenheim Verdacht, irgendetwas könne nicht mit rechten Dingen zugehen. Über Korvettenkapitän Humann erhält er schließlich Kenntnis von Geschäften Constens mit den Türken „für sich und zwei andere Herren“, wie er am 26. Oktober erzürnt nach Berlin kabelt. „Er hat außerdem die Gelder für die Expedition nach Afghanistan in unverantwortlicher Weise verwendet. Ich beginne daher gegen Genannten misstrauisch zu werden und bitte um baldige genaue Auskunft über ihn, 459 insbesondere seine persönlichen Verhältnisse.“
Lange war unklar, was Consten in den insgesamt sechs Wochen, die er in Bukarest verbrachte, tatsächlich gemacht hat. Denn die Akten des Auswärtigen Amtes gaben darüber keine weitere Auskunft. Schließlich fand sich jedoch im Bundesarchiv/Militärarchiv in Freiburg ein dünnes Dossier über Consten. Sein Inhalt, sechs Telegramme aus dem einstigen geheimen Aktenbestand der kaiserlichen Admiralität. Vier davon stammten von Hermann Consten und waren adressiert an Korvettenkapitän Humann; bestimmt waren sie aber für Enver Pascha und den für die Verpflegung der türkischen Armee zuständigen Ismail Hakki Pascha. Samt den ebenfalls über Humann laufenden Rückantworten brachten diese Dokumente näheren Aufschluss über die Art der Geschäfte. Am 17. Oktober, eine Woche 261
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
nach seiner Ankunft in Bukarest, kabelte Consten zum Beispiel folgende Offerte an den Bosporus: Habe hier Angebot für türkische Armee franco Constantinopel 500 Waggons weiße Bohnen 100 kg 24 francs, 1000 Waggons Heu 100 kg 13 frcs., 1000 Waggons Hafer 100 kg 16 frcs., 720 Waggons Mehl 100 kg 34 frcs., von letzteren 250 Waggons sofort lieferbar, 400 000 Kilo Benzin ohne Fässer 33 frcs. 200 kg, mit Fässern 63 frcs franco Constanza. Von weißen Bohnen liegen hier schon 200 Waggons in Constanza. Die Ausfuhrerlaubnis nach der Türkei ist in der Hand der Verkäufer mit Ausnahme für Mehl, wo die schon bestehende Ausfuhrerlaubnis für Griechenland rückgängig gemacht und für die Türkei erteilt werden soll. Zahlung hat durch Bankgarantie hier zu erfolgen, doch Auszahlung erst, wenn die Ware abgenommen, d. h. rumänisches Gebiet verlassen hat. Transport zu Lasten des Verkäufers, türkische Regierung hat nur die Schiffe zu stellen 460 und für Schutz zu sorgen. Von unserem Herrn Hildebrandt sind mir für alle Fälle 6400 Tonnen Gerste für die Türkei zur Verfügung gestellt und zwar zu Reichs-Einkaufspreisen hier am Platze, lagern in Constanza. Bitte dringend schnellste Antwort der türkischen Regierung erwirken. Option abläuft am 20ten dann sollen Sachen vielleicht nach Griechenland. Unsere hiesigen maßgebenden Kreise halten Angebot für äußerst günstig und für Türkei einzigartige Gelegenheit. 461
Consten Bucarest 17.10.
Am 23. Oktober lässt Consten durch das Konsulat Bukarest bei Enver Pascha anfragen, ob in Konstantinopel ein Tankschiff zur Verfügung stehe, das 400.000 bis 600.00 Liter Benzin fassen könne; die lägen im Hafen von Constanza für die Türkei bereit. Innerhalb von zehn Tagen könne die Fracht dann in Konstantinopel sein, mit kleineren Schiffen würde es 25 Tage dauern. Er habe die Transportkosten für alle Lieferungen auf 150 Francs (Lei) festgelegt. Ferner fordert er Transportdampfer für die Verschiffung von Gerste und Mehl an, außerdem hat er Gemüse- und Fleischkon serven anzubieten. Die lebenswichtige Information für die Afghanistan-Expedition steht ganz am Ende dieses Telegramms: „16 Waggons drahtlose 462 Stationen Consten rollen endlich nach Giurgewo.“ Giurgewo (Giurgiu) war Rumäniens Grenzbahnhof zu Bulgarien. 262
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
Am 26. Oktober kommt die positive Rückmeldung Envers für „Herrn Kaufmann“ mit der von Humann veranlassten Übersetzung durch Geheimrat Mueller, einen Mitarbeiter der Botschaft. Darin wird die gewünschte Abnahme der Lieferung bestätigt, die Garantie der Finanzierung mit Hinweis auf spätere Akkreditierung bei der Rumänischen Kreditbank zugesichert und mitgeteilt, dass Berlin über den Zahlungsmodus informiert werde. Am 5. November meldet sich Consten erneut, um mitzuteilen, dass die durch Vermittlung von Ludwig Roselius beschafften 6.400 Tonnen Gerste im Hafen Constanza zum Verladen bereit lägen. Doch nun gebe es neue Schwierigkeiten. Hier gekaufte Bohnen können infolge neuen Ausfuhrverbots für Säcke nicht mehr ausgeführt werden. Habe deshalb in Bulgarien 280 Waggons Bohnen gekauft unter der Bedingung der Ausfuhrerlaubnis. Preis nach 463 Rücksprache mit hiesigem Vertreter des Reichseinkaufs 29,70 pro 100 kg franco Constantinopel. Bitte Drahtantwort wohin Waggons aus Bul464 garien rollen sollen.
Beim Benzinpreis, so Consten weiter, gebe es Änderungen. Alle übrigen Einkäufe würden „durch Schikane der hiesigen Regierung im letzten Augenblick unmöglich gemacht“. Die Konservenausfuhr sei verboten worden, da alle Vorräte für die rumänische Armee reserviert würden. Stattdessen könne er in Bulgarien noch Mais aufkaufen. Auch bulgarische Butter und Stroh könne er anbieten und über Adrianopel ausführen. Nachdem ihm offenbar zu Ohren gekommen ist, was man in der Botschaft in Konstantinopel und im Auswärtigen Amt von seinen merkwürdigen Geschäften in Rumänien hält, fühlt er sich schließlich doch bemüßigt, zu betonen: Sämtliche Einkäufe geschehen unter Kontrolle und Mitwirkung hiesiger Kreditbank. Selbstverständlich ehrenamtlich[,] alle gegenteiligen Aus465 streuungen beruhen auf Erfindung.
Die Sonderaufträge, die Hermann Consten in Rumänien und Bulgarien „nebenher“ für das türkische Oberkommando erledigte, erfolgten vielleicht tatsächlich „ehrenamtlich“. Doch uneigennützig dürfte sein Einsatzeifer nicht gewesen sein, galt es doch Enver Pascha zu beweisen, wie unentbehrlich er für die Afghanistan-Expedition war, auch wenn er nicht zur preußischen 263
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Offizierskaste gehörte. Obwohl er schon das Ding mit den 300.000 Mark in Gold gedreht hatte, musste er den eher zurückhaltenden Enver wohl immer noch überzeugen, dass niemand anderer als er der ideale Expeditionsführer war. Für Roselius wiederum war Consten eine willkommene Kontaktperson bei der Durchleitung wichtiger Kriegstransporte durch die beiden neutralen Länder, vor allem nachdem der Weg über Serbien vollends blockiert war und Transporte über Rumänien immer schwieriger wurden. So gesehen kann allerdings nicht als sicher angenommen werden, dass es sich bei Constens oben zitierten Offerten wirklich um Lebensmittel- und Treibstofflieferungen gehandelt hat. Legt man die von Roselius und Mannesmann gehandhabten, im Archiv des Deutschen Museums in München aufbewahrten Telegrammschlüssel zugrunde, könnte es sich durchaus auch hier um Waffenlieferungen oder um verschlüsselte Lageberichte im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Schwarzmeer-Manöver der türkischen Flotte gehandelt haben. Am 9. November kann Hermann Consten schließlich mitteilen, es sei ihm gelungen, die Waggons für die Expedition nach Afghanistan und mehrere für die Türken bestimmte Waggons per Schleppkahn über die Donau auf bulgarisches Gebiet nach Rustschuk zu überführen. „Habe die Absicht alle Waggons in einem geschlossenen Zuge selbst zu geleiten“, meldet er 466 aus Bulgarien an das Bukarester Konsulat. Ein weiterer Trick der Berliner Expeditionsstrategen, die Durchfuhrsperren der rumänischen Behörden zu unterlaufen, war derweil weniger erfolgreich gewesen. Für Ägypten und Afghanistan bestimmte Antennen und Masten waren „unter Bezeichnung Stangen Zirkuszelts“ zwei von der Firma Telefunken gestellten Telegrafisten alias „Beleuchtungstechnikern“ als persönliches Reisegepäck mitgegeben worden. Im Zug nach Konstantinopel saß außerdem eine „Zirkustruppe“, bestehend aus 12 muslimischen Kriegsgefangenen, dem Lektor des Orientalischen Seminars der Berliner Humboldt-Universität, Mohammed Al-Arabi, und dem Kriegsfreiwilligen Stern als „Varieté-Direktor“. Um keinen Verdacht zu erregen, war das Gepäck der Muslime noch in Budapest umgepackt und dem Freiherrn Schabinger von 467 Schowingen, der für die Geheim-Expedition nach Ägypten vorgesehen war, als versiegeltes Kuriergut mitgegeben worden. Das Konsulat in Bukarest hatte bereits zuvor Bedenken gehabt und vorgeschlagen, die Masten 264
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
lieber als „für den Neubau der Botschaft Constantinopel“ bestimmte Gerüstteile zu deklarieren. Dies hatten die „Jihadisten“ in Berlin aber verworfen. So war das Verhängnis absehbar, als die „Zirkustruppe“ rumänisches Territorium erreichte. Die angeblichen Zirkus-Stangen waren so miserabel verpackt, dass der Zoll sie unschwer als Antennenmasten identifizieren konnte. Die Durchsuchung des übrigen Gepäcks erhärtete den Verdacht, es könnte sich um einen illegalen Militärtransport handeln. Die Lieferung wurde beschlagnahmt. Neben der Telegrafenausrüstung und Waffen fanden sich im „Zirkus-Gepäck“ noch größere Mengen Gold, sodass auch Finanzminister Costinescu eingeschaltet wurde. Bukarests Zeitungen überschlugen sich mit bissigen Kommentaren und ätzenden Karikaturen über diese „Zirkusnummer“ der Deutschen. Konsul von dem Bussche, der eine gewaltsame Öffnung der Kuriersäcke und die Beschlagnahme des Transportguts um jeden Preis vermeiden wollte, erhielt aus Berlin Weisung, den Rumänen zu erklären, es handele sich darum, dass die zerlegbaren Telefunkenanlagen „für unsere wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Unternehmen in entlegenen Teilen Kleinasiens bestimmt“ seien, wo die Kommunikation schwierig geworden sei. Für kriegerische Zwecke kämen sie selbstverständlich nicht in Betracht. Letztlich stellte das AA dem Konsul aber anheim, auch eine andere, die Rumä468 nen vielleicht eher überzeugende Version zu finden. All diese hochgeheimen Durchreisen durch Bukarest und der ganze damit verbundene Ärger um falsch deklarierte Militärtransporte müssen dem genervten Konsul angesichts des neuerlichen Desasters nur noch wie eine Farce kriegspielender Wichtigtuer vorgekommen sein, bei der sich ausländische Geheimdienste königlich amüsierten. Wenn nur die allgemeine Kriegslage nicht so ernst gewesen wäre! Warum aber Oskar Niedermayer in seinen Erinnerungen an die Afghanistan-Expedition später die Vermutung äußerte, die Geschichte 469 mit der Zirkustruppe sei wohl Constens Idee gewesen, bleibt rätselhaft. Er hat ihm nach allem, was er mit ihm erlebt hatte, wohl auch das zugetraut. In dem Punkt hat er ihn aber wohl doch unterschätzt. Von den neuerlichen Schwierigkeiten mit den rumänischen Behörden war Constens Transport insofern betroffen, als ein Teil der Funk-Ausrüstung für die Afghanistan-Expedition bestimmt war. Seine Waggons standen Mitte November zwar längst auf bulgarischer Seite, aber nun mussten 265
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
die von den Rumänen beschlagnahmten Gegenstände erst einmal über das Büro Mannesmann-Roselius in Berlin neu beschafft und auf den Weg gebracht werden. Während dieser Zeit arbeitete Consten weiterhin in Rumänien und Bulgarien eng mit Ludwig Roselius zusammen, sammelte vertrauliche Informationen, beobachtete Truppenbewegungen und das Treiben feindlicher Agenten in den Schwarzmeerhäfen der beiden Länder wie auch an ihrer gemeinsamen Grenze – und mischte selbst fleißig mit. In der Zwischenzeit hatte sich nämlich die Lage am Schwarzen Meer kritisch zugespitzt. Nachdem die Goeben und die Breslau – inzwischen als Yavuz Sultan Selim und Midilli in die osmanische Kriegsflotte integriert – am 27. Oktober mit einem türkischen Geschwader zu „Manövern“ ausgelaufen waren, hatte ihr Kommandant, der deutsche Admiral Souchon, die Häfen Sevastopol und Odessa angegriffen. Teile der Hafenanlagen waren in Brand geschossen und ein russischer Kreuzer versenkt worden. Damit war der casus belli gegeben; die Türkei – nach Monaten der Hinhaltetaktik gegenüber dem Allianzpartner in Berlin – war endlich in den Krieg einbezogen. Das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn konnten also auf Entlastung an der Ostfront hoffen. Alle warteten gespannt, was weiter passieren würde. Wie würden die nächsten Schritte der Russen sein, wie die Reaktion Bulgariens und Rumäniens, die bisher sowohl dem Werben der Entente als auch der Mittelmächte erfolgreich widerstanden hatten? Russlands Kriegserklärung folgte auf dem Fuß. Russische Truppen marschierten von Armenien aus in die nordtürkische Provinz Erzurum ein. Für Rumänien und Bulgarien bedeutete der Zwischenfall hingegen noch immer keinen Grund, sich auf die eine oder die andere Seite zu schlagen. Doch die Briten, denen die Entwicklungen in Mesopotamien und Ägypten zunehmend missfielen, sahen sich, zumal da sie inzwischen Wind von den geheimen deutsch-türkischen Expeditionsplänen bekommen hatten, zum Einschreiten veranlasst. Sie erklärten der Türkei nur wenige Tage nach den Russen ebenfalls den Krieg und verstärkten umgehend ihre militärische Präsenz am Persischen Golf. Frankreich und Italien sollten bald folgen und Feindseligkeiten in Syrien und Nordafrika eröffnen. Enver Pascha sah die Zeit gekommen, den schon länger geplanten Feldzug in den Kaukasus noch vor dem Einbruch des Winters zu beginnen, obwohl ihm von der deutschen Militärmission dringend abgeraten wurde. Das Generalhaupt266
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
quartier der Mittelmächte bevorzugte eine Herausforderung der Russen auf weiter von Südosteuropa entfernt gelegenen Schauplätzen. Damit rückten Persien und Afghanistan wie auch das östliche Mittelmeer und die Arabische Halbinsel in den Fokus. Plötzlich will man im Auswärtigen Amt genau wissen, wann die letzten Teilnehmer der Afghanistan-Expedition Konstantinopel verlassen werden, wo sich die vorausgereisten Mitglieder zur Zeit aufhalten, wie der ausführliche Expeditionsplan aussieht, welche türkische Begleitung vorgesehen ist, „welche Reiserouten, wann voraussichtlich Eintreffen Afghanistan, welche Art rückwärtiger Verbindung“ – lauter Fragen, die vorher niemanden sonderlich interessiert hatten. Ferner wird Wert darauf gelegt, sich auf den Hauptzweck, das „Aufrollen“ Afghanistans und die „Einwirkung“ auf Indien, zu konzentrieren. Wassmuss und Schünemann, die „Nebenunternehmungen“ planen, sollen regelmäßig ausführlich berichten und untereinander Kontakt halten. Die Expeditionsmitglieder sollen außerdem die Sicherheit der demnächst eintreffenden Inder gewährleisten, die mitreisen sollen, „um mit dortigen Indern Revolutionierung in Indien zu betreiben und afghanischen Vorstoß auch bei indischen Nichtmuhammedanern als Beginn 470 allgemeiner Erhebung gegen England zu propagieren.“ Auch will man nun Genaueres über die türkischen Pläne wissen. Erst am 23. November 1914 ist Hermann Consten wieder in der osmanischen Hauptstadt. Konstantinopel ist wie ausgewechselt. Die Stadt wimmelt von Militär, die Botschafter der Entente-Länder haben ihre Akkreditierungen zurückgegeben, Bürger ihrer Staaten werden verhaftet und interniert. Überall herrscht nervöse Betriebsamkeit, auch Angst. Neun Tage zuvor, am 14. November, hatte der Scheich-ul-Islam des Osmanischen Reiches an der auf den Ruinen einer byzantinischen Kirche errichteten und dem osmanischen Eroberer des alten Byzanz, Sultan Mehmed II, geweihten FatihMoschee vor einer riesigen Menschenmenge die ganze islamische Welt zum „Heiligen Krieg“ aufgerufen. Die Reaktion der Engländer kam prompt. Am Tag vor Constens Rückkehr hat ein aus Indien kommendes britisches Expeditionskorps Basra besetzt und rüstet sich nun zum Marsch auf Bagdad, um das Vordringen türkisch-deutscher Militärexpeditionen nach Persien zu verhindern. Consten hat zwei Waggons mit Waffen und Ausrüstung sowie den 267
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Goldbetrag im Kuriergepäck mitgebracht, außerdem mehrere Waggons mit weißen Bohnen und anderen wichtigen Versorgungsgütern für die türkische Armee. Die Herren können endlich ihr „Räuberzivil“ ablegen und in ihre Südwester-Uniformen ohne Rangabzeichen schlüpfen. Endlich auch können sie die Karten studieren und ihren Aufbruch nach Aleppo vorbereiten. Die nachgelieferten Telegrafenanlagen treffen Anfang Dezember in Konstantinopel ein. Jetzt erst stellt sich heraus, dass wichtiges Zubehör fehlt; teilweise lässt es sich in Konstantinopel beschaffen, aber 10.000 Meter dünner Kupferdraht und zwei Separatoren müssen nochmals aus Berlin nachgeschickt werden. Schlimmer ist: man stellt erst jetzt fest, dass keine der beiden angelieferten „Mittelmeerstationen“ in den Bergregionen Persiens oder Afghanistans eingesetzt werden kann; ihre Reichweite ist zu kurz, 471 die Sendeleistung und die Masten sind zu niedrig. Also muss die Expedition erst einmal ohne Telegrafenstation aufbrechen. Nach monatelangem Stillstand kommt endlich Bewegung in das längst nicht mehr geheime Expeditionsvorhaben. Die Teilnehmer wissen inzwischen auch, dass der britische Militärgeheimdienst auf jeden von ihnen einen Kopfpreis ausgesetzt hat. Und für die Russen ist jemand wie Hermann Consten ohnehin schon seit Jahren kein Unbekannter. Die Zeit drängt, sich mit dem um Wilhelm Wassmuss gescharten Teil des Expeditionskorps und den türkischen Offizieren zusammenzuschließen, um von Aleppo aus gemeinsam in Richtung Mesopotamien zu ziehen, bevor die Engländer ihnen den Weg abschneiden oder die Russen in Nordpersien einmarschieren können. Hastiger Abschied also von Konstantinopel, das die Herren in den zwei Monaten ihres unfreiwilligen Aufenthaltes immerhin einigermaßen kennenlernen konnten. Einige sprechen sogar schon ganz passabel Türkisch – wenn auch eher das Argot der Basarhändler und Kneipiers. Die geräuschvolle Verladung der Gewehrkisten, der übrigen Ausrüstung und des Proviants für die mehrtägige Reise auf dem Bahnhof Haydarpascha, von wo die Bahnen in Richtung Anatolien, Aleppo und Bagdad abgehen, erregt Anfang Dezember einen mittleren Volksauflauf. Zum Abschied erscheinen sogar einige halbseidene Damen am Bahnsteig, was scharfzüngige Beobachter zu süffisanten Bemerkungen über die inzwischen stadtbekannten und doch so geheimnisvollen Deutschen verleitet. Schließlich steigt die Gruppe um Niedermayer und Consten in den Zug. Und Bot268
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
schafter Wangenheim ist erleichtert, diese Gesellschaft erst einmal los zu sein. Durch die Nacht dampft die Lokomotive langsam in Richtung Süden und hält erst am späten Vormittag des nächsten Tages in Eskishehir. Im Hotel Madame Djadja, gleich gegenüber dem Bahnhof gelegen, reicht die Zeit immerhin für ein Mittagessen, bevor es weitergeht nach Konya, das am nächsten Morgen erreicht wird. Die berühmte Stadt der tanzenden Derwische näher in Augenschein zu nehmen wäre verlockend, doch liegt sie eine halbe Stunde per Pferdebahn vom Bahnhof entfernt. Also steigt die Gruppe nach einem Frühstück im direkt am Bahnhof gelegenen Hotel Bagdad wieder ein und fährt weiter bis Bosanti, dem vorläufigen Endhaltepunkt der noch nicht fertig gestellten Bagdadbahn. Viele Jahre ist dieses Großprojekt deutscher Investoren schon im Bau, doch fehlen noch immer wichtige Streckenabschnitte, zum Beispiel durch den Taurus und das Amanus-Gebirge wie auch im Einzugsgebiet von Euphrat und Tigris zwischen Djerablus und Mossul. Der eingleisige Ausbau und die Lücken im Streckennetz behindern gerade jetzt Nachschub und Militärtransporte in Richtung Suez, Arabien und Mesopotamien. Auch die Belieferung der Baustellen mit Material aus Deutschland ist durch die kriegsbedingte Überlastung der Transportkapazitäten und die Beförderungsblockaden auf dem Balkan ins Stocken geraten. In Bosanti, einem trostlosen Baustellencamp mit ein paar Militärbaracken zum Übernachten, muss das Gepäck auf Ochsenkarren umgeladen werden. Doch hat am Tag zuvor der ebenfalls mit einer Gruppe von Offizieren durchreisende Oberst Klein, der zu den Ölfeldern von Karun in Süd-Mesopotamien unterwegs ist, alle verfügbaren Lasttiere mitgenommen. Für Oberleutnant Niedermayer steht immerhin ein Automobil bereit, das ihn auf einer leidlich guten Fahrstraße über den Taurus bringen soll. Consten erhält den Auftrag, mit der restlichen Gruppe und dem Gepäck nachzukommen. Bis wieder Transportkarren verfügbar sind, vergehen drei Tage. Von Aleppo aus wird Consten später an Roselius schreiben: Ich habe dann auch noch den ganzen Goldtransport sowie noch Munition und Waffen von Bosanti aus nach hier geführt, trotz der drohenden Beschießung von Alexandrette durch die Engländer, während Oberleutnant Niedermayer […] mit seinem deutschen Burschen nach Aleppo im 269
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Extrawagen vorausfuhr, angeblich um alle Differenzen mit Wassmuss und mir […] aus dem Wege zu räumen. So hatte ich dann wieder einmal die ganze Arbeit am Halse, und nur meinen ganz vorzüglichen Verbindungen verdanke ich es, dass wir mit dem ganzen Tross nur 1½ Tage 472 später ankamen als Niedermayer.
Dennoch hat Consten die Mühsal des Weges auch genossen. Er war wieder unterwegs, wie er es aus der Mongolei kannte und liebte. Die mit Kiefern bestandene Hochgebirgslandschaft des Taurus mit atemberaubenden Fernsichten erinnerte ihn zuweilen an den Altaj. Er hätte nicht übel Lust gehabt, gleich auf die Jagd zu gehen, doch war er nicht mehr Herr über seine Zeit. Er trug außerdem Verantwortung für eine Gruppe von Menschen, mit denen ihn persönlich wenig verband, die er zum Teil kaum kannte, weil sie erst in Konstantinopel dazugestoßen waren. Wichtiger war: Er trug Verantwortung für kostbare Fracht, von der nichts verloren gehen durfte. Die Nacht hatte man in einem Chaan, einer einfachen Karawanserei am Wegesrand verbracht und war in aller Frühe nach Tarsus aufgebrochen. Ab dort fuhr wieder die Bahn, über Adana bis Mamuré, von wo noch einmal Lasttiere die Ausrüstung übernahmen; für die Männer standen Pferde zum Ritt durch das Amanus-Gebirge bereit. Unterwegs begegnete die Gruppe mehreren Arbeiterbataillonen; viele Armenier waren unter ihnen. Sie arbeiteten noch an der Autostraße nach Süden, deren Bau Enver Pascha nach Kriegsbeginn in aller Eile hatte in Angriff nehmen lassen. Andere waren dabei, unter Aufsicht deutscher Ingenieure bei Intilli einen langen Bahntunnel durch harten Granit vorzutreiben, der eines Tages das Amanus-Gebirge auf knapp 5.000 Meter Länge durchschneiden sollte. Vielen dieser Schwerstarbeiter hatte man die Entkräftung angesehen, denn die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen und die Lebensbedingungen in den Camps spotteten jeder Beschreibung. Schlechte Ernährung, üble sanitäre Verhältnisse, fehlende ärztliche Versorgung forderten ihren Tribut. Wer nicht mehr konnte, wurde zum Sterben an den Straßenrand gelegt. Neben verendeten Kamelen und Maultieren säumten Elendsgestalten den steinigen Weg durchs Gebirge. Ein kleiner Vorgeschmack nur auf das, was die Männer im Verlauf ihrer langen Reise noch zu sehen bekommen würden. Selbst der einigermaßen abgehärtete Hermann Consten war nachdenklich geworden. Nach zwei weiteren Tagen 270
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
war schließlich Islahiye erreicht, von wo zweimal wöchentlich eine Bahn nach Aleppo fuhr. Und so war man am 16. Dezember schließlich eingetroffen in der alten Syrerstadt mit ihrer mächtigen Zitadelle aus dem 13. Jahrhundert. Das Wiedersehen mit Wilhelm Wassmuss ist alles andere als erfreulich. Mit fast allen Expeditionsmitgliedern hat es sich der glücklose Konsul inzwischen gründlich verdorben. Auch zu den türkischen Teilnehmern ist das Verhältnis gespannt. Anfang November hatte er mit Franz Fredrich und 473 dem türkischen Oberst Reuf Bey, der die Expedition nach Afghanistan leiten sollte, mit drei Lastwagen nach Bagdad vorausfahren wollen. Schon am darauffolgenden Tag jedoch hatte Wassmuss wegen eines Streits um den richtigen Umgang mit den Chauffeuren die Weiterfahrt abgebrochen. Die beiden Deutschen waren nach Aleppo zurückgekehrt und hatten die Türken allein weiterfahren lassen. Von der ursprünglichen Gruppe sind nur noch wenige übrig. Die – wie Consten findet – Tüchtigsten haben wegen der dauernden Reibereien mit Wassmuss ihre Abberufung verlangt und 474 sich zur Division des Obersten Kress von Kressenstein nach Damaskus versetzen lassen. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte, war Wassmuss’ Versuch gewesen, sich durch eine unterschriftliche Verpflichtung der Mitglieder auf die in Konstantinopel vereinbarte Neuregelung der Zuständigkeiten, durch nach Rang gestaffelte Zuteilung von Tagegeldern und durch die Einführung eines festen Dienstplans mehr persönliche Autorität zu verschaffen. Doch der Schuss war nach hinten losgegangen. Die Folge war eine offene Rebellion gewesen. Etliche verweigerten die Unterschrift und erklärten, für sie seien immer noch die in Berlin gebildete Kommission und die dort getroffene Gehaltsregelung verbindlich. Die deutsche Afghanistan-Gruppe ist auf nur noch 16 Mann zusammengeschrumpft. Die Brüder Paschen und Günther Voigt hatten in Constens Ankunft einige Hoffnung auf Besserung der Atmosphäre gesetzt. Doch als dieser schließlich mit Tross und Bagage eintrifft, hat Niedermayer bereits ganze Arbeit geleistet. Angesichts des inzwischen verhängten Kriegsrechts soll auch die Expedition „jetzt ganz militärisch sein“, wie Consten an Roselius schreibt. Dem Verlangen der Türken jedoch, ihre deutschen Begleiter hätten von nun an türkische Uniform anzulegen, um ihre Teilnahme am „Heiligen Krieg“ auch überzeugend erscheinen zu lassen, setzt Niedermayer 271
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
sein ausdrückliches Verbot entgegen. Sie erhalten Südwester-Uniformen, Gewehre und Munition. Der Grund dazu war darin zu suchen, dass Herr Major von Versen von der Botschaft als der militärisch Rangälteste dazu bestimmt worden war, im Falle kriegerischer Operationen die Leitung zu übernehmen, wobei ihm das Triumvirat Wassmuss, Niedermayer, Consten beratend zur Seite stehen sollte. Deshalb musste Major von Versen an die Wand gedrückt 475 werden.
Die Lage erscheint total verfahren, wie Consten am 30. Dezember aus Aleppo weiter an Roselius schreibt: Alle diese Herren stellen ihren persönlichen Ehrgeiz über die gute Sache die naturgemäß dadurch leiden muss, und ich habe dann immer wieder die Sorge und Mühe, die ganze Sache nicht scheitern zu lassen. Dazu kommt noch, dass Wasmus und Niedermayer es absolut nicht verstehen, mit den Türken umzugehen. Das schroffe Auftreten des Herrn Oblt. Niedermayer […] hat viel dazu beigetragen, dass die Türken sich hierdurch tief verletzt fühlen, von der Afghanistan Expedition nicht mehr viel wissen wollen, und nur durch die persönliche Freundschaft, die ich mit einigen türkischen Offizieren, die uns begleiten sollen, seit Cospoli pflegte, das Vertrauen Envers, seines jugendlichen Onkels, des Divisionskommandeurs, Halil Bey und anderer hoher türkischer Würdenträger rettet 476 immer wieder die Situation.
Immerhin scheint sich insofern ein Ende der ewigen Streiterei unter den drei charakterlich grundverschiedenen Egomanen abzuzeichnen, als Wassmuss dem Oberleutnant Niedermayer geradezu erleichtert die weitere Führung überlässt und für sich selbst Pläne schmiedet, von Bagdad aus mit einer Handvoll Inder allein nach Südpersien vorzustoßen. Noch bevor sich der Dezember dem Ende zuneigt, ist er mit Niedermayer, Schünemann und deren Entourage „in fünf Extrawagen“ abgereist. Consten hat den Auftrag, den Rest der Gruppe samt Geschenken, Geldkisten, Ausrüstung und Waffen nach Mossul zu bringen. Dort sollen die Deutschen eine Etappe einrichten. Halil Beys türkische Division soll dort zu ihnen stoßen, damit sie gemeinsam in Richtung Persien und Afghanistan ziehen. Zwar schimpft 272
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
Consten, man habe ihm wieder die ganze Arbeit aufgebürdet, aber eigentlich ist er froh. Endlich ist er wieder in seinem Element und kann den an deren zeigen, was in ihm steckt. Er berichtet Roselius: Jeder Wagen kostet 16½ türkische Pfund. Ich sollte die Karawane auf 50 Wagen à 16½ Pfund türkisch nachführen. Ich glaube, dass keiner der Herren sich die Summe vorher ausgerechnet hat. Daher versuchte ich zuerst – nach Abreise der Herren Niedermayer und Wasmus – 16 Kamele à 2½ Pfund türkisch zu mieten. In der Zwischenzeit war Halil Bey, Envers Onkel, eingetroffen, der unsere Marschroute änderte und uns statt nach Mossul nach Bagdad dirigierte. Endlich hatte ich etwa 95 Kamele, große starke Tiere, zusammen requiriert, aber ich hatte die Rechnung ohne den hiesigen Gouverneur und den Kommandanten des Vierten Armeekorps gemacht. In einer langen, aber durchaus freundlichen Unterhandlung musste ich, da ein Befehl von Enver vorlag, dass in Aleppo und Umgebung Kamele nur vom Vierten Armeekorps, um den Vormarsch nach Suez zu beschleunigen, requiriert werden dürfen, meine Tiere wieder herausgeben. Ich entschloss mich daher, sofort Boote zu bauen und mit Mann und Ross den Euphrat hinunter zu fahren. Die Boote sind im Bau, und in etwa vier Tagen hoffe ich, den Euphrat hinunter zu schwimmen. Die ganze Sache wird uns etwa 180 Pfund türkisch kosten, nachdem wir das Holz in Bagdad verkauft haben werden. Die Reise selbst 477 wird etwa um 20 Tage kürzer sein.
Einen ähnlich lautenden Bericht über den Stand der Dinge und die weiteren Schritte hatte Consten an Reinhard Mannesmann verfasst. Auf einer Postkarte, die auf ihrer Vorderseite das Hotel Al-Chanbi in Aleppo zeigt, hatte Wilhelm Paschen, auch im Namen einiger Kameraden, Constens Bericht eine kurze Mitteilung beigefügt. Als ein „Mann der That und des Vorwärtsstrebens“, so Paschen, könne Mannesmann sicher beurteilen was es für die Gruppe bedeute, von Berlin bis Aleppo vier volle Monate zu brauchen. Und er hatte noch angefügt: Fünf bis sechs tüchtige Leute unter der Führung eines Mannes wie Cons478 ten und wir wären in diesen Monaten bereits bis ans Ende der Welt.
Consten kann sich also der Unterstützung einer kleinen verschworenen Ge273
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
meinschaft innerhalb der Expeditionsgruppe sicher sein. Ähnlich wie Wassmuss, wenn auch aus anderen Gründen und mit anderer Zielsetzung, erwägt er, eigene Wege zu gehen. In diesem Sinne schreibt er an Roselius: Nun noch eine Bitte. Die mir gütigst in Bukarest überlassenen Gelder habe ich nach Abzug der Unkosten an unsere Hauptkasse abgeführt. Ich halte das heute für einen großen Fehler, da die Bestrebungen Niedermayers, der nur Persien kennt, dahin gehen, aus der Afghanistan-Expedition eine große persische Sache zu machen. Ich bitte Sie, wenn Sie genügend Vertrauen zu mir haben, mir durch ein Telegramm die alleinige Verwaltung dieses Geldes zu übertragen, da einige Herren der Expedition fest entschlossen sind, sich mit mir unter allen Umständen nach Afghanistan durchzuschlagen, aber dazu muss ich für die äußerste Not über die mir für die Afghanistan-Expedition von Ihnen übergebenen Gelder verfügen können. Überlegen Sie sich die Sache gründlich; es sind nicht die schlechtesten Männer der Expedition, die mir für den Fall eines Zu479 sammenbruches allein nach Afghanistan folgen wollen.
Wohl wissend, dass ihm die Geheimagenten der Briten und der Russen längst auf den Fersen sind, fügt er noch selbstbewusst an: Einstweilen ist von Engländern und Russen ein ganz anständiger Preis auf meinen Kopf gesetzt worden. Mister Grey hat uns an der persischen und Afghan-Grenze einen warmen Empfang versprochen. Wir sind ihm dankbar dafür. Lebend bleibt mit meinem Willen kein Russe oder Eng480 länder hinter uns zurück.
Bevor sie am 7. Januar 1915 von Aleppo aufbrechen, feiern die Männer dort noch in feucht-fröhlicher Runde Weihnachten als deutsch-türkisches Verbrüderungsfest. Am Vorabend von Silvester folgen sie der Gegeneinladung zu einem Neujahrs-Essen im Haus des Gouverneurs. 18 Flaschen Champagner seien getrunken worden, notiert der Potsdamer Leutnant Franz Fred481 rich in sein Tagebuch. Danach habe er sich krank gefühlt. Um zu erfahren, wer denn nun mit ihnen und auf welcher Route nach Afghanistan ziehen wird, nimmt Consten von Aleppo aus direkten Kontakt mit den türkischen Armeeführern auf. Er telegrafiert an General Suleiman Askeri Bey, der die Sechste Armee bei Basra gegen die Engländer ins Feld führt. Er kor274
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
respondiert mit Admiral Reuf Bey, dem bisherigen Oberleiter der Expedition. Bis zur Abreise konferiert Consten außerdem täglich mit Oberst Halil Bey über die Erlaubnis zum Aufbruch. Die deutschen Männer tragen jetzt türkische Uniformen, einen Fez als Kopfbedeckung und bekleiden einen türkischen Offiziersrang jeweils eine Stufe über ihrem deutschen. Nichtmilitärs wie Hermann Consten erhalten den Rang eines Teğmen, eines Leut482 nants. Als Reisebegleiter fährt ein türkischer Hauptmann mit, dem Consten die beiden Maschinengewehre anvertraut. Botschafter v. Wangenheim meldet die Abreise der Consten-Truppe und 483 ihre geänderte Route nach dem Jahreswechsel nach Berlin. In der Zwischenzeit ist Schünemann, im Privatleben ein Geschäftsmann, der mit persischen Teppichen handelt, von Mossul aus bereits nach Kermanshah aufgebrochen, um dort ein Konsulat als Etappe für die Expedition einzurichten. Wilhelm Wassmuss meldet sich aus Bagdad und teilt mit, er werde baldmöglichst mit mehreren Indern auf südlicher Route in Richtung Persien aufbrechen, um den Weg für spätere Unternehmungen gegen Indien zu ebnen. Er bittet Wangenheim, den alleinigen Oberbefehl über die deutschen Teilnehmer Oberleutnant Niedermayer zu übertragen, der seine Weisungen in Zukunft über die Gesandtschaft in Teheran empfangen könne. Um Consten, der mit neun Leuten noch unterwegs ist, vollends auszuschalten, fügt Wassmuss noch an: Consten ist Element innerer Beunruhigung, die gedeihliches Arbeiten 484 auch fernerhin hindern wird.
Wangenheim stimmt, nach entsprechender Vollmacht aus Berlin, dem Vorschlag Wassmuss’ zu. Consten wird erst bei seiner Ankunft erfahren, dass er keinerlei Entscheidungsbefugnis mehr hat. Die etwa 120 Kilometer von Aleppo nach Djerablus am Euphrat fährt die Gruppe mit der Bahn. Der mächtige Strom, dessen beide Quellflüsse südlich des Kaukasus bei Erzurum und in der Nähe des Van-Sees entspringen, ist an dieser Stelle etwa 700 Meter breit. Eine Eisenbahnbrücke zum jenseitigen Ufer steht kurz vor der Fertigstellung. Am Euphrat-Ufer liegen etwa zwei Meter breite flache Ruderschiffe mit kastenförmigen Aufbauten, sogenannte Schachturs für die Gruppe bereit. Sie sollen Männer und Material rund 800 Kilometer stromabwärts nach Bagdad bringen. Am dritten 275
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Reisetag auf dem Fluss feiern sie Griesingers Geburtstag mit einer ungeplanten Euphrat-Taufe. An Bord geht es hoch her, man grölt deutsche Burschen- und Soldatenlieder, und wie immer, wenn er getrunken hat, führt Hermann Consten das große Wort. Herumtorkelnd, verlieren er und der Maler Peter Paschen zu vorgerückter Stunde das Gleichgewicht. Sie plumpsen in voller Montur über die niedrige Schiffsbrüstung in den Euphrat. Mit einiger Mühe können die beiden Trunkenbolde wieder an Bord gehievt werden, doch ihre Waffen hat Euphrates, der mesopotamische Flussgott, vorsorglich behalten. Einige der Anwesenden an Bord wenden sich angewidert ab. Über Meskene, Rakka, Deir ez-Zor mit seiner antiken steinernen Bogenbrücke ist die Gruppe Consten zehn Tage lang auf dem immer breiter werdenden, nun von Dattelpalmen gesäumten Strom unterwegs. In Meyadin machen die Boote ein letztes Mal an einer öffentlichen Anlegestelle fest. Ab dort ist die Weiterreise geheim, übernachtet wird an Bord. Die Schiffe passieren dicht bevölkerte Ufer mit großen Siedlungen, Burganlagen aus alter Zeit. Doch können sie nur noch an Stellen anlegen, die vorher mit den Türken abgesprochen wurden. Nur auf ein bestimmtes, täglich wechselndes Passwort hin werden die Männer ans Ufer gelassen. Mehrmals gehen Mitteilungen von Niedermayer ein, in denen es heißt, sie müssten sich nicht allzu sehr beeilen mit ihrer Ankunft in Bagdad. Dort scheint es wohl Probleme zu geben. Die gemächliche Flussfahrt ist zwar sehr erholsam, wird aber irgendwann auch langweilig. Ungeduld und Frustration nehmen wieder zu. Am 27. Januar wird noch Kaisers Geburtstag auf dem Euphrat gefeiert, nach Einbruch der Dunkelheit sogar die Reichsflagge gehisst, während die Schiffe Ramadiye passieren. Endlich nähert man sich der Bagdad-Region. Am 30. Januar legen die Schachturs in Faludja am linken Euphrat-Ufer an. Wagner, Wilhelm Paschen, Griesinger, der Arzt Fritz Niedermayer und der typhuskranke Winkelmann, der ins Spital geschafft werden muss, gehen von Bord und reisen auf dem Landweg weiter. Wenige Tage später verlassen an unbekannter Stelle auch die übrigen Teilnehmer die Schachturs. Munitions- und Geldkisten werden auf Ochsenkarren umgeladen. Die Schiffe werden zerlegt, damit das Holz verkauft werden kann. Prof. Zugmayer und Berghausen reisen mit einigen „Afghanen“ im Auto voraus, 276
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
Consten kommt mit dem Karrentransport hinterher. Nochmals zwei Tage braucht er, bis er schließlich am Mittag des 5. Februar am westlichen Ufer 485 des nach schweren Regenfällen hoch angeschwollenen Tigris eintrifft. Bei der Ankunft des Transports in unmittelbarer Nähe des Bagdader Bahnhofs übernehmen gleich türkische Militärs die Munitions- und Gewehrkisten und bringen sie samt den mitgeführten zwei Maschinengewehren und der übrigen Ausrüstung in ein Waffendepot. Consten lässt es geschehen und macht sich zu Fuß über eine schwankende Schiffbrücke auf den Weg in die einst so ruhmreiche Metropole Mesopotamiens. Ihn erwartet eine staubige Stadt unter Palmen, die auf den ersten Blick nur aus elenden Hütten zu bestehen scheint. Direkt am Tigrisufer stehen auch einige größere Gebäude mit Kuppeln und flachen Dächern, an denen der Putz von den Wänden fällt. Beim Wiedersehen mit Oskar Niedermayer in einem für die deutsche Gruppe angemieteten Haus nahe dem Konsulat meldet Consten die Beschlagnahme ihrer Ausrüstung. Niedermayer ist außer sich. Nicht nur über die Türken, sondern auch über Consten. Er berichtet kurz, was in der Zwischenzeit alles passiert ist: Die Türken haben das gemeinsame Vordringen nach Afghanistan mit den Deutschen abgesagt. Reuf Bey hatte Niedermayer offenbart, dass es überhaupt keine Verbindung zum Emir von Afghanistan gebe. Er sei sich gar nicht sicher, ob einer Expedition, zumal mit christlichen Teilnehmern, überhaupt das Betreten des Landes gestattet werde. Er beabsichtige nun, so Reuf Bey weiter, nur mit seinen osmanischen Truppen und der Hilfe einiger persischer Stämme auf verschiedenen Wegen nach Persien vorzudringen, um sich dort den Russen in den Weg zu stellen. Consten wirkt nicht allzu sehr überrascht, als ihm Niedermayer außerdem noch berichtet, der Oberkommandierende der türkischen Streitkräfte in Mesopotamien, Suleiman Askeri Bey, habe in einem Schreiben mitgeteilt, er sehe sich wegen der Landung der Briten in Basra gezwungen, die Tätigkeit der Expedition Klein, die sich der Ölfelder von Karun bemächtigen sollte, zu verhindern und ihre Mitglieder samt Waffen und Munition für seine eigenen Ziele einzusetzen. Plötzlich laufen Wagner, Paschen und Griesinger vorbei, die Consten auf dem Weg nach Kermanshah vermutete; deshalb waren sie früher von Bord gegangen. Doch kurz vor der persischen Grenze waren sie, wie er erfährt, von türkischer Gendarmerie aufgehalten worden. 277
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Man hatte sie entwaffnet und umgehend nach Bagdad zurückgeschickt. Die Expeditionsgruppe ist aufgefordert, Bagdad nicht zu verlassen und sich den Türken zur Verfügung zu halten. Sollte Consten angesichts der Beschlagnahmungen und des in Bagdad offen ausgebrochenen Streits zwischen Niedermayer und den Türken insgeheim etwa Genugtuung empfunden haben, so hatte er sich zu früh gefreut. Niedermayer bittet Consten um eine persönliche Aussprache, Prof. Zugmayer nimmt er als Zeugen hinzu. Er fordert ihn auf zu erklären, was ihm eigentlich eingefallen sei, entgegen ausdrücklicher Anordnung direkten Kontakt mit der türkischen Expeditionsleitung und Kommandeur Suleiman Askeri aufzunehmen; was ihn geritten habe, sich als alleiniger Expeditionsleiter des deutschen Kontingents auszugeben. Der nächste Vorwurf ist noch gravierender. Er, Consten, sei mitverantwortlich für all die Schwierigkeiten, mit denen die Deutschen seit ihrer Ankunft in Bagdad zu kämpfen hätten. Grund der Verstimmung der Türken sei nämlich niemand anderer als er. Die türkische Seite lege ihm, Consten, zur Last, die Expedition verraten zu haben. Suleiman Askeri Bey, Reuf Bey und andere hohe türkische Offiziere hätten sich beklagt, von ihm aus Aleppo und von unterwegs immer wieder lange, unchiffrierte Telegramme erhalten zu haben, in denen von Afghanistan und anderen Details, sogar von Rumänien die Rede gewesen sei, so Niedermayer. Lauter Dinge, die Suleiman Askeri Bey zum Beispiel gar nichts angingen. Und Reuf Bey, der sich natürlich geschmeichelt gefühlt hätte, als Oberleiter der Expedition angesprochen zu werden, habe dies als Vorwand benutzt, die Deutschen herumzukommandieren und nach Belieben Gelder aus dem Expeditionsfonds zu entnehmen. Durch sein Verhalten habe Consten den deutschen Interessen sehr geschadet. Niedermayer eröffnet ihm schließlich, die Leitung des deutschen Expeditionskorps liege inzwischen ausschließlich in seinen Händen; Consten habe keinerlei Entscheidungsbefugnis mehr. Konsul Hesse werde ihm dies noch schriftlich geben. Hatte Consten von der Absicht der Türken, die Deutschen auszubooten, vorher gewusst? Hatte er selbst seine türkischen Freunde gar „inspiriert“, Niedermayers Vorhaben wie auch die Pläne von Wassmuss und Oberst Klein zu durchkreuzen? Zumindest im Falle Wassmuss und Niedermayer kann man dies nicht ausschließen. Constens Drang, ohne seine beiden Ri278
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
valen nach Afghanistan zu gelangen, muss übermächtig gewesen sein. Was immer er dort suchte oder erreichen wollte, er war offenbar wild entschlossen, den Türken, wenn es sein musste, sogar seine Seele zu verkaufen. Jedenfalls ist durchaus denkbar, dass er bereit gewesen wäre, ihnen die komplette Ausrüstung einschließlich der Kisten voll Gold und Waffen zu überlassen, wenn sie ihn allein – vielleicht noch die paar Leute, die auf seiner Seite standen – mitnehmen würden auf ihren Feldzug durch Persien und Afghanistan, womöglich bis an den Indus. Constens Rechtfertigungsversuch gegenüber den Vorhaltungen Niedermayers klingt nicht gerade überzeugend. Er weicht aus, dementiert, antwortet mit Gegenvorwürfen und spielt den Beleidigten. Am nächsten Tag bittet er, aus dem Expeditionshaus ausziehen zu dürfen, da er sich unter den deutschen Teilnehmern nicht mehr wohl fühle. Niedermayer will ihm dies erst gestatten, wenn geklärt ist, wie Consten sich künftig gegenüber der Expedition verhalten wird. Das einmal geweckte Misstrauen lässt sich so leicht nicht beruhigen, zumal da Consten weiterhin insgeheim Verbindung mit den Türken hält, während die Kontakte Suleiman Askeri Beys und Reuf Beys zu Niedermayer abgebrochen sind. Consten hält sich von der deutschen Gruppe absichtlich fern. Er erscheint nicht zur täglichen Lagebesprechung, verbringt viele Stunden bei den Türken. Niedermayer, der scharfen Protest gegen die Sanktionen eingelegt und sich hilfesuchend an das Deutsche Konsulat gewandt hat, bleiben die Hände vorerst dennoch gebunden. Konsul Hesse bittet ihn, weitere Aktivitäten erst einmal zu unterlassen, bis er Weisungen aus Konstantinopel beziehungsweise Berlin erhalten hat. Immerhin kann er über Wangenheim erreichen, dass die beschlagnahmten Sachen wieder freigegeben werden; nur die beiden Maschinengewehre erhalten die Deutschen nicht zurück. Constens „Unwohlsein“ hatte auch noch einen anderen Grund. Bei seinem ersten Besuch im Deutschen Konsulat nach seiner Ankunft in Bagdad hatte ihn Konsul Hesse nicht nur offiziell davon unterrichtet, dass er nicht mehr zum Leitungsgremium der Expedition gehörte und ihm jeden weiteren Kontakt mit den Türken untersagt; Consten musste auch feststellen, dass bisher kein Telegramm von Ludwig Roselius eingetroffen war. Die Frage, was dahinter stecken könnte, beunruhigte ihn zutiefst. Das Ausbleiben des ersehnten Telegramms beschäftigte ihn auch in den folgenden Wo279
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
chen; es raubte ihm den Schlaf. Offenbar hatte er den Türken großartige Geldversprechungen gemacht und musste sie nun vertrösten. Noch ahnte er nicht, dass sein Ende Dezember abgeschickter Bericht aus Aleppo und die darin enthaltene Bitte an Roselius, ihm die alleinige Verfügungsgewalt über die in Bukarest übergebenen 300.000 Mark zu erteilen, diesen erst Anfang Februar 1915 erreicht hatte – also etwa in der Zeit, als Constens Schiffe bereits in Bagdad eintrafen. Schlimmer noch: Roselius, der wohl angenommen hatte, das Geld sei längst für Emir-Geschenke ausgegeben, war nach dem schließlichen Erhalt des Schreibens hinsichtlich einer eigenen Entscheidung in der Angelegenheit etwas mulmig geworden. Er hatte sich mit Bitte um weitere Instruktionen sicherheitshalber an das Auswärtige Amt gewandt. In einem Schreiben an den Gesandten von Bergen hatte er den Hintergrund der Geldübergabe noch einmal dargelegt, Constens Brief aus Aleppo zur Kenntnisnahme angefügt und mitgeteilt. Der jetzige Brief von Consten besagt nach meiner Ansicht, dass das Gold bis auf die Überführungsspesen durch Consten noch vorhanden zu sein scheint. Falls in Berlin keine Entscheidung getroffen werden kann, so würde ich vorschlagen, Herrn von dem Bussche und mich gemeinsam zu beauftragen, die Angelegenheit zu erledigen.
Doch Legationssekretär von Wesendonck, auf dessen Schreibtisch der Vorgang schließlich landete, vertrat die Auffassung, Consten dürfe ein solches Verfügungsrecht nicht zugesprochen werden; dieses müsse dem AA vorbehalten bleiben. Unterstaatssekretär Zimmermann war derselben Meinung und instruierte Botschafter Wangenheim, er möge die „Leitung der Afghanistan-Expedition“ – sprich Oberleutnant Niedermayer – „sowie Herrn Consten“ von diesem ablehnenden Bescheid unterrichten. In dem diesbezüglichen Telegramm aus Berlin hieß es abschließend: „Die Angelegenheit 486 dürfte damit ihre Erledigung gefunden haben.“ Für Hermann Consten fing damit der Ärger aber erst richtig an. In der letzten Februarwoche bestellte ihn Konsul Hesse zu sich ins Bagdader Konsulat, um ihn von dem Bescheid zu unterrichten und ihn zur Herausgabe des Geldes aufzufordern. Bei der Filiale der Deutschen Bank in Bagdad zahlte Consten daraufhin 240.000 Francs in Gold ein und brachte die Quittung ins Konsulat. Auf die Frage, was mit den fehlenden 60.000 sei, gab er an, er habe seinerzeit in Bu280
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
karest bei der Auszahlung der Roselius-Gelder umgerechnet nur 240.000 in Francs erhalten. Von der Botschaft in Konstantinopel seien ihm aber noch 20.000 Francs „zu Bestechungszwecken“ übergeben worden; davon habe er einen Teil verbraucht. Hesse forderte ihn auf, die Abrechnung vorzulegen und den Rest dieser Summe ebenfalls zurückzugeben. Consten sagte die Rückzahlung der Restsumme zwar zu, abrechnen aber wollte er nur mit der Botschaft. Er habe ohnehin vor, in den nächsten Tagen über Mossul nach 487 Konstantinopel abzureisen. Erstaunlicherweise zahlte Consten am folgenden Tag die 20.000 Francs aber ein, obwohl er davon angeblich doch schon Geld verbraucht hatte. Er war ganz offensichtlich gar nicht in der Lage, eine Abrechnung vorzulegen. Und er musste mehr Geld bei sich haben als er angegeben hatte. Auch in Konstantinopel hatte man inzwischen angefangen zu rechnen und zu überlegen, wie das zurückgezahlte Geld für die Zwecke der Expedition verwendet werden sollte. In diesem Zusammenhang war zwar auch ungeschminkt von der Notwendigkeit großzügiger Bestechungszahlungen die Rede, allerdings an Perser und Afghanen, nicht an die Türken, die sich aus dem in Konstantinopel verwalteten offiziellen Expeditionsfonds schon reichlich bedient hatten. „Wir müssen an wichtigen Punkten die Bestechungen unserer Feinde überbieten“, hatte Niedermayer aus Bagdad tele488 grafiert. Wesendonck hatte die Erwartung geäußert, über die noch ausstehenden 40.000 Francs ebenfalls Aufschluss zu erhalten. Dann ließe sich die Expedition mit der vollen Summe von 300.000 ausstatten. In Klammern hatte er noch angefügt: Gleichzeitig könnte erwogen werden, ob es nicht besser wäre, dass Cons489 ten sich von der Afghanistan-Expedition ganz zurückzieht.
Diese Gelegenheit bietet sich schneller als gedacht. Nur wenige Tage nach dem Gespräch über die Klärung der finanziellen Unregelmäßigkeiten zwischen dem Konsul und Hermann Consten taucht Major Klein, den die Türken von den Erdölfeldern im Süden Mesopotamiens ferngehalten haben, im Bagdader Konsulat auf. Er teilt Konsul Hesse mit, Consten habe ihm gegenüber eine Andeutung fallenlassen, wonach er in einem gegen Niedermayer angestrengten Kriegsgerichtsverfahren der Türken als Zeuge auftreten wolle. Also wird Consten ein weiteres Mal einbestellt und zu dieser 281
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Äußerung „amtlich vernommen“. Nach einigem Zögern rückt er mit der Sprache heraus. Beim Bagdader Kriegsgericht, bestätigt Consten, laufe ein Verfahren gegen einen Soldaten aus der türkischen Begleitmannschaft der Expedition. Dieser Soldat habe Geld von Niedermayer angenommen, um gegen türkische Offiziere zu spionieren. Einer dieser türkischen Offiziere, so Consten weiter, sei er selbst. Konsul Hesse sieht Gefahr im Verzug. Er fürchtet, durch „unvorsichtiges oder gehässiges Vorgehen des Consten“ könnte die Freiheit, vielleicht sogar das Leben deutscher Offiziere aufs Spiel gesetzt werden. Er untersagt ihm deshalb, ohne besondere Genehmigung Niedermayers noch irgendwelche Beziehungen zu den Türken zu pflegen. Consten entgegnet ihm mit erhobener Stimme, er stehe nicht mehr unter Niedermayers Befehl; in dieser Beziehung würden für ihn nicht einmal mehr Anweisungen Botschafter Wangenheims gelten, sondern nur direkte Befehle des Auswärtigen Amtes. Selbst der Hinweis, Wangenheim sei vom Reichskanzler persönlich ermächtigt worden, die Zuständigkeiten in der Expedition nach der Trennung von den Türken neu zu ordnen, verschlägt nicht. Schließlich stellt ihm Konsul Hesse anheim, seinen Austritt aus der Expedition zu erklären. Und Her490 mann Consten tut es. Damit ist die unerfreuliche Szene aber noch keineswegs beendet. Bevor Consten sich grußlos davon machen kann, gibt Hesse ihm noch die Warnung mit auf den Weg, auf keinen Fall irgendwelche ihm in der Zeit seiner Mitgliedschaft in der Expedition bekanntgewordene Interna an türkische Behörden weiterzugeben. Dies könne die politische Lage wie auch die Lage seiner Ex-Kameraden ernstlich gefährden. Constens Entgegnung bringt das Fass zum Überlaufen. Er sei türkischer Offizier, erklärt er mit sich fast überschlagender Stimme; der Konsul hätte ihm keinerlei Vorschriften zu machen. Darauf entgegnet ihm Hesse scharf, er sei zur Ausübung der Konsulargerichtsbarkeit berechtigt und könne ihn in Haft nehmen, wenn er Grund zu der Annahme hätte, Consten sei gesonnen, deutsche Amtsgeheimnisse einer fremden Macht zu verraten. Er würde darin den Versuch eines Landesverrats erblicken. Statt endlich einzulenken, streitet Consten ihm wutentbrannt und mit hochrotem Kopf jegliche Befugnis zu einem solchen Vorgehen ab. Der Konsul erklärt Hermann Consten daraufhin für vorläufig verhaftet, ruft seine Ordonnanz herbei und lässt den tobenden „Ex282
2. Querelen um die geheime Afghanistan-Expedition
peditionsführer a.D.“ in ein Zimmer einschließen. Dann bestellt er Niedermayer ins Konsulat. Dieser beteuert, er habe niemals einen Soldaten mit der Überwachung Constens oder der Beschaffung geheimer Auskünfte über türkische Offiziere beauftragt. Constens Austritt aus der Expedition, so Niedermayer weiter, nehme er unter der Bedingung an, dass dieser „unverbrüchliches Schweigen über die früheren Vorgänge innerhalb der Expedition gegenüber den Türken“ gelobe. Consten, der etwa eine Stunde in „Haft“ gesessen und sich inzwischen wieder ein wenig beruhigt hat, wird vorgeführt. Niedermayer wiederholt seine Aussage und bekräftigt sie mit seinem Ehrenwort. Hesse trägt Consten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen vor und ermahnt ihn nochmals zur Vernunft. Er stellt ihm sofortige Entlassung in Aussicht, wenn er sein Ehrenwort zur Verschwiegenheit gibt. Und siehe da, Consten akzeptiert und ist wieder frei. Suleiman Askeri Bey wird durch Hesse über Constens Austritt aus der Afghanistan-Expedition umgehend informiert. Der Konsul ersucht den Kommandanten der Sechsten Armee, den Deutschen in Zukunft als reine Privatperson zu betrachten. Außerdem unternimmt er vertrauliche Schritte, um die Niederschlagung des militärgerichtlichen Verfahrens zu erreichen. Er hat damit Erfolg, wie er am 6. März 1915 in seinem abschließenden Bericht über die unerquickliche Angelegenheit Botschafter Wangenheim mitteilt, der den gesamten Vorgang an Reichs491 kanzler von Bethmann Hollweg nach Berlin weiterleitet.
3. „Major“ Constens Sondereinsatz für Enver Pascha Am letzten Februartag des Jahres 1915 kehrt ein gescheiterter Hermann Consten der Stadt Bagdad, deren exotische Reize er in den turbulenten Wochen seit seiner Ankunft kaum hatte in Augenschein nehmen können, den Rücken. Nur ein einziges Mal hatte er Muße gefunden, ein Stündchen in einem Kaffeegarten am Tigrisufer unter Dattelpalmen zu sitzen, auf den vorüber ziehenden Fluss mit seinem lebhaften Schiffsverkehr zu schauen und die wärmenden Strahlen der Frühjahrssonne auf seinem Rücken zu spüren. Verzweifelt hatte er versucht, von dem Roselius-Geld noch etwas für sich zu retten. Fieberhaft hatte er überlegt, womit er die bereits getätigten Ausgaben begründen konnte. Wie ein Ritter von der traurigen Gestalt, dessen „Heldentaten“ sich in schöner Regelmäßigkeit ins Lächerliche kehren, 283
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
macht er sich zu Pferd am Tigrisufer entlang flussaufwärts in nördlicher Richtung über Samara und Tikrit auf den Weg nach dem 350 Kilometer entfernten Mossul. Hatte er mit seinem Verhalten wirklich versucht, Landesverrat zu begehen? Immerhin handelte es sich bei den Türken ja um Verbündete. Auch wenn er jetzt in der Uniform eines türkischen Kavallerie-Offiziers steckte und seine militärisch kurzgeschorenen Locken unter einem turban-ähnlich mit khakifarbenen Stoffbändern umwickelten türkischen Stahlhelm verbarg, war und blieb Hermann Consten ein glühender deutscher Patriot. Es hatte eher den Anschein, als sei er förmlich besessen von der fixen Idee, er könne im Alleingang die hochgestochenen Träume des Hohenzollernkaisers von der Eroberung Indiens unter Ausnutzung der Vision Enver Paschas von der Wiederherstellung eines osmanischen Großreiches Wirklichkeit werden lassen. Consten hatte wohl den Blick für die Realitäten verloren. Aber noch scheint ja nicht alles am Ende zu sein. Entgegen der Annahme des Konsuls Hesse, Consten hätte sich „mehrfach ohne Erfolg um Be492 schäftigung seitens der türkischen Behörden bemüht“, verlässt er die Stadt in türkischem Auftrag und mit dem begehrten Offiziersrang eines Binbaşı, eines Majors. Wie früher so oft in der Mongolei, betätigt er sich nun in Mesopotamien wieder einmal als Kurier geheimer Depeschen. Niemand geringerer als Armeechef Suleiman Askeri Bey, der nach den blutigen Kämpfen bei Basra verwundet in einem etwas heruntergekommenen, als Notlazarett eingerichteten Bagdader Palast liegt, hat ihm Briefe für Halil Pascha mitgegeben. Er scheint ihm die unchiffrierten Telegramme also verziehen zu haben. Schließlich hatten sie den Türken einen wunderbaren Vorwand geliefert, die ihnen immer unangenehmer in die Quere kommenden deutschen Expeditionen zu stoppen. Wie Elefanten im Porzellanladen hätten sich diese Kerle aus Almanya benommen, einige wären sogar in arabischer Kleidung zu einer hohen schiitischen Feier nach Kerbela gereist und hätten dem Obermufti auch noch die Hände geküsst, so Suleiman Askeris Vorwurf. Wochenlang hätten umständliche religiöse Reinigungsrituale in der Moschee stattfinden müssen, um die Befleckung der heiligen Stätten durch diese Ungläubigen wieder zu beseitigen. Andere, wie dieser Oberst Klein, hätten ihre Finger nach den Ölquellen am Karun ausgestreckt. Sie scherten sich nicht im geringsten um arabische Empfindlichkeiten. Außer284
3. „Major“ Constens Sondereinsatz für Enver Pascha
dem interessierten sie sich plötzlich allzu sehr für Persien; sie wollten die neutrale Regierung in Teheran auch noch in den Krieg gegen Russen und Engländer mit hineinziehen. Arabien und Persien aber betrachteten die Türken nun einmal als ihr ureigenes Glacis. Niemand anderer hätte sich 493 dort einzumischen, am allerwenigsten die eigenen Verbündeten. Oberst Halil hatte Reuf Bey nur für wenige Wochen als Gesamtleiter der türkisch-deutschen Afghanistan-Expedition abgelöst. Nach dem offen ausgebrochenen Streit mit den Deutschen und der Absage der gemeinsamen Expedition soll Halil nun Envers Eroberungspläne realisieren helfen. Der junge Armeeführer erscheint dem acht Jahre älteren Consten als letzte Rettung. Obwohl selbst nun ohne Waffen und ohne das Gold, hofft er insgeheim doch, von Halil weiterhin akzeptiert und mitgenommen zu werden auf den langen Marsch durch Persien nach Afghanistan. Dieser weiß wohl noch nichts von Constens Bruch mit Niedermayer, seinem unwürdigen Abgang aus der deutschen Expeditionsgruppe. Nach ihrer freundschaftlichen Begegnung in Aleppo um die Weihnachtszeit war Halil zunächst nach Konstantinopel zurückgekehrt, um sich dort an die Spitze der 51. Division zu setzen und mit 12.000 Mann durch das anatolische Hochland Richtung Osten zu ziehen. Halils Truppen sind mittlerweile im ostanatolisch-persischen Grenzgebiet, einer überwiegend von Kurden bewohnten Region, versammelt; sein Hauptquartier befindet sich östlich von Mossul. Der geplante Einmarsch nach Nordpersien ist bereits der zweite Versuch der Türken. Der erste, angeführt von Reuf Bey, war im Januar blutig gescheitert. Schlimme Gerüchte über grausame Massaker seiner Leute unter den persischen Grenzstämmen kursierten damals in Bagdad. Man sprach von regelrechten Raubzügen, bei denen Plünderungen, Brandschatzung, Vergewaltigung und Mord an der Tagesordnung gewesen waren. Sie ließen nichts Gutes für das weitere Kriegsgeschehen ahnen. Kein Wunder, dass Reuf Bey deutsche Offiziere nicht hatte dabeihaben wollen. Halils Truppen hingegen scheinen etwas disziplinierter und besser verpflegt zu sein als die marodierenden Söldner Reuf Beys. Doch heißt es, die Türken hätten bei den Persern inzwischen viel an Kredit eingebüßt, da Reuf Beys Banditenbrigaden sich inzwischen in Luristan ähnlich schlimme Zusammenstöße mit den dortigen einheimischen Stämmen lieferten und erneut eine Spur der Zerstörung hinterließen. 285
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Ursprünglich sollte Halils Division auf Teheran zumarschieren, doch nachdem Täbris angeblich durch russische Truppen eingenommen ist, soll sie nun unter südlicher Umgehung des Urmia-Sees in nordöstlicher Richtung auf Aserbeidschan vorrücken, um von dort die durch massive Verluste empfindlich gelichteten Reihen der türkischen Kaukasus-Armee zu unterstützen. Erst wenn die Russen ganz aus dem Gebiet vertrieben sind – soviel scheint klar –, wird der Durchmarsch durch Persien überhaupt möglich sein. Im Moment verzögert sich der Einmarsch in Persien aber noch aus einem anderen Grund. Die Bewaffnung der Truppen Halils lässt zu wünschen übrig. Große Mengen der für sie vorgesehenen Munition sind auf Befehl Suleiman Askeri Beys nach Samara geschafft worden, um bei dem Versuch verwendet zu werden, ein weiteres Vorrücken der Engländer vom Schatt-al-Arab her in Richtung Bagdad aufzuhalten. Die britisch-indische Expeditionsarmee ist soeben um eine zweite Division verstärkt worden. Britische Kanonenboote sichern Basra vom Euphrat her. Die türkischen Munitionswagen hingegen stehen auf dem Bahnhof von Samara nutzlos herum. Die Waffen sind gar nicht zum Einsatz gekommen, weil es mit der 494 Organisation mal wieder nicht geklappt hat. Hermann Consten, der von diesem Problem noch nichts weiß, beeilt sich, noch rechtzeitig in Mossul zu sein, um Halil Bey nicht zu verfehlen. Kurz vor dem Ziel gerät er mit seinen türkischen Begleitern in einen Hinterhalt. Es kommt zu einem heftigen Schusswechsel mit mehreren vermummten Gestalten. Constens Pferd wird getroffen, er selbst kann sich mit knapper Not zur Seite rollen und in Deckung gehen, seine Begleiter können den Angriff im letzten Moment abwehren. Ob es die Spähreiter auf Constens Depeschen abgesehen hatten oder auf ihn selbst, lässt sich nicht genau sagen. Er vermutete dahinter jedenfalls – wohl nicht ganz zu Unrecht – die Engländer. Wahrscheinlich hielten sie ihn noch für ein Mitglied der Niedermayer-Expedition und freuten sich schon auf das Kopfgeld für den erwischten Deutschen. Dokumente in den National Archives in Kew bei London belegen, dass die Gruppen Niedermayer/Wassmuss und Oberst Klein bereits in Konstantinopel ins Visier des britischen Militärgeheimdienstes MI-5 geraten waren und spätestens seit ihrer Ankunft in Bagdad systematisch observiert wurden. Etwa zur selben Zeit als sich Consten auf dem Weg nach Mossul be286
3. „Major“ Constens Sondereinsatz für Enver Pascha
fand, war Wilhelm Wassmuss mit seinen Begleitern auf dem Weg nach 495 Schiras im Süden Persiens überfallen worden. Auch er hatte entkommen können, doch war es seinen Verfolgern gelungen, sein Gepäck zu erbeuten. Unter anderem enthielt es eine Namensliste der Niedermayer-Expedition und ihrer Geheimcodes. Damit war es für die Briten ein Leichtes gewesen, die allgemeine Agentenjagd zu eröffnen. Genau aus dieser Zeit auch datieren die ersten vertraulichen Dokumente des MI-5 über den Diplomaten 496 Werner Otto von Hentig, der inzwischen für eine zweite, umsichtiger geplante Afghanistan-Expedition vorgesehen war. Sie sollte sich in Persien mit der Niedermayer-Truppe zusammenschließen und mit ihr gemeinsam 497 nach Kabul weiterziehen. Leicht lädiert und noch etwas unter Schock trifft Hermann Consten nach seinem mehrtägigen Ritt vom Tigris her durch das kurdische Bergland im Hauptquartier der 51. türkischen Division bei Mossul ein. Er erhält ein Zelt zugewiesen, wo er seine Sachen ablegen, sich frisch machen und seine Schürfwunden behandeln kann. Dann geht er hinüber zu Oberst Halil Bey, übergibt die Depeschen, berichtet beim gemeinsamen Tee, was ihm widerfahren ist. Generös überlässt ihm der türkische Divisionskommandant eine wundervolle braune Araber-Stute mit einer breiten, von der Stirn bis zu Nüstern und Maul reichenden weißen Blesse, langer blonder Mähne und blondem Schweif. Ein herrliches Tier, das ihm da mit bestickter Satteldecke und farbig passendem Lederzaumzeug zugeführt wird! Sein edler Stammbaum soll bis auf die Stute Saglavi zurückgehen – eine der fünf Stuten, die der Prophet Mohammed auf seiner Flucht von Mekka nach Medina geritten 498 hatte. Consten lehnt erst ab; er erklärt, ein solches Pferd könne er gar nicht bezahlen. Doch am nächsten Morgen steht einer der Männer Halils mit demselben Pferd vor seinem Zelt und erklärt ihm, sein Herr mache ihm das Tier zum Geschenk. Eine größere Freude hätte Halil Bey dem passionierten Reiter Hermann Consten gar nicht machen können. Eine noble Geste orientalischer Höflichkeit und Gastfreundschaft ist dies. Eine Geste der Anerkennung, um die er nicht einmal hatte bitten müssen, weil sie sich für einen Mann wie Halil Bey von selbst verstand. An diesem Morgen verschmerzt Hermann Consten seine Niederlage von Bagdad und gewinnt sein altes Selbstvertrauen zurück. 287
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Abb. 14: Consten als türkischer Offizier im osmanisch-persischen Grenzgebiet 1915. Nach einer Fotografie gemalt von Heinz Munz
Von einem Mann wie Halil Bey akzeptiert er wenig später sogar die Mitteilung, dass aus der Afghanistan-Unternehmung vorerst nichts wird. Consten soll stattdessen in den nächsten Tagen bereits auf seiner SaglaviStute nach Konstantinopel reiten und Briefe für Enver Pascha mitnehmen. Ein paar Tage verbringt Binbaşı Consten noch im Kriegslager der Türken bei Mossul. Er begleitet Halil Bey auf Erkundungsritten im Grenzgebiet, unternimmt Ausflüge durch die Steppe ins nahe „Teufelsanbeter-Gebirge“, ein kahles Randgebirge, dessen auberginefarbene Silhouette sich nordöstlich des alten Ninive am Horizont abzeichnet. Am Fuß des Gebirges gibt es mehrere von Jesiden bewohnte Dörfer, in denen Schatan – der gefallene Engel Luzifer, der „Lichtträger“ – als Gottheit verehrt wird. Die Kultstätten der „Teufelsanbeter“, wie sie von den Kurden genannt werden, sind eigenartige, spitz zulaufende Kegelbauten. Ihr Oberpriester residiert in einer auf einem Felsvorsprung oberhalb der Dörfer gelegenen Burg, welche die Gegend in weitem Umkreis beherrscht. Am Fuß des mächtigen Felsens breitet sich paradiesisch eine Oase mit Olivenhainen, Aprikosen- und Mandelbäumen aus. Zahlreiche Bäche durchziehen den üppig grünen, schattigen und fruchtbaren Landflecken. Das von drei goldenen Kuppeln gekrönte Haupt288
3. „Major“ Constens Sondereinsatz für Enver Pascha
heiligtum, Grabstätte des Sektengründers Schech Adi war einstmals von nestorianischen Mönchen errichtet worden. Es liegt noch ein Stück weiter nördlich, tief versteckt in einem bewaldeten Bergkessel. Von der Oase aus gelangt man in zweieinhalbstündigem Ritt und nach einem mühseligen Aufstieg über gewundene Bergpfade dorthin. Dies ist ein mystischer Ort, wo weißgekleidete Priester mit brennenden Ölschalen in den Händen als „Lichtträger“ hin und her huschen. Den fremden Besucher fordern sie auf, ihnen durch eine mit magischen Zeichen und Abwehrzauber geschmückte Tür einige Stufen hinab in einen lichtlosen, nur durch einige Öllampen schwach erhellten Raum, zu folgen, der nichts enthält – außer dem Rauschen des ihn im Finstern durchströmenden Bergbachs – wie monotoner, nie endender Gesang ewiger Anbetung. Im angrenzenden Raum ein mit schwarzem Tuch bedeckter Steinsarkophag. Er 499 soll die Gebeine des Sektengründers enthalten. Während seiner ganzen Reise hat es Hermann Consten nicht zu den Moscheen gezogen, doch es zieht ihn, genauer: seinen „inneren Dämon“, mit aller Macht zu diesem, der satanischen Gottheit geweihten Tempel – zu Schatan, der Gut und Böse unauflöslich in sich vereint, es zieht ihn zu seinem eigenen Schatten. Denn noch immer hat er nicht wirklich begriffen, was ihn im Innersten antreibt. Ist dies hier vielleicht der „Tempel des Lebens“, nach dem er schon lange gesucht hat? Den er irgendwo im Herzen Asiens vermutet? Aus dem weitläufigen, aber heruntergekommenen Mossul mit seinen staubigen Straßen und Plätzen hält sich Consten möglichst fern. Er hat schon gemerkt, dass dort jeder seiner Schritte überwacht wird – nicht etwa von englischen Agenten, sondern von den eigenen Landsleuten – Botschafter von Wangenheim hat es angeordnet. Seiner Exzellenz dem Reichskanzler Herrn von Bethmann Hollweg mit dem Hinzufügen gehorsamst vorgelegt, dass der kaiserliche Konsulatsverweser in Mossul von mir angewiesen worden ist, den dortigen Verkehr Consten’s vorsichtig zu kontrollieren, seine Weiterreise zu melden, eine etwaige Absicht aber, von dort aus die Grenze nach Persien zu über500 schreiten, türkischerseits jedenfalls verhindern zu lassen.
Am 9. April 1915 trifft er wieder in Konstantinopel ein und bezieht ein Zimmer im Hotel Germania. Das Mittelklassehotel wird bevorzugt von In289
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
genieuren der Firma Hochtief frequentiert, die maßgeblich am Bau der Bagdad-Bahn beteiligt ist. Nach einem mühseligen Ritt durch das Anatolische Hochland, wo er – so ist anzunehmen – Augenzeuge der dort gerade einsetzenden massenhaften Vertreibung und Ermordung der armenischen Bevölkerung wurde, über die düstere kurdische Hauptstadt Diarbekir mit ihrer Festungsmauer, ihren Türmen und Zinnen aus schwarzem Basalt war Consten schließlich nach Angora, dem heutigen Ankara gelangt. Da er doch recht erschöpft war, hatte er seine Saglavi-Stute dem dortigen Armeekommandanten übergeben und war mit der Anatolischen Bahn weitergereist. Nun ist er wieder am Ausgangsort der gescheiterten Afghanistan-Expedition in Konstantinopel gelandet. Er hat Enver Pascha die Briefe Halil Beys überreicht und hofft, noch eine Weile in türkischen Diensten bleiben zu können. Auch in der osmanischen Hauptstadt, der man die große Aufregung und Angst über den ersten Angriff der Entente-Kräfte auf die Dardanellen 501 am 18. März nicht mehr anmerkt, bewegt sich „Major“ Consten, unter den argwöhnischen Blicken der deutschen diplomatischen Vertretung, in seiner türkischen Offiziersuniform zwischen Envers Hauptquartier in Cospoli und der Botschaft in Pera hin und her. Wer von ihnen wird nun über sein weiteres Schicksal entscheiden? Consten hier eingetroffen. Hat sich bereits bei Enver um anderweitige Verwendung bemüht. Da dies unerwünscht, stelle anheim Rückberufung 502 nach Berlin und entsprechenden telegraphischen Auftrag an mich,
kabelt Botschafter Wangenheim an das Auswärtige Amt. In Berlin stehen Constens Aktien keineswegs zum Besten. Legationsrat von Wesendonck notiert auf Wangenheims Telegramm: Mit Herrn Steinwachs besprochen. Ob Mannesmann eine Verwendung für C. haben, erscheint zweifelhaft. Die Herren M. sind darüber ungehalten, dass sich C. wiederholt unberechtigterweise als ihr Vertreter ausge503 geben hat. Herr Steinwachs wird sich noch äußern.
Im Auswärtigen Amt ist derweil ein Telegramm aus Aachen eingegangen. Theo Dahme hat sich nach dem Verbleib Constens erkundigt, von dem er seit Weihnachten 1914 nichts mehr gehört hatte. Dass zum 1. April nun auch noch die Gehaltszahlung für Consten ausblieb, machte ihm dann doch 290
3. „Major“ Constens Sondereinsatz für Enver Pascha
Sorge. Sollte dem Freund und Verwandten etwas Ernstes zugestoßen 504 sein? Da die Aachener Zeitungen über die geheime Afghanistan-Expedition nichts berichtet hatten, weiß Dahme nicht einmal, ob Consten das Ziel der gefährlichen Unternehmung je erreicht hat, ob er vielleicht irgendwo krank und verwundet liegt, ob er überhaupt noch lebt. Man wird ihm kühl mitteilen, Consten stehe nicht mehr in Diensten des Auswärtigen Amtes; 505 die Zahlungen an ihn seien deshalb eingestellt worden. In Konstantinopel bekommt Consten nach seiner „Ausmerzung“ als 506 „ungeeignetes Element“ nur noch am Rande mit, dass die deutschen JihadPläne längst in eine neue Phase eingetreten sind. Persien spielt, wie er verwundert feststellen muss, mittlerweile die zentrale Rolle. Es war also nicht allein Niedermayers persönlicher Ehrgeiz gewesen, Aktivitäten in Persien zu entfalten; die Kursänderung kam aus Berlin, wo man allerdings Niedermayers Argumentation gefolgt war, nur zuverlässige rückwärtige Verbindungen könnten einen Erfolg des weiteren Vormarschs nach Afghanistan garantieren. Bemühungen, schwedische Instrukteure der Gendarmerie von Teheran, die dort auf der Basis einer britisch-russischen Vereinbarung Dienst taten, für ein Zusammengehen mit den Deutschen zu gewinnen, hatten inzwischen Früchte getragen. Damit schienen sich Aussichten zu eröffnen, auch Persien aktiv in die deutsche Insurgenten-Politik einzubeziehen und zur Aufgabe seiner Neutralität zu bewegen. Selbst der alte, von den Türken hochverehrte Feldmarschall Colmar von 507 der Goltz Pascha, der nach kurzem Zwischenspiel als Generalgouverneur im besetzten Belgien ein weiteres Mal nach Konstantinopel beordert worden war, unterstützte die Trennung der Deutschen von dem türkischen Ex508 peditionsvorhaben. Als treibende Kraft hinter dem neuen Kurs war die Politische Sektion der Abteilung III b des stellvertretenden Generalstabs in Gestalt ihres Leiters, des Hauptmanns und Diplomaten Rudolf Nadolny, hinzugetreten. Dieser sah den Augenblick gekommen, nicht nur von Konstantinopel aus den islamistischen „Brand vom Kaukasus bis Kalkutta“ zu 509 entfachen, sondern die gegen Russland und Britisch-Indien gerichtete Revolutionierung ganzer Völkerschaften auch vom Fernen Osten her in Gang zu setzen. So machte sich in Peking der dortige Militärattaché, Hauptmann Werner Rabe von Pappenheim, der ab 1913 bereits die militärischen Entwick291
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
lungen in der Mongolei für Auswärtiges Amt und Generalstab beobachtet hatte, im Januar 1915 mit einer Gruppe von deutschen und chinesischen Begleitern sowie einem ortskundigen Mongolen an der Spitze einer Kamelkarawane persönlich auf den Weg, angeblich zu einem Jagdausflug ins Chingan-Gebirge, dem mongolisch-russischen Grenzland. Seine Expedition diente jedoch in Wirklichkeit dem Zweck, Anschläge auf die russischen Fernost-Eisenbahnen zu verüben. Damit sollten sowohl der russische Nachschub für die Kriegsfronten im Westen wie auch japanische Waffenlieferungen an Russland unterbunden werden. Doch noch auf mongolischem Gebiet wurde die Gruppe am 20. Februar von mongolischen Soldaten überfallen und niedergemetzelt. Die genauen Umstände von Pappenheims Tod 510 wurden erst nach dem Krieg in Deutschland bekannt. Auch die rückwärtigen Aktionspläne gegen Indien nahmen in China ihren Ausgang. Von einer durch den deutschen Gesandten in Washington eingerichteten Zentralstelle im Generalkonsulat Shanghai und gestützt durch Vertrauensleute in Penang, Bangkok und Kalkutta, sollten reisende Agenten antibritischen Aufruhr in Birma schüren und quer über den Sub511 kontinent Verbindung nach Peshawar und Kabul herstellen – ein wahrhaft globales klandestines Projekt, das mehr von der um sich greifenden Kriegsparanoia als von realistischem Kalkül bestimmt war. Geld schien längst keine Rolle mehr zu spielen. Allein für die Propagandaarbeit in Afrika und Nahost sowie die Unterstützung der dort angezettelten Aufstände mit Waffen und Munition hatte das Auswärtige Amt im März 1915 beim Reichsschatzamt um „baldgefälligste Überweisung“ von acht Millionen 512 Mark nachgesucht – und sie kurz darauf auch erhalten. Baron von Wangenheim, über dessen Schreibtisch auch alle zwischen Berlin und Teheran gewechselten Telegramme liefen, drohten die zusätzlichen Aufgaben allmählich über den Kopf zu wachsen. Einerseits versuchte er im Verein mit dem persischen Botschafter in Konstantinopel, auf Enver Pascha einzuwirken, damit dieser dem „zügellosen Treiben der türkischen Truppen in Persien“ Einhalt gebiete. Erneut bot er an, den dortigen Verbänden deutsche Offiziere beizugeben, was Enver jedoch mit der Begründung zurückwies, die Deutschen seien einer „englisch infizierten persischen Quelle“ aufgesessen; sie würden die Lage an Euphrat und Tigris falsch einschätzen. Gerade in der persischen Frage hätten sich die deutschen Offizie292
3. „Major“ Constens Sondereinsatz für Enver Pascha
re nicht bewährt. Sie seien viel zu jung, ihr schroffes militärisches Auftre513 ten verletze Türken und Perser. Andererseits war Wangenheim immer wieder bestrebt, das Misstrauen der türkischen Seite zu besänftigen und Enver davon zu überzeugen, dass das Deutsche Reich weder in Mesopotamien noch in Persien irgendwelche Sonderinteressen verfolge. Denn ohne türkische Kooperation oder zumindest Duldung des über die Türkei laufenden deutschen Nachschubs waren alle Persien-Afghanistan-Indien-Pläne ohnehin Makulatur. Auch teilte Wangenheim Envers Sorge, der britische Geheimdienst könnte zu frühzeitig Wind von den neuen Vormarsch-Plänen durch Persien bekommen. Die diversen durchreisenden Gruppen sollten sich deshalb möglichst kurz nur in Konstantinopel aufhalten. Wangenheim betätigte sich außerdem als Vermittler und Koordinator zwischen den deutschen Gruppen innerhalb und 514 außerhalb des türkischen Territoriums. Mit wachsender Resignation stellte er jedoch fest, dass er kaum Möglichkeiten besaß, die weiteren Ent515 wicklungen in Persien von Konstantinopel aus noch zu beeinflussen. Wenige Tage vor Hermann Consten war Max von Oppenheim in Konstantinopel eingetroffen. Von der Stadt am Bosporus aus sollte er die Errichtung von „Nachrichtensälen“ in verschiedenen Teilen des Osmanenreiches steuern, um so den vor Monaten propagierten „Heiligen Krieg“ weiter zu schüren. Dessen Flammen loderten keineswegs so hoch, wie erhofft worden war. Weder Araber noch Kurden waren von dem Aufruf des 516 Scheich-ul-Islam sonderlich beeindruckt gewesen. Oppenheim weiß natürlich inzwischen, dass er mit Consten keinen guten Griff getan hatte – und er lässt ihn seine Verachtung spüren. Einzig Ludwig Roselius hat sich offenbar nicht von der „Ausmerzungskampagne“ anstecken lassen. Es ist zu vermuten, dass er – nach Rücksprache mit Reinhard Mannesmann – sogar eine Verwendung für Consten hat. Schließlich war das „Getreidegeschäft“ mit den Türken ja nicht schlecht gelaufen. Die seinerzeit beschaffte Summe, um die es in Bagdad so viel Streit gegeben hatte, stiftet Roselius der Af517 ghanistan-Expedition nachträglich aus seinem Privatvermögen. Von der Summe, über die Consten keinen Verwendungsnachweis vorlegen konnte, ist fortan nicht mehr die Rede. Inzwischen geht es um ganz andere Beträge. Roselius scheint der Einzige zu sein, dem Consten seine persönliche Sicht der zurückliegenden Ereignisse noch mitteilen mag. 293
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Konstantinopel, 16.April 1915 Sehr geehrter Herr Roselius, alles was ich in meinem Brief vom 30. Dez. 1914 Ihnen vorhergesagt habe, ist buchstäblich eingetroffen. Wassmuss und Niedermayer hatten die Angelegenheit unserer Expedition, der eine durch Dummheit, der andere durch schroffes Auftreten und persönlichen Ehrgeiz dermaßen verfahren, dass an ein Einrenken bei meiner Ankunft in Bagdad nicht mehr zu denken war. […] Die Türken haben zum Schluss sämtliche deutsche Herren von der Expedition mit Ausnahme meiner Persönlichkeit [sic] ausgeschlossen, […] ich war ohne Mittel und konnte mich deshalb den vorrückenden Türken nicht anschließen. Unter diesen gegebenen Umständen – die Zustände waren unhaltbar geworden – ritt ich auf Befehl Suleiman Askeri Beys mit Briefen an den Onkel Enver Paschas, Halil Bey nach Mossul und ebenfalls mit Briefen an Enver Pascha nach Constantinopel zurück. Wie mir Seine Exzellenz mitteilt, soll ich mich einige Tage ausruhen – ich war einen Monat unterwegs -, um dann sofort wieder verwendet zu werden. Ich bin der einzige von den Expeditionsmitgliedern, der von der türkischen Regierung direkt übernommen wird. Die anderen sind zum größten Teil kaltgestellt oder zurückberufen worden. Niedermayer ist über Mossul nach Persien, er hat sich wohl mit dem Rest der Expedition dem dort durchrei518 senden Gesandten, dem Fürsten Reuß angeschlossen. Die Herren werden nun wohl in Persien eine Tätigkeit entwickeln, die den Türken äußerst unangenehm ist; ich weiß das von Suleiman Askeri persönlich. […] Sobald ich von Enver Pascha einen neuen Auftrag erhalte, werde ich Ihnen Nachricht zugehen lassen. Einstweilen marschieren meine türkischen Freunde dem fernen Endziel der Expedition entgegen und haben vielleicht schon die dortige Grenze 519 erreicht. Wie steht es in Rumänien und Bulgarien? Ich habe an Toschkoff viele herzliche Grüße von Suleiman Askeri Bey zu bestellen. Ich glaube, die Bestellung wird Ihnen leichter fallen als mir. Wollen Sie es deshalb für mich besorgen? Leider kann ich alles, was er mir für Toschkoff auftrug, dem Papier nicht anvertrauen. Leben Sie wohl für heute, lassen Sie mir bitte eine Nachricht zugehen; es geht ja schnell durch den Berliner Kurier. Mit bestem Gruß Ihr ergebener Hermann Consten Bey, Major in der Osmanischen Armee, 520 z. Zt. Hotel Germania. 294
3. „Major“ Constens Sondereinsatz für Enver Pascha
Ganz bewusst unterzeichnet Consten mit seinem neuen türkischen Titel und Rang. Auf diesen Namen lässt er sich bei einem Graveur im Großen 521 Basar sogar ein Messing-Klischee für Visitenkarten anfertigen. In GalaUniform mit Majors-Epauletten, einem Fez aus schwarzem Karakul-Pelz und einem langem Säbel an der linken Seite lässt er sich in einem Konstantinopler Fotostudio ablichten. Auf seiner Nase trägt er einen Zwicker und am rechten Handgelenk sein Amulett: den alten chinesischen Jadearmreif, den ihm Žalchanc Gegeen wenige Jahre zuvor in Uliastaj geschenkt hatte. Bevor Hermann Consten jedoch die osmanische Hauptstadt in Richtung Sofia verlassen konnte, erschütterten schlechte Nachrichten die türkischdeutsche Militärführung am Bosporus. Am 25. April, nur einen Tag nach ersten Massenverhaftungen von Armeniern in Konstantinopel, begannen die anglo-französischen Landungsoperationen bei den Dardanellen. Um das weitere Vordringen der Gegner ins Innere der Halbinsel Gallipoli waren heftige Kämpfe entbrannt. Die räumliche Nähe des Kriegsschauplatzes zu Konstantinopel löste erhebliche Nervosität unter der ansässigen Bevölkerung aus. Die Glaubwürdigkeit der deutschen Militärberater Liman von Sanders und Bronsart von Schellendorf, die eine solche Konstellation stets ausgeschlossen hatten, war angeschlagen. Die allgemeine Aufmerksamkeit der in Konstantinopel stationierten ausländischen Diplomaten und Militärs drehte sich nicht mehr um die erstarrte Kriegslage in Westeuropa, sondern nur noch um das sich in nächster Nähe abspielende Drama und um die Frage, „ob die Türkei imstande sein würde, den übermächtigen Angriffen der englisch-französischen Flotten und Armeen auf die Dauer zu widerstehen 522 und die Meerenge zu halten“. Auch vom Kriegsschauplatz in Mesopotamien kamen Hiobsbotschaften. Reuf Beys Truppen waren von den Persern ein weiteres Mal zurückgeworfen worden. Und Suleiman Askeri Bey, der – noch nicht einmal voll genesen – seine Truppen vom Rollstuhl aus kommandiert hatte, musste mit ansehen, dass die rechte Flanke seiner Sechsten Armee dem britischen Ansturm bei Basra nicht standhielt. Im Angesicht einer beschämenden Niederlage wählte er den Freitod. Damit verloren die Türken nicht nur einen begabten Armeeführer, dem selbst die Deutschen am Ende den Respekt nicht versagten, sondern auch den Leiter ihrer Spezialorganisation Teşkilat-ı Mahsusa, einer Mischung aus Geheim- und Guerillaorganisation, die im 295
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
In- und Ausland Spionage und Propaganda gegen Feinde des Osmanischen Reiches betrieb und außerdem für politische Attentate zuständig war. Nicht auszuschließen übrigens, dass Constens Sonderauftrag von dieser Organisation kam, die 1911 von Enver Pascha gegründet und wenige Tage nach dem Abschluss der geheimen Militärallianz mit dem Deutschen Reich, am 5. August 1914, dem osmanischen Kriegsministerium unterstellt worden war. Constens Interesse wendet sich nun also dem Balkan zu. Anfang Mai 1915 informiert er Botschafter von Wangenheim offiziell, „dass er auf Wunsch Enver Paschas in türkische Dienste getreten ist, um in geheimer Mission 523 nach Sofia entsandt zu werden“. Streit gibt es noch wegen der Einstellung der monatlichen Zahlungen des Auswärtigen Amtes, auf die Consten meint weiterhin Anspruch zu haben. Doch überwiegt bei ihm die ErleichteAbb. 15: „Major Hermann Consten rung, der unerquicklichen AuseinanBey“ in türkischer Uniform. dersetzung über seinen unverantwortKonstantinopel 1915 lichen Umgang mit Geldern, die ihm nicht gehörten, bald den Rücken zukehren zu können. Da Wangenheims Verhältnis zu Enver ohnehin schon länger nicht mehr das allerbeste ist, erscheint es dem Botschafter nicht opportun, zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen, indem er Constens Sondermission noch zu verhindern sucht. Über die Natur seines Geheimauftrags lassen sich nur Vermutungen anstellen. Angesichts der Vernichtung von Constens persönlichen Aufzeichnungen im Jahr 1945 und in Ermangelung einschlägiger Dokumente aus 296
3. „Major“ Constens Sondereinsatz für Enver Pascha
türkischen Archiven lässt sich nicht einmal feststellen, ob sich der für einsame Entscheidungen bekannte Enver mit seinen Kollegen im Komitee für Einheit und Fortschritt oder mit dem türkischen Generalstab über die Beauftragung Constens überhaupt verständigt hatte. Wahrscheinlich stand die geheime Mission in Zusammenhang mit den zähen Verhandlungen um den Kriegseintritt Bulgariens und Rumäniens an der Seite der Mittelmächte. Zeitweise hatte das Osmanische Reich seinen eigenen Kriegseintritt davon abhängig gemacht. Denn die Sorge war groß, dass die beiden BalkanStaaten sich zu Handlangern Russlands machen lassen und ihrerseits die Türkei angreifen könnten. Zu den Bedingungen Envers gehörte u.a. ein bulgarischer Entlastungsangriff auf Serbien, mit dem die totale Unterbrechung des Transports von Kriegsgütern aus Deutschland für die türkische Armee beendet werden konnte, anderenfalls drohte den Türken in Gallipoli ein Desaster. Die Regierung Radoslavov war zu einem Abkommen mit der osmanischen Regierung aber nur unter der Voraussetzung bereit, dass ihr Rumänien nicht in die Quere kommen und die türkische Seite ihr mit der Abtretung eines Landstreifens in Thrakien entlang der Maritza entgegenkommen würde. Damit waren wiederum Enver Pascha und Innenminister Talaat nicht einverstanden. Eine Aufgabe des rechten Maritza-Ufers oder gar beider Flussufer, wie zeitweise auch im Gespräch, hätte die Gefahr eines bulgarischen Angriffs auf die Stadt Adrianopel heraufbeschworen. Wangenheim teilte die türkische Auffassung, dass letztlich nur österreichische Konzessionen gegenüber Rumänien, wie die Abtretung des zu Ungarn gehörenden Landstrichs Transsylvanien, Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen bringen konnte. Dagegen sträubte sich wiederum Ungarn; Wien waren die Hände gebunden. Im Frühjahr 1915 hatte sich das Verhältnis zwischen Türken und Bulgaren krisenhaft zugespitzt. Die festgefahrenen Verhandlungen drohten wegen der bulgarischen Forderungen zu platzen. Die diplomatischen Vertreter des Deutschen Reiches und vor allem Österreich-Ungarns in Konstantinopel und Sofia versuchten, den aufgebrachten Enver Pascha zu besänftigen und die Bulgaren wenigstens zu einer kleinen Konzession an die Türken zu bewegen. Zu mehr als „wohlwollender Neutralität“ war die Regierung Radoslavov jedoch nicht bereit. In der Hinterhand hatte sie nämlich den 297
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Trumpf eines viel weitergehenden Angebots der Entente-Mächte auf Kosten der Türkei, falls Bulgarien sich ihnen anschlösse und einen russischen Vormarsch auf dem Balkan unterstützen würde. Da Consten bekanntlich fließend Russisch sprach, hatte er vermutlich den Auftrag erhalten, Informationen über die Aktivitäten russischer Agenten und Auskünfte über die Kriegsabsichten der Russen auf dem Balkan zu beschaffen sowie herauszufinden, inwieweit sie Bulgarien und Rumänien 524 schon auf ihre Seite zu ziehen vermochten. Auch ein Geheimauftrag im Zusammenhang mit der Unterstützung des bulgarischen Mazedonien-Komitees ist denkbar, in dem der in Constens Brief an Roselius erwähnte 525 Totchkoff eine führende Rolle spielte. Gegenüber dem deutschen Generalkonsul in Budapest, Graf Fürstenberg-Stammheim, gab Consten wenig 526 später an, er sei „für den türkischen Generalstab amtlich tätig“. Immerhin könnte Constens türkischer Majorsrang, mit dem er auch in Budapest öffentlich auftrat, die Richtigkeit der Angabe unterstreichen. Um den 10. Mai 1915 reist Hermann Consten, diesmal in unauffälliger Zivilkleidung, nach Sofia ab. Über seine Kontakte in der bulgarischen Hauptstadt ist näher nichts bekannt. Allzu ergiebig scheinen sie nicht gewesen zu sein, denn wenige Wochen später erhält er von Enver den Auftrag, seine Arbeit von Bukarest aus fortzusetzen. Also zieht er nach Rumänien um, wo er dem türkischen Militärbevollmächtigten Kadri Bey zuge527 teilt wird. Dort scheint er jedoch bald schon zusätzlich für deutsche Stellen tätig geworden zu sein. Angesiedelt beim Militärattaché des deutschen Konsulats in Bukarest, hatte die Abteilung IIIb im April 1915 in Rumänien mehrere „Geheime Kriegsnachrichtenstellen“ eingerichtet, darunter im Grenzort Jassy nahe Bessarabien und im Donauhafen Galatz an der Grenze zu Bulgarien. Zu Constens Aufgaben gehören nun die Einvernahme aus Russland ausgewiesener oder geflüchteter Deutscher und Österreicher über russische Truppenbewegungen. Das Herausfiltern von Spionen aus den an der rumänisch-russischen Grenze eintreffenden Zügen und den in Galatz einlaufenden Schiffen ist eine weitere Aufgabe. Es stellt sich jedoch schnell heraus, dass die Resultate eher dürftig sind. Außerdem erregt die Vernehmungstätigkeit deutscher Agenten an den ankommenden Zügen und Schiffen das Missfallen der rumänischen Grenzbeamten. Die meisten Deportierten sind nach dem überstürzten Verlassen des Zarenreiches, das vielen von 298
3. „Major“ Constens Sondereinsatz für Enver Pascha
ihnen längst zur Heimat geworden war, außerdem noch zu verschreckt, um sich gleich nach ihrer Ankunft erneut Kontrollen und Verhören zu unterziehen. So werden die Nachrichtenstellen in Rumänien im Sommer 1915 bereits wieder aufgelöst. Die „Flüchtlingsgespräche“ werden nach Dresden beziehungsweise nach Budapest verlegt. Vor allem in der ungarischen Hauptstadt ist die Atmosphäre viel entspannter; die magyarischen Bahnbeamten schauen dem internationalen Agententreiben auf ihren Bahnhöfen eher mit 528 kakanischer Gelassenheit zu. Hermann Consten geht mit nach Budapest. Offenbar tat er dies, ohne seinen Vorgesetzten Kadri Bey, geschweige denn Enver Pascha vorher von dem Ortswechsel zu unterrichten. Zunächst hat er wohl vor, nur wenige Tage zu bleiben. Bei der Übergabe seines ersten, auf einen offiziellen Briefbogen des Deutschen Generalkonsulats Budapest säuberlich mit der Hand geschriebenen Berichts, teilt er Generalkonsul von Fürstenberg mit, er werde sich noch einige Tage in Budapest aufhalten, die täglich durchreisenden Flüchtlinge aufsuchen und, falls diese interessante Mitteilungen über die Lage in Russland machen könnten, weiter berich529 ten. In der Annahme, er könne in Zukunft problemlos zwischen Budapest und Bukarest hin- und herpendeln und so gleich zwei, warum nicht auch drei Herren dienen – umgehend hat er sich nämlich auch dem „Evidenzbüro“ Österreich-Ungarns angeboten –, unterschätzt Hermann Consten die Türken. Sie erwarten seine ständige Verfügbarkeit vor Ort. Ungeachtet dessen kommen Constens Berichte ab Juli 1915 aus der ungarischen Hauptstadt. Am Budapester Ostbahnhof nimmt er die dort auf ihre Weiterreise nach Westen wartenden Russlanddeutschen in Empfang und führt sie in ein nahes Kaffeehaus, bei gutem Wetter auch in einem Fiaker ans Ufer der Donau. Später, nachdem er sich ein eigenes Büro eingerichtet hat, scheint ihm dieses als Gesprächsort sicherer vor eventuell mithörenden Feinden zu sein. Consten versteht es, als freundlicher Plauderer den Ankömmlingen ihre Nervosität zu nehmen, um dann allerhand Informationen über russische Truppenbewegungen, Rekrutierungen, den Ausbau von Eisenbahngleisen, die allgemeine Versorgungslage, Pogrome gegen Deutsche und Juden, Unruhen in grenznahen und fernen Provinzen, Meutereien von Soldaten und über das Schicksal der deutschen und österreichischen Kriegs- und Zivilgefangenen in Russland aus ihnen herauszuholen. 299
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Wer sich dabei als sperrig erweist oder gar aus seiner unverbrüchlichen Liebe zu Russland kein Hehl macht, gerät natürlich schnell in Verdacht, als Spion eingeschleust worden zu sein. Da kann der freundliche „Major Consten“ plötzlich auch ganz andere Saiten aufziehen. Gestern verhaftete ich hier auf dem Bahnhof eine russische Spionin, die sich unter den Ausgewiesenen befand. Auftrag: Sie soll sich mit anderen Spionen im Operationsgebiet in Verbindung setzen, dann entweder über Jassy nach Russland zurückkommen oder in Rumänien bleiben. […] Weitere Untersuchungen und Erhebungen sind im Gange. 530 gez. Hermann Consten jr.
Den Bekannten der verhafteten Frau, einen Polen, der im Zug sitzen geblieben war, lässt er wenige Stunden später durch die Bahnhofspolizei in Wien festnehmen. Eine junge Dame, fast noch ein Mädchen, hat es mit ihm ebenfalls verscherzt: Bitte an die betreffende Behörde in Karlsruhe/Baden ein Telegramm oder Mitteilung gelangen zu lassen etwa folgenden Inhalts: Heute kam hier mit den Ausgewiesenen aus Russland Fräulein Koeppen durch, die sich zu ihren Eltern nach Karlsruhe begibt. Fräulein Koeppen ist eine fanatische Russenfreundin und will, sobald sie großjährig ist, die russische Untertanenschaft erwerben, und zwar gegen den Willen der Eltern. Sie verweigerte hier jede Auskunft über russische Verhältnisse. Fräulein Koeppen ist bisher nicht spionageverdächtig, jedoch muss ihr gesamter Briefwechsel nach Russland scharf überwacht oder ganz unter531 drückt werden. gez. Hermann Consten jr.
Wo war, so fragt man sich verwundert, seine eigene Liebe zu Russland und den Russen geblieben? Die Erinnerungen an Moskau, an die Freunde, an verflossene Liebesaffären und schmerzlich-schöne Abschiede, wenn er wieder einmal für Monate in die Mongolei verschwand? An seine Lehrer vom Lazarev-Institut, Professor Anučin, Professor Miller? Seine vielen Reiseund Jagdbegegnungen, die gemeinsamen Ritte mit den sibirischen Kosaken und den russischen Goldgräbern in der Mongolei – bedeuteten sie ihm nichts mehr? Seine langen Gespräche mit dem Gesandten Korostovec in Urga, dessen Freundschaft er sich doch rühmte, dem er seine Liebe zu Russ300
3. „Major“ Constens Sondereinsatz für Enver Pascha
land sogar offen bekannt hatte – all dies schien wie ausgelöscht. Er besaß doch eine Wohnung in Moskau, voller russischer Bücher, Bilder und Möbel. Und erst seine mongolische Sammlung! Dies alles wollte er eines Tages, wenn der Krieg zuende war, doch wiedersehen! Danach sehnte er sich doch! Zehn wunderbare Jahre seines Zusammenlebens mit Russen hatte Hermann Consten in nur einem einzigen Kriegsjahr offenbar erfolgreich aus seinem Leben getilgt, verdrängt. Oder es war mit seiner Liebe zu Russland und seinen Menschen nie so weit her gewesen, wie er immer behaup tet hatte! Musste er ausgerechnet dieses Mädchen mit dem glühenden Herzen als „fanatische Russenfreundin“ denunzieren, sie deutschen Polizeibehörden und Zensoren ausliefern? Diskreditierte er damit nicht sich selbst? Doch im Eifer des Entlarvens echter und vermeintlicher Spione dürfte Consten wohl nicht den leisesten Gedanken daran verschwendet haben, was er dieser jungen Frau und letztlich sich selbst damit antat. Da sich die Sache mit den Flüchtlingsgesprächen gut anlässt, dazu gut bezahlt wird und er sich in Budapest schon fast wie zuhause fühlt, schert er sich immer weniger darum, dass er ja eigentlich bei den Türken unter Vertrag steht – bis ihn schließlich im August 1915 ein erzürnter Enver Pascha an seine eingegangene Verpflichtung erinnert. Er stellt ihn vor die Wahl, entweder unverzüglich nach Bukarest zurückzukehren oder den Dienst zu quittieren. Eher widerwillig kehrt „Major Consten“ einstweilen in die rumänische Hauptstadt zurück. Von seiner Rückberufung erfahren die deutschen Behörden erst einige Tage später durch einen über die Botschaft in Konstantinopel weitergeleiteten Alarm der Kollegen vom österreichischungarischen Nachrichtendienst. Sie waren nämlich von Consten – gegen gutes Honorar, versteht sich – mit denselben Flüchtlingsberichten beliefert worden, die er auch im deutschen Generalkonsulat übergeben hatte. Der k.u.k. Leutnant Aurel Ubel teilt im Auftrage des Generalstabschefs des Militärkommandos Budapest, Herrn Oberst v. Jankowitsch mit, Major Consten sei abberufen worden. Der von ihm geleitete Nachrichtendienst wurde dadurch zu ¾ lahmgelegt. Major Consten habe Jahre lang in Russland gelebt und verstehe es hervorragend gut, die Flüchtlinge (150 bis 200 täglich) unauffällig auszufragen. Major Consten sei deshalb fürs erste nahezu unentbehrlich. Bei den großen Schwierigkeiten, Nachrichten aus Russland zu erhalten, sei der Constensche Nachrichtendienst 301
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
eine der Hauptquellen. Es werde deshalb gebeten, wenn irgend möglich 532 Constens Abberufung rückgängig zu machen.
Für das k.u.k.-Militärkommando in Budapest schienen Constens Berichte weit wichtiger zu sein als für Berlin. Schließlich bekam Österreich-Ungarn die russische Bedrohung an seinen Grenzen ja auch viel direkter zu spüren als das Deutsche Reich. Generalkonsul von Fürstenberg kann Anfang September dem Auswärtigen Amt immerhin mitteilen, es seien Bemühungen 533 im Gange, Constens Abberufung rückgängig zu machen. In einem Telegrammentwurf des Auswärtigen Amtes an die Botschaft Konstantinopel ist der kleine Agent im Großen Krieg sogar zum „Hauptleiter des Nachrichten534 dienstes Budapest“ avanciert. Die Antwort aus Pera, wo Botschafter Fürst Hohenlohe, in Vertretung des erkrankten Barons Wangenheim, wohl wenig Gutes über Consten in Erfahrung brachte, bleibt bei den nüchternen Fakten. Consten sei in türkischen Diensten nach Bukarest geschickt worden, heißt es dort. Gegen den Befehl des Kriegsministeriums sei er nach Budapest gegangen. Die Türken hätten ihn nun vor die Alternative gestellt, zurückzukehren oder auszuscheiden. „Stelle anheim ihn zu letzterem veran535 lassen“, so Hohenlohe abschließend in seinem Telegramm. Das im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin aufbewahrte Dokument trägt noch einen aufschlussreichen handschriftlichen Randvermerk, den Legationsrat von Pannwitz zwei Tage später darauf notierte: Der St. Generalstab (Major Koenemann) hat erklärt, die Constenschen Berichte seien „nicht uninteressant“; besonderer Wert wird auf dieselben 536 jedoch nicht gelegt.
Mit anderen Worten, die Politische Abteilung des stellvertretenden Generalstabs in Berlin war auf Constens Berichte nicht sonderlich scharf. Und so landete die ganze Angelegenheit schließlich mit folgendem Vorschlag von Pannwitz wieder auf dem Schreibtisch des deutschen Generalkonsuls in Budapest: Obgleich die Constenschen Berichte auch für die hiesigen Stellen nicht uninteressant sind, wird doch anscheinend von den dortigen Behörden auf dieselben weitaus größerer Wert gelegt. Es muss daher den dortigen Stellen überlassen bleiben, sich entweder mit der türkischen Regierung 302
3. „Major“ Constens Sondereinsatz für Enver Pascha
wegen der Belassung Constens in Budapest ins Benehmen zu setzen oder 537 diesem vorzuschlagen, den türkischen Dienst zu quittieren.
Sollten doch die Ungarn und Österreicher selbst bei den türkischen Verbündeten vorstellig werden, wenn sie Consten unbedingt behalten wollten! Was sie vielleicht auch versucht haben. Consten selbst scheint aber das Dasein in Budapest als weitaus attraktiver empfunden zu haben. Er zog also nach nur vier Monaten einen Schlussstrich unter sein türkisches Engagement und beendete seinen Dienst für Enver Pascha. Inzwischen hatten die Türkei und Bulgarien schließlich doch noch eine Vereinbarung unterzeichnet, nachdem sich die Regierung in Sofia am 6. September offiziell auf die Seite der Mittelmächte gestellt hatte. Also waren seine Dienste auch nicht mehr so dringend gefragt. Mit leisem Bedauern, aber ohne Gewissensbisse zog er nun mit Sack und Pack von Bukarest nach Budapest. Seinen türkischen Majorsrang wie auch sein bulgarisches und rumänisches Informantennetz nahm er natürlich mit.
4. Als V-Mann in Budapest: „Etzel“ in feiner Gesellschaft Während im Oktober 1915 die Offensive gegen Serbien ihren Anfang nimmt und nach der Eroberung Belgrads im November die direkte Bahnverbindung nach Konstantinopel endlich wieder funktioniert, findet Hermann Consten, nach Wochen im Hotel, schließlich eine passende Wohnung in Bahnhofsnähe, in der er auch die „Nachrichtenstelle Budapest“ einrichtet. Von der Abteilung IIIb erhält er eine geheime Telefonnummer, 48-12 538 Nobud. Er ist wieder sein eigener Herr. Wenn er schon sein persönliches Schicksal nicht immer fest in der Hand hat, so genießt er nun das Gefühl, wenigstens ein bisschen Macht über fremde Schicksale ausüben zu können. Täglich wandert er zum Ostbahnhof hinüber, wo die Züge aus Ost- und Südosteuropa einlaufen, pickt sich die aus Russland ausgewiesenen Personen deutscher Herkunft aus der Menge, bewirtet sie mit Kaffee und Kuchen, stellt seine Fragen, macht sich Notizen und schreibt anschließend seine Tagesberichte. Dann geht er zum Deutschen Generalkonsulat, liefert seinen Report ab, der dort verschlüsselt und nach Berlin weitergeleitet werden soll. Anfangs schreibt er noch mit der Hand, doch schafft er sich schon bald eine Schreibmaschine an. Dies ist eine wesentliche Erleichterung seiner Ar-
303
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
beit, zumal da seine Berichte im Laufe des September und Oktober immer länger werden. Schon im Juli hatte Generalkonsul von Fürstenberg bei Reichskanzler von Bethmann Hollweg diskret angefragt, ob er denn an diesen Berichten 539 überhaupt interessiert sei. Doch bürdete ihm die Antwort eher zusätzliche Arbeit auf. Bethmann Hollweg war sehr wohl interessiert und bat außerdem darum, jeweils eine Kopie für die Oberste Heeresleitung gleich in Budapest auf den Weg zu bringen, statt dass sie erst in Berlin angefertigt werden musste. Fürstenberg war geradezu erleichtert, wenn er Consten mal für ein paar Tage nicht auftauchen sah; dieser Mann musste erst noch lernen, sich nicht so wichtig zu nehmen und sich kurz zu fassen, fand er. Hatte Consten im Juli bereits 13 Berichte mit insgesamt 37 handgeschriebenen Seiten abgeliefert, so waren es im August schon 18 mit Maschine geschriebene Berichte im Umfang von insgesamt etwa 70 Seiten gewesen. Im September verfertigte er sogar 20 Berichte mit insgesamt 95 Seiten. Erst ab Oktober wurde es etwas weniger. Nur noch zwölf maschinengeschriebene Berichte von insgesamt ca. 50 Seiten waren von dem Chiffrierbeamten des Konsulats schon wieder leichter zu bewältigen. Im November kamen etwa 540 genauso viele – doch im Dezember hörte die Flut der Berichte abrupt auf. Constens letzter Report datiert vom 6. Dezember 1915, darin gab er u.a. Informationen eines „nicht erprobten Vertrauensmanns“ über die Verstärkung der rumänischen Befestigungsanlagen an der Donau und Versuche der russischen Flotte weiter, in die rumänischen Donaugewässer einzudrin541 gen. War das Ergebnis der Flüchtlingsbefragungen einmal etwas dürftig, wartete Consten mit Agentengeschichten auf, die er entweder selbst observiert hatte oder sich telefonisch von Vertrauensleuten aus Jassy, Galatz oder Bukarest durchgeben ließ. Besonders ins Auge fiel dabei im August 1915 die Geschichte über einen angeblichen Deserteur der k.u.k.-Armee aus Budapest namens Schmidt, der sich schon seit geraumer Zeit in Jassy herumtrieb. Seit einigen Tagen drängt sich in auffallender Weise zwischen Rumänisch-Ungehni und Jassy ein junger Mann an die aus Russland eintreffenden Emigranten. Er ist gekleidet in einen dunkeln Anzug und trägt weißen Panama-Hut. Er spricht französisch. Der Mann versucht mit al304
4. Als V-Mann in Budapest: „Etzel“ in feiner Gesellschaft
len Mitteln die Leute auszufragen. Es besteht nun unsererseits Verdacht, dass dies der in Jassy im Hotel Bendera oder Binder Zimmer Nr. 29 wohnende Schmidt ist, alias Stoja, ehemaliger Oberleutnant im hiesigen 29. Regiment, der vor kurzem desertiert ist.
Da besagter Schmidt mit der von ihm in Budapest verhafteten Spionin in enger Verbindung gestanden habe und auch andere durchreisende Spione mit Geld und Instruktionen versorge, so Consten weiter, wäre es wohl angebracht, die in Jassy eintreffenden Emigranten durch das dortige Konsulat warnen zu lassen, „keinem Menschen irgendwelche Auskunft zu geben“. Schmidt habe sich auch noch im Hotel Rossija in Jassy eingemietet und 542 werde öfters mit einer Dame auf dem Bahnhof gesehen. Wenig später wusste Consten weitere Einzelheiten mitzuteilen, denn auch die besagte Dame schien ihm in Budapest in die Falle gegangen zu sein, eine aus Osteuropa stammende Frau namens Helene Rudich, Geburtsjahr 1885 und uneheliche Tochter eines Paares mit polnischen Namen. Nach der Eroberung Lembergs durch die Russen, so berichtete Consten in einem seiner längeren Geheimreports, habe sie die Stadt in Begleitung zweier hoher russischer Offiziere verlassen. Gemeinsam sei man nach Kiev gefahren, wo sie sich mehrmals mit dem Grafen Ignatiev getroffen habe, „der scheinbar jetzt die ganze politische und militärische Spionage leitet“. Dort habe sie den Auftrag erhalten, nach Lemberg zurückzukehren und sich an deutsche oder österreichische Stabsoffiziere heranzumachen. Vor ihrer Rückkehr nach Lemberg habe sie aber besagten Schmidt alias Stoja mehrmals in Jassy getroffen. Schmidt durchsuchte ihr Gepäck und vernichtete sämtliche bei ihr vorhandenen Papiere und Schriftstücke. Dann bekam sie den Auftrag, sich nach Lemberg zu begeben [und] während der Fahrt auf alle Truppenverschiebungen, Militärtransporte, Regimentsnummern achtzugeben. Aber im besonderen war sie beauftragt, die Bekanntschaft deutscher und österreichisch-ungarischer Stabsoffiziere zu suchen, um sich in Besitz der deutsch-österreichischen Aufmarschlinien zu setzen. Als sie Schmidt frug, wie sie das machen sollte, wurde ihr mitgeteilt, dass sie genauso handeln sollte wie ihre Kollegin, die in Czernowitz angeblich einen Stabsoffizier im Bette ermordete und sich dann im Besitze der Pläne setz305
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
te [sic!]. Für jeden Plan wurden ihr 100.000 Rubel versprochen, für jede 543 Regimentsnummer 5.000 Rubel.
Für den Fall, dass Rumänien innerhalb von drei Wochen auf die Seite der Zentralmächte treten würde, so zitierte Consten die Angaben der Frau weiter, würde sich Schmidt nach Bulgarien oder der Schweiz begeben. Consten schloss seine Schmidt-Geschichte mit der Bemerkung: Schmidt wohnt immer noch Hotel Binder Zimmer 29 in Jassy. Er will, damit der große Verkehr bei ihm nicht auffällt, das Parterre des Hotels zu einem Restaurant einrichten.
Für die Generalstäbler in Berlin und an der Ostfront vermutlich interessanter als diese drittklassige Agentenaffäre dürften Informationen Constens über Vorgänge hinter der russischen Front gewesen sein, zum Beispiel eine Meldung vom November, welche die Kommando-Übernahme der auf 350.000 Mann verstärkten Bessarabien-Armee durch General Kuropatkin bestätigte. Auch die Ausladung russischer Geschütze im rumänischen Schwarzmeerhafen Reni oder die Eröffnung eines russischen Konsulats im rumänischen Giurgiu unmittelbar an der Grenze zu Bulgarien waren von 544 einigem Belang. Hilfreich dürften ferner Angaben über Bewegungen russischer Kriegsschiffe auf dem Schwarzen Meer, die Mannschaftsstärke der Festung Sevastopol, die dortige Flugzeugproduktion oder über den Bau von neuen Torpedobooten in der Schiffswerft am Pruth gewesen sein. Angaben wie diese hatte Consten Ende November von einer aus Russland ausgewiesenen deutschen Lehrerin erhalten, die im Haus des Bruders eines Ministers 545 im südrussischen Nikolaev die Kinder unterrichtet hatte. An Bethmann Hollweg schickte Consten noch einen ausführlichen Bericht über die Lage der Polen, die vor den deutschen Truppen nach Russ land geflohen waren. Sie hatten in Moskau eine Hilfsorganisation gegründet, die auch polnische Flüchtlinge österreichischer oder deutscher Staatsangehörigkeit versorgte. Das Komitee Dom Polski (Polnisches Haus) betreue insgesamt etwa 200.000 Flüchtlinge und werde von der russischen Regierung finanziell unterstützt, berichtete er. Die Menschen erhielten nicht nur kostenlose Unterkunft und Verpflegung, sondern auch Kleidung und Rechtsschutz. Für die Kinder habe man Schulunterricht organisiert. Auch ein Krankenhaus gebe es; sein Leiter sei ein Dr. Elias aus Lemberg. Und die 306
4. Als V-Mann in Budapest: „Etzel“ in feiner Gesellschaft
ehemalige deutsche Kirche werde jetzt von den Polen genutzt. Trotzdem sei die Stimmung dort so, dass alle Flüchtlinge am liebsten in das Okkupationsgebiet zurückkehren möchten. Alle sind von einem großen Hass gegen Russland erfüllt. Sie träumen und arbeiten auf die Gründung eines eigenen Königreichs Polen, auf Kosten Deutschlands, Österreichs und Russlands hin [,] unter dem Protektorat Englands.
Dann gibt Consten noch einen Satz seines Informanten wieder, der künftigen Entwicklungen vorzugreifen scheint: Im Polnischen Komité herrscht die Meinung, dass in dem Falle, da die russische Regierung in Friedensverhandlungen eintreten würde, in Mos546 kau die Revolution ausbricht.
Besaßen Constens Agentenberichte während der Sommermonate 1915 noch eine persönliche Note und vermittelten einen recht lebendigen Eindruck von den Ereignissen in Russland, so änderte sich ihr Stil mit der Anschaf fung der Schreibmaschine. Etwa ab Oktober verfasste er die Berichte geschäftsmäßig knapp und kühl, gliederte sie nach Sachgebieten und lieferte einen gesonderten militärischen Teil. Vermutlich hatte die Oberste Heeresleitung ihm entsprechende Anweisung gegeben. Er musste sich also beim Abfassen seiner Berichte mehr Selbstdisziplin abverlangen, arbeitete ab nun aber offensichtlich zur vollen Zufriedenheit seiner Auftraggeber. Mit Beginn der Kämpfe in Serbien und der Frage, wie Russland auf die veränderte Kriegslage auf dem Balkan, vor allem auf den Kriegseintritt Bulgariens reagieren würde, nahm ab Anfang Oktober das Interesse der deutschen Generalität an Constens Informationen aus Russland spürbar zu. Der Berliner Nachrichtenoffizier der Obersten Heeresleitung telegrafierte dem Chiffrierbüro des Auswärtigen Amtes, es möge das nachstehende Telegramm verschlüsselt an den Kaiserlich Deutschen Generalkonsul in Budapest schicken: Nachrichtenoffizier Berlin 4994 für Consten Kolon dortige Vernehmung der Rückwanderer über beobachtete Truppentransporte und starke Anhäufung von Truppen an bestimmten Orten in Russland von größter Wichtigkeit Punkt diese Angaben umgehend telegraphisch melden Punkt 307
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Ergänzungen und alle anderen Angaben schriftlich wie bisher Punkt 547 Schluss.
Nicht so begeistert dürfte Consten wenig später allerdings über eine von oben verordnete Änderung seiner bisher weitgehend selbstständigen Arbeitsweise gewesen sein. Anfang Dezember nämlich setzt ihm Major Walter Nicolai, der Chef der Abteilung IIIb, im Zuge einer umfassenden administrativen Neuordnung des inzwischen personell stark angewachsenen, zum Teil aneinander vorbei oder gar gegeneinander arbeitenden militärischen Nachrichtenwesens, einen Nachrichtenoffizier vor die Nase und stuft ihn zum schlichten V-Mann herab. Hauptmann Hanns Gobsch, von Dresden nach Budapest versetzt, übernimmt die Federführung über Constens Nachrichtenstelle und die ebenfalls in Budapest angesiedelte „Deutsche Überwachungsstelle“, ein Posten der für die Spionageabwehr zuständigen geheimen Feldpolizei. „Der bisher daselbst tätige Vertrauensmann Consten wurde ihm unterstellt“, heißt es dazu lapidar im sogenannten „Gempp-Bericht“ über den geheimen Nachrichtendienst und die Spionageabwehr im 548 Ersten Weltkrieg. Hauptmann Gobsch, dem die bisherigen Befragungen viel zu lax und widersprüchlich waren, lässt diese jetzt streng nach den Dresdner Kriterien durchführen. Er führt Fragebögen für die Verhöre, Leistungsnachweise für Agenten und V-Leute ein. Sicher gehörte er auch zu denen, die Consten insgeheim, später auch ziemlich unverblümt unterstellten, er habe in seinen farbigen Russland-Berichten auch schon mal der eigenen Phantasie die Zügel schießen lassen. Allerdings kommt Gobsch ausgerechnet zu einer Zeit nach Budapest, da die Zahl der Rückwanderer spürbar abnimmt und mit Beginn des Jahres 1916 der Strom praktisch ganz versiegt. Die Russen hatten inzwischen nämlich gemerkt, dass sie mit den Massenausweisungen reichsdeutscher Bürger aus Russland selbst die Bresche geschlagen hatten, durch die geheime Informationen aller Art praktisch ungehindert nach Westen gelangten. Dieses Loch hatten sie schließlich gestopft. Die noch in Russland verbliebenen Reichsdeutschen wurden nun, teilweise gewaltsam, an der Ausreise gehindert. Dem deutschen Nachrichtendienst wird sich vermutlich kaum eine zweite derartige Nachrichtenquelle wieder erschlossen haben, die es erlaubte, 308
4. Als V-Mann in Budapest: „Etzel“ in feiner Gesellschaft
täglich und viele Monate hindurch auf diese Weise über das innere Leben eines feindlichen Landes Aufklärung zu erlangen,
so Gempp in seinem, erst zwischen 1928 und 1944 für die Abwehrabteilung des Reichskriegsministeriums verfassten, insgesamt 11 Bände umfassenden 549 Bericht. Und „Major Consten“ – für die Crème der Nachrichtenoffiziere von IIIb nur der unbedeutende Budapester V-Mann „Herr Consten“? Er schaut sich die neue Situation mit einem Militärbürokraten als direktem Vorgesetzten nicht lange an. Mit dem Nikolaustag des Jahres 1915 stellt er seine Berichterstattung über die Flüchtlingsaussagen ein und nimmt erst einmal einen längeren Heimaturlaub. Zunächst fährt er nach Berlin, um sich nach einer neuen Aufgabe bei IIIb umzusehen, dann weiter nach Aachen. Das Weihnachtsfest 1915 und den Jahreswechsel verbringt er bei Theo Dahme und Cousine Mie, schaut auch im Haus am Kölntor bei der Stiefmutter, den inzwischen groß gewordenen Halbgeschwistern und Bruder Franz herein, erfährt vom Soldatentod seines zweiten leiblichen Bruders Willy, der in Frankreich blieb. Nicht nur der Tod des Bruders drückt auf die Weihnachtsstimmung der Familie Consten, auch die Geschäfte der Adler Brenn- und Brauerei gehen immer schlechter. Wegen akuter Lieferengpässe bei Braugerste, Malz und Weizen musste Bruder Franz die Produktion von Bier und Schnaps erheblich zurückfahren. Viele Stammgäste sind zu den Waffen gerufen, so manche bereits irgendwo in Frankreich oder an der Ostfront gefallen, etliche vermisst oder in Gefangenschaft geraten. Außerdem ruht der Restaurantbetrieb weitgehend. Frische Lebensmittel sind kaum noch zu bekommen, Essensgäste bleiben aus, man muss Personal entlassen. Aachens Industrie leidet, wie in anderen Teilen des Deutschen Reiches auch, unter Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen und Arbeitskräftemangel. Durch die Einberufungen freigewordene Arbeitsplätze werden notgedrungen mit Frauen oder mit russischen Kriegsgefangenen besetzt. In den Alsdorfer Kohlegruben müssen die schlecht behandelten und unterernährten Elends550 gestalten sogar unter Tage arbeiten. Über seine eigenen Erlebnisse seit seinem Weggang aus Deutschland berichtet Hermann Consten auffallend wenig. Diesmal wartet er nicht wie sonst mit wilden Abenteuergeschichten auf, sondern bleibt eher wortkarg. Schließlich ist er Geheimnisträger. So wissen Verwandte und Freunde am 309
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Ende nicht mehr von seinen Kriegsaktivitäten als dass er in Enver Paschas Dienste getreten war, einen türkischen Majorsrang besitzt, dass es ihn bis 551 Mesopotamien verschlagen hat und dass er nun in Budapest lebt. Überall, wo er während seines Heimaturlaubs hinkommt, spürt Consten, dass sich Bedrückung breitgemacht hat. Von der begeisterten Siegesgewissheit des Sommers 1914 ist nichts geblieben. Die Versorgungslage hat sich dramatisch verschlechtert, seit die Importe aus dem Ausland wegbleiben. Heizmaterial und Lebensmittel sind rationiert, vor allem Brot, Butter, Milch, Eier, Fleisch und Speiseöl sind knapp und teuer. Durch Aachens Nähe zur holländischen Grenze lässt sich das eine oder andere immerhin noch schmuggeln, aber man darf sich nicht von den Beamten der Grenzüberwachung er552 wischen lassen, die überall im Dreiländereck verschärft wurde. Zwischen Aachen und Vaalserquartier wird an einem elektrisch geladenen Metallzaun gearbeitet, der in Zukunft jeden Durchschlupf ins neutral gebliebene Nachbarland ganz unterbinden soll. Auch die Firma Mannesmann Mulag bleibt von Schicksalsschlägen nicht verschont, obwohl immerhin die Produktion bei ihr ungehindert weiterläuft – sie beliefert nun fast ausschließlich das Heer. Max Mannesmann hatte eine ganze Reihe neuer militärtauglicher Erfindungen, darunter einen Lazarettwagen für Verwundetentransporte, Flugzeugmotoren u.ä. gleich 553 nach Kriegsbeginn in München patentieren lassen. Aus dem Schriftverkehr zwischen den Brüdern Max und Reinhard Mannesmann geht hervor, dass die Kriegsaufträge für Mulag durch das Berliner Büro MannesmannRoselius hereingeholt wurden. Vermutlich lief die Verbindung über Alfred Mannesmann, Leiter des Röhrenwerkes in Komotau, der während des Krieges Hauptmann im Deutschen Generalstab war. Für die Produktion der Verwundeten-Anhänger zum Beispiel hatte Mannesmann Mulag im Oktober 1914 bei der Generalkriegskasse einen Vorschuss von 500.000 Reichsmark beantragt. Dieser war zunächst abgelehnt worden, weil der Antrag nicht über das Kriegsministerium gelaufen war. Doch konnte Reinhard Mannesmann nach Rücksprache bei der Inspektion des Militärischen Luft554 und Kraftfahrwesens den Antrag erneut stellen, diesmal mit Erfolg. Er ließ auch seine Beziehungen spielen, um für Mulag ein Automobilwerk in Széged und eine Reparaturwerkstätte in Sofia errichten zu können. Neben Fahrzeugmotoren, Lastwagen und den Verwundeten-Anhängern baut 310
4. Als V-Mann in Budapest: „Etzel“ in feiner Gesellschaft
Mannesmann Mulag nun Flugzeugmotoren und Motorpflüge. Militärische Entwicklungen liefern auch die Mannesmann Waffen- und Munitionswer555 ke in Remscheid. Die Mannesmanns gehören also zu denen, die am Krieg kräftig verdienen. Doch während eines Transports von Verwundetenwagen, den Max Mannesmann 1915 an die Westfront begleitete, hatte er sich in Frankreich eine Lungenentzündung zugezogen. An ihr starb er, 57-jährig, kurz nach 556 seiner Rückkehr nach Aachen, im März 1915. Der zweite Schock traf das Unternehmen, als Bruder Otto Mannesmann, der als Konsul in Nordafrika u.a. auch für die Abteilung IIIb arbeitete, ebenfalls 1915 während eines Erkundungsritts in der Nähe von Tripolis erschossen wurde – ein Schicksal, das auch Hermann Consten während der Afghanistan-Expedition jederzeit hätte ereilen können. Chef des Aachener Betriebs ist nun Reinhard Mannesmann. Dass Hermann Consten ihn während seines Heimaturlaubs in Berlin, Remscheid oder Aachen aufgesucht hat, ist anzunehmen, denn ein gewisser „Major Reimann“, der ab 1915 für die Mannesmanns in Ungarn und auf dem Balkan tätig war und Ausschau nach Möglichkeiten für Landerwerb, Landwirtschaftsbetriebe und Industrieansiedlungen hielt, die nach einem eventuellen Friedensschluss neue Geschäftsfelder für den Konzern eröffnen sollten, dürfte wohl niemand anderer als Consten gewesen sein. Schließlich brauchte er für seine geheime Tätigkeit in Budapest nach außen 557 hin einen unverdächtigen bürgerlichen Existenznachweis. Ende Januar 1916 kehrt er in die ungarische Hauptstadt zurück, im Koffer das halbfertige Manuskript des schon länger geplanten Buches über die Mongolei. Dieses möchte er nun langsam zuende schreiben. Er hat ja wieder mehr Zeit. Das polyglotte Budapest mit seinen zahlreichen Buch- und Zeitungsverlagen, seiner lebhaften Intellektuellen- und Künstlerszene scheint ein geeigneter Ort zu sein, sein Buch zu veröffentlichen. Bei den Ungarn, denen er im Laufe des Jahres 1915 begegnet war, hatte Consten bereits ein erfreulich großes Interesse an Geschichte und Gegenwart Zentralasiens feststellen können. Außerdem verhilft ihm die Stadt, in der es von Literaten und Journalisten nur so wimmelt, dazu, sich selbst nach außen hin ebenfalls als ein Vertreter der schreibenden Zunft zu geben und somit einen guten Grund zu haben, Informationen aller Art zu sammeln. So kann er ziemlich unbefangen auch weiter für die deutsche Abwehr tätig 311
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
sein. Consten hält sich nunmehr für „Sonderaufgaben“ der politischen Sektion der Abteilung IIIb bereit. Eines Tages sucht er die Redaktionsräume des Tageblatts Budapesti 558 Hirlap auf. Dessen Chefredakteur, Jenö Rákosi, hatte schon vor einiger Zeit Interesse an Artikeln des Zentralasienkenners Hermann Consten über die Mongolei bekundet. Die Bekanntschaft mit Rákosi erweist sich als anregend und fruchtbar. Consten dürfte die Begegnung im Nachhinein gar als schicksalhaft bezeichnet haben. Denn sie öffnet ihm in Budapest wichtige Türen. Die beiden Herren konstatieren erfreut ähnliche Interessen und politische Überzeugungen. Rákosi, donauschwäbischer Herkunft (sein ursprünglicher Name war Eugen Kremsner), gehört zu der Gruppe der Ungarndeutschen, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts, als der magyarische Nationalismus mit Volkshelden wie Lájos Kossuth und Sándor Petöfi auflebte, aus freien Stücken assimilierten und geradezu glühend fanatische Magyaren wurden – bis hin zur Verleugnung ihrer deutschen Herkunft und 559 ihrer Muttersprache. Auf der Suche nach den ethnischen Wurzeln des Magyarentums entwickelten Rákosi und seine Gesinnungsfreunde ein wissenschaftliches, seit Kriegsbeginn allerdings zunehmend von chauvinistischen und rassistischen Untertönen begleitetes Konstrukt, das sie Turán nannten. Gemeint war damit ein mythisches, einst von den Hunnen beherrschtes Reich im Herzen 560 Asiens, dem alle turanischen Ethnien entsprungen sein sollen. Diese sollten sich später über ganz Eurasien ausbreiten – von Finnland und Estland über Ungarn, die Türkei und den Kaukasus, und weiter hinaus über Afghanistan, Persien, Indien, Tibet bis nach China und Japan. Ihre Theorie untermauerten sie nicht so sehr linguistisch; sie wählten vielmehr einen „moderneren“ Ansatz, wie ihn auch Hermann Consten zehn Jahre zuvor während seines Studiums in Moskau kennengelernt hatte: den der Anthropologie, der Ethnographie und der Geographie. Ihre tiefste Verehrung galt Attila, dem sagenhaften Hunnenkönig aus dem 5. nachchristlichen Jahrhundert, der den Deutschen aus der Nibelungensage als Etzel vertraut ist. Rákosi gehört, wie sich im Gespräch mit Consten herausschält, nicht nur dem Magnatenhaus des Ungarischen Parlaments an, er ist auch führendes Mitglied einer in Budapest ansässigen „Turanischen Gesellschaft“, die vor allem im Hochadel eine Reihe einflussreicher Anhänger und Kenner 312
4. Als V-Mann in Budapest: „Etzel“ in feiner Gesellschaft
besitzt. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe von Publikationen und Vorträgen ein interessiertes Publikum auf die Zugehörigkeit der Ungarn zu den turanischen Ethnien aufmerksam zu machen. Ähnlich wie die Deutsch561 Asiatische Gesellschaft in Berlin, plant sie aber auch, den ökonomischen Drang Ungarns nach Osten vorzubereiten und der magyarischen Wirtschaft im Kampf mit der deutschen Konkurrenz im Orient zur Seite zu ste562 hen. Galten die Turaner vor dem Krieg als eher versponnene Träumer, so ist in einer Zeit, da Ungarn als Teilstaat der Doppelmonarchie an der Seite seines alten Verbündeten Deutschland und der neu hinzugekommenen Allianzpartner Türkei und Bulgarien gegen Russland kämpft, plötzlich das Interesse da. Die „Turanische Gesellschaft“ erhält Zulauf, staatliche Zuschüsse, gibt sich mit „Ungarisch-östliches Kulturzentrum“ (Magyar Keleti Kultúrközpont) einen weniger befremdlichen Namen. Neben der bekannten Vortragstätigkeit propagiert der Verein seine Ideen nun sogar im Schulunterricht und bietet Kurse in turanischen Sprachen, sogar in Japanisch an. Außerdem entwickelt er Pläne zur Gründung eines Orientalischen Instituts und der Schaffung eines Lehrstuhls für Orientalistik an der Budapester 563 Universität. Besonders aber produzieren einige seiner Mitglieder, ausgehend vom Weltkriegsgeschehen, politische Welteroberungsphantasien, die – sieht man vom religiösen Moment einmal ab – denen der „Jihadisten“ um Max von Oppenheim in Berlin oder den pan-turanischen Ideen der Jungtürken um Enver Pascha nicht unähnlich sind. Man träumt von einer dauerhaften Verbindung der turanischen mit den germanischen Staaten, die sozusagen gemeinsam einen Ring um Russland bilden, es einkreisen und vernichten könnten. Denn dann, so meinen sie, wären auch die turanischen Völker im Kaukasus, in Russisch-Mittelasien und in Sibirien in der Lage, das „slawische Joch“ abzuschütteln. Mit solchen Vorstellungen drohten die seriösen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Forschungsergebnisse allerdings mehr und mehr in den Sog einer abgehobenen politischen Utopie zu geraten, die mit den Realitäten der geostrategischen Verhältnisse und des Kriegsverlaufs nichts mehr gemein hatte. Zum Thema gemeinsamer kommerzieller deutsch-ungarischer Expansionen nach Osten steuerte Hermann Consten im Budapesti Hirlap einige längere Artikel bei, die ihre geistige Herkunft aus dem Büro Mannesmann-Roselius kaum verleugnen konnten. Sie wur313
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
den, wenn diesbezügliche Nachforschungen des linksliberalen ungarischen Politikers Mihály Graf Károlyi zutreffend waren, von der deutschen Hee564 resleitung, genauer von ihrer Nachrichtenabteilung IIIb, finanziert. Für Hermann Consten ist die „Turanische Gesellschaft“ von großer Wichtigkeit. Seine Kenntnisse und Erfahrungen, Zentralasien und besonders die Mongolei aus langjähriger persönlicher Anschauung betreffend, dazu sein enger Kontakt mit Enver Pascha, selbst ein Verfechter pan-tura565 nischer Ideen und Pläne, und darüber hinaus seine intime Bekanntschaft mit dem Gegenpart Russland stoßen in diesem Kreis auf ganz besonderes Interesse. Rákosi stellt Consten bei einer Abendveranstaltung dem Präsi566 denten der „Turanischen Gesellschaft“, Pál Graf Teleki de Szék vor. Teleki, aus transsylvanischem Adel stammend, ist einer der bekanntesten Geographen seiner Zeit, Professor und Mitglied der Königlich Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Generalsekretär der Ungarischen Geographischen Gesellschaft, Sozio-Ökonom. 1910 hatte Teleki die erste ethnographische Karte Ungarns veröffentlicht. Sie beruhte auf aktuellen Daten der im gleichen Jahr durchgeführten Volkszählung und gab Aufschluss über Streuung, Ballungsgebiete und prozentuale Anteile der jeweiligen Ethnien, Sprachen und Konfessionen im Vielvölkerstaat Ungarn. Von ihnen, dies sei am Rande vermerkt, beanspruchten die etwa 50 Prozent Magyaren die Suprematie über die anderen Ethnien und übten sie auch rücksichtslos aus. Es dürfte wohl Teleki gewesen sein, der Hermann Consten in die feine Budapester Gesellschaft einführte und ihm damit die Türen der Palais und Schlösser der großen Magnatenfamilien der ungarischen Monarchie öffnete. In dieser aristokratischen Atmosphäre blühte Consten förmlich auf. Rasch wurde er ein gern gesehener Gast bei Vortragsveranstaltungen, Abendessen und Festlichkeiten aller Art. Er hielt Vorträge in Budapest und verbrachte so manches Wochenende auf den Landsitzen des ungarischen Hochadels. Unvergesslich blieben ihm im Spätherbst 1916 herrliche Tage in Südungarn. Im Károlyi-Kastély, dem neobarocken Jagdschloss des Buda567 pester Bankiers Imre Graf Károlyi in Nagymagocs, genoss er Jagdfreuden in den ausgedehnten Wäldern des Grafen, Ausritte in das Hügelland an der Theiß und über die weiten Ebenen der Puszta. Damenflirts und abendliche Gesprächsrunden unter Männern am Kamin schlossen sich an. Hier fühlte er sich ganz in seinem Element. Er machte Eindruck mit seinem Erzählta314
4. Als V-Mann in Budapest: „Etzel“ in feiner Gesellschaft
lent und vergaß für Stunden, dass noch immer Krieg herrschte. Bei einer dieser geselligen Zusammenkünfte, als die neugewonnenen ungarischen Freunde wieder einmal fasziniert seinen mongolischen Reiseabenteuern und Jagdgeschichten gelauscht hatten, die Hermann Consten höchst farbig und lebendig auszuschmücken verstand, fand man zu vorgerückter Stunde endlich auch den passenden Spitznamen für ihn. Er gefiel ihm selbst so gut, dass er ihn nie wieder abgelegt hat. Von nun an war Hermann Consten für seine Freunde nur noch „Etzel“. Dieser in seinen linguistischen wie auch geographischen und geschichtlichen Bedeutungen geradezu schmeißfliegenhaft schillernde Beiname konnte passender wirklich nicht sein. Schon im 19. Jahrhundert hatte sich eine ganze Generation von Sprachgelehrten, unter ihnen auch der von Goethe überaus geschätzte Joseph von Hammer-Purgstall, an der Etymologie des Namens des berühmt-berüchtigten Hunnenkönigs Attila abgearbeitet. Vermuteten die einen eine kalmückisch-mongolische oder türkische Herkunft, so beharrten andere auf ostiranischen oder gar germanischen Wurzeln. Brachten die einen ihn in einen magisch-symbolischen Zusammenhang mit Flussnamen – die kalmückische Bezeichnung für die Wolga lautete z.B. atil – „breiter Fluss“, so vermuteten andere einen Helden- oder Herrschertitel, wie ostiranisch ätar – Held. Wilhelm Grimm steuerte eine Diminuitiv-Ableitung von atta – Vater bei; aus seinem „Väterchen“ wurde bei Joseph Marquardt ein aus dem Bulgarischen stammender „Vaterssohn“. Auch Übersetzungen als „Hundszunge“ oder „Pferdezunge“ (von türkisch attilas, germanisiert ad-dil) waren im Schwange. Jedoch sollte es dem 20. Jahrhundert, genauer: der schlimmen Hunnenrede Kaiser Wilhelms II. vorbehalten bleiben, den mit dem Namen Attila/Etzel verbundenen Deutungen und Assoziationen im Zusammenhang mit dem Auftreten des Deutschen Reiches in der Welt eine barbarisch-aggressive politische Konnotation zu verleihen. Bezogen auf Hermann Consten, von nun an auch „Etzel“ genannt, gerät das gesamte Bedeutungsspektrum dieses Namens gleichzeitig in Schwingungen. Er war Etzel, zugleich aber auch dessen Karikatur. Er war „Hundszunge“, zugleich aber auch „Held“ – wenn zugegebenermaßen ein Held eher zweifelhafter Natur. Er war Zentralasien eng verbunden, zugleich aber auch deutschnational und kaisertreu bis in die Knochen. Seit er sich mit dem Namen „Etzel“ schmücken konnte, schreckte Her315
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
mann Consten anscheinend vor nichts mehr zurück – nicht einmal vor einer heimlichen deutsch-ungarischen Romanze, die bis heute Rätsel aufgibt. Im geselligen Kreis der ungarischen Zentralasienfreunde, soviel immerhin lässt sich sagen, sollte er der Frau begegnen, die seine große Liebe wurde: Emma Gräfin K., schätzungsweise Mitte bis Ende Zwanzig, strahlend schön, intelligent, sportlich, ohne Allüren. Es ging etwas Burschikoses von der jungen Gräfin aus. Groß und schlank war sie, hatte dichtes dunkles Haar, dunkelbraune kluge Augen, Grübchen in den Wangen. Ihr Charme, ihr Temperament, ihre Natürlichkeit ließen „Etzel“ Consten nicht mehr los. Und – er sollte es zehn Jahre später noch seinem Tagebuch anvertrauen – 568 sie kannte die Mongolei! Natürlich konnte sie reiten wie der Teufel. Kurz, sie war „eine Frau zum Pferdestehlen“; sie war die schöne Prinzessin seiner kindlichen Allmachtsphantasien von einst. EE – Emma und Etzel? Ein völlig unmöglicher Traum! Das einzige noch vorhandene Foto in Hermann Constens Nachlass, auf dem die ungarische Gräfin im Kreis anderer Freunde an seiner Seite zu sehen ist, weist auf der Rückseite, von seiner Hand zart mit Bleistift geschrieben, die beiden Initialen EE auf. In der Constenschen Familienüberlieferung wird erzählt, sie sei eine Gräfin Esterházy gewesen. Ob dies zutrifft, lässt sich auch nach intensiven Recherchen nicht eindeutig klären. Vieles spricht eher dafür, dass sie aus einer der anderen Familien stammte, mit denen Hermann Consten über 569 die „Turanische Gesellschaft“ in freundschaftlichem Kontakt war. Consten selbst erwähnte in seinem mongolischen Reisetagebuch von 1928/29 gelegentlich ihren Vornamen: Emma, Emmy, oder auch zärtlich Emmele. Also vielleicht doch EE = Emma Gräfin Esterházy? Alle Spuren, die zu ihr führen könnten, hat Consten zu tilgen versucht, nachdem sie ihn Anfang 1927 verließ. Sie gehörte, dies war schon bei ihrer ersten Begegnung im Kriegsjahr 1916 klar, nicht zu den Frauen, die er mit seinem üblichen Macho-Gehabe und zweideutigen Komplimenten beeindrucken konnte. Vielleicht lag es ja daran, dass sie verheiratet war und kleine Kinder hatte, weshalb ihn bei ihrem Anblick wieder diese ungewohnte Scheu befiel. Er, Hermann Consten jr., Sohn eines Schnapsfabrikanten aus Aachen, wer war er denn schon? Ein in die Jahre gekommener Junggeselle, allmählich auf die Vierzig zugehend. Eigentlich ein gescheiterter Mann, der ein fragwürdiges Doppelleben 316
4. Als V-Mann in Budapest: „Etzel“ in feiner Gesellschaft
führte. Dazu noch kurzbeinig, mindestens einen Kopf kleiner als sie. Erstmals missfielen ihm, als er sich morgens beim Rasieren im Spiegel betrachtete, seine ausdrucklosen wasserhellen Augen, sein leichter Silberblick, der ihn seit seiner Jugend zwang, eine Brille zu tragen, dazu die scheußlichen Schmisse in seinem Gesicht. Einige Falten um die Augen hatte er auch schon, und sein krauses Haar wurde allmählich grau. Er war längst nicht mehr der „schwarze Consten“, der jungen Damen den Kopf verdrehte. Höchstens politisch traf diese Bezeichnung auf ihn zu, von seiner „schwarzen Seele“ ganz zu schweigen. Ein schwarzer Etzel war er, der sich insgeheim im zwielichtigen Agentenmilieu bewegte. Nichts gab es also, auf das er stolz sein konnte. Außerdem war er bürgerlicher Herkunft und, verglichen mit dem immensen Reichtum des ungarischen Hochadels, nicht sonderlich vermögend. Was hatte er einer Frau wie Emma, hohen Standes, außerdem längst einem anderen Mann ehelich verbunden, denn zu bieten? Wie konnte er überhaupt ihre Aufmerksamkeit, geschweige denn ihre Liebe gewinnen? Ein unverbindlicher freundschaftlicher Kontakt, gelegentlich ein gemeinsamer Ausritt oder ein Essen in Gesellschaft Dritter war doch das äußerste, das er sich je erhoffen konnte. Keiner der preußischen Nachrichtenoffiziere, mit denen er dienstlich zu tun hatte, würde je mit ihm privat verkehren, geschweige denn eine persönliche Freundschaft eingehen. Ihre „Standesehre“ 570 würde es ihnen verbieten. Würde diese wunderbare, diese unglaubliche Frau ihn jemals wieder grüßen, wenn sie wüsste, dass er als Geheimagent in Budapest eigentlich ein Aussätziger war, der schmutzige Geschäfte erledigte? Bei all diesen düsteren Gedanken dürfte ihm, erstmals vielleicht, seine Einsamkeit bewusst geworden sein. Ihn mag sogar ein Anflug von Selbstmitleid überkommen haben. Alle diese Zweifel und Fragen jedoch scheint sie, die junge Gräfin, auf ihre Weise beantwortet zu haben. Anders ist nicht zu erklären, dass die beiden ein Paar wurden. Zunächst einmal drängen die harten Realitäten seine Liebesnöte in den Hintergrund. Hermann Consten wird wieder gebraucht. Die Oberste Heeresleitung hat ihn inzwischen der Nachrichten-Abteilung der deutschen 571 Südarmee in Bukarest zugeteilt. Der Auftrag lautet, die rumänischen Rüstungsanstrengungen und russische Aktivitäten in Rumänien zu beobachten. Man rechnet nicht mehr damit, das Königreich Rumänien auf die 317
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Seite der Mittelmächte zu ziehen, sondern geht von dem baldigen Beitritt Bukarests zur Entente und damit von einer weiteren Eskalation des Weltkrieges aus. Die Entwicklungen im Westen, die monatelangen Materialschlachten bei Verdun und an der Somme, haben keine grundlegenden Änderungen der Kriegslage herbeiführen können, aber auf allen Seiten hunderttausende weiterer Menschenleben gekostet, immense Zerstörungen und Vernichtung von Material verursacht. Rumäniens Kriegserklärung an Österreich-Ungarn und sein Einmarsch in Siebenbürgen, die Vergeltungsaktionen der Verbündeten gegen Rumänien haben, für wenige Monate immerhin, Bewegung in die erstarrten Kriegsfronten gebracht. Doch steht jetzt eine Feindmacht auf ungarischem Boden. Während des Rumänienfeldzugs, der schließlichen Besetzung des Landes und der Eroberung Bukarests durch die vier vereinten Armeen des Deutschen Reiches, Österreich-Ungarns, Bulgariens und der Türkei, hält sich Hermann Consten 1916/17 meistenteils in Bukarest auf. Dokumente über diese Phase seiner Agententätigkeit waren in den Archiven nicht mehr auffindbar. Doch dürften Constens Auftraggeber von der Abteilung IIIb mit dem Ergebnis seiner Arbeit zufrieden gewesen sein. Auch die österreichisch-ungarischen und bulgarischen Verbündeten zeigten sich für seine Arbeit erkenntlich. In den Akten des Evidenzbüros im Österreichischen Kriegsarchiv in Wien ließ sich feststellen, dass sich Hermann Consten nach seinem Rumänien-Einsatz mit einigen Kriegsdekorationen schmücken konnte, darunter dem Ritterkreuz des Franz-Josefs-Ordens, dem deutschen Eisernen Kreuz und dem Offizierskreuz des bulgarischen Verdienstor572 dens. Erst ab dem Sommer 1917 ist er wieder fest für die Abteilung IIIb in Budapest stationiert. Allem Anschein nach wird er nun weniger auf äußere als vielmehr auf „innere Feinde“ angesetzt. Denn nach mittlerweile drei Jahren eines zermürbenden Krieges, der eigentlich schon nach wenigen Wochen siegreich beendet gewesen sein sollte, nimmt die Sehnsucht nach Frieden bei den Menschen und auch unter einigen Politikern innerhalb der k.u.k.-Monarchie, die von Anfang an gegen diesen Krieg gewesen sind, überhand. Dem deutschen Allianzpartner ist der allgemeine Stimmungsumschwung in Österreich-Ungarn nach dem Tod Kaiser Franz-Josephs im November 1916, vor allem auch die wachsende politische Spannung zwischen 318
4. Als V-Mann in Budapest: „Etzel“ in feiner Gesellschaft
Wien und Budapest keineswegs gleichgültig. Da Consten sich in der ungarischen Hauptstadt längst einen großen Bekannten- und Freundeskreis unter Leuten aller möglichen Couleur geschaffen hat, zu dem, neben allerhand dubiosen Gestalten, auch führende Vertreter der Regierung und der Wirtschaft gehören, hält ihn der Chef der Sektion Abwehr, Dietrich von Roeder, wohl für den geeigneten Mann „zur Aufdeckung der gegen 573 Deutschland gerichteten revisionistischen Machenschaften“. Constens neuer Auftrag geht dahin, innerhalb der ungarischen Gesellschaft „internationale anarchistische, radikal-sozialistische und pazifistische Strömun574 gen“ zu observieren. Besonders Parteien, die Friedensinitiativen propagieren oder die Friedensbemühungen der Entente unterstützen, sowie streikfreudige Arbeiterorganisationen soll er ins Visier nehmen. Er beginnt also, die lokalen Zeitungen genauer zu studieren und incognito Versammlungen linker Kreise zu besuchen. Von der Besuchertribüne des Abgeordnetenhauses aus folgt er den oft hitzigen Parlamentsdebatten über die Wahlrechtsreform und die schlechte Versorgungslage. Mit Hilfe bezahlter V-Männer verschafft er sich vertrauliche Informationen und kompromittierendes Material über missliebige ungarische Abgeordnete und Journalisten. Um die Aktivitäten ungarischer Pazifisten und Sozialisten in der Schweiz kontrollieren zu können, bedient er sich eines in Zürich leben575 den ungarischen Bohemiens mit dem Künstlernamen Emil Szittya, der sich, als seine bezahlten Hilfsdienste ruchbar werden, Angriffen in der ungarischen Presse ausgesetzt sieht. Es gelingt Consten auch, Beamte der Grenzkontrollstelle Feldkirch – dem Übergang zur Schweiz – sowie bei der k.u.k. Postzensur in Budapest als Lieferanten vertraulicher Informationen und abgefangener Briefe zu gewinnen. Seine geheimen Drähte reichen sogar bis in die ungarische Armeegerichtsbarkeit hinein, die ihm gelegentlich Gerichtsakten zuspielt. Am Generalkonsulat vorbei berichtet Consten direkt an die Nachrichtenabteilung IIIb (Ost) im Großen Hauptquartier, was ihm an Verdächtigem auffällt. Wichtige Post oder für ihn bestimmte Telegramme aus Berlin holt er sich weiter in der deutschen diplomatischen Vertretung ab. Auch mit dem k.u.k. Militärkommando in Budapest, vor allem mit ihrer Nachrichtenabteilung, ist Consten in laufendem Kontakt. Mit einem der gefürchteten Köpfe der politischen Polizei Ungarns, dem „Detektivchef-Stellvertreter“ 319
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Imre Hétenyi, arbeitet Hermann Consten ebenfalls eng zusammen. So dauert es nicht allzu lange, bis er sich sicher ist, dass er einen wirklich „dicken Fisch“ der ungarischen Linken zur Strecke bringen kann: den in den ultrakonservativen Adelskreisen Budapests und Wiens verhassten „roten Grafen“ Mihály Károlyi.
5. Enttarnt: Mihály Graf Károlyi und die „Affäre Konsten“ 11. Mai 1918, ein Samstag. Der Himmel über Budapest ist heiter. Wenn auch von der Donau her die Morgenbrise ein wenig frisch weht, verspricht es ein schöner Tag zu werden. An diesem Samstagvormittag stellt Minister576 präsident Sándor Wekerle im Abgeordnetenhaus des Ungarischen Reichstags sein neues Kabinett vor. Wekerle, der seit dem Sommer 1917 amtiert, gilt als ein erfahrener, aalglatter und nicht sehr prinzipienfester Politiker. Nach der Vorstellung des Kabinetts im Magnatenhaus im Nordflügel des prächtigen, am Pester Donauufer gelegenen Parlamentsgebäudes begibt sich Wekerle mit seinen neuernannten Ministern hinüber in die Wandelgänge der Abgeordneten auf der anderen Seite des großen zentralen Treppenhauses. Auch hier herrscht festliche Stimmung. Der Regierungschef begrüsst einige prominente Politiker des rechten Flügels, die dank des ihnen günstigen Mehrheitsverhältnisses eine leichte Parlamentssession erwarten. Dauerthemen wie die Wahlrechtsreform, die Verabschiedung eines neuen Steuergesetzes wie auch einige brennende Probleme der Kriegswirtschaft könnten bald endlich vom Tisch sein, denn die Opposition ist geschwächt. Als Parlamentspräsident Karl von Szász um viertel vor elf Uhr die Sitzung eröffnet, sind die Abgeordnetenreihen fast bis auf den letzen Platz gefüllt. Auch die zweistöckige Besucher-Empore, von der aus man den holzvertäfelten Abgeordnetensaal genau in den Blick nehmen kann, ist voll besetzt. Nach der Vorstellung seiner neuernannten Kabinettsmitglieder gibt Wekerle einen Überblick über die wichtigsten Punkte des am Vortag beschlossenen Regierungsprogramms. „Schüchterne Zwischenrufe von der Károlyi-Gruppe protestieren, doch die Rufe gehen unter in der lauten Zustimmungskundgebung der Rechten“, berichtet der Parlamentskorrespondent des Pester Lloyd gleichentags in der Abendausgabe seines deutsch577 sprachigen Tageblatts. Nachdem Wekerle geendet hat, eröffnet der Füh578 rer der Partei der Nationalen Arbeit, István Graf Tisza, die Debatte über 320
5. Enttarnt: Mihály Graf Károlyi und die „Affäre Konsten“
das Regierungsprogramm mit einer Breitseite gegen den linken Flügel, dem die geplante Wahlrechtsreform nicht weit genug geht. Tisza warnt vor den Gefahren, die der ungarischen Nation durch ein „radikales“, d.h. ein geheimes und freies allgemeines Wahlrecht drohen, wie es Mihály Graf Károlyi und seine Anhänger seit langem mit Nachdruck fordern. Bevor Oppositionsführer Károlyi als nächster Redner seine Entgegnung vortragen kann, verlassen fast alle Vertreter des rechten Flügels demonstrativ den Saal. Vor halbleerem Haus übt der von vielen seiner Standesgenossen geschnittene Graf mutige Kritik am Regierungsprogramm und stellt die freiheitlich-sozialen Konzepte seiner politischen Gruppierung, der Károlyi-Partei, dagegen. Auch andere Abgeordnete, vor allem die wenigen Vertreter der nichtmagyarischen Nationalitäten Ungarns, sind von Wekerles Programm enttäuscht. Es bleibt, so stellen sie einhellig fest, weit hinter bereits früher gemachten Versprechungen zurück. Mittags um Eins – etliche Parlamentarier zogen es bereits vor, zum Essen zu gehen – wird es für die im Saal verbliebenen Herren plötzlich richtig spannend. Der Parlamentspräsident ruft den Tagesordnungspunkt „Interpellationen“ auf. Das Wort hat der parteilose Abgeordnete Ferdinand Urmánczy. „Ich gehöre keiner Partei an“, beginnt er seine Ausführungen, „auch der 579 des Grafen Károlyi nicht. Und ich halte sogar die radikale Richtung seiner Politik nicht für richtig. […] Doch dass Graf Mihály Károlyi für den Frieden kämpft, das habe ich immer verstanden. Ich weiß, er tut es aus Sorge für die ungarische Nation. Er will, dass der ungeheure Blutverlust der ungarischen Nation ein Ende finde. […] Wer also an der Reinheit der Absichten Mihály Károlyis zweifelt, der ist aus irgendeinem Grunde befangen. Wer aber zu behaupten wagte oder – denn ich glaube nicht, dass es so einen Menschen geben könnte – wer auch nur zu glauben oder vorauszusetzen wagte, dass Graf Mihály Károlyi des Hochverrats fähig 580 ist, der verdient, ins Narrenhaus gesperrt zu werden.“
Kurz geht Urmánczy auf die allen Anwesenden bekannte Vorgeschichte ein, die im Januar 1918 ihren Anfang genommen und in ganz Budapest seinerzeit riesiges Aufsehen erregt hatte. Damals hatte Mihály Károlyis Cousin Imre, der Bankier, den gemeinsam mit ihm aufgewachsenen Blutsver321
III. Codes und Camouflagen 1914–1918 581
wandten in einem offenen, von der Budapester Zeitung Az Ujsag abgedruckten Brief politisch und persönlich in einer Weise angegriffen, die nicht unerwidert bleiben konnte. Unter anderem hatte er ihn wegen seiner Ablehnung des Bündnisses mit dem deutschen Kaiserreich als „schwindlerischen politischen Abenteurer“ und „halben Landesverräter“ diffamiert, der mit dem Feinde, also der Entente, kokettiere, der seinen ehrlichen alten 582 Familiennamen schände und sein eigenes Nest beschmutze. Dann kommt der Abgeordnete Urmánczy zum eigentlichen Anlass für seine Interpellation, einem Vorgang jüngeren Datums, der seiner Meinung nach aber mit dem erwähnten Eklat zwischen den beiden Vettern ursächlich zusammenhängt: „Es ist gegen den Grafen Mihály Károlyi eine Wühlarbeit eingeleitet, um ihn unmöglich zu machen. Und das Bedenkliche daran ist, dass sie hier in Budapest von einer fremden ausländischen amtlichen Hand gelenkt wird.“
Das Parlamentsprotokoll vermerkt an dieser Stelle: Bewegung. Die Tatsache, dass eine ausländische Macht die Hände im Spiel habe, mache aus einer Privatangelegenheit des Grafen Károlyi ein nationales Problem, so der Abgeordnete weiter. Deshalb habe er es übernommen, die Sache im Abgeordnetenhause vorzutragen. Und dann zitiert er in aller Ausführlichkeit aus Erklärungen des Grafen Károlyi und einiger anderer, in den ungeheuerlichen Vorgang eingeweihter Personen. Diese seien bereit, ihre Äußerungen jederzeit zu beeiden. Mihály Károlyis Erklärung, von Urmánczy verlesen, beginnt laut Parlamentsprotokoll mit folgenden Sätzen: „Am 26. Februar 1918, als ich mittags nach Hause kam, erwartete mich ein Herr, den ich nicht kannte. (Bewegung. Hört, hört! Links). Er stellte sich vor, sein Name sei Robinson und sagte, er käme zu mir, da er als Privatdetektiv von einem deutschen Major den Auftrag erhielt, ein mich belastendes Material zu verschaffen und zu erforschen, was in den Kisten 583 war, die ich jüngst nach Parád absandte. Die Information des Majors lautete, dass in ihnen das Dokument enthalten ist, dem ich meine Befrei584 ung verdanke. Der Major versprach ihm dafür 50.000 Kronen. Auf Kosten gab er ihm einen Vorschuss von 1.000 Kronen.“ (Bewegung)
322
5. Enttarnt: Mihály Graf Károlyi und die „Affäre Konsten“
Der Abgeordnete schildert, wie Mihály Graf Károlyi den Privatdetektiv „Robinson“ an seinen Sekretär Simonyi weiter verwies. Dann zitiert er aus Simonyis Erklärung, bei dem der Detektiv am nächsten Tag tatsächlich auftauchte und weitere Wünsche des Majors mitteilte. Der könne, so „Robinson“, auch Dokumente gebrauchen, „die sich auf ausländische Angelegenheiten beziehen“. Außerdem suche man Briefe, „die sich auf die Verbindung des Grafen mit Sozialisten, Freimaurern und mit den an dem letzten Arbeiterstreik beteiligten und diesen organisierenden Arbeitern beziehen“. Unbekümmert plauderte „Robinson“ gegenüber dem Privatsekretär des Grafen aus, der Deutsche bewohne in dem Haus Nagy-Janos utca Nr. 8 die Beletage, den 1. Stock, ganz allein. Sein Büro befinde sich im deutschen Generalkonsulat. Zu seiner Bedienung habe er einen österreichisch-ungarischen Soldaten, einen Feldwebel und einen Offiziersdiener. Und übrigens, sein Name sei Consten, Major Hermann Consten. Diesmal kommt die Bewegung vom zweiten Stock der Zuschauertribüne, wo üblicherweise Pressevertreter und nicht geladene Gäste Platz nehmen. Ein Stuhl fällt polternd zur Seite. Ein Mann hastet davon. Eine Tür fällt ins Schloss. Mihály Graf Károlyi, der den Vorgang von seinem Abgeordnetenplatz auf dem linken Flügel aus mit den Augen verfolgt, registriert, dass der Mann seinen Hut auf der Brüstung der Empore liegen gelassen hat. Der Abgeordnete Urmánczy hat nur kurz von seinem Blatt aufgesehen und fährt in seinem Bericht fort. In vorheriger Absprache mit Károlyi händigte der Sekretär dem Detektiv „Robinson“ nach und nach mehrere inhaltlich ziemlich belanglose Schriftstücke aus und vertröstete ihn immer wieder bezüglich brisanterer Ware. Damit wollte man Zeit gewinnen, um sich von der genauen Identität des Majors zu überzeugen. Man schickte Franz Vásárhelyi, einen Freund Károlyis, zum Generalkonsulat und zur Nagy-Janos utca Nr. 8. Dem gelang es schließlich, Constens persönliche Bekanntschaft zu machen. Nach anfänglichem Misstrauen informierte der Major auch ihn über sein Anliegen. Wörtliche Zitate der Konversation, die der Abgeordnete Urmánczy in seiner Interpellation wiedergibt, gehen in empörten Zwischenrufen auf dem linken und Heiterkeit auf dem rechten Flügel fast unter. Im Laufe des März, während der deutsche Major weiter hingehalten wurde und bereits Anzeichen von Nervosität erkennen ließ, verfiel man 323
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
derweil im Palais Károlyi, einem zweistöckigen klassizistischen Bau, im in Permanenz tagenden Freundeskreis auf eine neue Idee. Der Journalist Paul Kéri, eine bekannte Erscheinung in Budapests linken Intellektuellenzirkeln, wo Hermann Consten wohl noch nicht verkehrte, erklärte sich bereit, in die Rolle des Privatsekretärs Simonyi zu schlüpfen. Was folgte, war ein Musterbeispiel für exzellenten Enthüllungsjournalismus à la Günter Wallraff im frühen 20. Jahrhundert. Zunächst schickte man Vásárhelyi nochmals in der Nagy-János utca Nr. 8 vorbei. Dieser erklärte dem Major Consten umständlich, Simonyi sei fast gewonnen, fürchte aber, falls die Angelegenheit herauskomme, um seine Stelle. Worauf hin ihm Consten erwiderte, falls dies passiere, sei er bereit, ihn zu entschädigen. Er habe insgesamt 50.000 Kronen zur Verfügung; 5.000 habe er bereits dem Detektiv „Robinson“ bezahlt. „Schließlich meinte er, es handele sich um das Geld deutscher Bürger, mit dem er also sparsam umgehen müsse.“ (Heiterkeit links) Diese Summe, so gab ihm Vásárhelyi zur Antwort, sei möglicherweise zu wenig. Daraufhin wünschte Consten, Simonyi persönlich zu sehen. „Er könne ja in der Abenddämmerung heraufkommen, ohne erkannt zu werden.“ So vereinbarten sie, dass Vásárhelyi noch einmal mit Simonyi reden und ihn zu dem Besuch bei Consten ermuntern solle, und Consten gab ihm seine geheime Telefonnummer samt Codewort mit auf den Weg. Zwischenruf des Abgeordneten Fényes: „War beim Zensor auch dieses Telefon eingeschaltet?“
Der Abgeordnete Urmánczy fährt in seiner für einige Abgeordnetenkollegen offenbar höchst unterhaltsamen Detektivgeschichte fort. Immer wieder wird sie von Lärm, Heiterkeitsausbrüchen auf beiden Abgeordnetenflügeln und empörten Zwischenrufen wie „Deutsche Polizei in Budapest!“ (Parlamentsprotokoll: äußerst links) unterbrochen. Im weiteren Verlauf schildert er die Begegnung zwischen Major Consten und dem vermeintlichen Privatsekretär des Grafen Károlyi alias Paul Kéri, die am 29. April 1918 stattfand. Er zitiert Kéris eigene Worte: „Ich erschien gegen drei Uhr beim Major, der sich sehr über meinen Besuch freute und mir lange über seine bisherigen militärischen Exmissionen, in deren Verlauf er Tibet und Japan bis Arabien, ganz Asien und 324
5. Enttarnt: Mihály Graf Károlyi und die „Affäre Konsten“
auch Osteuropa durchwandert hat, plauderte. Als wir zu unserer Angelegenheit übergingen, sagte ich ihm, der Graf sei nicht in dem erwarteten Zeitpunkte [in die Schweiz; D.G.] abgereist, so dass ich nicht zu den Dokumenten gelangen konnte; übrigens habe der Graf nicht mehr so viel Vertrauen zu mir und das Verhältnis zwischen uns sei kühler geworden. Der Vertraute des Grafen sei jetzt sein Rechtsanwalt, Dr. Desider Polónyi. Der Major notierte sich sofort den Namen. (Heiterkeit rechts) ‚Auch ich dachte bereits’, bemerkte der Major, ‚dass der Graf Ihnen nicht mehr so viel Vertrauen entgegenbringe, doch kann ich Ihnen die Versicherung geben, dass ich daran unschuldig bin. Ich habe Ihren Namen nie ausgesprochen und wann immer in Unterredungen mit behördlichen Personen die Rede auf Sie kam, über Sie geschimpft, als ob keinerlei Verbindung zwischen uns bestanden hätte. Ich glaube, der Graf hat erfahren, dass gewisse, ihn belastende Schriften, bereits in meine Hand geraten sind, sodass er nun seiner Umgebung gegenüber weniger vertrauensvoll ist.’ Wir besprachen nun, welche Dokumente der Major benötigt. Er wünschte vor allem die Protokolle über die Unterredungen des Grafen mit den Führern der zu ihm stehenden Arbeiter.“
Auch angebliche Kontakte Mihály Károlyis mit den Freimauern, ihre Unterstützung mit Geld, um sie zu Streiks zu überreden, interessierten den deutschen Major. Außerdem verlangte Consten nach Korrespondenzen des Grafen mit französischen Politikern, die über Mittelsmänner in der Schweiz nach Paris weitergeleitet würden. Am liebsten wollte er die Originaldokumente ausgehändigt bekommen, um sie zu fotografieren und dann nach einer Stunde zurückzugeben. Im Augenblick der Übergabe, so versicherte er nochmals, werde Simonyi/Kéri die versprochenen 50.000 Kronen erhalten. Für den Fall, dass er seine Stelle verliere, winke ihm bereits eine neue, viel besser bezahlte – bei der Ungarischen Bank & Handels AG, deren Präsident, bis kurz vor der Veröffentlichung seiner Invektiven gegen seinen Vetter Mihály, niemand geringerer gewesen war als Imre Graf Károlyi. Als der „Privatsekretär“ noch immer keine festen Zusagen machen wollte, wann er die gewünschten Dokumente denn nun endlich liefern konnte, wurde Major Consten ungeduldig: „Haben Sie doch keine Bedenken und Gewissensbisse, Herr Simonyi. Der 325
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Graf ist ohnehin ein verlorener Mann (Heiterkeit äußerst links), der nicht zu retten ist. Übrigens wollen wir ihn nicht aufs Schafott bringen. Nur müssen wir es irgendwie, koste es was immer, bewirken, dass Graf Michael Károlyi und seine Partei aus der ungarischen Politik verschwinden.“ (Lärm)
Und Consten erläuterte ihm, er plane, die belastenden Dokumente Károlyis Schwiegervater, dem einflussreichen konservativen Politiker Gyúla Graf 585 Andrássy, zu zeigen und ihn aufzufordern, seinen völlig aus der Art geschlagenen Schwiegersohn zum Rückzug aus dem politischen Leben zu bewegen. Zum Beispiel könne Károlyi sich doch mit der offiziellen Begründung einer ernsthaften Erkrankung auf seine Landgüter zurückziehen und sich in Budapest nicht mehr blicken lassen. Falls dies nicht gelinge, dann allerdings „werden wir Károlyi zugrunde richten“. (Bewegung) Es müsse eigentlich in Andrássys eigenem Interesse liegen, so Consten weiter, denn wegen dieses Schwiegersohnes habe die deutsche Führung das Vertrauen in ihn verloren. Deshalb spiele er im neuen ungarischen Kabinett auch keine Rolle mehr. „Es liegt daher im Interesse Andrássys, wenn wir den eigenen Schwiegersohn unschädlich machen.“ Und Consten fuhr fort: „Was aber Sie betrifft, Herr Simonyi, so werden wir Sie mittlerweile verhaften lassen, damit Sie niemand wegen der Dokumente in Verdacht haben könne. (Heiterkeit) Ich werde schon für gute Behandlung sorgen. (Heiterkeit) Sie bleiben zwei Tage in Haft, dann setzen wir Sie in Freiheit. Sie begeben sich dann zum Grafen und erklären ihm, eine so riskante und unangenehme Stelle nicht weiter behalten zu wollen. Und nach einiger Zeit können Sie ohne Aufsehen Ihre Stelle bei der Ungarischen Bank antreten.“ (Lärm äußerst links)
Bevor der Abgeordnete Urmánczy nun seine dringende Anfrage an das Kabinett Wekerle formuliert, betont er – unter lauten Missfallensbekundungen der Linken –, viele weitere Details dieser Agentengeschichte habe er weggelassen. Sie würden wahrscheinlich, wenn sie bekannt würden, am Wiener Ballhausplatz wie auch im Ausland – sprich: in Berlin – einiges Aufsehen erregen. Doch sei man nun einmal im Dreibund mit dem Deutschen Reich zusammengeschmiedet und kämpfe in diesem blutigen Krieg Schulter an Schulter. Er stellte deshalb ausdrücklich auch ein gewisses 326
5. Enttarnt: Mihály Graf Károlyi und die „Affäre Konsten“
Recht der Deutschen nicht in Frage, zu ihrer eigenen Orientierung in einem mit ihnen befreundeten Land einen Spionagedienst einzurichten. Voraussetzung sei jedoch, dass die ungarische Regierung darüber informiert sei. Möglicherweise habe das Königreich Ungarn ja auch eine solche Organisation in Berlin. Wogegen er aber protestieren müsse, seien die unsauberen Mittel, mit denen hier gearbeitet werde, und die direkte Einmischung einer fremden Macht in die ungarische Politik. Hinzu komme die elende Hetze gegen einen führenden ungarischen Politiker, den Grafen Mihály Károlyi – und dies offenbar nur, weil man befürchte, er und seine Partei könnten „gegenüber den künftigen großen Plänen und Bestrebungen der Deutschen eine Kontrolle ausüben oder Schwierigkeiten erheben“. Und er unterstreicht: „Eine solche, unsere Souveränität berührende und verletzende unbefugte Einmischung dürfen wir nicht dulden. Und wir müssen ihr beim ersten Anlass, bei dem wir ihr begegnen, auf den Kopf treten, damit man hinfort nicht einmal im Gedanken mehr zu einer ähnlichen Perfidie zu greifen wage.“ (Lebhafter Beifall auf der äußersten Linken)
Schließlich richtet Urmánczy an den Ministerpräsidenten die Frage, ob er angesichts dieses eklatanten Falls erwäge, in Budapest lebenden Ausländern dergleichen Aktivitäten gesetzlich zu untersagen. Wekerle antwortet geschickt und ohne sich näher festzulegen. Von dieser „wie ein Detektivroman klingenden Geschichte“ höre er zum ersten Mal, erklärt er mit Unschuldsmiene. Tatsächlich verhalte es sich so, dass auch Ungarn in anderen Ländern einen Nachrichtendienst unterhalte. Den angeblichen Herrn Major kenne er überhaupt nicht. Er wisse aber, dass er kein Organ des deutschen Generalkonsulats sei. Besagter Major habe in Budapest keinerlei Verfügungsrecht; mit den hiesigen Stellen tausche er allenfalls Nachrichten aus. Dass er sich „in so phantastischer Weise“ sogar in die Kabinettsbildung eingemischt hätte, „muss ich für lächerlich erklären“ – eine Äußerung, die wiederum Heiterkeit unter einigen oppositionellen Abgeordneten auslöst. Wekerle sagt vage zu, Fälle wie diese „unzulässige Hetze“ in Zukunft zu unterbinden; er fühlt sich immerhin bemüßigt zu betonen: „Die Regierungsorgane haben ihn [Consten; D.G.] hierbei nicht unterstützt.“ Einwurf des Abgeordneten und Rechtsanwalts Desider Polónyi: „Fragen wir den 327
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Detektivchef-Stellvertreter Hetényi und den früheren Herrn Justizminis586 ter!“ Antwort Wekerle: „Solange ich an dieser Stelle stehe, wird das auch nicht der Fall sein. Ich werde im übrigen die Angelegenheit untersuchen und in der bezeichneten Richtung vorgehen.“ Mit dieser erschöpfenden Auskunft gibt sich das Abgeordnetenhaus erst einmal zufrieden. Hermann Consten, der „Major“, hatte eigentlich die öffentliche Verdammung und den ruhmlosen Abgang des Grafen Károlyi erwartet, als er an diesem sonnigen Maimorgen zum Parlament geeilt war, um dort von der Besuchertribüne aus den heimlichen Triumph seiner monatelangen „Wühlarbeit“ zu erleben. Nun ist er am Boden zerstört, vernichtet. Graf Károlyi und seine politischen Freunde waren klüger, geschickter gewesen als er; dies muss er sich leider eingestehen. Schon nach den ersten Sätzen des Abgeordneten Urmánczy hatte es ihn kaum noch auf der Empore gehalten. Als dann auch noch in aller Öffentlichkeit sein Name fiel, war er blindlings hinausgestürzt. Er war durch den Tabaksqualm der Wandelgänge gehastet, wo sich einige pausierende Abgeordnete, die ihn kannten, verwundert nach ihm umdrehten. Flüchtig hatte er einen seiner Freunde, den Turanier-Präsidenten Pál Graf Teleki, wahrgenommen, der im neuen Kabinett das Amt des Sozialministers übernommen hatte. Schrecklich, er hatte ihn nicht einmal gegrüßt! Die breiten, von Kandelabern gesäumten Treppen des Hauptaufgangs war er, an erschrockenen livrierten Parlamentsdienern vorbei, auf seinen kurzen Beinen hinuntergeschossen und wie ein ertappter Dieb hinab zur Donau geeilt. Dort hatte er erst einmal nach Luft geschnappt und beim Anblick des gleichmütig vorbeiziehenden Stroms langsam seine Fassung wiedergewonnen. Welche Scham und Schande! Was nun? Im ersten Moment hätte er sich am liebsten in die Donau gestürzt, wäre aus dieser Stadt, aus diesem Leben ein für allemal verschwunden. Was hatte er mal wieder falsch gemacht? Wer von seinen V-Leuten hatte das Wasser nicht halten können? Wahrscheinlich dieser Detektiv „Robinson“, ein früherer Preisringer, der ihm von Imre Károlyi doch so warm empfohlen worden war! Warum hatte ihn keine innere Stimme vor solchen unzuverlässigen Typen gewarnt? Warum hatte er sich überhaupt von dem gräflichen Bankier einspannen lassen, der seinem Vetter Mihály in Wirklichkeit nur dessen Besitzungen und Vermögen neidete? Imre interessierte sich für Politik eigentlich gar nicht, sondern nur 328
5. Enttarnt: Mihály Graf Károlyi und die „Affäre Konsten“
für Geldgeschäfte. Auf seinem Jagdschloss in Nagymagocs hatte er ihm einmal anvertraut, wie sehr er damit gerechnet hatte, Mihálys Landbesitz und immenses Vermögen würde eines Tages seinen fünf Söhnen zufallen. Doch dann hatte der verhasste Cousin, ein notorischer Junggeselle, Frauenheld und Spieler, im Kriegsjahr 1914 im Alter von 39 Jahren wider Erwar ten doch noch geheiratet, hatte selbst Kinder bekommen, 1917 sogar einen männlichen Erben. Hass und Neid hatten also den Plan genährt, Mihály Graf Károlyi wenigstens politisch fertig zu machen. Und er, Consten, hatte Imre Károlyi dabei geholfen. Er hatte Daten und Fakten geliefert, die Mihály Károlyi wie 587 einen Landesverräter aussehen ließen. Er selbst ist immer noch fest davon überzeugt, dass er untrügliche Beweise für den Hochverrat finden wird, wenn man ihn nur lässt. Natürlich war es auch ihm, Consten, ums Geld gegangen. So gut wie Imre Károlyi konnte ihn die eher knauserige Nachrichtenabteilung IIIb in Berlin eben nicht bezahlen. Die 50.000 Kronen stammten natürlich nicht von den deutschen Steuerzahlern. Vielleicht war ihm das alles ein bisschen zu Kopf gestiegen… Doch für Reue ist es jetzt zu spät. Noch an diesem 11. Mai wird die ungarische Öffentlichkeit erfahren, was sich soeben hinter den reichverzierten neogotisch-barocken Mauern des größten Parlamentsgebäudes Europas abspielt. Budapests geschwätzige Abendzeitungen werden seine Blamage hinausposaunen, ihn zum Gespött für Kommentatoren und Karikaturisten machen. Als Agent ist Hermann Consten damit erledigt, verbrannt, unbrauchbar geworden. Prompt lassen ihn alle, die sich seiner seit Jahren bedient hatten, fallen wie eine heiße Kartoffel. Ehe der Hahn dreimal krähte, hatte man ihn dreimal verleugnet. Als erster hatte Ministerpräsident Wekerle seine Hände in Unschuld gewaschen. Dabei hatte doch sein Pressesprecher Heinrich Gonda dem Deutschen mit dem türkischen Majorsrang die Wohnung 588 in der Nagy-Janos utca Nr. 8 überlassen. In der Sonntagsausgabe des Pester Lloyd kann Consten am nächsten Tag nicht nur en détail nachlesen, was sich nach seinem überstürzten Abgang im Abgeordnetenhaus weiter abgespielt hat, sondern auch gleich die Stellungnahme des deutschen Generalkonsulats zur Kenntnis nehmen, das die ungarische Presseagentur telegraphisch wissen ließ, dass der in der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses erwähnte Herr 329
III. Codes und Camouflagen 1914–1918 589
Konsten niemals deutscher Offizier gewesen und in keiner Verbindung mit dem Generalkonsulat gestanden hat. Selbstverständlich trägt er ausschließlich die Verantwortung für sein Vorgehen, das ohne Wissen oder 590 irgendeine Weisung von amtlicher Seite erfolgt ist.
Auch die Direktion der Ungarischen Bank- und Handels AG hatte sich beeilt zu erklären, die durch die Interpellation bekanntgewordene Stellenzusage durch Consten sei frei erfunden. Wir erklären, dass weder der durch den Herrn Abgeordneten Urmánczy genannte Herr, noch sonst wer die Vollmacht oder das Recht hatte oder hat, eine ähnliche Erklärung oder ähnliches Versprechen irgend jemand 591 zu machen.
Da die Aufdeckung der Spionageaffäre leicht zu einer Belastung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden verbündeten Staaten werden könnte, holt das österreichisch-ungarische Außenministerium bei seinem diplomatischen Vertreter in Budapest, v. Wodianer, noch am 11. Mai Erkundigungen über Consten ein. Es erfährt, ebenfalls schon am Tag nach dem Eklat, Einzelheiten zu seiner Person: Derselbe lebt seit dem Jahre 1915 in Budapest, war ursprünglich Gehilfe des deutschen Nachrichtenoffiziers und nach Abgang desselben hier zurückgelassen. Er verkehrt direkt mit dem deutschen Kriegsministerium, hat das Recht, den offiziellen Stempel zu benützen und gehen seine Berichte häufig mit Kurier. Die Mission Konstens scheint rein politischer Natur zu sein. Seine Vertrauensmänner waren hier an kompetenter Stelle bekannt und wurden überwacht, dieselben wurden mir als wertlos bezeichnet. Auch seine Verbindungen mit dem Detektivchefstellvertreter Hetényi, welcher unseren militärischen Behörden Dienste leistet, waren gekannt. […] Über die Person des Hermann Konsten habe ich erfahren, dass er den Rang eines türkischen Majors besitzt und sich Bey nennt, in der deutschen Armee ist er Landsturmmann. Ordonnanzen waren Kons592 ten seitens unserer Militärbehörden niemals beigegeben.
Derweil hat der deutsche Generalkonsul in Budapest, Graf FürstenbergStammheim, Reichskanzler Graf Hertling umgehend über die Affäre und seine Einschätzung informiert und die einschlägigen Nummern des Pester 330
5. Enttarnt: Mihály Graf Károlyi und die „Affäre Konsten“
Lloyd in Kopie beigefügt. Seine Stellungnahme und Beurteilung der Person Constens zeigen seine Distanzierung, wenn er u.a. schreibt: Aus dem Bericht ergibt sich, dass Consten, statt Material gegen den Grafen Károlyi zu erhalten, von diesem gründlich getäuscht und jetzt auch noch bloßgestellt worden ist. Bezeichnend für Consten ist, dass er in seiner Unterhaltung mit dem angeblichen Sekretär des Grafen Károlyi getan hat, als ob ungefähr alle Fäden der ungarischen Politik in seiner Hand zusammenliefen. Seine Mitteilungen, die er gelegentlich auch hierher hat gelangen lassen, bestanden stets in einem bunten Gemisch von Wahrheit und Phantasie. Sein Material gegen den Grafen Károlyi enthielt, soweit es hier bekannt geworden ist, keine einzige erweisliche Tatsache, die zu einer Verurteilung oder auch nur zu einer Bloßstellung genügt hätte. Bei seinen Bemühungen, das Material zu vervollständigen, ist er jetzt gründlich hereingefallen, so dass seine sofortige Abberufung notwendig geworden ist. Die Antwort des Ministerpräsidenten Wekerle ist nach dem Bericht des Pester Lloyd wesentlich vorsichtiger gehalten, als es nach den ersten ungenauen Mitteilungen der gestrigen Zeitungen den Anschein hatte. […] In den Kreisen der nationalen Arbeitspartei wird vielfach bedauert, dass die Constenschen Bemühungen ergebnislos ge593 blieben sind.
Das Dokument, das sich im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes befindet, trägt folgenden handschriftlichen Vermerk des Legationssekretärs Jordan vom 16. Mai: Consten wird vom Staatsanwalt Tornau (st.Gen.Stb.IIIb) beschäftigt. Tornau betonte telefonisch, dass Consten bisher nützliche Dienste geleistet habe. Ich habe Hrn. Tornau auf seine Bitte Abschriften von A 20143, 20393 u. 20636 gesandt. Er wird heute oder morgen dazu Stellung nehmen u. bestimmt, weitere Schritte einstweilen zu warten.
Das letztgenannte Aktenstück A 20636, ein Telegramm des Generalkonsuls, stammte vom 15. Mai und hatte folgenden Wortlaut: Ich höre soeben, dass Consten noch in Budapest sei und behauptete, ihm werde kein Haar gekrümmt. Er werde Karolyi doch noch fassen. Rate dringend sofortige Abberufung durch Generalstab herbeizuführen. Cons331
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
ten kann hier nichts mehr nützen, aber unberechenbaren Schaden an594 richten. Fürstenberg.
Dazu fand sich als weiterer, diesmal maschinenschriftlicher Vermerk auf dem erstgenannten Dokument: Der Ansicht des Grafen Fürstenberg trete ich durchaus bei. Bitte bei OHL auf umgehende Abberufung Constens dringen.
Inzwischen hatte sich das ungarische Abgeordnetenhaus am 13. Mai nochmals mit der Sache Consten befasst. Der Abgeordnete Juhácz-Nagy, ein Parteifreund Mihály Graf Károlyis, enthüllte weitere Details der SpionageAffäre. Zunächst äußerte er Zweifel an der öffentlichen Erklärung des Generalkonsulats, mit Consten nichts zu tun zu haben und legte zum Beweis des Gegenteils mehrere an das Generalkonsulat adressierte Briefumschläge des deutschen Generalstabs vor, mit der Aufschrift „Für Nobud“ – offenbar hatte sie einer der vielen Besucher Constens heimlich an sich genommen, die mit ihm wegen der Beschaffung der kompromittierenden Dokumente verhandelt hatten. Diese Briefe seien durch Vermittlung des Generalkonsulats an Consten gelangt, so der Vorwurf des Abgeordneten. Juhácz-Nagy erklärte ferner, Consten habe aus dem Ausland eingegangene Briefe für den Grafen Károlyi an sich genommen, geöffnet und behalten. Ihm hätten außerdem Strafakten des Honvéd-Divisionsgerichts gegen 595 Károlyi vorgelegen. Consten habe darüber hinaus Durchsuchung und Verhör einer Verwandten des Grafen Károlyi an der Schweizer Grenze veranlasst, weil sie verdächtig war, Briefe des Grafen bei sich zu tragen. Ferner habe Consten versucht, die Aufzeichnungen des Grafen Károlyi über eine Audienz bei König Karl in die Hand zu bekommen. Dieses Vorgehen, so resümierte der Abgeordnete, sei ein offener Versuch, die Immunität eines Abgeordneten und die Hoheitsrechte des ungarischen Staates anzutasten. Parlamentspräsident Szász erklärte darauf, er werde den Antrag an den Immunitätsausschuss weiterleiten. Ministerpräsident Wekerle verwahrte sich entschieden dagegen, in dem Verhalten Constens eine Verletzung der staatlichen Hoheitsrechte zu sehen und wiederholte seine bereits am Vortag vertretene Auffassung, es sei keineswegs unstatthaft, wenn die deutsche Heeresleitung in Budapest ein Organ ihres Nachrichtendienstes unterhalte. 332
5. Enttarnt: Mihály Graf Károlyi und die „Affäre Konsten“
Er bedauerte ausdrücklich, dass der Abgeordnete das Dementi des deutschen Generalkonsulats zum Gegenstand seiner Kritik gemacht hatte. Die Übermittelung eines Briefes bedeute noch nicht, dass das Generalkonsulat 596 mit Consten in Verbindung gestanden habe, so Wekerle. Immerhin veranlassten die neuerlichen Enthüllungen über das Ausmaß der Affäre den Pester Lloyd noch am 13. Mai zur Herausgabe eines Extrablatts mit der Balkenüberschrift: „Wer ist Major Konsten?“ Der Fall war ein gefundenes Fressen für die Budapester Journalisten, während die Vertreter von Regierung und Diplomatie fieberhaft bemüht waren, die peinliche Geschichte so gut es ging herunterzuspielen. Im internen Telegrammverkehr mit dem Auswärtigen Amt und der Reichskanzlei bestätigte Fürstenberg, dass für Consten bestimmte Briefe der Obersten Heeresleitung bzw. der Abteilung IIIb in der Regel an das Generalkonsulat adressiert waren und weitergeleitet wurden. In der fälschlichen Annahme, Consten sei unmittelbar nach den Enthüllungen über seine geheimdienstlichen Aktivitäten abgereist, ließ der Generalkonsul die Militärs aber wissen, er werden von nun an alle für Consten bestimmten Briefe ungeöffnet zurückschicken und empfahl ihnen, in Zukunft grundsätzlich für derartige Korrespondenz die militärischen Kurierdienste in Anspruch zu nehmen. Bezogen auf den aktuellen Anlass fügte er an: Wie mir übrigens der zum k.u.k. Oberkommando in Baden bei Wien 597 kommandierte Major Fleck mitteilt, stellt der Generalstab in Abrede, 598 mit Consten in Verbindung gestanden zu haben.
Was wohl nicht stimmte. In der Zwischenzeit hatte sich nämlich die Abteilung IIIb sehr wohl mit dem Fall Consten befasst. Dietrich von Roeder jedenfalls teilte dem Auswärtigen Amt unter Bezugnahme auf das Ferngespräch des Legationssekretärs Jordan mit Staatsanwalt Dr. Tornau mit, der V-Mann Consten sei angewiesen worden, seine Tätigkeit bis auf weiteres einzustellen. „Eine endgültige Entscheidung wird nach Eingang des schrift599 lichen Berichts des Consten getroffen werden können.“ Consten sah also zunächst gar keinen Grund, bei Nacht und Nebel aus Budapest zu verschwinden. Er saß in seinem Büro und verfasste den von IIIb verlangten schriftlichen Bericht, ließ sich im Generalkonsulat aber lieber nicht blicken. Der zunehmend verärgerte Generalkonsul war derweil 333
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
weiter genötigt, für Consten bestimmte Briefe zurückzusenden und dem Reichskanzler von der weiteren Entwicklung der leidigen Affäre Kenntnis zu geben. „Die Angelegenheit Consten ist nach wie vor Tagesgespräch“, depeschierte er unter dem 20. Mai. „Die Zeitung Az Est brachte gestern einen längeren Artikel, worin verschiedene Personen, deren sich Consten 600 angeblich bedient hatte, mit Namen genannt werden.“ Dieser Artikel bewog dann wohl die ungarische Regierung, Constens Abberufung auf diplo601 matischem Wege zu verlangen. Denn ein Beleidigungsprozess vor dem Budapester Bezirksgericht, der sich um mögliche Informanten Constens drehte, hielt das Thema weiter am Kochen. Angeklagt war der Detektiv „Robinson“, der mal wieder, diesmal vor Gericht, ein bisschen zuviel ausgeplaudert hatte. Offenbar hatte er dabei einige regierungsnahe Personen in den Verdacht gebracht, Consten ebenfalls zugearbeitet beziehungsweise ihn benutzt zu haben für eine Sache, bei der sie sich selbst nicht die Finger schmutzig machen wollten. Einige beunruhigende Andeutungen Robinsons gegenüber dem Richter, wie: „Wenn Sie wüssten, wer noch in die Konsten-Affäre verwickelt ist, dann würden Sie staunen!“ oder seine Bemerkung, das, was in den Blättern erschienen sei, 602 mache „kaum ein Prozent der Affäre Konsten“ aus, bereitete sogar einigen amtierenden ungarischen Ministern schlaflose Nächte. Dass sie Grund zur Nervosität hatten, beleuchtet ein Telegramm aus dem deutschen Generalhauptquartier an das Auswärtige Amt. Dieses Telegramm wirft zugleich ein bezeichnendes Licht auf die damalige unterschiedliche Interessenlage der Diplomatie und des Militärs hinsichtlich der deutsch-ungarischen Beziehungen. Unter Hinweis auf Fürstenbergs öffentliches Dementi – Hermann Consten habe nie in Verbindung mit dem Generalkonsulat gestanden und sei für sein Handeln selbst verantwortlich – bestätigte Freiherr von Berckheim unter dem 25.5.1918 die Richtigkeit dieser Darstellung mit den Worten: Anscheinend hat Konsten aus eigenem Entschluss gehandelt. Möglich ist aber auch, dass [die] Ungarische Regierung, die ihn gern benutzt hat, da603 mit in Verbindung steht.
Anfang Februar, so Berckheim weiter, habe ihm der Bevollmächtigte des preußischen Kriegsministeriums in Budapest den Wunsch des Hónved-Mi334
5. Enttarnt: Mihály Graf Károlyi und die „Affäre Konsten“
nisters, General von Szurmay, übermittelt, Consten [der offenbar abberufen werden sollte; D.G.] in Budapest zu belassen. Denn er sei „sehr gut eingearbeitet und der Ungarischen Regierung besonders angenehm“. Man habe der Bitte entsprochen, und so sei Consten in Budapest geblieben. Berckheim zog daraus folgenden Schluss: Es scheint sich also mehr um eine ungarische als um eine deutsche Angelegenheit zu handeln, jedoch muss dafür gesorgt werden, dass sie nicht als deutsche Angelegenheit hingestellt wird. Eine Abberufung des Konsten würde aber die deutschen Interessen schädigen. Die Angelegenheit 604 wird weiter untersucht, danach Entscheidung getroffen werden.
Plötzlich wird Constens Abberufung aber doch verfügt. Denn inzwischen hat Hónved-Minister Szurmay „seine Bedenken gegen die sofortige Abbe605 rufung des genannten Vertrauensmannes fallen lassen“. Da sich Consten – inzwischen sind seit der Enthüllung des Skandals zwei Wochen ins Land gegangen – noch immer in Budapest aufhält und für die nächste Parlamentssitzung eine weitere Interpellation in Sachen Consten angekündigt ist, wendet sich Fürstenberg in seiner Not direkt an Staatssekretär von Kühlmann. Denn nun will auch die ungarische Regierung den enttarnten Agenten so schnell wie möglich loswerden. Handelsminister Szérenyi teilt mir soeben mit, dass Ministerpräsident dringend bittet, Consten umgehend Budapest abzuberufen. Falls dies nicht vor Wiederaufnahme Parlamentsverhandlungen geschieht, müsse man hier zur Ausweisung greifen. Bitte dringend, Consten abberufen zu lassen, da Folgen weiterer Interpellation für uns sehr unangenehm werden können und es nicht auf Ausweisung ankommen zu lassen. Handelsminister teilte mir ferner mit, dass militärische Untersuchung gegen Graf Károlyi im Gange sei. Károlyi-Partei sucht durch Breittreten Consten Affaire Aufmerksamkeit von Verfahren gegen ihren Parteiführer ab606 zulenken und Deutsche Reichsregierung in Sache hineinzuziehen.
Doch gibt sich die Abteilung IIIb, die sich ihrerseits über die vielen zurückgesandten Briefe ärgert, gegenüber dem Drängen des deutschen Generalkonsuls kühl. Ihrer Ansicht nach trifft das Generalkonsulat sehr wohl eine Mitverantwortung an dem Eklat: 335
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Mit Bezug auf die Mitteilung des Generalkonsulats an das ungarische Abgeordnetenhaus hat Consten in einem von ihm hier jetzt eingegangenen Bericht bemerkt, das Generalkonsulat selbst habe den Grafen Imre Károlyi zwecks Informationen über den Grafen Michael Károlyi an ihn – 607 Consten – verwiesen.
So wird die heiße Kartoffel namens „Major Konsten“ zwischen den verschiedenen Stellen hin- und hergeworfen, damit sich ja niemand an ihr die Finger verbrennt. Das Wiener Evidenzbüro, mit dem allmächtigen und gefürchteten Geheimdienstchef Oberst Max Ronge an seiner Spitze, hatte sich schon ziemlich früh für die auffallenden Umtriebe des Nachrichtenmannes Hermann Consten auf kakanischem Boden interessiert. Anfang 1918 hatte Ronge ein Dossier über ihn anlegen lassen, das sich im Österreichischen Kriegsarchiv 608 in Wien befindet. Nicht zuletzt die Tatsache, dass der deutsche Agent u.a. Dienste von Konfidenten in Anspruch nahm, die gleichzeitig für die österreichisch-ungarische Staatspolizei arbeiteten, aber auch seine Verbindungen zu Persönlichkeiten aus Ungarns Politik und Wirtschaft wurden aufmerksam registriert. Die Einschätzung des Budapester k.u.k. Militärkommandos war, dass Constens Berichte über die politische, wirtschaftliche und soziale Lage Ungarns als gut zu bezeichnen waren. Ganz offensichtlich gelangte er über seine Verbindungen an normalerweise nicht zugängliche Hintergrundinformationen – was den Österreichern natürlich gar nicht schmeckte. Außerdem stieß ihnen unangenehm auf, dass Consten seine Verbindungen mit den verschiedenen politischen und polizeilichen Stellen zu nutzen versuchte, um „einen gewissen Einfluss auf politisch relevante Angelegenheiten auszuüben“. Damit war vermutlich die Ausforschung des Grafen Mihály Károlyi gemeint. Dessen pazifistische Bestrebungen genos609 sen zwar auch bei Max Ronge keinerlei Sympathie, er war aber wohl zu Recht der Meinung, dieses Problem gehe die deutsche Seite nichts an. Derzeit sei Consten dabei, so der Observationsbericht aus Budapest an Ronge weiter, seine Kontakte noch weiter auszubauen und sogar „eine gewisse Aufsicht über die Tätigkeit der erwähnten Behörden auszuüben.“ Constens Schwachpunkte, die ihn letztlich auch zu Fall bringen sollten, waren den Österreichern ebenfalls nicht entgangen:
336
5. Enttarnt: Mihály Graf Károlyi und die „Affäre Konsten“
Nachdem jedoch Consten in der Wahl seiner Vertraunsleute nicht gerade wählerisch vorgeht und die Verlässlichkeit derselben mangels des dazu notwendigen Apparates gar nicht oder nicht genau erheben kann, wird er von denselben gar oft irregeführt – und sendet nach Berlin mitunter ganz falsche Berichte. So stammt der Bericht über die Bildung des hiesigen Arbeiter- und Soldatenrates […] zweifellos von Consten und ist fast 610 durchwegs falsch.
Die Wiener Consten-Akten sind nicht nur deshalb von großem Interesse, weil die ihn betreffenden Dokumente der Abteilung IIIb nach deren Auflö611 sung Ende 1918 oder Anfang 1919 vernichtet worden sind. Aus einigen der in Wien noch vorhandenen Schriftstücke lässt sich darüber hinaus nachvollziehen, welche Eiertänze zum Beispiel der ungarische Kriegsminister Szurmay vollführt hat, um seine Verwicklung in die Affäre Consten zu vertuschen. Schon Wochen vor dem Eklat im Parlament wurden Anfragen aus Wien nicht mehr beantwortet. Der Hónved-Minister hoffte wohl, dass Gras über die Sache wachsen würde. Dann gingen Schreiben auf dem Dienstwege angeblich verloren oder waren im Ministerium nicht mehr auf612 findbar. Erst im August 1918 bequemte sich Szurmay, auf mehrmaliges Nachkarten des Evidenzbüros, Auskunft zu geben, ob und in welcher Weise Ungarns Kriegsministerium mit Consten in Verbindung gestanden hat. Es war eine pflaumenweiche Antwort. Auf Zuschrift Na. Nr. 8321 vom 11. April 1918 beehre ich mich mitzuteilen, dass das unter meiner Leitung stehende Ministerium mit dem reichsdeutschen oder türkischen Staatsangehörigen Hermann Consten niemals in Verbindung stand, ich bin daher nicht in der Lage über dessen Beschäftigung und Tätigkeit irgend ein Urteil zu geben, verweise jedoch auf die in dieser Angelegenheit am 11. Mai d. J. durch den Abgeordneten Urmánczy an den Ministerpräsidenten gerichtete Interpellation und die hierauf am selben Tage erteilte Antwort des Ministerpräsidenten. Wie mir im kurzen Wege bekannt wurde, hat das Militärkommando Budapest vor kurzem über die Tätigkeit des Consten an das AOK und an das KM berichtet. gez. Szurmáy
Nach vielem Hin und Her hatte Consten Budapest schließlich am 1. Juni 613 1918 verlassen und war nach Berlin gereist. Am 19. Juni stand sein Fall in 337
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
der Reichshauptstadt auf der Tagesordnung einer Besprechung der beiden Leiter der Nachrichtenabteilungen des k.u.k Oberkommandos und des deutschen Generalstabs, Ronge und Nicolai. Nachdem die Herren mit ihren jeweiligen Offiziersstäben eine Reihe anderer Fragen, wie die Revision der Nachrichtendienste gegen Italien und Russland, die Auswertung von Beuteakten, Nachrichtendienste fremder Heere etc. besprochen hatten, befassten sie sich unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges, Nr. 4“ mit dem Fall Consten. Das Protokoll dieser Sitzung vermerkt dazu folgendes: Der in Budapest platzierte angebliche deutsche Offz. Hermann Konsten, welcher als mittelbare Folge einer Anfangs Mai d. J. eingebrachten Inter614 pellation im kgl. Ung. Reichstag seitens der DOHL abberufen wurde, ist einfacher Landsturmmann und tatsächlich als Vertrauensmann des Stellvertretenden Generalstabes, mit dem Sitze in Budapest, tätig gewesen. Obstlt. Nicolai gibt bekannt, dass die Abberufung Konstens von Budapest bereits vor den Aufsehen erregenden Zeitungsnotizen beabsichtigt war, jedoch über Ersuchen des kgl. ung. Landesverteidigungsministers Exz. v. Szurmay aufgeschoben worden war. Konsten ist nicht Offizier. Ihm wurde deutscherseits wiederholt verboten, die Titulatur eines Nachr. 615 Offz. und Majors anzunehmen.
Doch war damit der Fall, der die Beziehungen der beiden verbündeten militärischen Nachrichtendienste wie auch der Außenministerien zumindest zeitweise erheblich belastet hatte, noch nicht gänzlich beigelegt. Nur einen Monat nach seiner Abreise klingelten im Juli in Budapest und Wien erneut einige Alarmglocken. Denn Hermann Consten war wieder aufgetaucht – allerdings „im strengsten Incognito“, wie die Polizeiabteilung des ungarischen Innenministeriums den deutschen Generalkonsul zur Beruhigung wissen ließ. Mit anderen Worten, Consten hielt sich unter anderem Namen in Budapest auf. Sein gefälschter Pass – er lautete vermutlich auf den Namen „Dr. Claudy“, unter dem Consten nach Kriegsende eine zeitlang in Thüringen lebte – war ihm offenbar von der Abteilung IIIb ausgestellt wor616 den. Der Generalkonsul wusste auch noch nach Berlin zu melden, die Partei der Nationalen Arbeit des Grafen Tisza stehe einer Wiederaufnahme der Tätigkeit Constens gegen Károlyi aus eigennützigen Gründen sympathisch gegenüber, da sie unter allen Umständen 338
5. Enttarnt: Mihály Graf Károlyi und die „Affäre Konsten“
Károlyi zur Strecke bringen und natürlich lieber sehen möchte, dass sich dabei ein Reichsdeutscher als ein eigener Parteigänger Finger ver617 brennt.
Jetzt fühlten sich sogar die Türken, auf entsprechende Demarchen seitens des ungarischen Außenamtes, bemüßigt, die Frage des Offiziersrangs des obskuren deutschen Geheimdienstmannes zu klären. Der Vertreter des Osmanischen Reiches in Budapest, Konsul Hikmet Bey, erhielt auf seine diesbezügliche Anfrage vom Außenministerium in Konstantinopel folgende Rückmeldung: Ministère de la Guerre me fait savoir, que “Hermann Consten” n’est nullement officier ottoman et ajoute que le consulat pourrait, s’il y a lieu, ré618 pondre dans ce sens à toute demande qui lui serait faite à son sujet.
Also hatte auch Enver Pascha den zur Belastung gewordenen „Major“ endgültig fallen gelassen. Es hieß dann zwar schließlich von seiten des deutschen Generalstabs, Consten sei nur „zur Erledigung seiner persönlichen Angelegenheiten“, insbesondere zur Auflösung seines Haushalts, noch einmal nach Budapest zurückgekehrt. Doch Graf Fürstenberg, der offenbar nicht einmal Constens Adresse kannte und natürlich auch nicht mit der Beantragung eines Visums für ihn befasst gewesen war, traute dem Braten nicht. Er war fast hysterisch bemüht, ihn so schnell wie möglich wieder loszuwerden und sein Konsulat von der Affäre Consten „reinzuhalten“, wie er sich in einem Schreiben an das Auswärtige Amt ausdrückte. Er drohte sogar damit, Constens Ausweisung höchstpersönlich bei der ungarischen Regierung zu beantragen, falls dieser etwa doch die Absicht habe, zu blei619 ben. Die Österreicher waren wieder einmal besser informiert und hatten schnell herausbekommen, dass Consten in seiner alten Wohnung in der Nagy-Janos utca Nr. 8 lebte. Sein Geheimtelefon 48-12 Nobud funktionierte auch noch, und er hatte wohl wieder „Verbindung mit seinen bisherigen 620 Konfidenten aufgenommen“. Schließlich verschwand er dann doch. Bevor die Gluthitze des fünften Kriegssommers die staubigen Straßen Budapests leerfegte und die ungarische Hauptstadt in graue Lethargie versinken ließ, als schließlich seine adligen Gönner und Geldgeber, all die Drahtzieher gegen Mihály Graf Károlyi, auf ihre Schlösser und Landgüter in die pannonische Tiefebene, an 339
III. Codes und Camouflagen 1914–1918
Theiß und Drau, nach Transsylvanien oder ins westungarische Burgenland abgereist waren, machte sich auch Hermann Consten auf den Weg, zurück nach Deutschland. Was den meisten, die ihn seit seiner Rückkehr nach Budapest beschattet hatten, jedoch entging: Hermann „Etzel“ Consten alias „Dr. Claudy“ verließ die ungarische Hauptstadt nicht allein. In seiner Begleitung befand sich Emma, seine schöne Gräfin und Geliebte. So hatte er allen, die ihn nicht mehr in Ungarn haben wollten, doch noch ein Schnippchen geschlagen. Zum Schluss dieses Kapitels noch ein kleiner Nachtrag der Autorin: Die „Affäre Konsten“ ließ sich nur anhand der amtlichen Quellen, ihrer Darstellung in der Budapester und Wiener Presse, und in den Memoiren des Hauptbetroffenen, Mihály Graf Károlyi – wenige Monate später erster Präsident der Republik Ungarn – einigermaßen rekonstruieren. Auch Paul Kéri, der falsche „Privatsekretär“, soll darüber geschrieben haben. Doch Constens eigene Sicht bleibt uns verschlossen. Die ruhmlose Geschichte von seiner Enttarnung gehörte zeit seines Lebens zu den Geheimnissen, über die er beharrlich schwieg. Offen bleiben muss vorerst auch die Frage, ob Gräfin Emma tatsächlich nur aus Liebe zu „Etzel“ aus Ungarn verschwand. Vielleicht hatte sie ja, nach dessen Enttarnung, weit schwerer wiegende Gründe, eine Zeitlang unterzutauchen und ihre Kinder in der Obhut von Verwandten zurückzulassen. Man kann nicht ausschließen, dass sie ebenfalls zu den Informanten des Geheimagenten Hermann Consten gehört hatte.
340
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927 1. „Dr. Claudy“ – Constens Neubeginn als Privatgelehrter In den Hochsommertagen des Jahres 1918, etwa zu der Zeit, als Hermann Consten gemeinsam mit seiner ungarischen Gefährtin Budapest den Rücken gekehrt hatte, reifte bei der Obersten Heeresleitung die Erkenntnis, dass der Krieg für das Deutsche Kaiserreich und seine Verbündeten nicht mehr zu gewinnen war. Es galt nicht nur, Friedensfühler auszusenden, man musste auch die eigene Bevölkerung langsam auf die unausweichliche Niederlage einstimmen. Angesichts systematischer Unterschlagung unangenehmer Wahrheiten über wechselndes Schlachtenglück und wirtschaftli621 chen Niedergang in der straff zensierten deutschen Presse war dies jedoch kaum noch zu leisten. Entsprechend groß war die allgemeine Überraschung, als General Erich Ludendorff Ende September eine neue Reichsregierung unter Einbindung der Mehrheitsparteien verlangte. Diese, nicht die Heeresleitung, sollte dann das Waffenstillstandsersuchen an die Entente richten. Mit der Abschiebung der Verantwortung für das Kriegsdesaster an Regierung und Parlament war auch das Ende der durch das Militär gestützten Monarchie absehbar. Für die junge Republik sollte sich die Übernahme 622 dieser Verantwortung noch als schwere Hypothek erweisen. Längst gärte es im Lande. Vor allem in Arbeiterkreisen und in den Kasernen der Etappe hatte die Obrigkeit verspielt und jeglichen Respekt verloren. In den größeren Städten kam es immer öfter zu Streiks und blutigen Auseinandersetzungen. An den Kriegsfronten in Ost und West, und vor allem bei der kaiserlichen Kriegsmarine, bildeten sich Soldatenräte, mehrten sich Gehorsamsverweigerung und Desertion. Der Militärgeheimdienst, der jeden Protest im Innern nur als feindliche Spionage wahrzunehmen verstand, wähnte sich in einem Zweifrontenkrieg gegen äußere und innere 623 Feinde, der seine Kräfte zu überfordern drohte. Nur unter dem Druck der Verhältnisse bequemten sich Politiker und Hofkreise, über allfällige Reformen nachzudenken. Dem geschundenen Volk in Zukunft weitergehende Rechte und aktive politische Teilhabe zuzugestehen, schien das Mindeste zu sein, um eine Revolution wie die, mit der in Russland die Zarenherrschaft 1917 hinweggefegt worden war, auf deutschem Boden noch in letzter Minute zu verhindern. Doch für kosmetische Verbesserungen, wie die 341
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
versprochene Ersetzung des Dreiklassen-Wahlrechts durch freie und geheime Wahlen zum Reichstag, war es eigentlich schon zu spät. Bei dem „revolutionären Brand“, den man jahrelang in den muslimischen Einflussgebieten der Feinde zu entfachen versucht hatte, beim Schüren des „Heiligen Krieges“, beim Fördern und Finanzieren politischer wie religiöser ausländischer Fanatiker, hatte man geflissentlich übersehen, dass am eigenen Haus die Lunte auch schon glimmte – ohne Zutun feindlicher Mächte, vielmehr durch selbstverschuldete Versäumnisse. Die Explosion stand unmittelbar bevor. Auch Hermann Consten muss nun ernsthaft nachdenken. Er wusste lange nicht, wie es nach seiner Enttarnung als Geheimagent und angesichts der Änderung seiner persönlichen Lebenssituation weitergehen sollte. Wovon sollten „Herr Dr. und Frau Claudy“ in Zukunft leben – und wo? Immerhin scheint die Abteilung IIIb ihren einstigen Budapester V-Mann nicht gänzlich fallengelassen zu haben, sodass zunächst Berlin durchaus noch als künftiger gemeinsamer Wohnort in Frage kommt. In Hermann Constens Schublade haben sich inzwischen diverse Buchmanuskripte angesammelt, die er – sollte der Krieg tatsächlich zu Ende gehen – endlich fertig stellen und veröffentlichen kann. Auch ist es an der Zeit, seine Vermögensverhältnisse in Aachen mal wieder näher in Augenschein zu nehmen, eine Auszahlung der ihm zustehenden Gewinnanteile aus der Consten-Brauerei durchzusetzen. Anfang November 1918 reist er mit Emma in seine Heimatstadt. Er präsentiert seine aristokratische Gefährtin der Familie und den Aachener Freunden – als seine Frau. Ganz offensichtlich ist man beeindruckt von dieser ungarischen Gräfin, hofft wohl auch insgeheim, dass sie dem mittlerweile Vierzigjährigen endlich gesittete Manieren und Freude an einem geordneten, häuslichen Dasein beibringen wird. Mit der Stiefmutter und Bruder Franz, den beiden Geschäftsführern der Adler Brenn- und Brauerei, setzt sich Hermann Consten über eine finanzielle Regelung auseinander. Dies erweist sich jedoch als schwierig, denn die Kriegsjahre waren schlecht fürs Geschäft gewesen. Consten kann von dort also nicht allzu viel erwarten. Seine Familie geht wohl auch nicht zu Unrecht von der Annahme aus, dass Emma eigentlich recht vermögend sein müsste. Sie dürfte also, wenn alles mit rechten Dingen zugegangen ist, einiges mit in die Ehe gebracht haben. 342
1. „Dr. Claudy“ – Constens Neubeginn als Privatgelehrter
Den Sturz der Monarchen und Duodez-Fürsten des Deutschen Reiches, die schließliche Absetzung Kaiser Wilhelms II., die Ernennung des Sozialdemokraten Friedrich Ebert zum Vorsitzenden des Rats der Volksbeauftragten und schließlich den Tag des Waffenstillstands am 9. November, die Flucht des Kaisers nur einen Tag später und die Besiegelung der Kapitulation am 11. November erlebt das Paar in wachsender Bestürzung in Aachen. Beunruhigend sind auch die Nachrichten aus Budapest. Bereits im Oktober hatte Ungarn seine Revolution erlebt. Ein „Ungarischer Nationalrat“ aus Bürgerlich-Radikalen und Sozialdemokraten, der den sofortigen Abschluss eines Sonderfriedens und staatliche Unabhängigkeit forderte, stand nach dem Rücktritt des Kabinetts Wekerle bereit, die Regierungsverantwortung zu übernehmen. In den Gewehren der Aufständischen steckten weiße Herbst-Astern – zum Zeichen, dass ein unblutiger Herrschaftswechsel beabsichtigt war. Einzig Constens Gönner, István Graf Tisza, fiel am 31. Oktober einem Mordanschlag zum Opfer, am gleichen Tag, an dem ausgerechnet der Mann auf den Schild gehoben und zum neuen Ministerpräsidenten ernannt wurde, an dem Consten so kläglich gescheitert war: Mihály Graf Károlyi. Ihm, der schon am 16. Oktober im Parlament den Krieg für verloren erklärt hatte, vertrauten sie die politische Verantwortung für ihr Land an. Als Erstes hatte der Pazifist Károlyi nichts Besseres zu tun gewusst, als die in der k.u.k.-Armee dienenden ungarischen Soldaten umgehend nach Hause zu holen. Damit waren die Niederlage des österreichischen Verbündeten und das Ende der Doppelmonarchie besiegelt. Nachdem König Karl am 11. November seinen Verzicht auf den ungarischen Thron erklärt hatte, prokla624 mierte Károlyi am 16. November 1918 die Republik. Interessiert Hermann Consten das alles jetzt noch? Es ist eine neue Lage in Ungarn entstanden, gut. Doch dürfte sich Károlyi nach seiner Einschätzung kaum lange an der Macht halten können. Wichtiger ist in jedem Fall, erst einmal die eigene Haut zu retten. Wenn in Budapest diejenigen die Zügel in die Hand bekommen haben, die er mit der Inszenierung von Lügenkampagnen und Intrigen bekämpft hatte, muss Consten Racheakte befürchten. Abtauchen, Unauffälligkeit und Anpassung sind das Gebot der Stunde. Auch Emma gilt es zu schützen. Sie beide sollten die weitere Entwicklung also besser im Verborgenen abwarten. Mit besonderer Dringlichkeit stellt 343
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
sich für Consten die Zukunftsfrage, als er wenige Tage später erfahren muss, dass der deutsche Militärgeheimdienst, die Abteilung IIIb, zu den 625 Formationen gehört, die sich als Erste in Nichts aufgelöst haben. Durch den Wegfall seiner Auftraggeber ist der kleine Agent im Großen Krieg praktisch arbeitslos geworden. Die bürgerkriegsähnlichen Unruhen in Berlin lassen es überdies angezeigt erscheinen, vorerst nicht dorthin zurückzukehren. Doch auch in Aachen kann er nicht bleiben, nachdem am 17. November die ersten belgischen Besatzungstruppen im Dreiländereck einmarschiert sind. Richtig gefährlich wird es für ihn, als kurz darauf in seiner Heimatstadt eine belgische Kommandantur eingerichtet wird und erste Anordnungen an die Bevölkerung ergehen. Consten weiß wohl zu genau, dass er, der einstige témoin de l’Empereur, „Zeuge“ angeblicher belgischer Kriegsgreuel im Jahr 1914, nicht vergessen ist. Dass er auf der schwarzen Liste der Belgier steht, ist so gut wie sicher; also muss er so schnell wie möglich aus Aachen verschwinden. „Gestern vor zehn Jahren fuhr ich mit E. aus Aachen fort und landete in Blbg.“ In einer späten Rückblende auf seine Jahre mit Emma, während seiner letzten Mongolei-Expedition Ende der zwanziger Jahre, fand sich unter dem 26. November 1928 dieser Tagebucheintrag Hermann Cons626 tens. Er ist der einzige Hinweis von Constens Hand auf jene Krisentage unmittelbar nach Kriegsende. Das Paar verließ Aachen also am 25. November 1918. Hinter der Abkürzung Blbg. verbirgt sich, wie die Fülle aus den zwanziger Jahren datierender Briefe an mehrere Adressaten und persönliche Erinnerungen von Zeitzeugen belegen, ein kleiner Kurort im Thüringer Wald: Bad Blankenburg an der Schwarza. Offenbar ein idealer Ort zum Untertauchen für einen Mann, der nicht nur bei einem fremden Geheimdienst auf der Abschussliste steht. Auch die Russen und die Engländer fahnden nach ihm. Persien hat ein auf zehn Jahre befristetes Einreiseverbot gegen 627 ihn verhängt. Niemand im Ort kennt jenen ergrauten Privatgelehrten Dr. Claudy und die aparte junge Frau, die dort Ende November 1918 unterhalb der Ruine der Burg Greifenstein eine Etage in der „Villa zu den Bergen“, Esplanade 265 (Nr. 11), beziehen. Von dem gediegen wirkenden Haus, das einem Baron von Qillfeldt gehört, hat man einen hübschen Blick auf den unterhalb des Hanges liegenden Ort mit seinem altdeutschen Dächergewirr, seinen 344
1. „Dr. Claudy“ – Constens Neubeginn als Privatgelehrter
Fachwerkhäusern, rund um ein Kirchlein mit barocker Turmhaube geschart. Und jenseits des Tals weitet sich der Blick auf einen bewaldeten Höhenzug. Es ist das reine Idyll, so scheint es. Ein ideales Liebesnest für ein frisch vermähltes Paar. Man richtet sich gemütlich ein, feiert dort das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel 1919 eher still. Derweil toben in Berlin, nach der Absetzung der Volksbeauftragten durch den linkssozialistisch dominierten Allgemeinen Rätekongress, blutige Kämpfe um die Macht über das seiner Monarchen und seines Kaisers entblößte Reich. Nach der Beschreibung von Klaus Strölin, dessen Mutter die Blankenburger Wohnung ab dem Frühjahr 1927 hütete, auch nach der Schilderung eines jungen Mannes in Bad Blankenburg, dessen Großeltern Constens ehemalige Wohnung zu DDR-Zeiten bewohnt haben, außerdem anhand ei628 nes Artikels mit Foto im Greifenstein-Boten und nicht zuletzt nach meinen persönlichen Eindrücken von einem Besuch in Bad Blankenburg, wo das Haus heute noch steht, lässt sich in etwa rekonstruieren, wie es dort ausgesehen hat. Zwar war dies kein Schloss oder elegantes Stadtpalais wie es Emma aus ihrer ungarischen Heimat gewohnt gewesen sein mochte. Aber es war immerhin ein größeres Haus mit drei Etagen, hölzernen, teilweise überdachten Balkonen und einer verglasten Terrasse im Erdgeschoss. Die Claudys alias Constens beziehen diese untere Etage. Sie bietet mit fünf Zimmern reichlich Platz für die afrikanischen und mongolischen Sammlungen des Hausherrn, der – wie es im Greifenstein-Boten so sinnig hieß – „mit diesem kleinen Völkerkundemuseum seiner Freundin ein Nest einrich629 ten“ wollte, sowie für seine umfangreiche Bibliothek. Wenn man eintrat, stand man in einer Art Vorhalle, deren Wände mit ostafrikanischen Massai-Schildern, gekreuzten Speeren, Masken, Bogen und Pfeilen dekoriert waren. […] In der Mitte des Raumes standen zwei riesige Globen, ein Erd- und ein Himmelsglobus. In den übrigen Zimmern gab es exotische Dinge aus aller Welt. Buddha- und Götzenfiguren aus Bronze oder Marmor und Ähnliches. Auch schmückten zahlreiche 630 Waffen die Wände.
Einen Teil der Einrichtung erwirbt das Paar aus der Versteigerung eines thüringischen Schloss-Inventars. Es sind schwere Sitzmöbel aus Edelholz mit Intarsien und ein runder Esstisch, dazu passend zwei Sessel mit intar345
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
sierten Wappen und ein Himmelbett aus Mahagoni mit goldbestickten blauen Vorhängen. Noch vorhanden ist die Aufrisszeichnung für eine Kartothek, eine von einer Marmorplatte bedeckte Kommode zur Aufbewahrung der beachtlichen Sammlung mongolischer und chinesischer Landkar631 ten des Hausherrn. Die Kartothek, eine geheimnisvolle Truhe, die beiden Globen und die schweren Sessel standen vermutlich in der Bibliothek, in der Hermann Consten auch seine Gäste empfing, so z.B. im Februar 1925 den mongolischen Volksbildungsminister Erdene Batchaan. Die hohen Wände stattet ein ansässiger Schreiner bis unter die Decke mit Bücherregalen aus. Alles wirkt vielleicht etwas düster, aber durchaus eindrucksvoll – eine angemessene Klause für einen Privatgelehrten, als der er nun öffentlich in Erscheinung tritt. Auffallend fröhlich dagegen das „Reich der Hausfrau“, die Küche im Thüringer Bauernstil. Der große Küchenschrank, die Anrichten und Gläserregale sind grün gestrichen, mit roten Einfassungen und Bauernmalerei – religiöse Motive, Ornamente und Ranken. Die Küche erfüllt auch heute noch in Strölins Sommerhaus oberhalb Esslingens ihren Zweck. Im Sommer wurde laut Klaus Strölin, bei dem auch das Esszimmer heute noch steht, allerdings nicht dort, sondern auf der verglasten Terrasse gegessen, die auf den Garten hinausging. Dass das Paar sich auch um den Garten kümmerte, beweist ein Brief Hermann Constens nach Witzenhausen, in dem er nach einem bestimmten Schädlingsbekämpfungsmittel aus Harnstoff fragte, welches ein Absolvent der Kolonialschule erfolgreich zur Schädlingsbekämp632 fung in Ägypten eingesetzt hatte. Das ganze Jahr 1919 über ist man also hinreichend beschäftigt, in der veränderten Lage Fuß zu fassen, das Zusammenleben unter einem Dach zu erproben und neue Bekanntschaften zu knüpfen. Thüringen ist keineswegs ein Hort der Ruhe, wie sich bald zeigt. Das Land mit seiner noch weitgehend vom 19. Jahrhundert geprägten Industriestruktur hat besonders unter 633 den Folgen des Weltkriegs zu leiden. Die großherzogliche Regierung in Weimar hatte bereits am 8. November 1918, einen Tag vor der Ausrufung der ersten Berliner Republik durch Philipp Scheidemann, zwei Tage vor der Flucht Kaiser Wilhelms II. ins holländische Exil, das Handtuch geworfen. Auch in Thüringens Städten hatten Arbeiter- und Soldatenräte das Ruder übernommen. Hochburgen der revolutionären Bewegung waren die Indus346
1. „Dr. Claudy“ – Constens Neubeginn als Privatgelehrter
triestandorte Gotha und Eisenach. In Sondershausen und Rudolstadt, den Residenzstädten des Fürsten Günther von Schwarzburg, hatten die Landtage mit der absoluten Mehrheit der Sozialdemokraten Ende November 1918 die Abdankung dieses letzten noch regierenden Fürsten auf deutschem Bo634 den durchgesetzt. Beide Fürstentümer wurden zu Freistaaten erklärt. 1920 sollten sie sich gemeinsam mit den sechs übrigen ehemaligen Fürstentümern Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Gotha sowie Reuß ältere und jüngere Linie zum Land Thüringen zusammenschließen. Doch vorher noch tagte ab Januar 1919 im Weimarer Nationaltheater wochenlang die verfassunggebende Versammlung der jungen Republik unter dem militärischen Schutz eines Freikorps, des Landesjägerkorps unter General Maercker. Am 14. August trat dann zwar eine der freiheitlichsten Verfassungen des damaligen Europa in Kraft. Doch die Zersplitterung der deutschen Parteienlandschaft, der mangelnde Rückhalt des Demokratiegedankens in weiten Kreisen der Bevölkerung und der Notstandsartikel 48, der dem Reichspräsidenten im Falle der Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nahezu diktatorische Vollmachten einräumte, untergruben schon bald das freiheitliche Fundament dieser Verfassung. Mitten hinein in die Weimarer Theateridylle waren im Mai die Bedingungen der Siegermächte für den Abschluss eines Friedensvertrags mit Deutschland geplatzt. Die Forderung, das deutsche Reich müsse sich zu seiner Schuld am Kriegsausbruch bekennen und Reparationszahlungen in Milliardenhöhe leisten, es müsse Gebiete an seinen westlichen und östlichen Grenzen abtreten und die Zahl seiner Streitkräfte drastisch reduzieren, löste große all635 gemeine Empörung aus. Consten braucht viel innere Geduld, vor allem nach Bekanntwerden der als zutiefst schmachvoll und ungerecht empfundenen Bedingungen des Versailler Vertrages, die revolutionären Stürme, welche die ungefestigte Weimarer Republik in ihren Anfängen erschüttern, einfach so an sich vorüberziehen zu lassen. Gelegentlich ist er in Berlin, wo der renommierte geographische Verlag Dietrich Reimer (ehem. Ernst Vohsen) die Veröffentlichung seines Mongolei-Buches „Weideplätze der Mongolen“ übernommen hat, das er schon in seiner Budapester Zeit hatte herausbringen wollen. Noch im Herbst 1919 erscheint der erste Band unter Constens richtigem Namen. Der zweite 347
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
Band soll 1920 folgen. Den Namen Claudy scheint er übrigens nur so lange verwendet zu haben, bis der auf diesen Namen ausgestellte Pass seine Gültigkeit verlor. Eine zeitlang benutzt er noch, wohl um sich in dem kleinen Bad Blankenburg nicht verdächtig zu machen, übergangsweise den Doppelnamen Consten-Claudy, um schließlich ganz zu seinem rechtmäßigen Familiennamen zurückzukehren. Allerdings dekoriert er ihn nun mit dem akademischen Titel, an den er sich im kakanischen Ungarn offenbar gewöhnt hat. Dort dürfte ihn jeder Ober, der ihm auch nur einen Kaffee servierte, so tituliert haben. Im Bad Blankenburger Einwohnerverzeichnis von 1925 ist er als Consten, Dr. Hermann, Forschungsreisender, Esplanade 265 636 und mit seiner Fernsprechnummer 42 eingetragen. Ab Beginn der Zwanziger Jahre, etwa in der Zeit, als er auch das Fürstenporträt in Auftrag gab, entwickelte Consten ein auffallendes Interesse an seiner Herkunft. Er beauftragte einen Berliner Genealogen, in Aachen nach Kirchenbüchern und Urkunden suchen zu lassen und einen Stammbaum der Constens anzufertigen. Die familiengeschichtlichen Nachforschungen zogen sich über längere Zeit hin. Erhalten sind mehrere Briefe aus dem Jahr 1922, die bis dahin offenbar unbefriedigenden Ergebnisse der Suche nach Constens Vorfahren betreffend. Das Resultat war aber schließlich doch ein bis ins 18. Jahrhundert zurückreichender handgeschriebener Stammbaum der Constens. Dieser ist insofern interessant, als er zwar die beiden Ehen des Vaters anführt, die aus diesen Ehen hervorgegangenen neun Kinder aber unterschlägt – bis auf einen: Dr. phil. Hermann Consten, 637 geboren zu Aachen 1878.
2. Wissenschaftler oder Karl-May-Verschnitt? Das Erscheinen der Weideplätze der Mongolen. Im Reiche der Chalcha – zwei großformatige, reich mit Bildmaterial und von Consten selbst angefertigten Landkarten versehene Bände – findet allgemeine Aufmerksamkeit. Sogar die Crème der deutschen Zentralasienforschung, bei der Hermann Consten zuvor ein Unbekannter war, nimmt von diesem aufwendig gestalteten Werk Notiz. Angesichts der Fülle der in den zwanziger Jahren auf dem deutschen Markt erscheinenden populärwissenschaftlichen Reise- und Abenteuerliteratur dürfte es keineswegs einfach gewesen sein, sich als ein zumindest einigermaßen seriöser Autor zu etablieren. Nach dem verlorenen 348
2. Wissenschaftler oder Karl-May-Verschnitt?
Krieg, der auch das Ende deutscher Welteroberungs- und Kolonialträume bedeutete, waren es wohl vor allem die Bücher Sven Hedins, die das bis dahin weitgehend unbekannte Zentralasien in den Mittelpunkt der Faszination einer breiten Leserschaft rückten. Im Kielwasser der schon seit Jahren in hohen Auflagen auf dem deutschen Markt erscheinenden Werke des schwedischen Forschungsreisenden finden weitere Autoren wie Wilhelm Filchner, Fritz Mühlenweg und Ferdinand Lessing – Teilnehmer späterer Hedin-Expeditionen – ebenfalls ihr Lesepublikum. Sogar die eher reißerisch 638 aufgemachten Bücher des Polen Ferdinand Ossendowski, vor allem seine Bücher Tiere, Menschen und Götter (deutsche Ausgabe 1923) und In den Dschungeln der Wälder und Menschen (1924) verkaufen sich blendend. So profitiert Hermann Consten, zumindest zeitweise, mit seinen Büchern über die Mongolei ebenfalls von diesem Trend. Dabei ist die zweibändige Ausgabe der „Weideplätze“ alles andere als preiswert. 105 Reichsmark muss 639 man 1920 für sie im Buchhandel bezahlen. Die abschließende Arbeit am Buch und seine Veröffentlichung in dem angesehenen Berliner Verlag hatten Consten in Kontakt mit den führenden Herren des Berliner Völkerkundemuseums gebracht. Er hatte Albert von LeCoq, Friedrich Karl Müller und Albert Grünwedel wohl häufiger aufgesucht, um bestimmte Fragen zu klären, zum Beispiel zu den Wechselbeziehungen der Religionen in Zentralasien und den Wurzeln der geheimnisvollen Darstellungen des tantrischen Buddhismus. Besonders mit Grünwe640 del pflegte er Verbindung und zählte ihn bald schon zu seinen engeren Freunden. Das Renommé dieser Forscher war durch mehrere Expeditionen in das Turfan-Gebiet zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die Sicherstellung wichtiger buddhistischer wie auch vorbuddhistischer Funde für die Berliner Museen – Fresken aus den Höhlentempeln der Turfan-Senke und zahllose Handschriften – begründet worden. Grünwedels besonderes Interesse an Constens Werk spiegelt sich unter anderem darin, dass er für die grafische Gestaltung der Buchdeckel der beiden Bände die Vignetten zweier von ihm selbst gezeichneter tanzender Skelette überlassen hat, die zum Bestand des Völkerkundemuseums gehörten. Die in Schweinsleder gebundene Luxusausgabe der „Weideplätze“ konnte Consten sogar mit farbigen Einbandentwürfen Grünwedels schmücken lassen; sie zeigen allerdings tibetische, keine mongolischen Klosteranlagen. Ei349
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
nes dieser Prachtexemplare, samt Grünwedels Original-Aquarellen, ist im Consten-Nachlass noch vorhanden. Bei seiner ausführlichen Beschreibung der Innenausstattung des großen Majdar-Tempels der Klosterstadt Ich Chüree im zweiten Band seiner „Weideplätze“ nimmt Consten sogar ausdrücklich auf Grünwedels Erläuterungen zur buddhistischen Ikonographie 641 und ihrer Symbolik Bezug. Bei soviel Entgegenkommen verwundert es nicht, dass Grünwedel seinerseits die „Weideplätze“ als „wertvolles 642 Buch“ bezeichnet hat. Auch hat ihm Grünwedel einiges an Fachliteratur überlassen. Jedenfalls finden sich unter den wenigen, heute noch vorhandenen Büchern aus der einst mehrere tausend Titel umfassenden Consten’schen Bibliothek zwei, die den Eigentumsvermerk „Grünwedel“ tragen, unter ihnen ein nicht aufgeschnittenes Exemplar des Berichts von John Bruce 643 Norton über den Sepoy-Aufstand in Indien 1857. Constens Art zu schreiben, eine eher lockere Mixtur persönlichen Erlebens, gepaart mit seriöser Hintergrundinformation aus ungenannten frem644 den Quellen, kommt beim breiten Publikum offenbar an. Sprachlich geschickt springt er in den „Weideplätzen“ von epischen Beschreibungen der Steppen-, Wüsten- und Gebirgslandschaften, der Tierwelt und des wechselnden Wetters unvermittelt zu atemlos abgehackter „Live-Berichterstattung“ von den Brennpunkten kriegerischen Geschehens mit kurz eingestreuten historischen Rückblenden, von seinen persönlichen, wortreich ausgeschmückten Jagd- und Reiseabenteuern zu mehr oder weniger tiefschürfenden Unterhaltungen mit Nomaden, Mönchen, Händlern und Fürsten, von der Wiedergabe seiner Tagebuchnotizen im Telegrammstil, einschließlich der zweimal täglich abgelesenen Geo-Messdaten, zur nüchternen, gelegentlich etwas langatmigen Auflistung von Warenpreisen der chinesischen und russischen Händler auf den mongolischen Märkten – letztere ganz offensichtlich Teile seiner 1912/13 für die Brüder Mannesmann erstellten Evaluierungsberichte. Als in sich geschlossene Kapitel stehen sie jedenfalls wie sperrige Felsblöcke im Erzählfluss. Neben dem insgesamt aber recht munteren Reportagestil beeindruckt das Bildmaterial der „Weideplätze“ ganz besonders. Die 127 Schwarz-Weiß-Aufnahmen der beiden Bände weisen in ihrer technischen Brillanz und künstlerischen Qualität Hermann Consten als einen überaus begabten Fotografen aus. Der hohe dokumentarische Wert des Bildmaterials verleiht dem Autor dieses repräsentativen 350
2. Wissenschaftler oder Karl-May-Verschnitt?
Werks über die Mongolei selbst dann noch Glaubwürdigkeit, wenn seine Schilderungen gelegentlich überborden und ins Angeberische oder Phan645 tastische abzugleiten scheinen. Auch das als Supplement mitgelieferte Kartenwerk – darunter eine von Consten unter Heranziehung russischen Kartenmaterials bearbeitete, detaillierte Karte der Weideplätze der Mongolei zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ist ein eindrücklicher Beleg dafür, dass er zumindest sein Handwerk als Kartograf hervorragend verstand. Eingetragen sind alle damals existierenden städtischen Siedlungen, Grenzwachtposten und Poststationen. Auch wichtige Karawanenrouten und Pässe, Lager, Brunnen und Quellen, Klöster und Tempel, ja sogar die Ruinen alter Kloster- und Stadtanlagen sind eingezeichnet. Und schließlich – als Vorboten der Moderne – enthält sie die einzige durch das Chalch-Gebiet führende Telegrafenlinie, vom chinesischen Kalgan über Urga nach dem russischen Kjachta, wie auch die einzige damals existierende Eisenbahnlinie der von Sibirien kommenden Mandschurischen Eisenbahn, die auf der Strecke von Südsibirien über Chajlar nach Peking in der Gegend des Oberlaufs von Argun- und Chajlar-Fluss den äußersten Ostzipfel der Mongolei durchquerte. Das dem zweiten Band beigefügte Blatt ist eine topografische Karte, die sich in einem breiten West-Ost-Streifen auf die nähere Umgebung des Reisewegs Constens von Bijsk über Uliastaj nach Urga und wieder zurück über Chovd, den Altaj und die russisch-mongolischen Grenzgebirge beschränkt, den er selbst 1911/12 systematisch vermessen hat. Für Historiker und Geopolitiker, die wie Karl Schlögel „im Raume die Zeit“ zu lesen verstehen, dürften diese beiden Mongolei-Karten von großem wissenschaftlichen Wert sein. Ein methodisches Herangehen oder eine Systematik im Umgang mit dem reichen Stoff, den Consten in seinen „Weideplätzen“ ausbreitet, vermag man freilich nicht zu erkennen. Im Vorwort zum ersten Band räumt er selbst ein, keine Angaben über die benutzte Literatur machen zu können, die er vor Kriegsausbruch in seiner Moskauer Wohnung zurückgelassen und deren Titel er vergessen habe. Bei der Schreibung mongolischer Namen habe er sich auf sein Gehör verlassen und auf wissenschaftlich sanktionierte Umschriften bewusst verzichtet. Auch fehlt ein Anhang mit dem üblichen wissenschaftlichen Beiwerk eines Namens- und Sachregisters oder Anmerkungsapparats. So wundert es nicht, dass manche seiner akademi351
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
schen Fachkollegen den wissenschaftlichen Anspruch des Werks in Frage stellten. Doch anerkannte man durchaus seine Bedeutung als Zeitdokument. So bezeichnete der Sinologe Walter Fuchs in seinen Erinnerungen aus China Constens „Weideplätze“ als ein „sehr gutes und interessantes Buch“ und fuhr fort: Die politischen Personen und Ereignisse, die in diesem Buch vorkommen, sind zum großen Teil heute natürlich vergessen, aber für den Kenner doch eine interessante Welt und Zeit. Vielleicht ist das Buch manchmal etwas trocken, aber man darf es nicht abtun. Die Temperaturmessungen, die er gemacht hat, geben dem ganzen einen wissenschaftlichen An646 strich.
Gerade den soll jedoch ein Geologe wie Fritz Weiske, der in den zwanziger Jahren als Bergingenieur in der Mongolei tätig war und der die in dem Werk verarbeitete Ausbeute von Constens geographischen und geologischen Feldstudien zu beurteilen vermochte, bezweifelt haben. Er soll gegenüber dem Gewährsmann Curt Alinge, einem seit 1923 in Ulaanbaatar tätigen Juristen und administrativen Berater der mongolischen Regierung, die Meinung geäußert haben, das Buch sei wissenschaftlich wertlos und käme nur als Unterhaltungsstoff infrage. Auch auf mongolischer Seite stehe man, so Alinge, dem wissenschaftlichen Wert von Constens „Forschung“ skeptisch gegenüber. Ein Herr habe ihm unumwunden gesagt, die 647 „Weideplätze“ taugten günstigstenfalls als „Feuilletonlektüre“. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts urteilte der amerikanische Mongoleispezialist Owen Lattimore immerhin ein wenig milder: Ein vielfach sensationell aufgemachter und manchmal verstümmelter und entstellter, aber immer noch interessierender Bericht über die Mongolei in der Zeit der Revolte gegen China 1911/12. Mit einigen eindrucks648 vollen Photos wichtiger politischer Persönlichkeiten jener Zeit.
Mittlerweile ist die Bedeutung der „Weideplätze“ als ein wichtiges Zeitdokument der jüngeren Geschichte der Mongolei wohl unstrittig. Besonders in der Mongolei selbst weiß man das Werk zu würdigen. Die jüngere Generation mongolischer Historiker, die nach dem Ende des Sozialismus einen neuen, unbefangenen Zugang zu ihren eigenen nationalen Quellen gefun352
2. Wissenschaftler oder Karl-May-Verschnitt?
den hat und nun den Beginn der staatlichen Unabhängigkeit der Mongolei nicht erst 1921 bzw. 1924 ansetzt, sondern bereits 1911, betrachtet Constens Werk ohne große Vorbehalte und plant eine Übersetzung des Werks ins Mongolische. In einem Schreiben des Instituts für Internationale Studien der Mongolischen Akademie der Wissenschaften vom Februar 2010 an die Autorin heißt es: Consten gilt in der Mongolei als ein Reisender, der seine Berichte mit besonderer Akribie und historischer Detailtreue verfasst hat. Sie sind daher unverzichtbare Lektüre für jeden Historiker, der sich mit der Mongolei in der Phase des Anfangs ihrer nationalstaatlichen Entwicklung beschäf649 tigt.
Die mongolischen Forscher interessiert darüber hinaus, welche „Hebammendienste“ Hermann Consten persönlich bei der schwierigen Geburt der Mongolei als Nationalstaat geleistet hat. Nach dem Erscheinen der „Weideplätze“ korrespondiert Consten mit Kultur- und Sprachforschern, erbittet ihre Arbeiten, schickt ihnen sein Werk. „Was ich im fernen Asien nur manchmal andeutungsweise verstand und erfuhr, wuchs sich nach dem Weltkriege zu einem Spezialstudium aus“, merkt er dazu in der Einführung zu seinem nächsten Buch Mysterien. Im Lande der Götter und lebenden Buddhas an. Seine Briefpartner wiederum wenden sich gelegentlich sogar mit speziellen mongolistischen Fragen an ihn. Zeitungen und Illustrierte bitten ihn um Artikel und Foto-Reportagen. Man lädt ihn ein zu Vorträgen über die Mongolei und sogar über Me650 sopotamien. Sein angeschlagenes Selbstbewusstsein erhält neuen Auftrieb. Hochverehrter Herr Professor! Haben Sie herzlichen Dank für Ihren freundlichen Brief vom 29.1.21. Mit größtem Interesse bin ich Ihren Ausführungen gefolgt. In der Zwischenzeit habe ich auch Ihr „Eran“[?] durchgearbeitet, besonders war aber die Chronologie der Alttürkischen Inschriften für mich wertvoll. Seite 19 schreiben Sie: bei Urγŭ (d. heutige Urga an der Tola) usw. mit d. Anmerkung: „wenn Thomsens Lesung urγŭda anstatt andarγŭda richtig ist und die heutige Stadt Urgu damals schon existierte“. Hierzu möchte ich ergebenst bemerken: Das Wort Urga ist nur bei den Russen gebräuchlich, wahrscheinlich aus dem Wort mong. 353
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
Orgö, welches Palast oder Lager einer vornehmen und gewählten Person bedeutet. Orgö ist wohl gleich Ergé zu setzen oder umgekehrt. Soviel mir bekannt, ich hatte das auch im Band II p. 64 meiner „Weideplätze der Mongolen. Im Reiche der Chalcha“ veröffentlicht, ist das heutige Urga durch den zweiten Sohn des Tushetu-chan […] erbaut worden. Dieser baute nämlich mit Hülfe chinesischer Arbeiter das erste Kloster a. d. Tuul, das aber im Kampf mit Haldan (Galdan) zerstört wurde. 1727 gab d. Kaiser Jun-Tschiän den Befehl, 100.000 Lamas nach Urga zu schicken und anstelle des alten […] Tempels einen neuen zu bauen. […] 1737 wurde dann auch der Maidari-Tempel vollendet. […] Die Mongolen nennen die Stadt u. Tempel Da-Churje, Jechä-Churje, Bogdo-Churje, doch hörte ich im Volkslaut immer für Churje „Küren“. Da Küren, heiliges Lager, Bogdo-Küren, Gottes Lager oder Ergé = Orgö, großes Haus. Wo das alte Urga gelegen haben mag, ist mir zur Zeit unklar. […] Es wäre wohl möglich, dass nach der Zerstörung Urgas durch Galdan der Chutuchtu am Selbi auf dem alten historischen Boden des Orchongebiets wiedereingeführt wurde. Und das würde mit der Fundstelle der alten Türk-Inschriften eher in Einklang zu bringen sein. […] Doch das sind alles nur Vermutungen, die mir beim Lesen Ihrer Anmerkung 1) p. 19 Die Chronologie der alttürkischen Inschriften durch den Kopf gingen. […] Ich möchte gerne alles, was Sie über die historischen Verhältnisse der alten Türk- und Mongolenvölker veröffentlicht haben, käuflich erwerben. Dürfte ich Sie vielleicht bitten, mein hochverehrter Herr Professor, mir die Bücher durch Nachnahme zugehen zu lassen? Indem ich Ihnen nochmals für Ihren ausführlichen Brief danke, bin ich Ihr ergebener Consten
Säuberlich auf Karteikarten-Format eingefaltet, fand sich, von Constens Hand, die Abschrift dieser Zeilen an den „hochverehrten Herrn Professor“ in einem Karteikasten aus Constens Hinterlassenschaft, der fast 50 Jahre lang unbeachtet im Seminar für Sprache und Kultur Zentralasiens der Bonner Universität gestanden hat und sich heute in der Berliner Staatsbibliothek befindet. Der Verfasser hatte die Briefkopie mit der Datumszeile Bad Blankenburg 9.2.21 unter dem Stichwort „Urga“ abgelegt. Doch war nicht zu erkennen, an wen das Schreiben eigentlich gerichtet war. Erst die Suche über die im Brieftext erwähnten Arbeiten führte schließlich zu dem Berliner Universitätsprofessor, Orientalisten und Sprachwissenschaftler Joseph 651 Marquardt als Adressaten von Constens gelehrten Ausführungen. 354
2. Wissenschaftler oder Karl-May-Verschnitt?
Die in dem Brief zum Ausdruck kommende Haltung, eine Mischung von gespielter Bescheidenheit und Stolz, spiegelt die noch unvertraute Rolle des Privatgelehrten, in die Hermann Consten während seiner Blankenburger Jahre geschlüpft ist. Vermutlich war Consten über die DeutschPersische Gesellschaft, einen noch vor Kriegsende, im Januar 1918 von den beiden Orient-Diplomaten Werner Otto von Hentig und Hartmut von Richthofen gegründeten Kulturverein in Berlin, mit Marquardt in Kontakt gekommen. Die Mitglieder der Gesellschaft, Deutsche wie Perser, stammten mehrheitlich aus dem Umfeld der „Nachrichtenstelle für den Orient“. Ihm gehörten außerdem führende Vertreter der Wirtschaft an. Politisch unterstützte und förderte die Gesellschaft eine gegen England gerichtete nationalpersische Bewegung. Wenig glücklich war man daher über die Trup652 penpräsenz des türkischen Verbündeten in Nordpersien. Möglicherweise hat Hermann Consten sogar seinen Mesopotamien-Vortrag bei einer Veran653 staltung der Deutsch-Persischen Gesellschaft gehalten. 1925 erscheinen in der Reihe „Pan – Bücherei eines Freien Lesebundes“ des Verlags der Vossischen Buchhandlung in Berlin zwei weitere, thematisch zusammengehörende Werke Constens, die sich mit der Mongolei befassen. Diesmal in romanhaft fiktiver Form, schildern sie historische Ereignisse, die das einstmals mächtige Mongolenreich unter die Schutzherrschaft Chinas, genauer: der mandschurischen Qing-Dynastie, geraten ließen. Neben Constens Fotos von einigen historischen Schauplätzen wurde für die beiden Erzählungsbände der wie Consten aus Aachen stammende, in Weimar lebende Tier- und Landschaftsmaler Heinrich Linzen (1886–1942) mit Illustration und Einbandgestaltung betraut. Im ersten Band, den bereits erwähnten „Mysterien“, versucht Consten zu belegen, dass die Ausbreitung des Buddhismus im 17. Jahrhundert sowie die innere Zerstrittenheit und Verweichlichung der Chalch-Fürsten die Ursachen für den Untergang des Mongolenreiches gewesen seien. Seine Sympathie gilt den Schamanen des Altaj, deren Überleben sowohl durch den Buddhismus als auch durch die russische Orthodoxie bedroht ist. Der Versuch des Schamanenhäuptlings Entschu, im Bündnis mit Galdan, dem Stammesfürsten der westmongolischen Ölöt (Ööld), dem Jebtsundampa Chutagt der Klosterhauptstadt Da Chüree (Urga) Paroli zu bieten, ist zunächst erfolgreich. Der zweite Band, Der Kampf um Buddhas Thron, schil355
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
dert die Eroberung und Zerstörung der Klosteranlage 1689 durch Galdans Truppen, die schließlich aber durch die von den Chalch-Fürsten und dem Chutagt herbeigerufenen Chinesen 1696 besiegt, nach Westen zurückgedrängt und, geschwächt durch Krankheit und Hunger, aufgerieben werden. 654 Galdans Schicksal ist damit besiegelt. Doch auch die Chalch-Fürsten bezahlen für ihre Rettung durch Kaiser Kangxi einen hohen Preis. Die Unterwerfung des Landes unter die Herrschaft der Qing sollte bis zum Befreiungsschlag von 1911 dauern. Erst als die Macht der Qing in China selbst vollends erodiert war, konnte die Äußere Mongolei den Weg in die eigenstaatliche Unabhängigkeit wagen. Nach Constens eigenen Worten fallen die beiden Erzählungen „ganz aus dem Rahmen“ dessen, was er bisher über die Mongolei geschrieben 655 habe. Abgesehen von dem historischen Hintergrund, für den er sich ebenso verbürgt wie für die darin ausgebreiteten Naturschilderungen, Jagdepisoden, das Tun und Treiben der Menschen, sprengen sie in anderer Hinsicht tatsächlich den üblichen Rahmen historisierender Reise- und Abenteuerliteratur. Consten mutet seinen Lesern nämlich ausgesprochen drastische Darstellungen dunkler Geheimriten der sogenannten „Roten Kirche“ zu. In unheimlichen, nachgerade grauenhaften Traumsequenzen und Visionen wird die magisch-mystische Seite des Lamaismus, werden tiefer liegende, ältere Schichten dieser angeblich so sanften und friedliebenden Religion aufgedeckt, wie sie u.a. Albert Grünwedel für Tibet und die Höhlenklöster im Turfan-Gebiet anhand dort aufgefundener bildlicher Darstellungen und 656 Textfragmente ausführlich untersucht und beschrieben hat. Teilweise hängen diese Riten, wie Grünwedel als einer der Ersten nachgewiesen hat, mit außerbuddhistischen Einflüssen manichäischen oder hinduistischen Ursprungs oder auch mit der tibetischen Bön-Religion zusammen. Auch einige von Consten bis in scheußlichste Details ausgemalte Folterszenen im Gefängnis von Da Chüree lassen an Drastik nichts zu wünschen übrig. Die schockierte Reaktion der literarischen Kritik und der mongolistischen Fachwelt auf die beiden Bücher ließ dann auch nicht auf sich warten. Der Mandschurist Erich Hauer, der an der Berliner Universität auch Sinologie, Tibetologie und Mongolistik lehrte, meinte in der Orientalistischen Literaturzeitung nicht ohne sarkastischen Unterton: Augenscheinlich haben die Erfolge Ossendowskis bei diesem Buche Pate 356
2. Wissenschaftler oder Karl-May-Verschnitt?
gestanden. „Die Handlung erzählt, wie ein Schamane und Fürst des Altai durch das Schicksal durch ganz Asien herumgetrieben wird, dabei lernt man die gesamten Religionen Zentral-Asiens mit ihren geheimnisvollen Zeremonien und ihrer grauenhaften Mystik kennen“, sagt der Verf. in der Einführung auf S. 8 und „Den Handel, die Lebensweise und die Gewohnheiten der Leute habe ich so geschildert, wie sie sich bis zum Jahre 1914 seit Jahrhunderten in ein und derselben Weise immer wieder vollzogen […].“ Alles in allem: eine Indianergeschichte à la Karl May, deren 657 Besprechung nicht vor das Forum dieser Zeitschrift gehört.
Und der bereits erwähnte Curt Alinge, der wenige Jahre später unter unerfreulichen Umständen mit Consten zu tun haben sollte, gab in einem Bericht für die deutsche Gesandtschaft in Peking die Meinung eines nicht genannten Informanten aus Deutschland wieder, der Consten jeglichen wissenschaftlichen Ernst absprach und die „Mysterien“ „günstigstenfalls als 658 minderwertigen Lederstrumpfersatz“ bezeichnet habe. Es gab aber auch positive Resonanz. So schrieb der Journalist Tony Kellen in einer ausführlichen Rezension in den Mitteilungen des Bundes der Asienkämpfer, u.a.: Es sind Ereignisse von gewaltiger dramatischer Wucht, die uns hier vorgeführt werden, und obschon sie sich am Ende des 17. Jahrhunderts abgespielt haben, ist nichts von einer trockenen historischen Darstellung oder einer Bücher-Kulturgelehrtheit an ihnen zu merken, wie leider an so vielen geschichtlichen Romanen. Man liest sie vielmehr als ob sie sich erst gestern abgespielt hätten und als ob der Verfasser selbst als Zuschauer oder gar als Mitwirkender dabei gewesen wäre. […] In den „Mysterien“ liegt ein großartiger Rhythmus, ein pathetischer Schwung, der uns fesselt und mit fortreißt, und das ist wohl das höchste Lob, das man diesem Buche zollen kann. Der Verfasser ist nicht bloß ein beobachtender Forscher, sondern auch ein gestaltender Dichter, der uns keine leeren Phantasien, sondern Bilder der Wirklichkeit vorführt, und so verbindet sein Buch die Spannung der Unterhaltung mit einer gediegenen ethnographischen Belehrung. Auch die Bilder, mit denen das Buch geschmückt ist, beruhen 659 auf authentischen Vorlagen.
Ähnlich wird Hermann Consten in derselben Zeitschrift auch für die Fortsetzung ein dichterischer Schwung attestiert, der „den Schriften Constens 357
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
eine besondere Note gibt und sie weit hinaushebt über das Niveau sonstiger historischer Romane“. Literarisch hinterlassen die beiden Erzählungen in der Tat einen „gemischten“ Eindruck. Zweifellos handelt es sich hier um Trivialliteratur, die gelegentlich auch die Grenzen des guten Geschmacks verletzt. Freilich sind es insgesamt durchaus süffig geschriebene, historisch faktisch immerhin einigermaßen abgestützte Geschichten. Man mag begründete Einwände gegen genüsslich ausgemalte Todesarten oder bei der Deutung bildlicher Darstellungen tantrischer Gottheiten mit ihrer Shakti, der weiblichen Energie, als krude Erotik, wie überhaupt gegen ein einseitig auf Geschlechtlichkeit reduziertes Frauenbild vorbringen. Auch rassistische Stereotypen und die gelegentlich „altertümelnden“ Dialoge sind nicht Jedermanns Geschmack – möglicherweise war Consten für die Dialoge tatsächlich bei Karl May in die Schule gegangen. Für seine Naturschilderungen aber hatte er dies nicht nötig, da er – anders als Karl May – die Landschaften, in denen seine Geschichten spielen, zu Pferd oder Kamel alle persönlich durchzogen hat. Und er weiß sie in seiner ganz eigenen Sprache, einer höchst eigenwilligen Diktion, die auch keine Rechtschreibregeln zu kennen scheint, bildhaft zu beschreiben. Doch auch wenn Constens Versuch, einen durchgängig hohen epischdramatischen Ton beizubehalten, die Lektüre streckenweise etwas anstrengend macht, auch wenn manche Szenen kitschig und abgeschmackt erscheinen, finden sich, verborgen im Wortgestrüpp, immer wieder funkelnde sprachliche Juwele. Auch wenn er Naturphänomene wie Sand- und Schneestürme, Gewitter, Nebel und Hagelschauer gern benutzt, um die Dramatik von Kriegszügen und Kämpfen, des Massensterbens von Steppentieren oder auch von Schamanen herbeigerufene Dämonen-Erscheinungen lautmalerisch fast bis zum Exzess zu steigern, gelingen ihm doch immer wieder unglaublich schöne, atmosphärisch dichte Stimmungsbilder der Natur, deren poetische Qualität unstrittig ist. Seinen Geschichten ist ein expressionistischer Stil eigen, wie er in der Weimarer Zeit populär war, nur dass er ihn in eine andere Zeit und eine andere Welt transponiert hat. Überraschend präzise – und daher besonders für Völkerkundler interessant – sind Constens Beschreibungen von Palastjurten, einfacher und kostbarer Kleidung, Schmuck, von Fürstenversammlungen, Schamanenbe358
2. Wissenschaftler oder Karl-May-Verschnitt?
schwörungen, der Einbalsamierung eines verstorbenen Asketen und von geheimen Tempelriten. Hier merkt man seine intime Kenntnis des Landes und seine scharfe Beobachtungsgabe – nicht zuletzt auch geschult an seiner eigenen Tätigkeit als Geheimagent. So wundert es nicht, dass in seinen Geschichten auch ein „Späher“ eine Rolle spielt. In „Der Kampf um Buddhas Thron“ gibt es eine Stelle, wo Galdans Gefährten, die sich, nachdem einige der Ihren, darunter ihr Anführer Kara Kisek, aus dem grauenvollen Gefängnis in Da Chüree – Consten nennt die Stadt hier Urga – in einem nächtlichen Handstreich befreit worden sind, am Ufer der Tuul (Tola) wieder zusammenfinden. Es kommt zu einer Verbrüderungsszene mit einem Späher aus dem Stamme der Ööld (Ölöt), der die Befreier auf geheimen Pfaden quer durch die Gebiete der Chalch (Khalkha) sicher dorthin geführt, ihre Verfolger abgelenkt hatte und erst wenige Tage nach den anderen ins Lager zurückgekehrt war: Als die Lagerfeuer in den kleinen Jurten brannten und die steilgeschwungenen Linien der Berge verwischt, unmerklich in das Flimmern der Myriaden von Sternen verschwinden und schwarz das Tiefland, bedeckt vom Flussnebel, daliegt, erzählt der Ölöt Kara Kisek und den Freunden von seinem Aufenthalt in Urga, von seinem Herumstrolchen und Auskundschaften. […] Eines Morgens war der Ölöt-Späher aus dem Lager verschwunden und ritt, seine Pfeife rauchend, mit einem Khalkhahaufen. Lachend und schwatzend war er der Lustigsten einer. Seine Augen forschten rastlos, und seine Ohren fingen jedes unbedachte Wort auf. So trafen sie eine Dseren-Antilopenherde, hinter der der Ölöt mit einigen Khalkhas herjagte. Dabei verloren seine Gefährten ihn aus den Augen, und als er am zweiten Lagerplatz nicht wieder zu ihnen stieß, nahmen sie an, dass er sich verritten habe und sich nun einer anderen Gruppe 660 anschließen würde. Alle vermissten den lustigen Kriegsgefährten.
Hier meint man tatsächlich, Hermann Consten selbst vor sich zu haben, wie er in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg als scheinbar harmloser, lustig seine Shag-Pfeife rauchend umherstreifender Jäger kreuz und quer durch die Mongolei gezogen ist. Er war eben auch ein Sammler und Jäger von Informationen, wie wir wissen. Ähnlich an anderer Stelle, als der Späher zu Galdan geführt wird, der „unter einem mächtigen Baldachin auf sie359
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
ben gelbseidenen olboks, länglichen Seidenkissen, auf deren Mitte ein roter Flecken aufgenäht ist, um so sein Lamatum vorschriftsmäßig zu betonen“, in seiner Prachtjurte sitzt und in die Lektüre einer kostbaren tibetischen Handschrift vertieft ist. Der Späher tritt ein und Galdan fordert ihn auf zu berichten, was er unterwegs gesehen hat. Der Späher richtet sich auf, rutscht auf den Knien vor Galdan hin, sein Blick flackert unauffällig, aber jede Regung Galdans und der fürstlichen Feldhauptleute in sich aufnehmend, verstehend, verwertend, von einem 661 zum anderen.
Und auch seine Erlebnisse vom Kriegsbeginn in Belgien, von der Belagerung Lüttichs, die er – anders als viele seiner schreibenden Kriegskameraden nach 1918 – unmittelbar literarisch niemals verarbeitet hat, scheint Hermann Consten lieber in ein fernes Land und eine ferne Zeit verlegt zu haben. Vor den Toren der Klosterhauptstadt Da Chüree stoßen die Heere des Jebtsundampa Chutagt und Galdans aufeinander, und für winzige Momente blitzt ein ganz anderes Schlachtfeld auf: Voll Hass und Zwietracht ist das Mongolenland. Rings auf den Höhen und in den Schluchten tobt im flimmernden Mondmantel der Julinacht 662 die Schlacht. – Gesser Khâns Banner flattert im wilden Nordwest. Die Tughs, die Feldherrenstandarten, wehen und glänzen weithin sichtbar. Die Khalkhas stemmen sich mit letzter Wucht gegen den heranbrausenden Feind, drängen seine Reitergeschwader zurück, riegeln die Schluchten ab und werfen im wilden Reiterkampf mit wuchtigem Anprall den Gegner über den Haufen. Es würgen sich mongolische Brüder im Nahkampf, werden zu Mördern an eigener Rasse. Beilzeit … Schwertzeit … Es brechen und krachen die Schilde. Keiner will den anderen schonen. Umkrampft, umkrallt, mit durchbissener Gurgel, das Messer des sterbenden Gegners in der Brust, zerhackt, zerschlagen, zerfetzt, verstümmelt, verwundet liegen sie an den Hängen und in Schluchten, zwischen stöhnenden, schreienden, wiehernden Pferden. Wundglut tobt. – Auf leisen Soh663 len schleichen Ärlik Khâns Boten über das Schlachtfeld. Laut knirscht 664 der Tod…
Der letzte Satz klingt verdächtig nach dem logischen Ende der „herausge360
2. Wissenschaftler oder Karl-May-Verschnitt?
knirschten Sehnsucht ‚Ins Feuer!’“, mit der jenes angeblich von Nanny Lambrecht verfasste „Stimmungsbild vom deutsch-belgischen Kriegsschauplatz“ in der Abendausgabe des Berliner Lokalanzeiger vom 14. August 1914 endete, das den Kriegsrausch der deutschen Truppen in Aachen kurz vor dem Einmarsch in Belgien in Worte zu fassen suchte. An solchen verdeckt autobiografischen Stellen in Constens Mongolei-Erzählungen war die Biografin natürlich besonders interessiert. Viele davon fanden sich zwar nicht, aber die eine oder andere war dafür beson ders aufschlussreich. Im „Kampf um Buddhas Thron“ zum Beispiel taucht eine denkwürdige Episode aus den „Weideplätzen“ wieder auf. Sie zeigt, dass eigenes Fehlverhalten Consten manchmal doch länger beschäftigt hat, dass die literarische Verarbeitung ihm offenbar innere Notwendigkeit war. Es geht um die im vierten Kapitel des zweiten Teils dieser Biografie erwähnte Szene, als Consten einmal am Char us, dem südöstlich von Chovd gelegenen, von einem breiten Schilfgürtel umgebenen „Schwarzen See“, mit seiner mehrschwänzigen Peitsche (nagaika) unter Schwärme von Wildenten und Wasservögel gegangen war und zum Entsetzen der ihn begleitenden Mongolen etliche von ihnen mutwillig in der Luft zerfetzt hatte. In der Erzählung klingt die Episode aus dem Jahr 1911 so: Da liegt ja ein Stückchen Land inmitten des großen Wassers! Was ist das? Wer wohnt dort? Von welchem Stamm sind die Menschen? Sieh doch die Vögel! Hörst du den Vogelruf, Uten? Uten folgt mit den Augen dem ausgestreckten Arm Naiduks und ist ebenso wie die anderen, die noch nicht an dem See gewesen waren, überrascht und erstaunt, denn der Khara-ussu ist ein wahres Vogelparadies. „Du brauchst hier deinen Falken nicht steigen lassen!“ ruft ihm Boro Nakhül zu. „Wildgänse und Wildenten, Kranich und Reiher jeder Art kannst du hier mit der Nagaika totschlagen. Die Vögel kennen noch nicht den Menschen als ihren Feind. Niemandem von den hier wandernden Stämmen fällt es ein, einen Vogel zu töten, um ihn zu essen, wo doch die Steppe, so weit unser Auge 665 reicht, von Wild wimmelt.“
Aufschlussreich im Zusammenhang mit Constens Selbstbild ist noch eine andere Stelle gegen Ende des Buches, als Galdan, die besiegten ChalchMongolen in südöstlicher Richtung bis gegen die Große Chinesische Mauer 361
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
vor sich hertreibend, an ein einsam gelegenes Kloster am Rande der Wüste gelangt und nun überraschend eine Reflexion über sich selbst anstimmt. Ulan Chijd (Ulan Khit), das Rote Kloster, auch Kloster der Selbstversenker genannt, entpuppt sich als ein Sehnsuchtsort des Lamakriegers, der nun seinen erstaunt zuhörenden Vertrauten seine weiche, kriegs- und wandermüde Seite zeigt. „Zwiespältig ist in mir die Natur. Mahâkâla, der große Schwarze, der in mir die große Zeit verkörpert, treibt mich vorwärts durch Blut und Rauch. Ihm zu Ehren, als seine Opfer, sterben die Gesandten, fallen die Krieger, und doch treibt der wiedergeborene Mönch in mir mich immer wieder zurück in des Klosters Zelle. Die Selbstversenkung bleibt mir wahrscheinlich für immer durch eines meiner Vergehen in einem vorigen 666 Galab versagt. Wie gerne möchte auch ich mit meiner Seele durch die Erde, durch die Himmel bis an die Grenze der Weltmeere vordringen. Doch rings um mich ist nur Kampf und Tod, Vernichtung und Verzweif667 lung.“
In Hermann Constens Briefen, vor allem aber in seinen Tagebüchern finden sich gelegentlich ganz ähnlich klingende Selbstbetrachtungen als einem an der Zwiespältigkeit seiner Natur, seiner inneren Unruhe und dem Umhergetriebensein leidenden Menschen. Selbst im Bajdrag, dem Gold führenden Fluss, den er einst für sein Mannesmann-Projekt aufsuchte, scheint sich etwas von seinem eigenen Wesen, einem paradoxen „Freiheitszwang“ zu spiegeln, der bei genauerem Hinsehen ein latenter Todestrieb ist: Frei, wie der Einsame, der ruhelos, heimatlos, von unstillbarer Sehnsucht getrieben, durch Asiens Steppen, Wüsten, weite Ebenen, über Berge, Schneegipfel, Gletscher, durch Schluchten und Täler wandert, ohne Ziel dem Zwang gehorchend, so fließen wie der Pulsschlag der Natur, die großen Flüsse, auch der Baidarik, der erbarmungslosen Wüste und dem 668 Wüstentod, dem Süden entgegen.
Das Kloster Ulan Chijd, fernab der Karawanenwege am Rande der Wüste gelegen, sollte auch in Constens Erzählung Der rote Lama eine Rolle spielen, die 1928 bei Strecker & Schröder in Stuttgart erschien, als er sich längst 362
2. Wissenschaftler oder Karl-May-Verschnitt?
wieder auf dem Weg in die Mongolei befand. Diese Geschichte, laut Untertitel „ein Erlebnis aus dem innersten Asien“, spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Zeit also, die Consten selbst unmittelbar miterlebt hat und deren Protagonisten ihm großenteils persönlich bekannt waren. Zugleich beschreibt sie aber auch ein innerstes „spirituelles“ Erlebnis, das in einem grausam erscheinenden, bluttriefenden zeremoniellen Menschenopfer gipfelt, wie man sie in künstlerischer Stilisierung auf manchen Thangkas mit den zornigen Götter- und Dämonendarstellungen des tantrischen Buddhismus findet oder – in verschlüsselter Form – in den heiligen Büchern und den Versen des Kâlacakra Tantra, an deren Übersetzung ins Deutsche Albert Grünwedel über viele Jahre, bis zu seinem Tod 1935, gearbeitet hat. Der Held in Constens Geschichte ist ein Lamakrieger wie Galdan, ein Mann mit vielen Namen, dessen eigenartiges und grausames Schicksal sich einfügte in die kriegerischen und revolutionären Ereignisse, die Zentralasien, vor allem auch die Mongolei in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, erschüttert und grundlegend verändert haben. Es ist die Geschichte von Dambijžancan, auch Žal Lama oder Chojor Temeet lam, „Lama mit den 669 zwei Kamelen“ genannt. Dieser war ein Kalmückenführer aus Astrachan, der sich selbst für eine Reinkarnation Abb. 16: Der historische Žal Lama, um 1913 des Amursana hielt. Jener berühmte Heerführer aus dem Ojrad-Stamm der Chojd war Mitte des 18. Jahrhunderts nach vielen Kämpfen gegen den Qing-Kaiser zum Gesamtherrscher der Dsungaren aufgestiegen. Ähnlich fühlte sich Dambijžancan beru363
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
fen, die einst unter Galdan verlorenen zentralasiatischen Gebiete den Chinesen, Mongolen und Russen wieder abzujagen und ein neues westmongolisches Großreich als würdigen Nachfolgestaat des einstigen Weltreiches Čingis Khans zu errichten. Die zaristische Geheimpolizei, der er schon in seinen Anfangsjahren gefährlich erschien, hatte ihn festgenommen, in ein Moskauer Gefängnis verbracht und, nach der Urteilsverkündung, zu langjähriger Zwangsarbeit nach Sibirien verbannt. Hier setzt Constens Geschichte ein, die sich nicht unbedingt streng an die historischen Fakten hält – wie er auch den Titelhelden selbst und seine „Berufung“ zum Befreier und künftigen Herrscher über ein neues Westmongolenreich romanhaft ausgestaltet. Von Sibirien kann Dambi, wie er zu Beginn der Erzählung heißt, nach langen Haftjahren fliehen. Im Traum hatte ihn ein Ruf seines Tempels erreicht, und so wagt er den Ausbruch. Dieser Tempel scheint fernab in einer versteckten, subtropischen Gebirgsoase irgendwo inmitten der Wüsten Zentralasiens zu liegen. Consten schildert ihn samt der ihn umgebenden Flora und Fauna wie ein Paradies, wie eine Oase des Friedens und der Glückseligkeit. Dieser „Tempel des Lebens“, wie er ihn nennt, scheint wie das im Westen vielfach verklärte Shangri-la ein imaginärer Ort zu sein. Ähnliches gilt offenbar für all die Lamaklöster, darunter auch Ulan Chijd, in denen Žal Lama auf der langen beschwerlichen Reise zum „Tempel des Lebens“ Station macht – nachdem ihm mit Hilfe eines Waldläufers die Flucht durch die unwegsame Taiga ins nordostmongolische Grenzgebiet gelungen ist und er am Ufer des Argun von einem mit zwei weißen Kamelen auf ihn wartenden ehrwürdigen Mönch, seinen Lehrer und Sendboten seines Klosters, in Empfang genommen wurde. Einerseits ist also die Reise, zu der die beiden Kamelreiter nach einer Erholungsphase für Žal Lama, der feierlichen Erneuerung seines Mönchsgelübdes und einigen reinigenden Zeremonien, die ihn von seinen weltlichen Sünden befreien und in seine Lamawürde wieder einsetzen, sehr konkret. Sie führt quer durch die Landschaften der Mongolei, die auch in diesem Buch in ihrer ganzen Schönheit und Unerbittlichkeit beschrieben werden. Zugleich aber geben diese Landschaften und die aufgesuchten Klöster die Kulisse ab für die andere, die spirituelle Reise. Diese, die eigentliche Reise, führt den Protagonisten in fünf Stufen immer tiefer hinein in die verborge 364
2. Wissenschaftler oder Karl-May-Verschnitt?
nen Geheimnisse des Geistes und der Seele. Doch verfällt Consten hier nicht etwa esoterischer Schwärmerei, vielmehr legt er in aller Brutalität offen, dass es um düstere, verbrecherische Geheimnisse geht. Žal Lamas Reise führt zu insgesamt fünf Klöstern, in denen meistens Angehörige der Rotmützen-Sekte leben. Beginnend mit Traumbildern paradiesischer Glückseligkeit im Kreis gelehrter Mönche führt ihn die Reise in mehreren Etappen immer tiefer hinab in die düsteren Urgründe des tantrischen Buddhismus. Archaische Horrortrips voll zorniger Dämonen suchen ihn heim, er wird Zeuge orgiastischer Klosterfeiern in weiblicher Gesellschaft und blutiger Ritualmorde, bis er am Ende, im „Tempel des Lebens“ angekommen, schließlich selbst in einer verborgenen Kulthalle gefesselt und nackt auf einen stiergestaltigen Altarstein gehoben wird. Unter dem dröhnenden Klang von Trommel, Trompete, Muschelhorn und Flöte wird er Mahākāla dem zornvollen Beherrscher der Unterwelt dargebracht. Ein uralter Priester, Vertreter eines archaischen Glaubens, nähert sich ihm mit dem Ritualdolch in der einen und einer mit Silber ausgelegten Schädelschale in der anderen Hand, ritzt erst die Herzgegend an und fängt mit der Schale einige Blutstropfen auf, zeichnet mit dem Blut auf Stirn, Hals und Herz die magischen Silben Om, Ma und Khum, entmannt ihn dann mit scharfem Schnitt, schneidet das Herz aus seiner Brust, trennt ihm Nase und Ohren ab und legt ein Körperteil nach dem anderen in der Schädelschale ab, wo sie von assistierenden Henkerlamas zu einer zimmetfarbenen Pyramide aufgeschichtet werden. Auch die Eingeweide werden ihm, dessen Geist noch immer über der grausigen Szene schwebt, entnommen, der Schädel wird geöffnet und die eine Hälfte mit dem noch zuckenden Hirn zu den übrigen Opfergaben gestellt. An grausigen Einzelheiten sollte dies genügen. Consten beschreibt das Opferritual und die Annahme des Opfers durch den „blutschlürfenden Mahākāla“, der schließlich unter Donnergetöse, Flammen und Rauch erscheint, selbst fast wie im Rausch. Mit geradezu voyeuristischer Ekellust und mit einer Detailfreude, als habe er dem furchtbaren Ritus tatsächlich selbst beigewohnt, führt er seine Leser durch schlimmste Folter- und Höllenqualen. Die Ausschmückung solcher Szenen bis an die Grenze des Erträglichen war für einen phantasiebegabten Autor wie Hermann Consten natürlich kein Problem. Man kann jedoch davon ausgehen, dass ihm, so365
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
weit es die Architektur der unterirdischen Tempelanlagen, die Deutung ikonographischer Fakten und magischer Silben betrifft, die Arbeiten Albert Grünwedels, vor allem sein 1924 erschienenes Buch „Die Teufel des Avesta und ihre Beziehungen zur Ikonographie des Buddhismus in Zentralasien“, sehr zustatten kamen. Das Bemühen um faktische Genauigkeit bei seinem Versuch, Details von Opferdarstellungen an den Wänden von Höhlenklöstern und auf Thangkas, literarisch in lebendige Szenen zu überführen, kann man ihm jedenfalls nicht absprechen. Doch darf man füglich bezweifeln, dass Grünwedel über diese Art der Verwendung seiner Forschungsarbeiten allzu glücklich gewesen ist. Dennoch muss vorerst dahingestellt bleiben, ob Consten es mit solchen Schilderungen wirklich nur auf die Sensationsgier seiner Leser abgesehen hatte oder ob er nicht doch auf etwas ganz anderes hinauswollte. Beispielsweise gibt es mitten in der eben geschilderten Szene eine auffallende Verschürzung dieses als Realität beschriebenen Menschenopfers mit einem realen Geschehen, dem nachweislich Millionen von Menschen zum Opfer gefallen waren: dem Weltkrieg und der russischen Revolution. Diese historisch verbürgten Ereignisse wiederum sind es, die dem „Wesenlosen, das von Dschal Lama übrigblieb“, gegen Ende der Zeremonie als Schreckensvision künftigen Unheils erscheinen. Plötzlich bildet sich oberhalb der Schädelschale des Naru Pantschen ein neuer Lichtkranz. Die Flammennebel darin zerfließen, zergehen! Es wallt auf und ab im ziehenden Flammenrauch. Dieser ballt sich zu Wolken zusammen. Erst dämmernd und noch ungewiss zeigt sich in unendlicher Ferne die russische Erde. Zackige rote Mauern! Buntstrahlende Zwiebeltürme! Gestalten werden jetzt klar und deutlich. Dschal Lama in seiner wahren Gestalt und doch mit Amursan wesenseins, in russische Ketten geschmiedet, schreitet umgeben von russischen Kasaken durch ein finsteres Tor. Wiederum verschwunden das Bild… Reiterscharen stäuben 670 durch die Steppe. Dahinter Lschamsrin und die Schrecklichen! Ein fürchterlicher Graus! Asien reckt sich riesengroß vor der verblutenden Welt! Das eiserne Herz der Erde erzittert… – Erdfontänen toben unter fürchterlichem Einschlag. Eisen- und Stahlhagel! Der Tag wird durch Gaswolken zur Nacht. Die Nacht zerspaltet ununterbrochener, krachender Stahlblitz. Feuergarben platzen, säen weit und breit den Tod! Kom366
2. Wissenschaftler oder Karl-May-Verschnitt?
men und Vergehen! Städte brennen, krachen auseinander!… Heulender, tobender Pöbel. Fäuste ballen sich, recken sich in gieriger Wut. Weiber morden! Würgen ihr eigenes Fleisch und Blut. Verzehren, irrsinnig vor Hunger, den menschlichen Fraß. Empörung! Bruderkampf… Sterne stürzen. Fäuste zerren unter Führung Dschal Lamas ordenbesäte Offiziere aus dem Hofzug, reißen dem Tsagan Khan, dem „weißen Zaren“, Orden, Kokarde, Achselstücke und Litzen herunter. Die blutgierige Meute tobt!… Das Bild verblasst, lodert noch einmal auf. Weite, weite Steppe. Einsam und verlassen irrt ein mongolischer Reiter auf abgehetztem, stolperndem Pferde vorwärts. Dschal Lama!… Hinter ihm in der Steppe Punkte wie schwarze Geier… In unendliche Ferne getaucht vor ihm – wie ein Sche671 men – der Tempel des Lebens!
Das Buch endet schließlich damit, dass der Held der Geschichte in seiner heilen, voll bekleideten Gestalt wie aus einem schrecklichen Sekundentraum oder einer Trance erwacht, als sein Abt ihm gerade mit dem Mittelfinger die heiligen Silben auf Stirn, Kehle und Herz zeichnet und die Mönche ihren Schlussgesang anstimmen – einen Lobpreis des im Menschen selbst anwesenden Gottes, der die Tempel verschiedener Lehrmeinungen gar nicht braucht. Der „Tempel des Lebens“ erscheint als ein Ort, in dem sie alle – ob Brahmanen, Taoisten, Buddhisten, Juden und andere – aufgehoben sind. Nach all dem Schrecklichen ein seltsam versöhnlicher, abrupter Schluss. Das Ende, das dem historischen Žal Lama 1922 beschieden war, als gedungene Mörder den als unverwundbar geltenden Tyrannen im Auftrag der Regierung in Ulaanbaatar in seiner Burg durch zahlreiche Schüsse in Brust und Hals umbrachten und anschließend enthaupteten, ähnelte schließlich dann doch ein wenig dem mörderischen Ritus, mit dem Consten seine Leser das Schaudern lehrte. Wenig bleibt noch zu sagen zu dem 1926, ebenfalls bei Strecker & Schröder in Stuttgart unter dem verunglückten Titel „… und ich weine um dich, Deutsch-Afrika“ erschienenen Buch mit Constens frühen Afrika-Erzählungen. Auf sie war im Kapitel über Constens afrikanische Jahre bereits Bezug genommen worden. Hinzuweisen ist noch auf das knappe, etwas melancholische Nachwort Constens, wo es unter anderem heißt: „Erinnerungen sterben nur, um das Hässliche zu verschönen. Die Sehnsucht aber bleibt ewig in der Kühle der stillgewordenen Jahre jung.“ 367
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
3. „Krisenmanager“ in schwieriger Zeit Während Hermann Consten noch an seinen Erzählungen schreibt, hat er die Gelehrten-Phase eigentlich schon wieder hinter sich gelassen. Alles andere als ein zurückgezogen lebender, vergeistigter Wissenschaftlertyp, mischt er schon bald, nachdem er sich nicht mehr unmittelbar in der Gefahr wähnt, im Gefolge des Friedensdiktats von Versailles an einen fremden Geheimdienst ausgeliefert zu werden, im aktuellen politischen Geschehen wieder fleißig mit. Von „stillgewordenen Jahren“ kann gar keine Rede sein. Da er kein Freund der Weimarer Republik ist, für Demokratie und 672 Parlamentarismus nichts übrig hat und angesichts der Rheinlandbesetzung, der Kämpfe an der Ruhr, der politischen Unruhen in Mitteldeutsch land und Oberschlesien wie auch der allgemeinen Verschlechterung der Lebensverhältnisse nicht länger tatenlos zusehen mag, wie sein Vaterland immer mehr an den Abgrund getrieben wird, sucht Consten die Nähe militaristisch gesinnter deutschnationaler Kreise. Er nimmt Kontakt zu einstigen Mitarbeitern der Abteilung IIIb wieder auf, wird Mitglied der DVP und engagiert sich schließlich im Stahlhelm, einer 1919 gegründeten Organisation ehemaliger Frontsoldaten. Jemand mit hochgradigen Verbindungen und einer Vergangenheit als militärischer Geheimagent wie er kann dort wertvolle Dienste leisten. Da die Freikorps 1919/20 nach und nach aufgelöst und durch reguläre Verbände der personell stark verkleinerten Reichswehr ersetzt wurden, schlossen sich viele ehemalige Freikorpskämpfer sogenannten „Arbeitsge673 meinschaften“, Einwohnerwehren oder Sport- und Schützenvereinen an. Dort konnten sie ziemlich unbehelligt weiterhin den vertrauten Umgang mit der Waffe pflegen und sich körperlich fit halten. Unter dem Deckmantel bürgerlicher Wohlanständigkeit hielten sie sich bereit, den verhassten Linken bei sich bietender Gelegenheit doch noch aufs Haupt zu schlagen, die Regierung in Berlin zu beseitigen und eines Tages vielleicht auch die „Schmach von Versailles“ zu sühnen. Erst einmal wird Hermann Consten Mitglied des Schützenvereins von Bad Blankenburg. Er gibt sich lokalpatriotisch, interessiert sich plötzlich sehr für die alte und wechselvolle Geschichte dieser Ecke Thüringens, beteiligt sich aktiv am damals gerade beginnenden Ausbau der Ruine Greifenstein zum Domizil von Jugendgrup674 pen, verfasst sogar unter dem Namen Consten-Claudy einen Beitrag zum 368
3. „Krisenmanager“ in schwieriger Zeit
Abb. 17: Der Schützenverein von Bad Blankenburg. Erster von rechts sitzend: Hermann Consten, um 1923 675
Stadtführer für Bad Blankenburg (erschienen 1922) und feiert bei den jährlichen Schützenfesten natürlich immer feste mit. Einmal wird er sogar, wie Klaus Strölin nicht ohne Stolz berichtet, Schützenkönig von Bad Blan676 kenburg. Im März 1921 beteiligt sich Consten, vermutlich als Kundschafter, an der blutigen Niederschlagung kommunistischer Arbeiteraufstände in Thüringens Städten. Eine Tagebuchkladde aus der fraglichen Zeit, die, dem Übergabeverzeichnis zufolge, zusammen mit weiteren Kladden aus den Jahren 1910–1913 nach Constens Tod dem Zentralasienseminar der Bonner Universität übergeben worden war, ist leider verschollen. Sonst ließen sich mehr Einzelheiten über die Natur seines aktiven Einsatzes in den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen linksradikalen Arbeitern und militanten Kräften der völkisch gesinnten Rechten an dieser Stelle mitteilen. Doch hat Consten selbst gegenüber der amerikanischen Ethnologin Ethel John Lindgren, die ihn in seinem Haus in Bad Blankenburg besuchte, Andeutungen über seine direkte Beteiligung an standrechtlichen Exekutionen 677 gefangener Aufständischer durch Erhängen gemacht. 369
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
Im Mai 1921 nimmt Consten in Oberschlesien am Sturm auf den südlich 678 von Oppeln gelegenen Annaberg teil. Das unter Aufsicht der Entente stehende Gebiet beanspruchte Polen für sich. Nach zwei polnischen Aufständen und der Volksabstimmung vom März, in der die Bevölkerung trotz massiven Drucks mehrheitlich für den Verbleib im Deutschen Reich votiert hatte, spitzte sich die Lage gefährlich zu. Während es die in Oberschlesien stationierten Vertreter der Ententemächte Frankreich, Großbritannien und Italien bei fruchtlosen Appellen zur Anerkennung des Abstimmungsergebnisses beließen, unternahm die polnische Seite in einer schon länger geplanten Militäraktion den Versuch, Oberschlesien mit gewaltsamen Übergriffen gegen die deutsche Bevölkerung im Handstreich zu nehmen. Daraufhin eilten innerhalb weniger Tage tausende Freiwillige aus Deutschland und Österreich, unter stillschweigender Duldung der Reichsregierung, dem eiligst gebildeten Selbstschutz Oberschlesien zu Hilfe, um gemeinsam den polnischen Angriff abzuwehren. Bei der Erstürmung des Annabergs und der Rückeroberung des berühmten Wallfahrtsortes taten sich vor allem das Freikorps Oberland und die Organisation Escherich (Orgesch) hervor. Die Kämpfe in Oberschlesien sollten noch bis in den Sommer hinein andau679 ern. Im Oktober 1923 schließlich reist Consten in geheimer Mission nach Bayern. Er musste dafür offenbar ein Treffen ehemaliger Kolonialschüler in Witzenhausen kurzfristig verlassen. Lieber Kamerad Bindel! Heute von meiner Bayernreise zurück. Da weht miese Luft! Ich bedaure es lebhaft, dass ich durch die Ereignisse gedrängt so plötzlich abreisen musste, ohne Ihnen nochmals persönlich Lebewohl zu sagen. Aber ich musste fort,
schreibt er nach seiner Rückkehr am 15. Oktober 1923 nach Witzenhausen. Bei dem alten, noch immer amtierenden Direktor Ernst Fabarius entschuldigt er sich, „auch im Namen meiner Frau“, dass er und Emma ihm wegen „dringender Angelegenheiten“, die ihn nach Bayern zu reisen genötigt hät680 ten, nicht mehr ihre Aufwartung hätten machen können. Aller Wahrscheinlichkeit nach war Consten einer der zahlreichen Emissäre des Stahlhelm, die im Oktober 1923 in Bayern auftauchten, um auf eine Entscheidung hinsichtlich des gemeinsam gefassten Plans zum „Marsch auf Berlin“ 370
3. „Krisenmanager“ in schwieriger Zeit 681
zu drängen. Für dieses Vorhaben stellte der „rote Gürtel“ – gemeint waren die Linksregierungen in Sachsen und Thüringen – natürlich ein Hindernis dar. An der nordbayerisch-thüringischen Grenze waren schon seit einiger Zeit Bewegungen legaler und illegaler Verbände zu beobachten, die wiederum in Weimar und Dresden, aber auch in Berlin für einige Nervosität sorgten. Bayern war in den ersten Nachkriegsjahren zu einem Sammelbecken von Extremisten aller möglichen Couleurs geworden. Hatte nach dem Ende der Wittelsbacher Monarchie zunächst die radikale Linke die Geschicke an sich gerissen und unter Kurt Eisner eine rote Räterepublik ausgerufen, so sammelten sich nach Eisners Ermordung 1919 und dem Scheitern des KappLüttwitz-Putsches 1920 immer mehr rechtsextreme Kräfte aus allen Teilen der Republik in und um München, unter ihnen an prominenter Stelle ExGeneralfeldmarschall Erich Ludendorff, ferner Korvettenkapitän a.D. Hermann Ehrhardt, dessen Organisation Consul (O.C.) für zahlreiche Fememorde verantwortlich gemacht wurde, darunter auch für die Attentate auf Erzberger (1921) und Rathenau (1922). Auch der Stabschef der Arbeitsgemeinschaft Vaterländischer Kampfbünde (AGVK), Oberstleutnant Hermann Kriebel, steuerte die von Adolf Hitler im Februar 1923 gegründete 682 Organisation militärisch von München aus. Vor allem Hitler mit seiner SA und Georg Escherich, Anführer der unter dem Namen Orgesch zusammengeschlossenen Nachfolgeorganisationen der bayerischen Einwohnerwehren, stellten selbst für die bürgerlich-konservative Münchner Regierung eine ernste Bedrohung dar. Zwar war die Orgesch 1921 offiziell aufgelöst worden, doch hatte sich die Gefahr von Rechts dadurch eher noch verschärft. Viele von Escherichs Leuten waren in sogenannte „Arbeitsgemeinschaften“ überführt worden, die irgendwo auf dem Lande Ackerbau und Viehzucht betrieben oder forstwirtschaftliche Tarnbetriebe gegründet hatten. Im ganzen Land, bis hinein ins benachbarte Tirol und nach Ungarn gab es geheime Waffenlager in Schlössern und Klöstern. So rüsteten sich separatistische Gruppen für die endgültige Niederschlagung kommunistischer Aufstände im Deutschen Reich und den 683 Angriff auf die demokratisch gewählte Reichsregierung in Berlin. Alle diese rechten Gruppen, denen Consten politisch nahestand, verband das gemeinsame Ziel, eine nationalistische Militärdiktatur über ganz 371
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
Deutschland zu errichten. Innerlich zerstritten waren sie nur wegen der Frage, wer den Anfang machte. Nach Meinung der norddeutschen Gruppen sollten die Bayern als Erste losschlagen. Doch diese zögerten und wollten lieber den Norddeutschen den Vortritt lassen. Denen allerdings fehlte ein charismatischer Führer. Der geheime Wunschkandidat, Reichswehrchef Hans von Seeckt, fühlte sich dann doch an seinen auf die Weimarer Verfassung geleisteten Eid gebunden, verfolgte insgeheim aber eigene Pläne. Letztlich kam General Otto von Lossow eine Schlüsselrolle zu. Wie Consten hatte Lossow während des Weltkriegs zeitweise in türkischen Diensten gestanden; nun amtierte er als Kommandeur der Reichswehr im Wehrkreis VII und zugleich als bayerischer Landeskommandant. Schon mehrmals hatte sich gezeigt, dass Lossow seiner Loyalität gegenüber Bayern den Vorrang vor seinen Verpflichtungen als Reichswehrkommandeur gegeben hatte. Unter anderem unterhielt Lossow in Sachsen und Thüringen einen geheimen Nachrichtendienst, um unter den dort stationierten Reichswehrverbänden die Stimmung auszuforschen und Informationen über Truppentransporte, Funkstationen und Telegrafenleitungen sowie eventuelle Sabo684 tageobjekte zu sammeln. Doch selbst Lossow zögerte, fürchtete er doch, in eine Situation zu geraten, in der Reichswehr auf Reichswehr schießen 685 würde. Daher also die „miese Luft“, die in München wehte, als Consten dort 686 auftauchte. In seinem kurzen Schreiben an Theodor Bindel, den Geschäftsführer des Altherrenverbands der Deutschen Kolonialschule, deutete er damit die Meinungsverschiedenheiten zwischen den einzelnen Kampfgruppen und das drohende Scheitern der Putschpläne an. Sonst ging er nicht näher auf die Natur seiner Gespräche in der bayerischen Hauptstadt ein. Erst ein Brief aus den 30er Jahren, geschrieben aus China, sollte ein wenig mehr Aufschluss über seinen Auftrag und seine dortigen Kontakte geben. So hatte Consten in München neben anderen auch Oberstleutnant Kriebel aufsuchen wollen. Er habe aber nur dessen Frau angetroffen, schrieb er. Kriebels Frau kenne ich aus der Zeit des thüringischen Aufstandes. Kurz vor dem Hitlerputsch war ich in München. Kriebel war nicht anwesend, aber seine Frau. Ich holte mir damals kurze Informationen wegen Thüringen. Sprach 687 dann mit Escherich usw.
372
3. „Krisenmanager“ in schwieriger Zeit
Der eigentliche Grund für seine plötzliche Reise nach Bayern hing also, wie sich dank seines späteren Hinweises auf Thüringen herausfinden ließ, ganz offensichtlich mit der dortigen politischen Entwicklung zusammen. Es waren wohl vertrauliche Informationen über die damals unmittelbar bevorstehenden Kabinettsumbildung in der Weimarer Regierung, einer Koalition aus SPD und USPD, gewesen, welche bei der extremen Rechten die Alarmglocken schrillen ließen. Wie in Sachsen, so reiften auch in Thüringen Pläne, der wachsenden Gefahr eines rechtsradikalen Staatsstreichs durch die Bildung einer linken Einheitsfront mit der KPD zu begegnen. Sofort machten Gerüchte über einen bevorstehenden Linksputsch, die Herbeiführung eines von Moskau ferngesteuerten „deutschen Oktober“, die Runde. Den rechten Kräften in Mitteldeutschland schien es daher dringend geboten, umgehende Entscheidungen in Bayern herbeizuführen, damit der zwischen München und Berlin liegende „rote Gürtel“ gesprengt würde, bevor die Kommunisten ihr Vorhaben wahr machen könnten. Pläne der rechten Mili688 tärs, die Durchmarschroute auf die Hauptstadt notfalls freizuschießen, existierten bereits. Tatsächlich nahm Thüringens sozialdemokratischer Regierungschef August Fröhlich am 16. Oktober 1923 zwei kommunistische Minister in sein Kabinett auf. Dies wiederum veranlasste die Reichsregierung in Berlin, gedrängt von der Reichswehrführung, ihrerseits zum Eingreifen. Reichswehr marschierte in Sachsen und Thüringen ein und stellte die beiden Länder unter Reichsexekutive. Die Regierung in Sachsen wurde abgesetzt, und ein Reichskommissar übernahm in Dresden die Exekutivgewalt. Thüringen wurde unter Ausnahmerecht gestellt. Mit diesen Maßnahmen waren aber auch die rechtsextremistischen Pläne, von Bayern aus durch Thüringen nach Berlin zu marschieren, erst einmal gestoppt. Am 12. November verließen die KPD-Minister das Weimarer Kabinett. Am 7. Dezember trat die Regierung Fröhlich ganz zurück, der thüringische Landtag wurde aufgelöst und Neuwahlen angesetzt. So blieben Thüringen sowohl die Reichsexekution als auch ein erneutes Aufflammen des Bürgerkrieges zwar erspart. Eine der weiterreichenden Folgen des verfassungswidrigen Eingreifens in rechtmäßig amtierende Landesregierungen war auf Reichsebene jedoch der Ausstieg der Sozialdemo689 kraten aus dem Kabinett Stresemann. Mit der thüringischen Landtags373
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
wahl vom Februar 1924 sollte sich schließlich die politische Landschaft grundlegend verändern. Ein „Ordnungsbund“ aus rechtskonservativen Parteien sollte fortan die weiteren Geschicke des Freistaates bestimmen. Unter dessen Ägide beruhigte sich zwar die Lage. Kulturell aber bedeutete der Rechtsruck auch das Ende eines vielversprechenden Aufbruchs in die Moderne. 1925 musste das „Bauhaus“ in Weimar schließen. Dafür durften Ludendorffs Völkische Freiheitspartei und Hitlers NSDAP fortan ihre geistlo690 sen Parteitage in der Stadt Goethes und Schillers abhalten. Für Constens politische Rolle in einer der dramatischsten Phasen der Weimarer Republik könnte eine genauere Untersuchung seiner Verbindung zu Hermann Kriebel, dessen Frau und Georg Escherich möglicherweise aufschlussreich sein. Auch ob unter dem Wörtchen „usw.“ in dem oben zitierten Brief an Bindel etwa Ehrhardt, Lossow, Adolf Hitler oder Ludendorff verborgen waren, bedürfte einer genaueren Recherche, für die an dieser Stelle allerdings der Platz wie auch die Zeit fehlen. Dass Consten ein über zeugter Anhänger, später auch ein Parteigänger Hitlers war, ist durch den Eintrag seines Namens in der Mitgliederkartei der NSDAP jedenfalls akten691 kundig und auch durch einige seiner Briefe aus China sowie durch die Memoiren anderer China-Deutscher belegt, auf die an späterer Stelle einzugehen sein wird. Nicht nur für die Weimarer Republik, sondern auch für Hermann Consten und Emma persönlich ist das Jahr 1923 ein ausgesprochen unruhiges und schwieriges Jahr. Dem ansonsten vermutlich noch recht einträchtig im idyllischen Bad Blankenburg zusammenlebenden, immerhin nicht ganz unvermögenden Paar bereiten die Versorgungsengpässe, die massive Geldentwertung und Teuerung schon einige Sorgen. Consten kann wenigstens noch die Meierei der Kolonialschule in Witzenhausen bewegen, ihnen ab und an per Nachnahme und Eilboten ein Paket mit Butter und Käse zu schicken. Doch verfallen die Preise schließlich so rapide, dass die Molkerei ihre Produkte in der zweiten Oktoberhälfte nur noch gegen Vorkasse abgeben will. Der Molkereileiter schreibt nach Bad Blankenburg: Durch die fortschreitende Geldentwertung sind wir leider nicht mehr in der Lage, Ihnen die Butter und den Käse durch Nachnahme zu schicken. Denn als wir Ihnen die letzte Sendung zugehen ließen, stellten wir Ihnen die Butter mit 800 Millionen das Pfund in Rechnung, und als das Geld 374
3. „Krisenmanager“ in schwieriger Zeit
hier einging, kostete das Pfund Butter schon über 1 Milliarde. Vielleicht ist es Ihnen möglich, das Geld vorher durch Wert- oder eingeschriebenen Brief uns zuzusenden. Da Sie aber den Butterpreis nicht vorher wissen können, wäre es wohl zweckmäßig, wenn Sie einen größeren Betrag uns 692 zuschickten.
Die beiden werden außerdem – wie ein unerwarteter Aktenfund im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes offenbarte – noch einmal in höchst unangenehmer Weise an Constens unrühmliche Vergangenheit als Geheimagent in Budapest erinnert. Im Juni 1923 erhält Hermann Consten nämlich eine Aufforderung des Landgerichts I in Berlin, in einem Prozess des Grafen Mihály Károlyi gegen den Prinzen Ludwig Windischgraetz und den Ullstein-Verlag als Zeuge der Verteidigung auszusagen. Windischgraetz hatte in seinen Memoiren, die 1920 unter dem Titel Vom roten zum schwarzen Prinzen. Mein Kampf gegen das k.u.k. System bei Ullstein erschienen waren, Károlyi beschuldigt, während des Krieges Geld von der Entente genommen zu haben, um es in ihrem Sinne gegen die Zentralmächte zu verwenden – Vorwürfe, die übrigens auch in den hitzigen Debatten des ungarischen Parlaments während der letzten Wochen der Kriegsagonie von seiten der Rechten immer mal wieder gegen den „roten Grafen“ 693 erhoben worden waren. Doch Windischgraetz bezichtigte Károlyi in seinem Buch nun auch öffentlich des Hochverrats. Er lastete ihm die Alleinschuld am Ende der ungarischen Monarchie und an der Kriegsniederlage an. Károlyi hatte nach dem Rücktritt König Karls I. nur wenige Monate als Ministerpräsident und ab Januar 1919 als Staatspräsident der ersten ungarischen Republik amtiert. Im März 1919 war er dem Machtanspruch des aus dem Moskauer Exil heimgekehrten Radikalsozialisten Béla Kun gewichen. Im Juli war er dann mit seiner Familie ins Exil nach Podebrad bei Prag gegangen und lebte dort seither in vergleichsweise bescheidenen Verhältnissen. Die Klage gegen Windischgraetz und den Ullstein-Verlag hatte er 694 schon im Frühjahr 1922 angestrengt. Nachdem Béla Kuns Schreckensregiment durch eine Gegenrevolution gestürzt war und Ungarns Monarchisten im März 1923 Miklós Horthy zum Reichsverweser ausgerufen hatten, lief in Budapest ein Hochverratsprozess gegen Károlyi an, der für ihn mit dem Verlust seiner Latifundien in Ungarn, der endgültigen Verbannung aus 695 seiner Heimat enden sollte. 375
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
Hermann Consten – von dem Windischgraetz offenbar fest annahm, er sei im Besitz der Beweise für Károlyis Hochverrat – lehnt es ab, vor Gericht zu erscheinen. Mit der Begründung, als Geheimnisträger habe er sich seinerzeit unter Eid verpflichtet, niemandem Auskünfte über seine Tätigkeit zu geben und der Behauptung, noch immer Geheimnisträger zu sein, verweigert er die Zeugenaussage. Als zweiten Grund gibt er an, durch seine Aussage könnte ihm ein vermögensrechtlicher Schaden erwachsen. Im belgisch besetzten Aachen habe er noch Vermögen, das ihm von der Entente beschlagnahmt werden könnte. Denn in seiner Aussage müsse er ja gegen die Entente Stellung nehmen. Daraufhin wendet sich das Landgericht Berlin an das Reichsjustizministerium, um für Consten eine Aussagegenehmigung zu erwirken. Dieses wiederum möchte zunächst eine Stellungnahme des Reichswehrministeriums einholen. Das Reichswehrministerium rät von einer Aussagegenehmigung ab, will seinerseits aber vom Auswärtigen Amt wissen, inwiefern eine Aussage Constens unter Umständen dem Staatsinteresse und den Auswärtigen Beziehungen der Nachfolgerepublik 696 des Deutschen Kaiserreichs schaden könnte. So schiebt man den Fall zwischen den Ministerien eine ganze Zeitlang hin und her. Schließlich werden noch die Deutsche Gesandtschaft in Budapest und der ehemalige Generalkonsul, Graf Fürstenberg-Stammheim, eingeschaltet. Letzterer kann sich ein paar zynische Bemerkungen über das kurze Gedächtnis der jetzt in Budapest tätigen Beamten des AA nicht verkneifen, die von der peinlichen Agenten-Affäre aus dem Jahr 1918 gar kei697 ne Ahnung mehr haben. Tatsächlich scheinen der Systemwechsel im Reich, die Auflösung der Abteilung IIIb, die Vernichtung einschlägiger Akten und schließlich die Entsendung recht junger und unerfahrener Diplomaten auf die neu zu besetzenden Auslandsposten genügt zu haben, um die „Affäre Consten“ sang- und klanglos im Papierkorb der Geschichte verschwinden zu lassen. Selbst direkte Vorgesetzte Constens, wie der damalige Abwehrchef Major von Roeder, können sich nur noch vage erinnern. Herr Consten war von mir mit Genehmigung der Abteilung III b St. und im Einverständnis mit der OHL Abt. III b, nach Budapest entsandt worden, um dort im Einvernehmen mit den zuständigen Ungarischen Militärdienststellen an der Aufdeckung der gegen Deutschland gerichteten revolutionären Machenschaften zu arbeiten, 376
3. „Krisenmanager“ in schwieriger Zeit
erwidert Roeder auf eine entsprechende Anfrage der Heeresleitung vom 24. Juli 1923 und fährt fort: Hierbei nahm die Angelegenheit Károlyi einen breiten Raum ein und hat Consten hierüber zahlreiche Berichte nach Berlin gesandt, die nach Durcharbeitung an die zuständigen Stellen weitergeleitet wurden. Soweit ich mich heute noch erinnern kann, waren seine Geschäftsführung und seine Leistungen zufriedenstellend. Ob Consten im Falle Károlyi ungeschickt und nicht einwandfrei vorgegangen ist, kann ich heute nicht mehr sagen.
Roeder meint sich zwar dunkel zu erinnern, dass das Auswärtige Amt seinerzeit solche Ansichten geäußert habe. Wären sie jedoch zutreffend und von erheblicher Natur gewesen, so hätten die ungarischen Militärdienststellen seinerzeit mit Sicherheit auf Constens Abberufung gedrängt. Im übrigen liege es in der Natur der Aufgaben, wie sie Consten zu erledigen hatte, „dass hierbei oft ungerade Wege zu ihrer Lösung eingeschlagen werden 698 müssen“. Daher sieht Roeder in einer Zeugenaussage Constens eigentlich kein Problem. Er empfiehlt dennoch, vor einer endgültigen Entscheidung Constens unmittelbaren Vorgesetzten, den mittlerweile in Detmold tätigen Staatsanwalt Tornau zu befragen. Traugott Tornau war während des Weltkriegs Leiter der Politischen Gruppe der Abteilung IIIb des Stellvertretenden Generalstabs. In seiner Stellungnahme vom 17. August 1923 übt der gelernte Jurist zunächst einmal Kollegenschelte. Er kritisiert, dass die Anfrage von einer Zivilkammer stammt und aus den Anlagen nicht ersichtlich sei, worüber genau Consten denn befragt werden solle. Dann äußert er sich, nicht minder scharf, zu der von Consten in Budapest erbrachten Leistung: Consten war seinerzeit in dem von Herrn Major von Roeder angedeuteten Sinne in Budapest tätig. Seine Leistungen und seine Geschäftsführung haben mir seinerzeit nicht immer gefallen. Seine Berichte waren zum Teil phantastisch und praktisch nicht immer brauchbar. Auch lag bei der Art, wie er sich Nachrichtenquellen erschloss, die Gefahr einer Kompromittierung nahe. Diese trat dann auch eines Tages ein. Consten war auf einen Provokateur der Gegenseite, den man auf ihn angesetzt hatte, hereingefallen und musste Budapest verlassen. Wie die Dinge sich 377
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
damals im einzelnen abgespielt haben, ist mir nicht mehr erinnerlich. Ich glaube aber, mich daran zu erinnern, dass er sich hatte verleiten lassen, auf ein Erbieten zum Entwenden von Urkunden einzugehen. Diese Angelegenheit betraf, soviel ich mich erinnere, den Fall des Grafen Karo699 lyi.
Mit der Begründung, eine Zeugenvernehmung könnte die Reichsinteressen schädigen, rät Tornau nachdrücklich von einer Erlaubnis zur Zeugenaussage ab. Nachdem man auch im Auswärtigen Amt noch einmal gründlich über die Akten gegangen ist, auch das Consten-Kapitel der soeben in deut700 scher Sprache erschienenen Memoiren Károlyis eingehend studiert hat und zu dem Schluss gekommen ist, Károlyi habe dort vermutlich sämtliches ihm vorliegende Material gegen Consten ausgebreitet, fällt die Antwort an das Reichswehrministerium dann doch etwas anders aus als ursprünglich gedacht. Unter anderem heißt es dort: Die „Affaire Consten“ hat seinerzeit in Ungarn viel Staub aufgewirbelt und eine große Rolle in der Stimmungsmache gegen Deutschland gespielt. Die plumpe deutsche Einmischung in innere ungarische Angelegenheiten verletzte die stark ausgeprägte ungarische nationale Empfindlichkeit. Der Ansicht des Reichswehrministeriums, dass eine Aufrollung dieser ganzen Angelegenheit durch die Zeugenvernehmung Constens in dem Prozess Karolyi-Windischgraetz-Ullstein unerwünscht ist, muss deshalb beigetreten werden. Eine Aussage Constens hätte insbesondere das peinliche Ergebnis, dass die von Karolyi und seinen Freunden aufgestellten Behauptungen über die Beziehungen Constens zur Reichsregierung bestätigt würden und damit die Unwahrheit der seinerzeit abgegebenen 701 amtlichen deutschen Erklärungen in evidenter Weise aufgedeckt wäre.
Eine solche Selbstdesavouierung mit allen ihren unerfreulichen Folgen – so der Tenor der weiteren Stellungnahme des Auswärtigen Amtes – wäre nur dann in Kauf zu nehmen, wenn Constens Zeugenaussage den Beweis erbringen würde, dass Graf Károlyi tatsächlich Geld von der Entente genommen oder sich einer anderen landesverräterischen Handlung schuldig gemacht hätte. Denn dann wäre das damalige deutsche Vorgehen gegen Károlyi gerechtfertigt und gleichzeitig ein erbitterter Feind Deutschlands für immer unschädlich gemacht. Auch der derzeitigen ungarischen Regie378
3. „Krisenmanager“ in schwieriger Zeit
rung könnte es nur genehm sein, wenn Károlyi von einem deutschen Gericht des Landesverrats überführt würde. Doch erscheine es unwahrscheinlich, dass Consten über diesen Beweis verfüge. Denn hätte er seinerzeit einen solchen Beweis besessen, dann hätte das Generalkonsulat in Budapest davon gewusst, und der Generalstab hätte den Kampf gegen Károlyi 702 sicher weiter verfolgt. Tatsächlich hätte eine Aussage Constens, wäre durch sie die seinerzeit vehement bestrittene Einmischung deutscher staatlicher Stellen in die ungarische Politik offenbar geworden, die Bemühungen der Außenpolitiker der Weimarer Republik konterkarieren können, den Deutschen nach der „Schmach von Versailles“ allmählich wieder zu internationalem Ansehen zu verhelfen. Ob die von Graf Károlyi angestrengte Klage gegen Prinz Windischgraetz und den Ullstein-Verlag von Erfolg gekrönt war, ließ sich nicht mehr ermitteln. Hermann Consten jedenfalls dürfte erleichtert gewesen sein, sich nicht ein weiteres Mal wegen Károlyi öffentlich blamieren zu müssen.
4. Alte Netzwerke und neue Expeditionspläne Nachdem er und Emma in Thüringen also heimisch geworden sind, können sich auch die Honoratioren des gediegenen Kurortes an der Schwarza und des nahegelegenen Städtchens Saalfeld gelegentlich mit der Gesellschaft des ausgefallenen Paares schmücken. Unter all den Sanitätsräten, Bergwerksdirektoren, Tierärzten, Gymnasialleitern und wohlhabenden Geschäftsleuten ist der Paradiesvogel „Dr.“ Hermann Consten mit seiner ungarischen Lebensgefährtin schon bald eine stadtbekannte Größe. Er pflegt geselligen Umgang mit dem Zahnarzt Dr. Müllejans, der wie er aus dem Rheinland stammt, und mit Dr. Schmelzer, der in Bad Blankenburg ein Sanatorium leitet. Constens Mitgliedschaft im Schützenverein wurde bereits erwähnt, auch dass er wieder Verbindungen ins gar nicht so weit entfernt gelegene Witzenhausen geknüpft hat. Zu seiner alten Burschenschaft, der Arminia in Karlsruhe, nimmt Consten ebenfalls wieder Kontakt auf. Im Juni 1922 ist der Altherrenclub der ehemaligen Kolonialschüler neu 703 gegründet worden. Consten unterstützt die Clubaktivitäten finanziell, er stiftet auch Trophäen und erscheint ziemlich regelmäßig zu den gemeinsamen Treffen. Ferner erbietet er sich – wie einst aus Afrika –, gelegentliche 379
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
Artikel zur Zeitschrift Der deutsche Kulturpionier beizusteuern oder auch mal einen Vortrag zu halten. Nur sein Thema hat sich geändert. Nicht mehr der Kaffeeanbau in der – durch die Kriegsniederlage ohnehin verlorenen – Kolonie Deutsch-Ostafrika, sondern die Chancen der Einführung deutscher Viehzuchtmethoden in der Mongolei erscheinen ihm jetzt aussichtsreich. Zeitweise sieht er darin sogar ein neues Betätigungsfeld für die aus der Kolonialschule hervorgegangenen, jetzt arbeitslos gewordenen Experten. Zu geselligen Anlässen erscheint Hermann Consten gern auch in Begleitung Emmas: Mein lieber Kamerad Bindel, soeben erhalte ich den Kulturpionier. Besten Dank. […] – Zu gleicher Zeit bitte ich um genaue Angabe des Bankkontos d. Altherrenverbandes der Kolonialschule damit man weiß, wohin mit den Geldern. Zum 1. Juni [sic! Consten meinte wohl den 1.7. D.G.] komme ich mit meiner Frau, wahrscheinlich ein oder zwei Tage früher. Näheres später. – Bitte um Mitteilung über Kleidervorschrift, Orden und Ehrenzeichen u.s.w.,
schreibt Consten am 4. Juni 1923 aus Bad Blankenburg, später noch zu ergänzen:
704
um wenige Tage
Uns will sich eine Freundin meiner Frau anschließen, ich bitte deshalb Baronin Schobek auch unterzubringen. Kostenpunkt spielt keine Rolle. Auch heute hätte ich einen Vorschlag und zwar bin ich bereit, den jungen und alten Kameraden einen Lichtbildvortrag über meine letzte große Expedition im Inneren Asiens zu halten. Thema: Land und Leute in der Mongolei. Was denken Sie darüber? […] [handschriftlicher Vermerk Bindels auf Constens Postkarte: erle705 digt, ja, gerne willkommen ]
Im Jahr darauf bietet er Theodor Bindel an, einen Artikel über die Viehzucht in der Mongolei für den Kulturpionier zu verfassen. Herausgekommen ist jedoch etwas ganz anderes, wie er unter dem 7. Mai 1924 an Bindel erläutert: Einliegend schicke ich Ihnen den versprochenen Artikel. Ich wollte Ihnen eigentlich für den Kultur-Pionier einiges über die Landwirtschaft, Viehzucht usw. schreiben und als ich mir den Schaden besah, habe ich mich einige Stunden mit der hohen asiatischen Politik befasst, die vielleicht ebenso interessant sein würde wie Landwirtschaft und Viehzucht in der Mongolei. Denn erstens 380
4. Alte Netzwerke und neue Expeditionspläne
gibt es im Reiche der Khalkha keine Landwirtschaft und die Viehzucht überlässt der Mongole für gewöhnlich der Natur. Er sorgt nicht einmal für das Winterfutter, sodass die Tiere, wenn sie nicht durch Naturauswahl besonders widerstandsfähig sind, zu Grunde gehen. Aber alles Lebende, Mensch und Tier, die einen echten mongolischen Winter überleben, sind hart wie Stahl. Da ich nun Ihren vorgeschriebenen Raum so glänzend überschritten habe, wage ich es gar nicht, Ihnen noch Clichees mitzuschicken. Sollten Sie trotzdem wel706 che wünschen, so können Sie ja noch die Clichees sofort erhalten.
Wenige Tage später fügt er noch an: Sollten Sie übrigens meine Epistel für den Kulturpionier nicht für geeignet halten, so schicken Sie mir diese nur ruhig zurück, denn ich habe ständig in Zeit707 schriften und Tageszeitungen Verwendung dafür.
Man kann also getrost davon ausgehen, dass sich Consten nicht eigens die Mühe gemacht hat, über das ursprünglich angebotene Thema, das den Interessen der Kolonialschule viel eher entsprochen hätte, lange zu recherchieren. Dass er stattdessen einen politischen Artikel nach Witzenhausen schickt, ist aber insofern interessant, als es zeigt, dass er die aktuellen Entwicklungen in der Mongolei weiterhin sehr genau verfolgt. Bestätigt wird dies durch seine Karteisammlung. Sie enthält u.a. auch eine ganze Reihe von Zeitungsausschnitten deutschsprachiger Blätter, interessanterweise meist aus dem in Budapest erscheinenden Pester Lloyd, über die damaligen Ereignisse in der Mongolei. Und auch Besucher berichten ihm über die zentralasiatischen Verhältnisse und die Schicksale alter Bekannter. Immer zahlreicher und häufiger laufen jetzt die Nachrichten aus Centralasien hier in unserem stillen Bad Blankenburg bei mir ein,
schreibt Consten zum Schluss seines Artikels, der vor allem die Ereignisse zu Beginn des Jahrhunderts, das gemeinsame Streben der Mongolen und Tibeter nach Unabhängigkeit und die Rolle Agvan Doržievs beleuchtet hatte. Zwischen Nachrichten über großzügige Pläne und Projekte über Viehzucht, Industrie, Bahnbauten usw. laufen andere ein, die den Tod lieber 708 Freunde und großer politischer Führer Asiens melden. 381
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
Zum Sommer 1924 soll das Viehzucht-Thema aber doch noch zu Ehren kommen – als Vortrag. In dem Schreiben an Bindel, in dem Consten seine Bereitschaft dazu signalisiert, gibt allerdings ein Nebensatz Rätsel auf: Selbstverständlich bin ich bereit über das Thema „Tierzucht in der Mongolei“ zu sprechen, werde ich doch selbst von allen russischen Unternehmungen in dieser Frage um Rat und Sachverständigenurteil angegangen. Redezeit ist zwar etwas kurz, aber das schadet nichts, dann braucht man sich auch nicht zu sehr anzustrengen. Mir persönlich ist nämlich eine gute Flasche Wein lieber als der beste von mir gehaltene Vortrag, besonders wenn ein vernünftiger 709 Kerl einem dabei hilft, die Flasche zu leeren.
Constens Behauptung, alle russischen Unternehmungen würden ihn in Fragen, die Mongolei betreffend, um Rat und Sachverständigenurteil angehen, erscheint reichlich kühn. Ganz ausschließen lässt sich allerdings nicht, dass sie einen wahren Kern enthält. Denn, wie sich nur wenig später zeigen soll, gibt es offensichtlich Kontakte Constens zu Russen, und zwar im Zusammenhang mit der Mongolei. Mit Viehzucht hat dies allerdings wohl weniger zu tun, eher schon mit der Auffrischung alter Bekanntschaften – und mit neuen Reiseplänen. So erwähnt er in seinem Mongolei-Artikel für den Kulturpionier, er habe vor wenigen Tagen erst einen Brief „eines hohen burjatisch-mongoli710 schen Führers“ erhalten, der ihn über den Tod des Bogd Chan Jebtsundampa Chutagt unterrichtet habe. Das geistliche und weltliche Oberhaupt der Mongolei war 1924 unter ungeklärten Umständen gestorben. Davor bereits, so Consten in dem Artikel weiter, habe ihn der derzeitige russische Botschafter in Urga in Bad Blankenburg besucht und damals schon erwähnt, dass die Tage des Chutagt gezählt seien. Dieser Sowjetdiplomat, 711 Aleksej Nikolaevič Vasiljev, hatte seine Karriere vor dem Weltkrieg beim Telegrafenamt in Urga begonnen. Er gehörte zu Constens russischen Bekannten während seiner frühen Aufenthalte in der Mongolei. Vermutlich hat ihm Vasiljev davon abgeraten, für einen erneuten Aufbruch ins Land der Mongolen den für ihn recht riskanten Weg über die Sowjetunion zu wählen. Doch hält sich Consten in solchen Detailfragen sowieso noch bedeckt. Was nun meine Reisen betrifft, so muss ich erst einen Teil meines wissen382
4. Alte Netzwerke und neue Expeditionspläne
schaftlichen Materials aufgearbeitet haben, ehe ich wieder losziehe. Dann aber 712 werde ich mir in Deutschland vorher eine feste Basis schaffen,
schrieb er schon im April 1924 an Bindel. Nachdem er im August dann in Witzenhausen seinen Vortrag auf dem Altherrentag gehalten hat – Emma ist diesmal nicht mitgekommen –, empört er sich im September über mangelnde Geheimhaltung: Durch eine Indiskretion ist mein Expeditionsplan bekannt geworden. Von allen Seiten laufen Anfragen ein. […] Für die Expedition ist erforderlich: 1. wissenschaftliche und technische Vorbildung, Kenntnisse der Landessprache, mindestens Russisch. 2. Die Reise geht über Colombo, Tientsin. 3. Jedes unnütze Mitschleppen von Mitläufern kostet einen Haufen Geld. 4. Einheimische Bedienung gibt es in Hülle und Fülle. 5. Nach Beendigung der Expedition und deren Auswirkung für unsere landwirtschaftlichen Projekte greife ich unbedingt auf unsere Kolonialleute zurück. 6. komme ich in den nächsten Tagen 713 nach Witzenhausen.
Consten selbst hatte wohl zu fortgeschrittener Stunde und nach etlichen Flaschen Wein nicht den Mund halten können, hatte der Herrenrunde Pläne eines neuerlichen Aufbruchs in die Mongolei ausgeplaudert, die noch nicht reif waren. Immerhin war durch seine Replik auf die von ihm beklagte „Indiskretion“ zu erfahren, dass er realistisch genug war, die Route über China ins Auge zu fassen, obwohl sie wegen des dort herrschenden Bürgerkriegs auch nicht sicher war. Mit der „festen Basis in Deutschland“, die er sich vorher noch schaffen will, scheint es zum damaligen Zeitpunkt nicht allzu weit her gewesen zu sein. Zwar konnte die verheerende Inflation durch die Schaffung der Rentenmark in der Zwischenzeit gestoppt und eine wirtschaftliche Beruhigung herbeigeführt werden. Doch dürfte Consten klar gewesen sein, dass er vom Schreiben allein seine Reise nicht würde finanzieren können – es sei denn, er könnte die „wissenschaftliche Aufarbeitung“ seines Materials so gestalten, dass sie ihm ein breites Lesepublikum und damit hohe Auflagen bescherte. Möglicherweise war dies sogar der Grund, dass er sich gerade in jener Zeit an das Verfassen seiner historischen Erzählungen machte, dass er mehr oder weniger lustige Episoden seiner Jagdabenteuer in Zentralasien 714 und Afrika für die Gartenlaube und als Jugendliteratur aufbereitete. 383
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
Auch suchte er die Nähe einflussreicher Persönlichkeiten der Weimarer Republik, in denen er potentielle Gönner und Geldgeber vermutete. Ganz unabhängig von der Finanzierungsfrage scheint es ihm jedoch – wie schon bei seinen früheren Expeditionen, so auch jetzt – wichtig zu sein, besser allein zu reisen. Selbst Emma scheint zunächst nicht in seine Pläne eingeweiht zu sein, in ihnen auch gar keine Rolle zu spielen – allenfalls als Hüterin des gemeinsamen Domizils in Bad Blankenburg. Dabei wäre sie unter Umständen sogar eine ideale Reisepartnerin gewesen, war sie doch eine Frau, „die die Mongolei gut kennt“. Dies erklärte Consten jedenfalls 1929 in einem mongolischen Tempel gegenüber einem Lama, den er – voller Zukunfts715 ängste – als Orakel konsultierte. Vielleicht wäre sie gern mit ihm gekommen und hätte auch diese Passion mit ihm geteilt. Aber selbst von einer heißgeliebten Frau wollte er sich nicht in die Karten schauen lassen. Was Consten offenbar zum erneuten Aufbruch drängt, ist nicht nur der innere Trieb, wieder hinauszugehen, sondern auch die wachsende Befürchtung, andere könnten ihm zuvorkommen und seine Früchte ernten – spukt ihm im Hinterkopf doch noch immer der Wunsch, die 1912 entdeckte Totenstadt und das Fürstengrab in der Höhle am Bajdrag zu öffnen, die Schätze zu bergen. Damit hofft er wohl, sich das wissenschaftliche Renommee zu verschaffen, das ihm immer noch nicht in dem Maße zugestanden wird, wie er es für sein Selbstwertgefühl braucht. In der Zeitung hatte er über die Zentralasien-Expedition des amerikanischen Naturwissenschaftlers Roy Chapman Andrews gelesen. Auf den Spuren der Dinosaurier war er ausgerechnet nahe jener Gegend fündig geworden. Dies macht Consten verständlicherweise nervös. Außerdem hat er zur Kenntnis nehmen müssen, dass es schon seit geraumer Zeit Bewegung in den deutsch-mongolischen Beziehungen gibt. Zwar scheint eine offizielle Anerkennung noch immer in weiter Ferne zu liegen, doch waren 1922 und 1923 zwei deutsche Diplomaten – der eine von Moskau, der andere von Peking aus – mehrmals in die Mongolei gereist, um die Möglichkeiten wirtschaftlicher und kultureller Zusammenarbeit zu sondieren. Anfang August 1922 traten sie dort sogar gemeinsam auf und wurden vom Ministerpräsidenten, Žalchanc Chutagt Damdinbazar, empfangen, den Consten doch zu seinen ganz persönlichen Freunden zählte. 716 Die ausführlichen Berichte des Legationsrats Rudolf Asmis von der deut384
4. Alte Netzwerke und neue Expeditionspläne
schen Gesandtschaft in Moskau und des in Peking stationierten Legations717 sekretärs Hermann Gipperich hatten immerhin zur Folge, dass sich die Reichsregierung offen zeigte für die Einrichtung eines mongolischen Wirtschaftsbüros in Berlin, für die Aufnahme inoffizieller Handelskontakte und für die Entsendung deutscher Fachleute in die Mongolei. Auch der Gedanke einer Zusammenarbeit auf dem Bildungssektor war in den Berichten von Asmis und Gipperich erstmals angesprochen worden. Die Mongolen, genauer ihre burjatischen Berater, bekundeten jedenfalls ernsthaftes Interesse, die staatlichen Schulen der Mongolei nach dem deutschen Schulsystem zu organisieren und sie mit entsprechenden Unterrichtsmaterialien aus Deutschland auszustatten. Vor allem schien es ihnen die Reformpädagogik angetan zu haben, die in der frühen Sowjetunion eben718 falls auf bildungspolitisches Interesse gestoßen war. Beide Diplomaten zeigten sich angenehm überrascht angesichts der großen Deutschfreundlichkeit ihrer mongolischen Gesprächspartner. Zu ihnen gehörte neben anderen auch Prof. Žamsrano Ceveen. In seinem dritten Bericht schrieb Gipperich über ihn: Im Unterrichtswesen gilt seit Jahren als unbestrittener Führer Dschamserano, ein intelligenter Burjäte, der auch die treibende Kraft in der hauptstädtischen Akademie der Wissenschaften ist. Er gilt als deutschfreundlich und beschäftigte sich eine zeitlang mit dem Gedanken, Deutschland zum Studium des Unterrichtswesens zu bereisen. Der Plan 719 ist – angeblich wegen Geldmangels – vorläufig zurückgestellt worden.
Den beiden Diplomaten waren natürlich nicht die latenten Spannungen im sowjetisch-mongolischen Verhältnis entgangen. Gipperich wurde in Ulaanbaatar Anfang August 1922 sogar Zeuge einer größeren Verhaftungswelle, 720 der u.a. der mongolische Ex-Premier D. Bodoo zum Opfer fallen sollte. Über seine noch immer recht guten Kontakte zum Auswärtigen Amt war es Consten gelungen, sich Kopien der als geheim eingestuften Berichte der beiden Diplomaten zu verschaffen. Jedenfalls fanden sich bei den dies721 bezüglichen Akten des Politischen Archivs ausführliche Stellungnahmen Constens als Anhang – insgesamt etwa 20 eng mit der Schreibmaschine beschriebene Blätter, auf denen er einzelnen Punkten mal zustimmte, mal sie ergänzte, gelegentlich den Einschätzungen Asmis’ und Gipperichs auch ve385
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927 722
hement widersprach. Vor allem aber schien er bemüht, die eigene Pionierrolle, seine Spezialkenntnisse und seine persönlichen Verdienste um die Propagierung deutscher Interessen in der Mongolei, wie auch als Überbringer des mongolischen Wunsches nach offiziellen Beziehungen zum Deutschen Reich in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, immer wieder herauszustreichen. So schrieb er u.a. zur Beurteilung der allgemeinen politischen Lage in der Mongolei in Asmis’ erstem Bericht vom August 1922: Auch Punkt b zeigt keinerlei Veränderung gegen das Jahr 1912 (s. meine Weideplätze), hatte doch auch damals schon der Dalai Lama seinen Ver723 treter „Aquan Dortscheff“ [d.h. einen Burjaten; D.G.] dort in Urga sitzen. Die russischen Truppen wurden damals auch gebeten, in Urga zum Schutze gegen die Chinesen zu bleiben und Unabhängigkeitsverträge zwischen den unerfahrenen Mongolen und Russland geschlossen. Und nur mein Eingreifen vereitelte es den Russen, eine vollständige Monopol724 Stellung zum Schaden Deutschlands in der Mongolei durchzusetzen.
Mit gespielter Bescheidenheit nahm Consten auch das Hauptverdienst an der großen Deutschfreundlichkeit der Mongolen für sich in Anspruch. Für mich persönlich ist die Deutschfreundlichkeit der Mongolen von größtem Interesse, glaube ich doch, einen kleinen Teil dazu beigetragen zu haben. Es ist nicht anzunehmen, dass die Russen während des Krieges nach meiner Rückkehr gerade für uns Propaganda gemacht haben, ebenso wenig die Chinesen. Als Faktor für die mongolische Deutschfreundlichkeit kämen vielleicht noch einige deutsche Offiziere in Frage, die angeblich unter Ungern-Sternberg gefochten haben. Zu meiner Zeit war in der Mongolei nur die Waffenfabrik Mauser wegen ihrer Pistolen und Gewehre bekannt. Ich hatte alle Mühe, die Mongolen auf die deutsche Industrie aufmerksam zu machen, da deren Erzeugnisse von den russischen 725 und chinesischen Importeuren als ihre eigenen ausgegeben wurden.
Dass ihm bei der Einschätzung der aktuellen Lage in der Mongolei nicht nur eigene Kenntnisse und Erfahrungen, sondern vor allem auch russische und mongolische Gewährsleute zu Gebote standen, deutete Consten beiläufig mit der Bemerkung an, nicht nur prominente Burjaten wie Žamsrano persönlich zu kennen, sondern auch I. M. Majskis Buch Sovremennaja 386
4. Alte Netzwerke und neue Expeditionspläne
Mongolija (Die heutige Mongolei) bereits ins Deutsche übersetzt zu haben. 726 Das Werk sei „von mir seit Monaten vollendet und durchgearbeitet“, erklärte Consten gleich zweimal. Eine landwirtschaftliche Erschließung der Mongolei durch deutsche Siedler, wie sie von Asmis ins Gespräch gebracht wurde, bewertete Consten als konfliktträchtig, aber dennoch möglich. Weniger Ackerbau und Viehzucht als vielmehr die Forstwirtschaft hielt er für aussichtsreich, Industrie hingegen für „Zukunftsmusik“. Ähnlich kritisch auch seine Einschätzung einer deutschen Beteiligung an der Erschließung mongolischer Goldvorkommen. Was insofern bemerkenswert ist, als sich Consten selbst, zehn Jahre zuvor, bereits als Mongolei-Vertreter eines von Mannesmann geführten deutschen Konsortiums für die Erschließung der mongolischen Goldvorkommen gesehen und eine entsprechende Evaluierung vor Ort vorgenommen hatte. Constens Resümee zu den Diplomatenberichten ist überraschend nüchtern: Ein Eingreifen der Deutschen in die Leitung der mongolischen Wirtschaft ist nach den trüben Erfahrungen im Weltkriege nur dann möglich, wenn wir uns von dem Standpunkte „Bei uns zu Hause wird das so ge727 macht“ ein für allemal zurückziehen.
Schließlich befand Consten im Sommer 1923 hinsichtlich Gipperichs zweiten Mongolei-Berichts, dieser bestätige „alles, was ich vor Jahren schon über die Mongolei niedergeschrieben habe“. Gipperichs Schlusssatz über eine deutsche Betätigung in der Mongolei meinte er dahingehend ergänzen zu müssen, dass sie „von landeskundigen deutschen Leuten geleitet wird“. Womit er sich natürlich selbst ins Spiel zu bringen versuchte. Und er glaubte, das richtige Rezept zu haben, wie deutsche Wirtschaftsinteressen in der Mongolei durchzusetzen seien, ohne dabei Mongolen, Chinesen und Russen zu verärgern. Auch ich bin der Meinung, dass ein deutsch-russisches Zusammenarbeiten auf wirtschaftlichem Gebiet möglich ist, wobei Russland das Durchgangsland sein wird. Ebenso wichtig aber für unseren Handel ist ein gleichzeitiges deutsch-chinesisches Zusammenarbeiten. In beiden Fällen käme die Gründung deutsch-russischer und deutsch-chinesischer Handelsgesellschaften in Frage, bei denen kaufmännisch und technisch der deutsche Einfluss vorherrschend sein müsste. Der deutschen Tüchtigkeit, 387
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
der Kenntnis von Land und Leuten müsste es vorbehalten bleiben, die Wirtschaftslage in der Mongolei zu unseren Gunsten auszunützen, ohne dabei Mongolen, Chinesen und Russen zu verletzen. Immerhin liegt die Gefahr vor, dass wir bei der Entwicklung der politischen Situation zwi728 schen zwei Mühlsteine geraten.
Doch gab es, wie Consten im Laufe der Zeit ebenfalls zur Kenntnis nehmen musste, inzwischen längst auch andere deutsche Fachleute mit Führungsqualitäten und Mongolei-Erfahrung. Einige von ihnen, wie der bereits erwähnte Geologe Fritz Weiske oder der für das Flugzeugunternehmen Junkers tätige Bernhard Waurick, waren im Ersten Weltkrieg auf der Flucht aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Zentralasien gelangt und oft erst nach Monaten oder Jahren des Aufenthalts in der Mongolei über China oder die Sowjetunion nach Deutschland zurückgekehrt. Diese Leute versuchte Consten nach Möglichkeit zu ignorieren oder, wenn dies nicht klappen wollte, gegenüber Dritten – wie im Falle Waurick geschehen – als poli729 tisch unsichere Kantonisten hinzustellen. Anfang 1925 findet er sich dann aber doch im Kreis derjenigen wieder, die aktiv an der Belebung deutsch-mongolischer Beziehungen arbeiten. Consten erhält Gelegenheit, den Volksbildungsminister der Mongolischen 730 Volksrepublik, Erdene Batchaan (Batukhan), auf einer Rundreise durch Deutschland zu begleiten. Erneut gibt es für ihn einen wichtigen Grund, seine Teilnahme an einer Altherrentagung in Witzenhausen abzusagen: Leider kann ich zu unseren Altherrentagen nicht kommen, da ich durch die Anwesenheit des mongolischen Kultusministers, mit dem ich schultechnische Fragen zu erledigen habe, verhindert bin. Wenn ich es eben möglich machen kann, werde ich den Herrn bei einem späteren Termin nach Witzenhausen 731 schleppen.
Erdene Batchaan sucht Consten in Bad Blankenburg auf. Beide Herren posieren in Constens Bibliothek für die Presse. Auf einem Tisch vor sich ausgebreitet haben sie ein Exemplar der von Consten angefertigten politischen Landkarte der Mongolei. Aus dem gemeinsamen Besuch in Witzenhausen wird allerdings nichts. Denn, so lässt er Bindel unter dem 27. März 1925 wissen:
388
4. Alte Netzwerke und neue Expeditionspläne
Es kam uns allerhand dazwischen, umso mehr wir in Berlin durch Einkaufen eines Observatoriums, verschiedener Laboratorien usw. allerhand zu tun hat732 ten.
Es dürfte Consten angenehm überrascht haben festzustellen, dass er es mit einem mongolischen Politiker zu tun hat, der mit recht konkreten Vorstellungen sowie einer gut vorbereiteten Einkaufsliste nach Deutschland gereist ist und der realistisch genug ist, dabei Prioritäten zu setzen und mit dem Wichtigsten zu beginnen: der Schaffung der technischen Voraussetzungen für ein Schul- und Berufsbildungssystem, das den Anforderungen der Moderne gewachsen ist. Bevor Batchaan im Februar 1925 zu seiner Rundreise aufgebrochen war, hatte er in Berlin bereits drei Mo- Abb. 18: Erdene Batchaan zu Besuch bei Consten in Bad Blankenburg, 1925 nate lang den Unterricht an Volks- und Gewerbeschulen beobachtet sowie Lehrwerkstätten großer Berliner Firmen, darunter Siemens-Schuckert und Junkers besichtigt. Während seines Aufenthalts in der Reichshauptstadt erhielt der Minister, der von der sowjetischen Botschaft betreut wurde und bei Bernhard Waurick lebte, auch einen Gesprächstermin im Auswärtigen Amt. Dort empfing man ihn durchaus zuvorkommend. Man hatte ein offenes Ohr für sein Anliegen wie auch einen guten Eindruck von der Persönlichkeit des Gastes aus der Mongolei. Bei den Besprechungen erwies sich Batushan [sic] als gebildeter, kluger, sorgfältig abwägender Mann, der mit angestammtem Misstrauen einen 733 klaren Blick für die Bedürfnisse seiner Heimat verbindet.
Nun geht es also darum, die notwendige Ausstattung für die Gründung ei389
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
nes Technikums in Urga zu beschaffen und Möglichkeiten zu sondieren, mongolische Schüler und Berufspraktikanten zur Ausbildung nach Deutschland zu schicken. Ganz in der Nähe von Bad Blankenburg gehört die Freie Schulgemeinde Wickersdorf zu den reformpädagogischen Einrichtungen, für die sich Batchaan besonders interessiert. So ist anzunehmen, dass Consten ihn zu seinem Gespräch mit Gustav Wyneken, dem Schulgründer, und mit dem Schulleiter Peter Suhrkamp dorthin begleitet. Als eine der wenigen Freien Schulen in Deutschland nimmt Wickersdorf ausländische Schüler auf. Darunter befinden sich in der Weimarer Zeit auch Kinder sowjetischer Diplomaten. Die andere in Frage kommende Institution ist die Freie Schul- und Werkgemeinschaft Letzlingen bei Gardelegen; auch sie steht auf Batchaans Besuchsliste. Beide Schulgemeinden sind zur Aufnahme mongolischer Schüler bereit. Man bespricht die Modalitäten. Vor allem geht es dabei um die Notwendigkeit ausreichender deutscher Sprachkenntnisse, Fragen des Schulgelds und der Betreuung durch mongolische Ansprechpartner in Berlin. Man kommt überein, dass ausgewählte Schüler und Ausbildungsaspiranten 1926 nach Deutschland kommen und zunächst gemeinsam privaten Deutschunterricht in Berlin erhalten sollen. Ab 1927 sollen sie dann auf verschiedene Einrich734 tungen, Berufsfachschulen und Ausbildungsbetriebe verteilt werden. In Leipzig, wo die Reisegruppe den Sinologen und Mongolisten Prof. 735 Erich Haenisch aufsucht und die Mongoleisammlung im Grassi-Museum für Völkerkunde in Augenschein nimmt, gibt Batchaan außerdem noch bei dem kartografischen Betrieb Wagner & Debes den Druck der ersten modernen Landkarte der Mongolei sowie einen Schulatlas mit mongolischen Lettern in Auftrag. Und schließlich landet man wieder in Berlin, wo nicht nur das von Consten bereits erwähnte Observatorium und die Laboratorien für das geplante Technikum angekauft werden, sondern auch eine komplette Ausrüstung für die Herstellung von Kinofilmen. Die Filmhochschule Babelsberg erklärt sich zur Ausbildung eines Filmtechnikers bereit. Während Consten Ende März nach Bad Blankenburg zurückkehrt, rüstet sich Batchaan für die Heimreise in die Mongolei. Ebenfalls zu jener Gruppe burjatischer Intellektueller gehörend, die eine führende Rolle in der jungen mongolischen Volksrepublik spielen, scheint Erdene Batchaan Hermann Consten schon aus früheren Jahren gekannt zu 390
4. Alte Netzwerke und neue Expeditionspläne
haben. Laut Auskunft der Enkelin, Dr. A. Saruul, lebte der Großvater seit 1912 in Urga – einer Zeit also, als sich Consten dort ebenfalls aufhielt. Consten selbst bezeichnete ihn gegenüber Ethel J. Lindgren als einen „alten 736 Freund“. In seinen „Weideplätzen“ hat er ihn allerdings nirgends erwähnt. Wie auch immer, Consten scheint tief beeindruckt zu sein von der Klugheit, Umsicht und Zielstrebigkeit, mit der Erdene Batchaan sein Vorhaben umzusetzen versucht. Einen längeren Artikel über die Mongolen, den er unter dem unmittelbaren Eindruck seiner Begegnung mit dem Volksbildungsminister geschrieben hat und der am 29. März 1925 in der liberalen Bremer Weser-Zeitung erscheint, beschließt er mit dem folgenden Passus: Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Mongolei unter der jetzigen mongolischen Volksregierung, die, was Intelligenz anbelangt, zu dem besten gehört, was Asien seit langem hervorgebracht hat, in seiner Entwicklung einen großen Schritt nach vorwärts tut. Die jetzige Volksregierung will vor allem den Durchschnitt der Bevölkerung in seiner Lebenshaltung höher heben, ihr Wissen durch Einführung europäischer Schulen vergrößern und das Volk von dem unglücklichen Einfluss der niedrigen Lamas 737 mit Hilfe der höheren intelligenteren Lamas befreien.
Der letzte Satz lässt nur anklingen, dass tatsächlich einige der ranghöchsten Lamas des Landes führende Regierungsämter übernommen hatten. Im ersten Jahrzehnt des unabhängigen mongolischen Staates, und selbst noch über den Tod des VIII. Jebtsundampa Chutagt und die Gründung der Volksrepublik 1924 hinaus, hatten diese Persönlichkeiten, selbst während der politischen Wirren im Gefolge des Ersten Weltkrieges, der Rückeroberung Urgas durch die Chinesen und des Schreckensregiments unter dem Kosakenoffizier Roman von Ungern-Sternberg, die angestrebte Unabhängigkeit nicht aus dem Auge verloren. Žalchanc Chutagt, über den Consten schon in den „Weideplätzen“ voller Bewunderung geschrieben hatte, war 1921 Innenminister in Ungern-Sternbergs Marionettenregierung und, ab 1922 bis zu seinem Tod 1923, Ministerpräsident der Regierung des Bogd Chan. Er war es auch gewesen, der im August 1922 Asmis und Gipperich empfangen und den Wunsch seiner Regierung nach Abschluss eines mongolisch-deut738 schen Handelsvertrages geäußert hatte. Diluv Chutagt Žamsranjav, der vielgerühmte Delobin Gegen aus Constens „Weideplätzen“, hatte bereits ab 391
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
1919 Aufgaben für die Regierung übernommen. Er trat sogar in die 1921 gegründete Mongolische Volkspartei (MVP) ein und amtierte zeitweise als 739 Erster Sekretär der Mongolischen Botschaft in Moskau. Dass das Zeitfenster einer gewissen, von der allgegenwärtigen Komintern geduldeten Liberalität und Weltoffenheit der noch nicht einmal ein Jahr alten Volksrepublik Mongolei – nach Jahren blutigster Kämpfe um Macht und Vorherrschaft im Land – nur ein kurzes Aufatmen sein würde, dass mit dem Tod Lenins und dem Aufstieg seines Nachfolgers Stalin die Hardliner der Komintern, der KPdSU und der Mongolischen Revolutio740 nären Volkspartei zum Frontalangriff auf den tief in der mongolischen Kultur und Gesellschaft verankerten Lamaismus und den als Rechtsnationalismus geschmähten Kurs einer eigenständigen Politik übergehen würden, das konnte Consten von seiner fernen deutschen Warte aus dann doch noch nicht erkennen. Der Deutschland-Besuch Erdene Batchaans, ihr Wiedersehen und die Gespräche während der gemeinsamen Rundreise jedenfalls dürften Constens Wunsch, noch einmal in die Mongolei aufzubrechen, erst recht angefacht haben. Gern dürfte er deshalb auch die Einladung, sich am Ausbau des Komitees für Schrifttum zu einer Mongolischen Akademie der Wissenschaften zu beteiligen, angenommen haben, zumal da ihm Batchaan angeblich auch grünes Licht für archäologische Grabungen gab. Nur die Kosten für seine Reise in die Mongolei, die musste er wohl selbst auftreiben. Wieder einmal sucht Hermann Consten die Nähe der Reichen und (einstmals) Mächtigen. Mit Herzog Adolf Friedrich [von Mecklenburg; D.G.] habe ich beim Begräbnis des Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt, den ich mit 300 Fackeln nachts mit meinen Leuten beerdigte, alte Erinnerungen aufgefrischt und von morgens vier bis um sechs gefrühstückt,
schreibt Consten unter dem 1. Juli 1925 an Bindel und fügt mit Blick auf die auf Förmlichkeit und Etikette achtende Strenge des alten Kolonialschulleiters Fabarius scherzhaft an: Ich hätte sein Entsetzen sehen wollen, wenn er mich bei der Fürstin von Schwarzburg und bei Adolf Friedrich in meinem grauen schmutzigen Velvet741 anzug verschmiert und verrußt durch die Fackeln gesehen hätte. 392
4. Alte Netzwerke und neue Expeditionspläne
Fürst Günther von Schwarzburg-Rudolstadt war bereits am 16. April gestorben. Doch hatte seine Beisetzung in der Schwarzburger Fürstengruft wenige Tage später zunächst nur vorläufig stattgefunden. Denn eine Notgemeinschaft der schaffenden Stände, Bund der Deutschen hatte den Vorschlag gemacht, eine Kapelle als letzte Ruhestätte des Fürsten und einen Gedenkstein errichten zu lassen. Zu diesem Zweck sollte ein feierlicher Spendenaufruf an die vaterländischen Verbände wie auch an die Bevölkerung der beiden ehemaligen Schwarzburgischen Länder die erforderlichen Mittel beibringen. Also nicht das Begräbnis, sondern die Veröffentlichung dieses Spendenaufrufs im Sommer 1925 war das Ereignis, weshalb sich die erlauchte Gesellschaft zur nächtlichen Trauerfeier im Fackelschein an der Fürstengruft auf der Heidecksburg in Rudolstadt zusammenfand. Bei dem erwähnten nächtlichen Anlass begegnet Consten u.a. auch Prinz Heinrich 742 der Niederlande, einem Neffen der Fürstin Schwarzburg. Im Februar 1926 reist er zu einer „wichtigen Besprechung“ mit dem aus dem Hause Mecklenburg-Schwerin stammenden Gemahl der niederländischen Königin Wil743 helmina nach Berlin. In Constens Nachlass existiert außerdem noch ein kurzes Handschreiben des Prinzen aus dem Jahr 1927, in dem er verspricht, ihm eine Audienz bei Legationsrat Ago von Maltzahn zu verschaffen und 744 wünscht ihm viel Erfolg für seine bevorstehende Mongolei-Expedition.
5. Ende einer großen Liebe: Consten und die Frauen Ausgerechnet als seine Expeditionsvorbereitungen konkrete Formen anzunehmen beginnen, trifft Hermann Consten im Februar 1927 ein unerwarteter Schlag. Emma, seine ungarische Gefährtin, verlässt ihn zum Monatsende, zieht aus ihrem gemeinsamen „Nest“ in Bad Blankenburg endgültig aus. Zwei Wochen vorher hatte sie ihm die Trennung in einem Brief ange745 kündigt. Konsterniert, ratlos und wütend steht Consten vor den Trümmern einer Liebesbeziehung, die – gewiss mit vielen Höhen und Tiefen – immerhin neun Jahre gehalten hatte. Die tieferen Gründe für den Bruch lassen sich nur erahnen. Wie immer, wenn sich zwei Menschen auseinandergelebt haben, wenn eine große Liebe stirbt, sind wohl mehrere Faktoren verantwortlich für die beiderseitige Entfremdung. Im Falle Constens kann man davon ausgehen, dass seine häufige Abwesenheit von Bad Blankenburg, mangelnde Offenheit hinsichtlich sei393
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
Abb. 19: Sommerfreuden in Bad Blankenburg. Das einzige noch existierende Foto, das den hier als Lama verkleideten Hermann Consten mit seiner ungarischen Lebensgefährtin (re.) zeigt. Foto 1926
ner persönlichen Absichten und Pläne, Eifersucht und vor allem finanzielle Probleme immer mal wieder zu Streit Anlass gaben. Nicht zu unterschätzen aber dürfte auch gewesen sein, dass Emma unter Heimweh nach Ungarn und der – wahrscheinlich unfreiwilligen – Trennung von ihren Kindern wohl mehr litt als sie sich selbst eingestanden hatte. Vielleicht hatten beide Partner auch die psychische Belastung unterschätzt, die daraus resultierte, dass sie ihre Beziehung auf eine Lebenslüge gebaut hatten – eine Fiktion, die auf die Dauer nicht aufrechtzuerhalten war – ebenso wenig wie zuvor Constens angeblicher Majorsrang und, demnächst irgendwann, sein angemaßter Doktortitel. Denn entgegen dem Eindruck, den Hermann Consten bei Freunden und Verwandten stets erweckte, waren er und seine ungarische Gräfin keineswegs miteinander verheiratet. Sie lebten – je nach Standpunkt – in „freier Lebenspartnerschaft“ oder in „wilder Ehe“ zusammen. Wäre dies jedenfalls ruchbar geworden, so wäre ihnen damals sowohl in den konservativen Kreisen, in denen sie zu verkehren pflegten, wie auch in der kleinbürgerlichen Enge Bad Blankenburgs die gesellschaftliche Isolation sicher gewesen. 394
5. Ende einer großen Liebe: Consten und die Frauen
Wie Du weißt, war ich vorher niemals verheiratet, obwohl ich manchmal dazu energische Anläufe unternahm. So war auch die Dame, die in Blankenburg allgemein als meine Frau galt, nicht mit mir verheiratet. Gott sei Dank, sage ich heute, denn als sie mich freiwillig verließ, war die Sache für alle Beteiligten viel einfacher u. eine Scheidung nicht nötig.
Diese Zeilen wird Hermann Consten mehr als zehn Jahre später, als er dann tatsächlich verheiratet ist, aus China an Margarete Jacobi-Müller (Grete Strölin) schreiben – an die Frau also, die er unmittelbar nach Emmas Weggang mit einem ihrer beiden Söhne aus geschiedener Ehe in seine Blankenburger Wohnung aufnimmt und die anschließend, über Jahrzehnte hinweg, in seltener Treue Constens Bibliothek und Sammlungen hütet. Und um das Kapitel Emma ein für alle Mal zu beenden, wird Consten in seinem Brief an ihre damalige Nachfolgerin noch anfügen: Ich habe niemals mehr etwas von ihr gehört. Doch halt, einmal erhielt ich Nachricht, dass sie nach Ungarn zu ihrem Vater zurückgekehrt sei. Für mich ist die Sache längst begraben u. deshalb bitte ich Dich auf diese Geschichte in Deinen Briefen nicht weiter einzugehen. Man soll Tote ruhen und in Frieden 746 lassen und im übrigen war das alles „Schicksal“.
Dass Emmas Auszug für Consten nicht nur eine persönliche, sondern auch eine finanzielle Katastrophe bedeutet haben muss, beleuchtet ein Brief aus Budapest, den er um die Jahreswende 1925/26 von Emmas Vater erhalten hatte – ein Brief, der die Abhängigkeit des Paares von Geldzuwendungen aus Ungarn deutlich machte. Diesem Mann, der in seinen privaten Auf747 zeichnungen immer nur als „Ede bácsi“ – auftaucht, scheint Consten im Zusammenhang mit seiner Agententätigkeit gegen Mihály Graf Károlyi, ei748 niges an Rückendeckung zu verdanken. All dies, wie auch Emmas Rolle in dieser Affäre, gehört nach wie vor zu den dunklen Geheimnissen in Constens Leben. In dem erwähnten Brief jedenfalls – in familiärer Vertrau749 lichkeit wird Consten hier „Pöty“ (Knöpfchen) genannt – war es unter anderem um Geld gegangen – genauer um Geld, das eigentlich „Ede bácsi“ beziehungsweise Emma gehörte. Lieber Pöty! Budapest, den 1.1.1926 Dein Schreiben vom 28. vorigen Monat habe soeben erhalten u. kann Dich ver395
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
sichern, dass dessen Inhalt mir einen Wutanfall verursachte, nachdem deine mir geschilderte Lage schon zur großen Allgemeinheit gehört. Der Unterschied besteht nur darin, dass der eine die jetzige missliche Lage mit mehr Geschick, Einteilung u. Entbehrung durchschwimmt, der andere aber hilflos im Wasser herumarbeitet, und dadurch sein[em]Untergehen noch nachhilft. Die jetzige Zeit ist die Zeit der Geduldsproben u. Karakterstärke [unles.] der Entbehrungen. Wer letztere Eigenschaften besitzt u. trachtet sie zu besitzen, kommt durch. Wer sich aber ins Unabänderliche nicht fügen will oder kann, der geht unter. Du, der bei Deinen großen Reisen schon Proben von Willensstärke, Ausdauer und Entbehrungen ablegtest, wirst wohl die jetzige missliche Lage durchstehen können. Mit strenger Einteilung und Entsagung vom Gewöhnten kann das Gleichgewicht von Haben u. Soll stets hergestellt werden. Ich kenne sehr viele, welche heute knausern und ihre Ansprüche aufs Minimum reducieren, die früher in Hülle u. Fülle lebten. Bei diesen ist die Erkenntnis gekommen, dass man sich nach der Decke strecken muss und nicht sich ausbreiten unter einer kleinen Decke, da dann nur ein kleiner Teil gedeckt wird.[…] Wie Du aber mir zu wissen gibst, muss am 1. Jänner 400 Mark Miete gezahlt werden. So sende ich morgen pro Jänner 700 Goldmark. Da ich dein Schreiben erst heute erhielt u. ich mir Mark erst morgen verschaffen kann, so kann [ich] das Geld erst morgen, den 2. Jänner 1926 absenden. Hoffentlich wird der Hausherr Einsehen haben, so wie ich es habe, denn in meinem sowie Emmas Haus sind Mieter, die den Zins pro November noch nicht beglichen haben. Da bei uns der Mietzins erst zu 6% vom Friedenszins war, die Steuern u. Abgaben, sowie die wichtigsten Reparaturen fast den ganzen Ertrag auffressen, die 36% Stiegenmieter auch in Rückstand sind, die Wertpapiere ohne Wert u. namhaften Ertrag sind, so reducieren sich die Einnahmen auf ein Minimum. Und da bei uns die Reparaturen vom kleinen Zins bestritten werden sollen, daher sind alle Häuser in einem desolaten Zustand, der für die Dauer nicht bestehen kann. Nach den großen Reparaturen werden die Häuser auf Jahre hinaus nichts tragen, also keine Revenuen abwerfen. Dies [ist] die Lage mit der man rechnen muss, u. in die man sich hineinfinden muss. Jeder ernst denkende Mensch muss sich ins Unvermeidliche u. Unabänderliche hineinfügen. Ich will gern hoffen, dass dies auch bei Euch der Fall sein wird. Also, wie Du siehst, ist der erhoffte Wutanfall nicht so schlimm aus750 gefallen u. glaube, dass Du meinen Erörterungen Recht geben musst. 396
5. Ende einer großen Liebe: Consten und die Frauen
Im weiteren Verlauf seines Briefes schilderte „Ede bácsi“, wie die Familie in seiner Budapester Villa seinen 65. Geburtstag und das Weihnachtsfest verbracht hatte. Man habe das Grab seiner ersten Frau besucht und Silvester eine große Gesellschaft gegeben. Er berichtete über gemeinsame Bekannte und Emmas halbwüchsigen Sohn „Bubi“, der alle, auch in Emmas Namen, beschenkt und sich mittlerweile zu einem der flottesten Tänzer im Ballsalon des Hotels Gellért gemausert habe. Über diesem Teil des ernsten Briefes an den „Schwiegersohn“ schimmerte noch ein schwacher Abglanz der ungarischen Monarchie und der großen Adelsfeste von einst. Doch diese Zeiten sind nun endgültig vorbei. Und Hermann Consten steht praktisch wieder einmal vor dem Nichts. Da ihm auch Bruder Franz Consten angesichts wachsender finanzieller Schwierigkeiten der Adler Brenn- und Brauerei in Aachen den üblichen Monatsscheck nicht mehr an751 weist, weiß der „freiwillig Verlassene“ nicht einmal, ob er noch die nächste Miete für sein Dach über dem Kopf wird aufbringen können. In Aachen hat man aus Constens Mitteilung, Emma habe ihn für immer verlassen, den Eindruck gewonnen, sie sei plötzlich gestorben und er nun ein trauernder Witwer. Cousine Mie und Theo Dahme, Constens einzige Vertraute in der alten Heimat, versuchen zu trösten und Auswege aus der Sackgasse zu zeigen, in die er geraten ist. Laurensberg, 15.3.1927 Mein lieber Hermann! Ich hoffe, dass inzwischen auf meine ziemlich energische Mahnung an Franz etwas für Dich geschehen ist. Wir können nicht verstehen, wie ein Bruder seinem Blutsbruder gegenüber so handeln kann. An dem betreffenden Tage, an dem du einsam wurdest & Emmy von Dir ging – war beim Franz ein Hausball!! Tragischer Kontrast! Aber, lieber Hermann, jetzt Kopf hoch. Du bist in den besten Lebensjahren, Du hast dasselbe Lebensrecht unter denselben Lebensbedingungen wie Deine Brüder. Packe Deine Möbel & Sachen & komme nach Aachen. Hier ist ein großes & wichtiges Arbeitsfeld, wo Deine Kräfte zu all Eurem Nutzen noch gut zu verwerten sind. Die Firma C. hat genug zu tun, die fremden Kräfte können ausgeschaltet werden (der Oberbuchhalter soll M 450,- verdienen) & Du wirst Dich schnell einarbeiten. Franz ist ja meistens in der Kundschaft & Du könntest den kaufm. Betrieb leiten. Franz drückte sich mir gegenüber auch mal aus, Du solltest doch nach Aachen kommen. 397
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
Denn Blankenburg ist doch keine Heimat mehr für Dich & Aachen bleibt Deine wirkliche warme Heimat. Teile mir bitte bald gefl. mit, ob Franz endlich geholfen hat, damit ich sonst noch energischer vorgehe. Also, Hermann, Kopf hoch, guten Mut. Bei Dir ist noch nichts verloren. 752 Herzl. Grüße, auch von Mia, Dein Thé
Hermann Consten denkt natürlich nicht im Traum daran, nach Aachen zurückzukehren und dem Oberbuchhalter Lohn und Brot wegzunehmen. Denn so ganz hat ihn das Glück doch noch nicht verlassen. Im Postamt von Bad Blankenburg macht er die Bekanntschaft von Margarete Strölin, die mit ihm in der Warteschlange vor dem Briefmarkenschalter steht. Man kommt miteinander ins Gespräch, findet einander sympathisch. Wenig später bereits zieht sie mit ihrem zweijährigen Sohn Klaus in der „Villa zu 753 den Bergen“ ein. Beiden von ihren jeweiligen Partnern Verlassenen ist fürs Abb. 20: Grete Strölin Erste geholfen. Hermann Consten kann mit Söhnchen Klaus, um 1927 sich nun wieder einigermaßen beruhigt der Planung seiner Reise zuwenden. Schließlich waltet wieder eine Frau, vermutlich als Untermieterin, in seinem Haushalt. Etwa vier Wochen nach Emmas Abreise und kurz nach Frau Strölins Einzug in die von ihr verlassenen Räume erhält Hermann Consten im April 1927 den Besuch dreier Damen – Mutter und Tochter sowie einer dritten Person. Sie stammen aus den USA beziehungsweise England. Ihr Anliegen hat mit einer geplanten Forschungsreise der Jüngsten der Drei in die Mongolei zu tun. Sie heißt Ethel John Lindgren, ist Anfang zwanzig, hat gerade ihr Anthropologie-Studium an der renommierten englischen Universität Cambridge abgeschlossen und bereitet sich nun auf die Promotion vor. Schon im Herbst 1926 hatte sie bei Consten angefragt, ob er den organisatorisch-technischen Part ihrer geplanten Forschungsreise in die Mongolei und 398
5. Ende einer großen Liebe: Consten und die Frauen
nach Chinesisch-Turkestan übernehmen könne. Seine Reisekosten und die Ausrüstung für eine Karawane würden von ihr und einer Londoner Freundin übernommen, die sie begleiten solle. Wie auf einem Silbertablett bot sich für Hermann Consten die unverhoffte Chance, seine eigenen, seit Jahren gehegten Expeditionspläne doch noch realisieren zu können. Auf der Suche nach einer geeigneten Person mit Expeditionserfahrung, Landes- und Sprachkenntnissen war Miss Lindgren durch die Lektüre der „Weideplätze“ auf Hermann Consten gestoßen, und man hatte seinerzeit eine vorläufige Vereinbarung getroffen. Nun geht es also um die Details. Da geplant ist, dass die zweite Dame, die britische Wirtschaftshistorikerin Dr. Eileen Power, Miss Lindgren auf dieser Reise begleitet, lag ihr daran, dass Consten und Dr. Power sich vorher auch persönlich kennenlernen und dass Letztere ihr Einverständnis zu den vorher getroffenen Absprachen gibt. Consten hatte offenbar schon bei Miss Lindgrens erstem Besuch in Bad Blankenburg die finanziellen Konditionen akzeptiert. Seiner Einschätzung nach wären 1.000 britische Pfund zur Deckung der Gesamtkosten ausreichend. Dr. Power bittet sich bei der Besprechung, an der auch Lindgrens Mutter, Mrs. Eichheim aus Santa Barbara, Kalifornien, teilnimmt, einen Monat Bedenkzeit aus, da sie für den auf sie zukommenden Kostenanteil noch einen weiteren Geldgeber finden müsse. Consten zeigt sich zunächst mit der Verzögerung einverstanden. Kaum dass sich Dr. Power aber verabschiedet hat, gibt er Miss Lindgren zu verstehen, er könne nicht so lange auf eine Entscheidung warten. Zur Begründung legt er ihr ein – vermutlich fingiertes – Schreiben vor. Darin lädt man ihn für den Juni 1927 „zur Teilnahme an einer Expedition nach Ost- oder 754 Südafrika ein“. Auf diese Weise erwirkt er ihre sofortige Zusage, dass die Reise nach Zentralasien in jedem Fall stattfinden werde. Unter Umständen müsse er noch eine dritte Person akzeptieren, die eventuell noch ausstehende Kosten mittragen würde. Man könne sich aber auch auf die Mongolei beschränken, dann würde die Reise insgesamt nicht so teuer. Consten glaubt nun, mit der zwar selbstbewusst auftretenden, seiner Meinung nach aber unerfahrenen jungen Dame leichtes Spiel zu haben. So schiebt er alle Sorgen und seinen Kummer erst einmal beiseite. Seine Stimmung heitert sich zunehmend auf. Als ihn dann Bad Blankenburger 755 Freunde auch noch bei der Schlaraffia Salevelde einführen, um ihn auf 399
IV. Vom bürgerlichen Dasein 1919–1927
andere Gedanken zu bringen, da ist er fast schon wieder der Alte. Nach all den Aufregungen, die er in den letzten Wochen mit Frauen durchmachen musste, genießt er die heitere Männerrunde umso mehr. Ihre feucht-fröhlichen abendlichen „Sippungen“ im „Loch“, Saalfelds ältestem Gasthaus, ganz in der Nähe des Blankenburger Tors gelegen, reißen ihn aus der Depression, in die er zu fallen drohte. Mit einer launigen Rede gibt er dort seinen Einstand als „Junker Männe“ in einem höchst komisch klingenden Mittelalter-Deutsch, das viel Gelächter hervorruft. Er verspricht den Saalfelder Schlaraffen, sich von seiner „Reyse gen Mongolia“ ab und an brieflich zu melden und von seinen „Aventüren in den Landen der Sinesen und Mongolen“ zu berichten. Am 25. August 1927 nimmt Hermann Consten Abschied von Margarete Strölin und ihrem Jungen. Sie wird sich fortan um seine Wohnung und sonstige Angelegenheiten in Deutschland kümmern. Consten verlässt Bad Blankenburg und macht sich mit der Bahn auf den Weg nach Genua.
400
V. Die letzte Expedition 1928–1929 1. Per Schiff nach China – Expeditionsvorbereitungen Über den nun folgenden Abschnitt im Leben Hermann Constens, seine letzte Expedition in die Mongolei zu schreiben erschien mir während der Vorbereitung der Biografie noch als der am leichtesten zu bewältigende Teil des Buches. Aus Constens Nachlass lagen Reisetagebücher vor, gab es jede Menge Empfehlungsschreiben, Quittungen, Dokumente, Durchschläge, Telegrammcodes, Abschriften von Briefen an verschiedene Adressaten, Erinnerungsstücke und vieles mehr. Und Prof. Eleanor von Erdberg, Constens Frau von 1936 bis zu seinem Tod 1957, stand – obwohl selbst bereits über neunzigjährig und schwer bettlägerig – meiner Journalistenkollegin Rita Mielke und mir bis kurz vor ihrem Tod im November 2002 in Laurensberg bei Aachen noch für eine Reihe höchst angeregter Gespräche über Hermann Consten bereitwillig zur Verfügung. Dabei besaß sie, wie sie freimütig bekannte, von Constens Leben vor ihrer gemeinsamen Ehe nur lückenhafte Kenntnisse. Sie nahm die Tatsache, dass er ihr nie eine „Lebensbeichte“ abgelegt hatte, aber sehr gelassen. Sie respektierte den geheimen, den undurchsichtigen Teil der Vita ihres ersten Mannes, war sich auch lange nicht schlüssig, ob es wirklich so klug wäre, daran zu rühren. Alle seine Freunde bedauerten, dass er nicht seine Lebensgeschichte geschrieben hat – Sie wissen ja, welch faszinierender Erzähler er war. Er hat das immer abgelehnt,
schrieb Eleanor von Erdberg 1983 an Margarete Jacobi-Müller und die Familie Strölin in Esslingen. Unterlagen habe ich auch gar keine; an das Auswärtige Amt, in dem ich solche vermute (wenn sie nicht am Kriegsende vernichtet wurden), möchte ich mich nicht wenden – ich glaube nicht, dass ihm das recht gewesen wäre. Es gab Dinge, von denen er nie sprach, auch zu mir nicht, und ich habe das respektiert und nicht gefragt. Seine Vergangenheit gehörte ihm 756 allein, nur seine Gegenwart gehörte mir.
Im Sommer 2002 jedoch freute sie sich darüber, dass wir ihr einen ersten Bericht über das Vorhandensein von Consten-Akten im Politischen Archiv 401
V. Die letzte Expedition 1928–1929
des Auswärtigen Amtes und ihren ungefähren Inhalt noch vorlegen konnten, dass erste Artikel über Hermann Consten in der Aachener Reiterzeit757 schrift Aixcours und den Mongolischen Notizen erschienen. Frau Prof. von Erdberg erinnerte sich im Laufe unserer Gespräche, dass es noch einen chinesischen Lederkoffer mit Fotos geben müsse. Tatsächlich fanden sich in diesem Koffer etwa 2.700 Negative, Glasplatten, Rollfilme und Abzüge von Aufnahmen, die Hermann Consten während seiner Jahre in China und davor, während seiner letzten Reise ins Land der Mongolen, gemacht hatte. Auch einige ältere Aufnahmen waren noch darunter, so das Pressefoto, das Consten mit Volksbildungsminister Erdene Batchaan 1925 zeigt. Eine Auswahl dieser Aufnahmen haben wir im Rahmen eines Projekts der DeutschMongolischen Gesellschaft e.V. (Bonn) zum Jubiläumsjahr Čingis Chaans für eine Wanderausstellung aufbereitet, die im Sommer 2005 im Forum für Fotografie in Köln ihren Anfang nahm. Beiträge Rita Mielkes, Barbara Frey-Näfs und meiner Wenigkeit in dem zu dieser Ausstellung erschiene758 nen Katalog spiegelten den damaligen Stand unserer Erkenntnisse über Hermann Constens letzte Mongolei-Expedition wider. Was wir damals in Händen hatten, war aber, wie mir im Laufe meiner vertieften Recherchen zu seiner Lebensgeschichte immer klarer wurde, lediglich seine Version der Expeditionsgeschichte. Wieviele verschiedene Facetten allein diese Geschichte in Wirklichkeit hatte, das erschloss sich mir erst allmählich, als mir zwischen 2007 und 2010 weitere wichtige Quellen zugänglich wurden, darunter ein Vorgang „Expedition Consten“ unter den China-Akten im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin, die Aufzeichnungen der Anthropologin Ethel John Lindgren über ihre Erfahrungen mit Hermann Consten in den Hoover Institution Archives der Stanford Universität in Palo Alto/Kalifornien, sowie Hermann Consten betreffende Reisedokumente und amtliche Vermerke im Archiv des Außenministeriums der Mongolei in Ulaanbaatar. Wie und unter welchen Umständen diese Reise überhaupt zustande gekommen war, wer sie finanziert hatte, wohin genau Consten wollte, was er mit ihrem Ergebnis vorhatte, diese und viele andere Fragen klärten sich erst mit dem eingehenden Studium dieser neu erschlossenen Dokumente. Hinzu kam, dass die anschließende neuerliche Beschäftigung mit Constens Expeditionsjournalen und Briefen von unterwegs, deren Abschrift 2004 allein schon mehrere Monate in An402
1. Per Schiff nach China – Expeditionsvorbereitungen
spruch genommen hatte, manches Rätsel löste, dafür an anderer Stelle neue Fragen aufwarf. Dass es zum Beispiel Dr. Ethel J. Lindgren in Constens Leben überhaupt gegeben und welche Rolle sie gespielt hat, war aus Constens eigenen Aufzeichnungen nicht zu entnehmen. Einige kryptische Andeutungen im letzten seiner Reisejournale ließen nur vermuten, dass er in Ulaanbaatar mit jemandem verabredet war und dass es mit diesem Jemand am Ende Probleme gegeben haben muss – traf er doch mit mehrmonatiger Verspätung in der mongolischen Hauptstadt ein. Wer war diese Person? Vielleicht waren es ja auch zwei Personen, die seiner harrten. Etwa eine Woche vor seiner Ankunft lautete eine von mehreren bangen Fragen, was ihn dort wohl er759 wartete: „Ist John da?“ Dann, nach seinem Eintreffen, war in mehreren Journaleinträgen von I. L. bzw. I. oder L. und dem Ende der Expedition die Rede. Nur einmal fiel der Familienname Lindgren, und zwar in Zusammenhang mit angeblichen „sexuellen Verfehlungen“, weshalb sie des Landes verwiesen werden sollte. Dies alles schien sehr dubios zu sein. Es war schwierig, wenn nicht gar unmöglich, sich einen Reim darauf zu machen, geschweige denn darauf zu kommen, dass sich hinter John, I. L., I. und L. immer ein und dieselbe Person verbarg, dass diese Person eine Frau war, die den Nachnamen Lindgren hatte und dass das Schicksal der Consten-Expedition in ihrer Hand lag. War sie vielleicht eine Schwedin? Lautete ihr Vorname etwa Inge oder Inger? Wenn ja, woher kannte Consten sie, in welcher Verbindung standen sie? Kannten sie sich aus Berlin? Konnte es sein, dass sie eine ausländische Mongolistik-Studentin Professor Erich Haenischs in Leipzig gewesen war? Hatte sie etwa mit dem Grassi-Museum in Leipzig zu tun, von dem sich die Kopie einer Wunschliste des damaligen Museumsdirektors, Prof. Karl Weule, zur Beschaffung volkskundlicher Gegenstände aus der Mongolei für das Museum in Constens Nachlass fand? Oder gehörte sie gar zum Forscherkreis um Sven Hedin? War sie etwa Constens Geliebte und hatte den Grund für den Bruch mit Emma geliefert? Was machte sie in Ulaanbaatar? Wenn sie mit seiner Expedition zu tun hatte, warum waren sie nicht zusammen dorthin gereist? Lauter Fragen, die allein dieses winzige Detail in den vorhandenen Quellen über Constens Mongolei-Expedition aufwarf und die lange Zeit nicht beantwortet werden konnten. Diesbezügliche Nachfor403
V. Die letzte Expedition 1928–1929
schungen beim Universitätsarchiv Leipzig, beim Grassi-Museum, beim Hedin-Archiv in Stockholm erwiesen sich alle als falsche Fährten. Allmählich kam ich dann aber doch auf die richtige Spur. Während der Recherchen über Constens Jahre in China im Archiv des Studienwerks Deutsches Leben in Ostasien e.V. (StuDeO) im oberbayerischen Kreuth, das neben einem reichen Akten- und Fotobestand sowie einer Bibliothek auch einige Gästezimmer bereithält, las ich abends in den Memoiren ehemaliger China-Deutscher, darunter des bereits erwähnten Diplomaten Hermann 760 Gipperich. Der Zufall wollte es, dass Gipperich nach einem Deutschlandaufenthalt am 27. August 1927 von Genua aus mit demselben Schiff, der Coblenz des Norddeutschen Lloyd, wieder nach China zurückreiste. Er erwähnte beiläufig einige „Mitreisende bekannteren Namens“, darunter auch „H. Consten, Fräulein Lindgren“ und, sinnigerweise, Trebitsch-Lincoln, den schillernden Doppelagenten und Hochstapler, gegen den jemand wie Her761 mann Consten geradezu blass, bieder und harmlos wirkte. Auf Lindgrens 762 vollen Namen, Ethel John Lindgren, stieß ich erstmals 2009 in dem dünnen Aktenvorgang „Expedition Consten“ im Archiv des Auswärtigen Am763 tes. Neben ihrer Visitenkarte und diversen Schreiben ihres Anwalts in Tientsin enthalten die dort gesammelten amtlichen Dokumente ein umfangreiches Beschwerdeschreiben des seinerzeit als Regierungsberater in Ulaanbaatar tätigen Dr. Curt Alinge über Hermann Constens Verhalten gegenüber dieser Dame. Eine weitere Facette der seltsamen Expeditionsgeschichte war gefunden. Jedenfalls half mir der volle Name endlich, gezielter im Internet zu suchen und sehr schnell genauere Angaben zu der US-Anthropologin mit schwedischen Wurzeln zu finden: Ethel John Lindgren (1905–1988), Tochter des Bankiers und Vizekonsuls für Schweden und Norwegen, John R. Lindgren (1855–1915) aus Chicago. Die Mutter, eine Pianistin deutscher Herkunft, nach dem Tod ihres ersten Mannes verheiratet mit dem Musikethnologen, Dirigenten und Komponisten Henry Eichheim (1870–1942), ebenfalls deutscher Herkunft. Studium der Sozialanthropologie an amerikanischen und britischen Universitäten. Promotion in Cambridge über die Rentier-Nomaden der Mandschurei. 1931 in Oslo Heirat mit dem Norweger Oscar Malling Mamen, den sie 1928 in der Mongolei kennenlernte – in der Zeit also, als sie vergeblich auf Hermann Consten gewartet hatte. Geburt eines 404
1. Per Schiff nach China – Expeditionsvorbereitungen
Sohnes. In zweiter Ehe mit dem samischen Ethnologen Mikel Utsi verheiratet. Gemeinsames Projekt der Ansiedlung von Rentieren im schottischen 764 Bergland. Erwerb der britischen Staatsbürgerschaft. Unter ihren Wissenschaftskollegen stand und steht Ethel John Lindgren bis heute wegen ihrer Arbeiten über das Sozialverhalten der Rentiernomaden der sibirischen Taiga und Nordskandinaviens und der von ihr zusammengestellten volkskundlichen Sammlung im Ethnologischen Museum der Universität Cambridge international in hohem Ansehen. Ich fand außerdem einen Hinweis, wonach ein deutscher Wissenschaftler plane, eine Biografie Lindgrens zu schreiben, was mich mit Dr. Joachim Otto Habeck vom Sibirienzentrum des Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung in Halle/S. in Kontakt brachte. Dr. Habeck bedauerte zwar, mir mitteilen zu müssen dass aus dem Biografie-Plan nichts geworden sei, half mir jedoch freundlich mit weiteren Angaben und Adressen. Und schließlich fand sich auch der Ort, an dem heute E. J. Lindgrens wissenschaftlicher Nachlass ruht: in Stanford, wohin ich dann im Herbst 2010 reiste. Unter den Ethel John Lindgren-Utsi Papers in den Hoover Institution Archives fanden sich auch ihre Aufzeichnungen über die geplante gemeinsame Forschungsreise mit Hermann Consten, genauer: eine Zusammenfassung, die sie nach deren Scheitern 1931 in Peking anhand ihrer eigenen Tagebuchnotizen angefertigt hatte. Samt der Vorgeschichte der Expedition, den Gründen für das Scheitern und dem unerquicklichen Nachspiel, das sich noch über mehrere Jahre hinziehen sollte, lag hier ihre Version vor. Sie unterschied sich in auffallender Weise von Constens Darstellung und ließ, in Verbindung mit Alinges Beschwerdeschrift über Consten an die Deutsche Gesandtschaft in Peking, einigen Schriftstücken des Deutschen Generalkonsulats in Tientsin und Lindgrens Anwalt nur einen Schluss zu: Hier muss eigentlich von einer Expedition Ethel J. Lindgrens gesprochen werden. Hermann Consten war darin eine bestimmte Aufgabe und Funktion arbeitsvertraglich zugewiesen, nämlich – wenn man so will – die eines „Organisationsleiters“. In seinem Dossier vom Mai 1929 ging Alinge sogar so weit, es der Beurteilung der Gesandtschaft anheimzustellen, ob Consten überhaupt noch als Forscher angesprochen werden dürfe oder nicht viel765 mehr „auf die Rolle eines Karawanenführers reduziert erscheint“. Als Beleg bot er eine Kopie des Arbeitsvertrages zwischen Lindgren und Consten 405
V. Die letzte Expedition 1928–1929
an, die sich allerdings nicht in dem Aktenvorgang „Expedition Consten“ fand, möglicherweise auch nicht eigens angefordert worden ist, da die in dem Dossier ausgebreiteten Fakten für sich sprachen. Constens Exemplar der Ausfertigung des Vertrags ist im Privatnachlass ebenfalls nicht mehr vorhanden, vermutlich hat er das Dokument vernichtet. Immerhin, es existierte also ein notariell beglaubigter Kontrakt, den Consten unterschrieben, aber ganz offensichtlich nicht eingehalten hatte. Nachdem dies alles geklärt war, konnte die Geschichte von der letzten Expedition Hermann Constens in die Mongolei nicht mehr so erzählt werden wie ursprünglich gedacht. Nun mussten die unterschiedlichen Facetten einander spiegeln bzw. ablösen, mussten disparate Darstellungen einander gegenübergestellt werden, um auf diese Weise ein wenigstens einigermaßen vollständiges Bild davon zu erhalten, was sich tatsächlich zugetragen hatte. Womit beginnen? Da in Constens Hinterlassenschaften von der Schiffsreise Genua–Tientsin und den ersten Vorarbeiten für die Expedition auf chinesischem Boden nur Fotos – dazu meist unterwegs gekaufte Ansichtskarten, aber keine persönlichen Aufzeichnungen mehr existieren, da seine noch vorhandenen Reisejournale erst im Mai 1928 mit dem Aufbruch seiner Kamelkarawane von Peking einsetzen, stehen Lindgrens Aufzeichnungen am Anfang. Ihre Notizen belegen, wie sehr Hermann Consten, der – wie gesagt – glaubte, leichtes Spiel mit ihr zu haben, diese zielstrebige, 22 Jahre junge Frau unterschätzt hatte. Es begann damit, dass sie schon vor dem gemeinsamen Reiseantritt recht genau wusste, mit wem sie es zu tun hatte. Und zwar war sie nach ihrem Besuch in Bad Blankenburg im Frühjahr 1927 mit ihrer Mutter weiter nach Berlin gereist. Dort hatte sie Bernhard 766 Waurick kontaktiert, der Consten aus dem Jahr 1922 kannte und auch bei anderen Persönlichkeiten Erkundigungen über Consten eingeholt. Waurick berichtete ihr, Consten habe 1923/24 vergeblich versucht, in die Mongolei zu gelangen und werde es möglicherweise auch diesmal nicht schaffen, weil man ihm misstraue. Lindgren vermerkte dazu in einer Fußnote, ihr habe Consten erzählt, er sei seinerzeit schon fertig zum Aufbruch gewesen, habe die Reise aber „wegen der Erkrankung seiner Frau“ absagen müssen. Gegenüber Bindel hatte Consten bekanntlich 1924 betont, er müsse sich in Deutschland erst eine „feste Basis“ schaffen, bevor er wieder losreisen kön406
1. Per Schiff nach China – Expeditionsvorbereitungen 767
ne. Bei seinen früheren Reisen, so zitierte Lindgren Wauricks damalige Bemerkungen weiter, sei Consten vom zaristischen Russland unterstützt worden, und man fürchte, er könne sich erneut in politische Dinge einmischen. Mit Consten zu gehen, wäre zwar kein Schaden, aber besser wäre, 768 Lindgren würde allein losziehen. Soweit also Bernhard Waurick. Denkwürdig war Lindgrens Begegnung mit Albert von LeCoq, dem Direktor des Museums für Völkerkunde im April 1927. Le Coq was deeply disturbed to hear that some arrangement was to be made with Consten, and did everything in his power to dissuade me. “I cannot say anything definite against him”, he said, “but I have a strong feeling of dislike for that man, I do not trust him at all. He doesn’t dare to show himself at the museum any more. He has been urging Grünwedel on from behind against Müller [durchgestrichen: and me, d.h. Le Coq; D.G.], for one thing, thus lending himself a certain importance.” My contention was that, faute de mieux, one had to take what one could find, with a small sum of money at one’s disposal and the choice – I had been given to understand – confined to Germans, as those with the best access 769 to Outer Mongolia.
LeCoq sei, so Lindgren weiter, sogar so weit gegangen, das Auswärtige Amt anzurufen, um mitzuteilen, ihm liege die vertrauliche Anfrage einer „schwedischen Dame“ über Consten vor, und um Auskünfte zu bitten. Man habe sich zugeknöpft gegeben. Immerhin habe er die Auskunft erhalten, Consten sei ein Mann „mit einer Vergangenheit“ [so deutsch im englischen Original; D.G.]. Einzelheiten habe man jedoch vergessen, diesbezügliche Akten seien vernichtet worden. Nach diesem Telefonat fasste LeCoq nach Lindgrens Darstellung seinen Eindruck dahingehend zusammen, Consten müsse für das Auswärtige Amt eine Zeitlang wohl sehr nützlich gewesen sein. Deshalb hielte man es dort wohl für klüger, sein Verhalten und seinen Charakter nicht allzu kritisch zu bewerten. An dieser Stelle fügte sie in ihren Aufzeichnungen über die Vorgeschichte der Expedition die bereits erwähnte eigene Andeutung Constens von „gewissen Aufträgen in Mesopotamien“ und seiner aktiven Beteiligung an der Vollstreckung standgerichtli770 cher Urteile während der Kommunistenaufstände in Thüringen an. Lindgren war klug genug, anzunehmen, dass Consten Kenntnis von ih407
V. Die letzte Expedition 1928–1929
ren Nachforschungen erhalten und sich möglicherweise irgendwann rächen könnte. Deshalb griff sie zu einem Trick, um seine Reaktion zu testen. Sie schrieb ihm noch am selben Abend, um ihn, ohne nähere Einzelheiten zu nennen, darüber zu informieren, dass sie im vorangegangenen Herbst über schwedische diplomatische Kanäle Erkundigungen über seine Reputation in Schweden eingeholt habe. Sie fügte an, sie selbst sei zu sehr „Aben teurerin im Geiste“, um nicht zu verstehen, wenn jemand aus Abenteuerlust über die Grenzen der Vorsicht und Diskretion hinausschieße und sich vom eigenen Ehrgeiz zu Unbedachtheiten hinreißen lasse. Constens Antwort kam rasch. Er bekundete Verständnis für ihr Vorgehen und deutete an, er habe seinerzeit umgehend einen Wink über ihre Nachforschungen zu seiner Person erhalten. Having reaped a lie in return for a lie, I was fortunate enough to know, from then on, that whether on grounds of vanity or other motives, I could 771 expect almost anything from the ‘manager’ of the future trip.
Am 2. Oktober 1927 erreicht die Coblenz den Hafen von Shanghai. Dort erwarten Ethel John Lindgren und Hermann Consten schlechte Nachrichten. In Nordchina seien heftige Kämpfe im Gange, berichten die Zeitungen. Warlords, marodierende Soldaten, Flüchtlingsströme und Räuberbanden machten die Gebiete nördlich der Großen Mauer unsicher, ein Durchkommen schwierig. Chiang Kaisheks Nordfeldzug sei mal wieder ins Stocken 772 geraten. Consten erklärt, seiner Einschätzung nach dürften die Chancen, in die Mongolei zu gelangen, unter diesen Umständen schon bald auf ein 773 Minimum sinken. Während Lindgren bereits in Shanghai von Bord geht, weil sie dort noch Bekannte treffen will, soll Consten für alle Fälle nach Tientsin (Tianjin) vorausreisen und ihr telegrafieren, wie sich die Lage in Nordchina aus dortiger Sicht darstellt. Auch soll er sich schon um die Beschaffung der nötigen Papiere und der Expeditionsausrüstung kümmern. Dafür erhält er von ihr eine größere Summe in US-Dollar ausgehändigt. Etwa zehn Tage später meldet ihr Consten seine Ankunft in Tientsin, dann hört sie wochenlang nichts mehr von ihm. Schließlich fordert sie ihn telegrafisch auf, ihr endlich Mitteilung über die Lage und den Stand seiner Vorbereitungen zu machen. Jetzt reagiert er und lässt sie wissen, im Moment sei gar nichts zu machen. Daraufhin reist sie zunächst für zwei Wo408
1. Per Schiff nach China – Expeditionsvorbereitungen
chen nach Japan. Nach ihrer Rückkehr hält sie in Shanghai einige wissenschaftliche Vorträge. Und als sie schließlich um den 20. Dezember 1927 in Tientsin eintrifft, wo sich Consten inzwischen seit gut zwei Monaten befindet, muss sie feststellen, dass er praktisch nichts für die gemeinsame Expedition in die Mongolei in die Wege geleitet hat. Auf ihre Nachfrage gibt er, wie sie notiert, unklare, einander teilweise widersprechende Auskünfte über die Lageeinschätzungen des deutschen Generalkonsulats und die Langsamkeit der chinesischen Behörden. Consten wohnt, wie sie feststellt, bei einer Familie Junkel in der Woodrow Wilson Street. Dr. Otto Junkel ist praktischer Arzt und Chirurg und verheiratet mit einer aparten Halbchinesin, die es Consten offenbar angetan hat. Jedenfalls erklärt er Lindgren, „er plane, ethnographisch, eine genaue Untersuchung des eurasischen 774 Typus“. Um sicher zu gehen, dass Consten der in Bad Blankenburg getroffenen Vereinbarung nachkommt, wendet sich Miss Lindgren schließlich ratsuchend an das US-Generalkonsulat in Tientsin und lässt sich einen amerikanischen Anwalt in der Stadt empfehlen. Dieser formuliert einen Arbeitsvertrag, in dem Constens organisatorische Aufgaben bei dem gemeinsamen Expeditionsvorhaben genau definiert werden und er zur detaillierten Rechnungslegung über seine Ausgaben verpflichtet wird. Consten wehrt sich gegen schriftliche Festlegungen, doch wird er am Ende diesen Vertrag unterschreiben. Ihm bleibt wohl auch gar nichts anderes übrig, denn wie sich zeigen soll, besitzt er praktisch keine eigenen Mittel. Er kann also nicht einfach aus dem gemeinsamen Unternehmen aussteigen. Eine Basis für vertrauensvolle Zusammenarbeit ist der Kontrakt natürlich nicht. From there on there was a hide-and-seek-policy on both sides. On the excuse of delays in getting Chinese permits, Consten put off making any application for Mongol ones, and finally only applied, for himself alone, 775 towards the end of April.
In welcher Weise Hermann Consten das Versteckspiel schon von Anfang an betrieben hatte, war Ethel J. Lindgren in seinem ganzen Ausmaß dennoch nicht bekannt. Dafür geben die Akten des deutschen Generalkonsulats in Tientsin und der Gesandtschaft in Peking über sein Vorgehen Auskunft. Sie enthalten u.a. Empfehlungsschreiben für Consten, die er sich 409
V. Die letzte Expedition 1928–1929
schon im Juli 1927 in Berlin an höchster Stelle besorgt hatte. Bereits am 17. August 1927, also zehn Tage vor dem Ablegen der Coblenz im Hafen von Genua, war in der Deutschen Gesandtschaft in Peking ein Schreiben des Auswärtigen Amtes folgenden Inhalts eingegangen: Dr. Hermann Consten, der Verfasser des Buches „Weideplätze der Mongolen“ (verlegt bei Dietrich Reimer in Berlin), beabsichtigt seine Mongoleiforschungen fortzusetzen und wird demnächst über Indien nach China reisen, um von Peking bzw. von Kalgan aus eine neue Forschungsreise durch die Mongolei anzutreten. Unter eingehender Schilderung der aus der dortigen Berichterstattung bekannten Verhältnisse ist Dr. Consten darauf hingewiesen worden, dass er damit rechnen muss, dass sich seine Pläne nicht oder nur teilweise verwirklichen lassen. Er hofft jedoch, auf Grund eingehender Kenntnis von Land und Leuten und auf Grund seiner Kenntnis der mongolischen Sprache seine Reise durchführen zu können. Begleiter wird er nicht mitnehmen. In Tientsin und Peking will er sich nur ganz kurz, und ohne irgendwie hervorzutreten, aufhalten. Über seine Pläne ist auch hier nichts weiter bekannt geworden. Die Kosten der Reise bestreitet er aus eigenen Mitteln. Dr. Consten wird dort seiner Zeit vorsprechen. Da er als ernst zu nehmender Forscher anzusehen ist, wird ergebenst gebeten, ihm bei der Verfolgung seiner Ziele so weit angängig, behülflich zu sein. Durchschlag für das Generalkonsulat Tientsin ist bei776 gefügt. Im Auftrage [gez. Michelsen]
Kurz nach seinem Eintreffen in Tientsin war Consten, wie die Akten weiter belegen, mit der Bahn nach Peking gereist, er hatte am 24. Oktober 1927 bei der deutschen Gesandtschaft vorgesprochen. In einem Aktenvermerk hieß es zu Constens Besuch: Herr Dr. Consten sprach heute hier kurz vor und teilte mit, dass er sich einige Tage (incognito) in Tientsin aufgehalten habe und sich heute in Peking aufhalte, um den mongolischen Tempel [des] Mahakala zu besichtigen. Er will heute abend nach Tientsin zurückreisen und etwa am Donnerstag wieder hierher kommen, um sich beim Herrn Minister [d.h. dem Gesandten] zu melden. Er beabsichtigt, seine Expedition in Tientsin ohne jedes Aufsehen vorzubereiten und sie von Jehol aus heimlich in 777 Marsch zu setzen. [Kürzel: Scha] 410
1. Per Schiff nach China – Expeditionsvorbereitungen
Wenige Tage später war er erneut in Peking und überreichte dem Gesand778 ten Adolf Boyé ein Empfehlungsschreiben Herbert von Dirksens, zu jener Zeit Ministerialdirigent in der Ostabteilung des AA, folgenden Inhalts: Der bekannte Schriftsteller und Forschungsreisende Dr. Hermann Consten fährt über Suez und Indien nach China, um von Peking aus eine Forschungsreise durch die Mongolei anzutreten. Die Ergebnisse früherer Forschungen hat Herr Consten in dem wertvollen, sicherlich auch Ihnen bekannten Buch „Weideplätze der Mongolen“ niedergelegt. Es kann nur in unserem Interesse liegen, dass Herr Consten seine Forschungen ausbaut; ich komme daher gern einer in Abwesenheit der Herren Wallroth und Trautmann an mich gelangten Anregung des früheren Reichskanzlers, Herr Dr. Luther, nach und erlaube mir, Sie mit diesen Zeilen zu bitten, Herrn Consten, soweit angängig, Ihre wertvolle Hilfe bei der Verfolgung seiner Pläne zu leihen. Ich händige diese Zeilen Herrn Consten aus, damit er sie Ihnen persönlich überbringt. Wie ich höre, ist die Gesandtschaft bereits auf amtlichem Wege von den Reiseplänen Herrn Constens verständigt worden, diesen selbst haben die zuständigen Herren im Amt über die Schwierigkeiten, die heutzutage ein Forschungsreisender in China zu gewärtigen hat, eingehend unterrichtet. Mit angelegentlicher Emp779 fehlung bin ich Ihr ergebener [gez. v. Dirksen]
Die Dokumente des Auswärtigen Amtes bestätigen außerdem, dass Consten die erforderlichen Reisepapiere der chinesischen Behörden vor Lindgrens Eintreffen in Tientsin für sich selbst längst beantragt hatte. Ganz offensichtlich wollte er seine Auftraggeberin hintergehen und weg sein, bevor sie nach Tientsin kam. Constens Antrag vom 15. Dezember 1927 offenbart außerdem seine Absicht, auf einer ganz anderen Route zu reisen als mit Lindgren abgesprochen. Herr Dr. Hermann Consten bittet, für ihn beim Waichiaopu [Außenministerium] einen chinesischen Reisepass zu beantragen für eine Reise nach: Chihli, Shansi, Shensi, Kansu, Hsinkiang, Drei Ostprovinzen, Drei Sonderbezirke und Innere Mongolei, unter Aufführung der mitgenommenen Waffen: 2 Mausergewehre 98, 1 Vogelflinte, 2 Schrotgewehre und 3 Brownings. Zwei Dollar hat er übergeben und die Einsendung seiner
411
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Photographie (doppelt) zugesagt. Der Pass soll an Herrn Konsul Dr. Tigges 780 [Tientsin] zur Aushändigung gesandt werden.
Die Reihenfolge der im Passantrag genannten Provinzen lässt den Schluss zu, dass Consten vorhatte, auf der Wüstenroute bis Xinjiang (Hsinkiang) zu ziehen, dann in nordöstlicher Richtung direkt auf das südmongolische Gebiet am Bajdrag zuzusteuern und das dort 1912 entdeckte Fürstengrab zu öffnen. Anschließend gedachte er wohl nach Ulaanbaatar weiterzureisen, sich Erdene Batchaan und vor allem Žamsrano Ceveen vom Komitee für Schrifttum mit seinen Funden als großer Archäologe zu präsentieren, um schließlich irgendwann durch die Ostmongolei über die drei mandschurischen Provinzen und die Innere Mongolei nach Peking zurückzukehren. Dass er den Auftrag übernommen hatte, eine junge amerikanische Forscherin zu den nordmongolischen Rentiernomaden zu begleiten, hatte er schlicht ausgeblendet. Ob Consten etwa glaubte, durch seine Routenwahl gegen die unangenehme Überraschung gefeit zu sein, Ethel J. Lindgren unterwegs eventuell doch noch zu begegnen? Diese Sorge machte er sich vermutlich überhaupt nicht. Er schien sicher zu sein, dass sie ohne ihn als „Reisemarschall“ sowieso nicht in die Mongolei gelangen würde. Wie aus dem Aktenvermerk der Deutschen Gesandtschaft Peking ferner geschlossen werden kann, hatte Consten wohl erwartet, innerhalb einer Woche Bescheid zu erhalten und, sobald er den Pass in Händen hielt, umgehend aus Tientsin zu verschwinden. Aber er hatte sich getäuscht. Einen vollen Monat musste er auf den Bescheid warten; in der Zwischenzeit war Miss Lindgren eingetroffen und hatte ihn wieder in seine mit ihr eingegangene Verpflichtung eingebunden. Als der Bescheid des Waichiaopu Mitte Januar 1928 schließlich bei der Deutschen Gesandtschaft einging, erlebte Consten, der zur Entgegennahme eigens nach Peking einbestellt wurde, die zweite Enttäuschung. Die mit der Erteilung des Passes verbundenen Auflagen durchkreuzten seine Pläne ebenfalls. Darin hieß es: Nach Empfang des gefälligen Schreibens vom 17. v. Mts. betr. Reisepass Consten ist hier ein Reisepass ausgestellt und das Kriegsministerium um Ausstellung eines Waffenpasses gebeten worden. Jetzt ist ein Antwortschreiben vom Kriegsministerium eingegangen, in dem es heißt: „Die Provinzen, nach denen jener Doktor zu reisen beabsichtigt, sind zum 412
1. Per Schiff nach China – Expeditionsvorbereitungen
größten Teile Bezirke, in denen militärische Operationen vor sich gehen. Die von ihm beantragte Ausstellung eines Waffenpasses muss daher vorläufig aufgeschoben werden.“ Anliegend wird daher der ausgestellte Reisepass ergebenst übersandt zur Weitergabe mit der Bitte, jenen Doktor wissen zu lassen, dass er vorläufig keine Waffen mitnehmen soll. Da ferner die Straßen in Hsinkiang nicht sicher sind, ist hierfür der Pass vorläufig nicht ausgestellt worden. Auch wird gebeten, ihm zu erklären, dass er nicht nach den sonstigen Gebieten, in denen militärische Operationen vorgenommen werden, reisen soll. Dies wird gebeten, ihm mitzuteilen 781 und ihn zu warnen.
Bei dem genannten Vorgang findet sich neben dem Quittungsvermerk über die Aushändigung des Reisedokuments an Consten noch eine von ihm un782 terschriebene Bestätigung, dass er vom Inhalt des beigefügten Schreibens Kenntnis genommen habe. Consten wusste also, dass er die Bürgerkriegsgebiete zu meiden hatte und dass es ihm nicht gestattet war, seine Waffen mitzunehmen. Da Xinjiang ganz ausfallen musste und ihm durch den Arbeitsvertrag mit Lindgren ohnehin inzwischen die Hände gebunden waren, blieb ihm nichts anderes übrig als die Karawane auf dem direkten Weg durch die Innere Mongolei über Zamyn Üüd (Ude) nach Ulaanbaatar (Urga) zu führen, und zwar unbewaffnet. Doch, ähnlich wie während des Ersten Weltkriegs im Fall der geheimen Afghanistan-Expedition, so verfiel Consten auch diesmal kurzerhand auf einen neuen Plan, sowie sich ihm ein Hindernis in den Weg stellte. Sein verborgenes Ziel aber verlor er dabei niemals aus dem Auge. Im Gegenteil: Je schwieriger das Erreichen des Ziels zu werden schien, desto fieberhafter suchte er nach Mitteln und Wegen, es dennoch zu schaffen. Constens nächster Schritt war die Beantragung eines mongolischen Reisepasses für sich. Als Begründung gab er „wissenschaftliche Studien“ an. Das Generalkonsulat in Tientsin ersuchte das mongolische Außenministerium außerdem, „angesichts der Tatsache, dass Dr. Consten möglichst schnell in die Mongolei aufbrechen möchte“, um unverzügliche Erteilung der Ein783 reiseerlaubnis. Gegenüber Miss Lindgren erbot sich Consten, scheinbar generös, bei seinem Eintreffen in Zamyn Üüd auch für sie eine Einreiseerlaubnis in die Mongolei zu erwirken; sie solle in der schwedischen Mission der Inneren Mongolei warten, bis er ihr Bescheid gebe. Doch Ethel J. Lind413
V. Die letzte Expedition 1928–1929
gren, die derweil in Peking eine neue Reisepartnerin, die wesentlich ältere Catherine ffrench of Monivea, ausfindig gemacht hatte, nahm die Angelegenheit lieber gleich selbst in die Hand, ohne dass wiederum Consten davon erfuhr. Miss ffrench hatte einem estnischen Bekannten, der sowieso nach Ulaanbaatar musste, ihre beiden Passanträge direkt mitgegeben. Aus altem anglo-normannischem Geschlecht in Irland stammend, hatte Catherine ffrench of Monivea schon ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Statt zu heiraten, hatte sie noch zur Zarenzeit die Güter ihrer früh verstorbenen russischen Mutter übernommen und wirtschaftlich wieder rentabel gemacht. Doch ging in der Revolution 1917 ihr gesamter russischer Besitz verloren, sie selbst hatte nur knapp ihr Leben retten können. Als Exilantin verbrachte sie mehrere Jahre in Harbin, nach einigen Jahren auf ihrem Anwesen in Monivea in der irischen Provinz Galway war sie nach China zu784 rückgekehrt. Als Lindgren in Peking ihre Bekanntschaft machte und von ihren Mongoleiplänen erzählte, hatte sie spontan zugesagt, mitzukommen. Eines Tages im März 1928 war Catherine ffrench mit interessanten Informationen aus Harbin zurückgekehrt. Sie betrafen Hermann Consten. Denn unter den russischen Emigranten in Harbin lebte auch der einstige Konsulatssekretär in Uliastaj, Xionin. Er war niemand Geringerer als Constens „Lieblingsfeind“, der 1911 als Erster den Verdacht geäußert hatte, Consten müsse ein deutscher Spion sein. Miss ffrench wusste bei ihrer Rückkehr nach Peking zu berichten, sie habe Xionin von ihrem gemeinsamen Vorhaben erzählt. Als der Name Consten gefallen sei, habe Xionin ausgerufen: „Wie, hat man ihn denn immer noch nicht gehängt?“ Übrigens habe sie Xionin Lindgrens Exemplar der „Weideplätze“ zu lesen gegeben. Er und seine Frau hätten die schönen Fotos bewundert und sich gern ihrer Jahre in der Mongolei erinnert. Diese Fotos hätten sie für all die Missgunst und Intrigen entschädigt, die ihnen seinerzeit durch Consten widerfahren seien. Die Darstellung von Xionins Verhalten gegenüber den in Uliastaj lebenden Chinesen sei allerdings falsch. Mittlerweile ist auch der April mit Vorbereitungen und Warten vergangen. In Peking ist es Frühling geworden. Consten und Lindgren haben ihre Ausrüstung beisammen, etliche schwere Kisten sind, zusammen mit Constens Gepäck, bei Bertrams in Paomachang nördlich Pekings im Keller eingelagert, sein Reitpferd und neun Kamele samt Packsätteln und Kameltrei414
1. Per Schiff nach China – Expeditionsvorbereitungen
bern stehen bereit, dazu der „Boy“ Wassili als Dolmetscher für Russisch und Chinesisch, ohne den der des Chinesischen nicht mächtige Deutsche aufgeschmissen wäre. Doch fehlt noch die Rückmeldung aus Ulaanbaatar wegen der Einreisegenehmigungen. Als Erste erhalten E. J. Lindgren und Catherine ffrench of Monivea grünes Licht. When the wire came that the permits were granted us, Consten was ready to set out with his nine camels (bought at 100 local Dollar each). We were to meet in Urga in two or more months. He was very sceptical of my ability to reach there, however. I arrived in Urga on July 9 th, 1928, and he February 14th, 1929. […] He was ‘on the road’ nine months, and no one 785 knows to-day where he spent most of the time.
Dieses Geheimnis wird Hermann Consten in den nächsten Kapiteln nun selbst lüften. In seinen Mitte Mai 1928 einsetzenden Reisejournalen hat er an jedem Tag seines Unterwegsseins notiert, was passierte. Nachdem jedenfalls Ethel John Lindgren und Catherine ffrench of Monivea mit der Bahn in Richtung Kalgan davongedampft sind, hält es Hermann Consten, der immer noch auf seinen mongolischen Pass wartet, nicht länger in Peking. Er bricht überstürzt und reichlich verwirrt auf.
2. Mongolei zum Dritten: Über die Große Mauer Richtung Norden Tage der Freude, Tage des Kummers, Minuten des Glücks, Sekunden des Schmerzes, wo das Herz zerspringen will, sind vorüber. Sorge und Leid brüderlich vereint schoben mir voller Freud den Arm unter und wanderten unverdrossen, ständig ihre Lasten mir lächelnd reichend, weiter. Und doch klage ich nicht! Ich fand für Sekunden das Glück! Fand die Taitai, fand Otto, fand das süße kleine Stück Heimat, fand Enakind, alles eine Welt für sich. Und nun wandere ich wieder! Ach du lieber Gott, muss ich schon wieder fort auf die Chaussee. Aber ich ziehe nicht mehr heimatlos herum! Ich habe ein Sehnen, wenn ich einsam reite, ich habe ein Hoffen, wenn ich einsam im Lager liege. Übermorgen, wenn es geht morgen, soll ich flott werden.
Mit diesem Gefühlsausbruch setzt Hermann Constens erstes Reisejournal unter dem Datum des 19. Mai 1928 ein. Schon die Anfangssätze offenbaren, 415
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Abb. 21: Lotte „Taitai“ Junkel mit Tochter Gisela, Tientsin 1928
dass er sich nicht in bester Gemütsverfassung befindet und dass es ihm offenkundig schwerfällt, sich von der Familie loszureißen, die ihm in Tientsin ein halbes Jahr lang Gastrecht gewährte, ihm so etwas wie einen Familienanschluss geboten hatte. Die Nähe und Intimität, die er innerhalb der Fami786 lie Junkel erfahren durfte, ist mit Händen zu greifen. Für seine beiden Gastgeber, die er bald schon Lotte oder einfach Taitai – Ehrentitel jeder verheirateten Frau in China – und Otto, wegen dessen Chirurgenberuf auch Messerich nennen durfte, war Consten selbst wieder Etzel geworden. Er fühlte sich ähnlich angenommen, wie während des Weltkriegs bei den Magnatenfamilien in Budapest. Vielleicht mit dem entscheidenden Unterschied, dass hier niemand etwas von ihm wollte, sondern nur gab, schenkte, vor allem Wärme und Herzlichkeit und ein unverstelltes Vertrauen. Während seiner Karawanenreise wird ihm Lotte Junkels Bemerkung an einem ihrer unbeschwerten gemeinsamen Abende im Familienkreis wieder 787 einfallen: „Etzel hat Sonne im Herzen“. Er wird sich erinnern, dass sie ihm, als er mit einer Fleischvergiftung darniederlag, Hühnerpudding, ein 788 chinesisches Gericht zur Krankenstärkung gebracht hatte. Zumindest zeitweise konnte sich Hermann Consten also in der Illusion wiegen, dazuzugehören, Teil dieser wunderbaren Familie zu sein, bevor sich die Wolken über ihm wieder zusammenzogen und die Sonne aus seinem Herzen ver416
2. Mongolei zum Dritten:Über die Große Mauer Richtung Norden
schwand. Mit den Junkels hatte er am 14. März 1928 noch seinen 50. Geburtstag gefeiert. Offensichtlich hatte Consten in Tientsin ebenfalls fleißig Tagebuch geschrieben. Jedenfalls finden sich auf den vier Anfangsseiten des ersten Journals, einer großformatigen schwarzen Kladde, deren vorderer Deckel entfernt wurde, diagonal mit Bleistift geschrieben, folgende Angaben vermerkt: Taitai Tientsin 1928; Taitai Februar Tientsin 1928; Tientsin, den 21. Februar 1928; Taitai Peking 25. Februar 1928; Taitai Peking 2.–5. März 1928; Taitai Tientsin 14.–19. März 1928; Taitai 26.–28. März Tientsin 1928; Taitai Peking 30. März – 2. April 1928; Taitai Tientsin 7.–10. April Ostern 1928; Tientsin, 28. April – 3. Mai 1928 Taitai. Es ist anzunehmen, dass Consten diese Teile seiner Tagebuchaufzeichnungen später herausgetrennt und vernichtet hat. Denn es gab nach seiner Rückkehr aus der Mongolei einen triftigen Grund, sich dieses schmerzlich-schöne Kapitel seines Lebens aus dem Herzen zu reißen. Aus den notierten Daten geht immerhin hervor, dass ihn seine Gastgeberin in der Zeit der Reisevorbereitungen mehrmals nach Peking begleitet hat. Mit ihren Chinesischkenntnissen dürfte Lotte Junkel ihm beim Beschaffen der Ausrüstung und bei den Einkaufsgesprächen auf dem Kamelmarkt am Fuße der alten Pekinger Stadtmauer eine wertvolle Hilfe gewesen sein. Auch dürfte Consten etliche seiner deutschen Bekanntschaften in Peking niemand anderem als ihr und Otto Junkel verdanken. Ein paar Sätze vorweg zu den Tagebüchern, die das Rätsel seiner neunmonatigen Karawanenreise lösen: Hermann Constens Aufzeichnungen von seiner letzten Mongoleireise 1928/1929 waren 2003, zusammen mit Briefen und Original-Reisedokumenten mehr durch Zufall bei Herrn Michael Scheluchin, einem in der Nähe Aachens lebenden Verwandten Frau Prof. von Erdbergs, aus einer Kiste wieder aufgetaucht, die jahrelang auf dem Dachboden gestanden hatte. Sie erwiesen sich als ein wahrer Schatz. Anhand dieser Notate lässt sich nämlich der Verlauf der Reise, beginnend mit dem 19. Mai 1928, bis zur erzwungenen Rückkehr nach China im März/April 1929, also über ein knappes Jahr lückenlos verfolgen. Die täglichen Eintragungen geben nicht nur Aufschluss über den Reiseverlauf und die damit verbundenen Probleme, sondern auch über Constens eigenwillige, völlig unakademische Forschungsmethoden und darüber hinaus über seine ganz persönliche Befindlichkeit, seinen Charakter, seine Selbsteinschätzung, sein Denken. 417
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Dabei sind die Grenzen von Sachlichkeit und Intimität gelegentlich fließend. Manche Kürzel und Bemerkungen bleiben rätselhaft, manche Hintergründe erschließen sich erst durch einige – ebenfalls noch vorhandene – Briefe aus jener Zeit, von denen Consten Abschriften bzw. Durchschläge aufzubewahren pflegte und die seine abenteuerlichsten Momente auf dieser Reise im Zusammenhang und farbig ausgeschmückt, wie es seine Art war, beschreiben. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch, dass Consten seine Notizen gelegentlich mit Skizzen, manchmal sogar detaillierten Zeichnungen anreicherte. Dies trifft besonders auf die nähere Beschreibung von Tempelanlagen, ungewöhnlichen Naturerscheinungen und auf seine archäologischen Grabungen zu, die er während einer durch die Umstände bedingten längeren Unterbrechung seiner Reise in der Inneren Mongolei durchführte. Auch kleine Karten mit seinen geplanten oder bereits zurückgelegten Routen finden sich. Vom ersten Abschnitt seiner Reise, die ihn von Peking aus durch die Innere Mongolei bis an die Staatsgrenze der Mongolischen Volksrepublik führte, hat Consten seine unterwegs, manchmal gar auf dem Pferderücken im holprigen Steppengelände im Telegrammstil notierten Eindrücke und meteorologische Messergebnisse von einem kleinen Taschenbüchlein, das er stets am Körper trug, abends oder an Tagen erzwungener Ruhe mit Bleistift in großformatige (27 x 20 cm) zwei cm dicke Trennsatz-Kladden mit Durchschriftblättern übertragen und ausformuliert. Einen Durchschriftensatz schickte er, sozusagen als Sicherheitskopie, nach Tientsin. Nach seiner Festnahme im Oktober 1928 waren ausführliche Einträge in seine dicken Kladden wegen der Gefahr der Beschlagnahmung nicht mehr möglich. Von da ab existieren nur noch die kleinen (10 x 15 cm), teilweise äußerst schwer zu entziffernden Taschenkladden, in die Consten abends in seiner „Gefängnisjurte“, im trüben Licht einer defekten Sturmlampe, mit stumpfem Bleistift und in winziger Schrift heimlich seine Notizen machte. Insgesamt sind drei der großen und drei der kleinen Tagebuchhefte aus jener Zeit im Nachlass vorhanden; von letzteren sind zwei mit ihren Deckeln fest zusammengeklebt. Hinzu kommt ein schmales Notizbuch im Hochformat mit festem Einband (16,5 x 10,5 cm; Yung Hsing Stationary Company, Peking-Tientsin), in das Consten mit blauer Tinte seinen Telegrafenschlüssel hineingeschrieben hat. Ein zweites Exemplar müsste er bei 418
2. Mongolei zum Dritten:Über die Große Mauer Richtung Norden
der Familie Junkel hinterlegt haben, denn auch von ihr ist ein verschlüsseltes Telegramm – mit der Entschlüsselung von Constens Hand – im Original noch vorhanden. Ferner existiert eine schwarze Kladde mittlerer Größe (20 x 12,5 cm), die ein Stichwort-Register mit Satzbeispielen enthält. Vermutlich diente sie der für einen späteren Zeitpunkt geplanten romanhaften 789 Ausgestaltung seiner Reiseabenteuer. Sonnabend den 19. Mai 28 Müde! – – – Alkohol für mich und Reise nicht gut! Schadet und schwächt wie die Liebe zu einer schönen Frau! Mit Auto Paomachang. Niemand da! – Kameltreiber kommen erst um 9 Uhr statt 7 Uhr. Man konnte sich scheinbar nicht über die Verteilung der Beute beim Verkauf des neunten Kamels an mich einigen. Das zehnte Kamel bin ich. – Als die Lasten aufgeladen werden, bemerkt Wassili der Idiotboy, dass er die Schlüssel im 790 Wagon de Lits vergessen. Er muss zur Stadt zurück! Viel Arbeit mit dem Beladen der Kamele. Wenn das immer so geht, dann stehe mir Gott bei!
Constens erster Reisetag fängt gut an. Die vorangegangene Nacht hat er bei einem seiner neuen Pekinger Bekannten, Wilhelm Schmidt von der Luft-Hansa, nach einem durchzechten Abend zusammengekrümmt auf einem Sofa verbracht. Am Vortag hatte er in Peking einen ehemaligen Bekannten aus Budapest vorbeilaufen sehen. Das hatte ihn unvermittelt und schmerzhaft an seine Enttarnung 1918 und den Verlust Emmas 1927 erinnert. Am Morgen des 19. Mai war er schließlich aufgebrochen, ohne sich von seinem Gastgeber Rudolf Bertram zu verabschieden. Nun verlässt er auf dem Rücken eines Rappen, dem er den Namen Kara Etzel – Schwarzer Etzel – gab, mit seinen neun Kamelen und ihren Treibern Chinas alte Hauptstadt. Er zieht in nordöstlicher Richtung auf die Große Mauer zu, die das Reich der Mitte einst gegen den Ansturm der hunnischen und mongolischen Reiterstämme errichtet hatte. Die erste Nacht verbringt Consten mit seinem Tross in einer Karawanserei am Wege. Am nächsten Tag, einem Sonntag, geht es weiter in nordöstlicher Richtung. Seinem Leitkamel hat er vorn die schwarz-weiß-rote Reichshandelsflagge angesteckt. Im Parteienstreit um dieses Relikt aus der Kaiserzeit, das zu hissen deutschen Auslandsvertretungen in der Flaggen419
V. Die letzte Expedition 1928–1929
verordnung vom Mai 1926 gestattet worden war, hatte Reichskanzler Hans Luther, zu dem Consten vor seiner Abreise noch Verbindung aufgenommen 791 hatte, seinen Hut nehmen müssen. Consten merkt bereits, dass sich seine Kamelführer und der immer wieder als „Idiotboy“ titulierte Dolmetscher Wassili zusammentun, um, wie er meint, ihn allmählich auszunehmen. Draußen ist es heiß geworden. Die Karawane kommt nur langsam voran. Für ihn bedeutet das, auch in den nächsten Tagen viel Zeit zu haben, seinen Gedanken nachzuhängen. Meist kreisen sie um Taitai – in einer Weise, die deutlich macht, dass sie ihn, bei aller Herzlichkeit und Fürsorglichkeit wohl doch auf Distanz gehalten hat. „Du hehre Frau“, notiert er unter dem 21.5., nennt sie, wie ein fahrender Minnesänger, „erhaben und keusch“. Sie hat ihm einige Dinge mit auf die Reise gegeben, die er nun wie Heiligtümer verehrt: einen silberbeschlagenen Ledergürtel mit der Gravur Taitai ihrem 792 getreuen Etzel auf der Schließe, eine Armbanduhr, einen japanischen Taschenwärmer, ein Kopfkissen und einen Faltstuhl. Später wird er die Gaben nur noch als „Gnadengeschenke“ bewerten. Je weiter sich seine Karawane von Peking entfernt, desto mehr nimmt Consten nun auch die nordchinesische Landschaft wahr, er schildert Dorfszenen und Begegnungen mit 793 Händlern und Soldaten. Viertel vor acht Uhr Tien schan jen. Bäume. Telegr.linie. Die Luft ist frisch. 8.15 Ku lin schu[,] Mohamedaner Dorf mit Mohamed. Schule. Überall vorwitzige Elstern auf dem Wege, in den Dörfern auffallend viele Kinder, Mädchen und junge Frauen mit verkrüppelten Füssen. 9.15 in Wanju war. Leichter kühler Wind[,] etwas verdächtig bedeckter Himmel. Weg stark sandig[,] für Kamele gut. Ziehen 500 m entfernt Parallele mit d. Telegr.linie – Kommen den Bergen immer näher! 10 v. 10 Uhr Sen djan[,] den Brunnen auf einem Art Dorfplatz. Bäume, in deren Schatten Kinder! Vorne ein Lätzchen bis zum Nabel. Die untere Partie ist frei. In ihrer Verlegenheit spielen sie an ihrem kleinen Penes mit d. rechten Hand, den Zeigefinger der Linken haben sie in den Mund gesteckt. Ein Bild für einen Gottbegnadeten Künstler. Elf Uhr in Mu jai chang. – You go chang 11.45. Heisser Wind – Sandiger Weg – 12 Uhr endlich in Niu lan chan. Heiss. Beziehen in einer Karawanserei Quartier. Leute können nicht weiter. Behaupten, die vierbeinigen Kamele könnten nicht mehr. Also bleiben wir [im] Dorf trotz der Gefahr[,] und wegen der Gefahr die 420
2. Mongolei zum Dritten:Über die Große Mauer Richtung Norden
Tiere jetzt noch nicht überanstrengen. Besuche das Männerkloster Tschi sang miao. Vorne ein Taoistischer Tempel, dahinter ein Buddhistischer – 794 795 Am Pai Men ein Tsansolin Soldat auf Posten. Modell 88 Erfurt. Nach Hause zurück. Fütterung d. Kamele. Kara Etzel frisst[,] seitdem er täglich von mir seine Portion Salz bekommt[,] ausgezeichnet. Um neun Uhr abends schickt der Zoll um meinen Pass! Wassili muss hin, da ich schon ausgezogen bin und Tagebuch schreibe. – Alles hat gutgegangen.
Was hatte Consten von der Passrevision zu befürchten? Seine Papiere sind ja wohl in Ordnung. Aber er ist schon etwas nervös, denn eine der Auflagen der Pekinger Passbehörde bzw. des chinesischen Kriegsministeriums hat er schlicht ignoriert. Er führt natürlich alle seine Waffen samt den Munitionskisten mit sich. Von Karawanenleuten, die aus Richtung Jehol unterwegs sind, hört er erste Gerüchte, dass Chunchusen, Räuberbanden unterwegs seien. Dann muss er feststellen, dass er auf dem Lande nicht mit Papiergeld zahlen kann. Er muss also noch einmal nach Peking zurück, um mehr mexikanische Silberdollars einzutauschen, die, mit dem Porträt Yuan 796 Shikais versehen, hierzulande gängiges Zahlungsmittel sind. Auch chinesische Visitenkarten will er sich noch machen lassen – lauter Dinge, die er eigentlich vorher hätte erledigen können. Während seine Karawanenleute in der Nähe des Dorfs Miyün einen Ruhetag einlegen, lässt Consten sich von einem Auto nach Peking mitnehmen, das unterwegs auch noch ein Hinterrad verliert und mit überhitztem Kühler liegenbleibt. Anderentags fährt er mit einem chinesischen Omnibus zurück. Seine Leute sind nervös, weil sie sich vor Chunchusen fürchten, die jenseits der Großen Mauer ihr Unwesen treiben sollen. Am 27. Mai, acht Tage nach dem Aufbruch, kommt die Große Mauer in Sicht. Der Weg wird schwierig. Er führt über blanken Fels erst durch niedrige Vorhügel. Um neun Uhr vormittags erreicht die Karawane, die wegen der großen Hitze am Tage lieber durch die Nacht gewandert war, das Nantianmen, das Südliche Himmelstor, eines der Vorwerke der alten Festung Koupeikou (Gubeikou), die einen der wichtigen Übergänge an der Großen Mauer Richtung Norden bewacht. Montag 28. Mai 28. Kou pei kou Höhe 410. Barm. 73.1 Vor dem Aufbruch besuche ich noch einmal das Innere der alten Festung! Die Tempel, in421
V. Die letzte Expedition 1928–1929
nerhalb des alten Tores, durch das wir von Miyün kommend einzogen und dem Außentore, durch das wir hinaus müssen, gelegen, sind ohne jeden künstlerischen Wert. Der Tempel des Medizingottes liegt dicht beim Eintrittstor. Man muss eine Enttäuschung unterdrücken. Provinziale Ar797 beit!
Abb. 22: Die Consten-Karawane an der Großen Chinesischen Mauer, 1928
Die Eingangspforte der Festung erinnert Consten wegen ihrer engen Passage und dem teilweise auf den gewachsenen Fels gesetzten, gewaltig aufragenden Ziegelmauerwerk lebhaft an das Ištar-Tor in Babylon, das er aus dem Pergamon-Museum in Berlin kennt. Die Tore selbst fehlen, nur Angelnlöcher und Drehstein, sowie die Löcher, wo die Querbalken eingelegt wurden, sind noch vorhanden. Die in die Festung eingelassenen Fensteröffnungen kommen ihm dagegen romanisch vor. Durch das Ost-Tor (Dongtianmen) zieht Constens Karawane anderentags in der Frühe hinaus und marschiert nach Norden. „Fotografiere“, notiert er in sein Journal. „Ein herrlicher Anblick: Berggipfel und Übergänge gekrönt von Türme[n] und 798 Tore[n], ist ganze [sic] eine gewaltige Burg.“ Ab Gubeikou bewegt sich die Karawane unter militärischem Geleitschutz. Die Gegend wird unsicher. Der direkte Weg nach Norden ist durch Räuberbanden versperrt, deshalb schwenkt die Karawane nach Osten ab. 422
2. Mongolei zum Dritten:Über die Große Mauer Richtung Norden
Die ganze Umgebung nimmt einen rein mongol. Charakter an. Neben uns her rechts v. Wege läuft über die Berge die Telegrafen Linie. Sie trug meine Grüße der Taitai und den Ihrigen nach Tientsin. Siedlungen am Wege. Mais angepflanzt. Halten Richtung O. Im N. und O. blaugezackte Berge. – Kuo loo go 9.10 Uhr vorm. 4 große Pappeln mit Baumwuchs recht spärlich. Bewölkter Himmel über mongolischer Hügellandschaft. Lehmhütten. – Im alten Flussbett ein dünnes Bächlein. Marschrichtung O. Um 10 Uhr in Hua loo go. Kurz darauf in Go tschang tschouang. Wir haben heute 25 Li bis hierher zurückgelegt. Kreuzen die Telegrafen Linie. Der untere Draht ist so niedrig, dass meine hochbeladenen Kamele grade noch unten durch können. Auf den Bergen die ersten Tschacharhir799 ten. Sie hüten Schweine! Rechts am Wege haben wir leichten Kiefernbestand. Ein Postreiter zieht auf sommerlichem Esulein vorbei. Wie ganz 800 anders die Buchä der Mongolen. […] Noch einmal blicke ich zurück, dort glänzt im Sonnenschein die Grosse Mauer. Ob ich sie noch einmal wiedersehe?! Mir kommen trübe, so trübe Gedanken! Bin ich doch hier, ausserhalb der Mauer, in diesem gewaltigen Gebiet der einzige einsam 801 wandernde Europäer!
Durch Landschaften, die ihn mal an die bewaldeten Hügel Thüringens, mal an die schroffen Felswände des Čuijskij-Trakts im russisch-mongolischen Grenzgebiet erinnern, nähert sich Constens Karawane am 30. Mai schließlich der alten Kaiserstadt Jehol (Chengde). Es stellt sich heraus, dass sein Begleitsoldat die Adresse der Karawanserei verloren hat. Im Postamt, wo er nach postlagernden Briefen fragt, erfährt Consten, es gebe in Jehol eine belgische Missionsstation. Also wendet sich die Karawane dorthin, und bald 802 darauf wird Consten von Pater Joseph Mullie aufs freundlichste empfangen. Der Pater überrascht mich bei der Begrüßung – ich hatte meine Karte zu ihm hereingeschickt – damit dass er sagt: „Also das ist der Verfasser der Weideplätze“. Bald haben wir gemeinsame Bekannte, Grünwedel, Marquardt, de Groot, Billot, le Cocq u. andere. Passrevision! Gebe meinen Pass ab. Der Kath. Comprador der Mission erhält den Auftrag[, für] einen neuen Boy und für die Karawane zu sorgen, die in der Stadt liegt. Abends die Nachricht, die Militärbehörden wollen meine Kisten nachse423
V. Die letzte Expedition 1928–1929
hen. Das ist fatal. Wieder wird der Pass herausgeholt und der Comprador, der über gute Beziehungen, wie die Mission überhaupt verfügt[,] wird losgeschickt. Hoffentlich gibt es nur, wo alles so gut ging, keinen 803 Stopp.
Constens Sorge erweist sich als unbegründet, und in Pater Mullie, einem in Fachkreisen bekannten Sinologen und Mongolisten, hat er einen wunderbaren Gesprächspartner. Mullie ist nicht nur mit dem örtlichen Dialekt, den Sitten und Gebräuchen Nordwestchinas seit bald zwei Jahrzehnten vertraut, er hat in der Gegend von Hata (Ulaan Chad, Chifeng) auch als Erster die Gräber dreier Könige der Liao-Dynastie aus dem 9.-12. Jahrhundert entdeckt. Diese Nomadenkönige hatten zeitweise ein riesiges, die Mandschurei, Südsibirien und die Mongolei umfassendes Territorium beherrscht und im heutigen Linken Baarin-Banner der Inneren Mongolei ihre „Erhabene Hauptstadt“ (Shanjing) gehabt. Joseph Mullie hatte 1922 über die Ruinen der einstigen Liao-Metropole und die historische Geografie des Gebiets einen ersten Artikel in der sinologischen Fachzeitschrift T’oung Pao veröf804 fentlicht. Dieser ermöglichte die spätere Identifikation einer ganzen Reihe archäologischer Stätten, die erst ab den 60er Jahren näher untersucht wur805 den. Anderentags trifft noch ein Pater Bouldewyn ein, der vier Tagereisen entfernt eine Missionsstation leitet und Schreckliches über Räuberattacken auf christliche Einrichtungen, Verhaftungen und Vergewaltigungen chinesischer Christen zu berichten weiß. Consten verspricht, die deutsche Ge806 sandtschaft über die Vorkommnisse zu unterrichten. Bouldewyn begleitet ihn in den nächsten Tagen bei Gängen in die Stadt und beim Besuch der kaiserlichen Sommerresidenz, deren wunderschöne Anlage dem Verfall preisgegeben zu sein scheint. Die Dächer verfallen, Holzsäulen geplatzt, alles ohne Farbe, nur hier und da ein leichter Hauch noch, sonst grau in grau. Man ist froh, wenn man aus dieser – durch Habsucht der Beamten verfallenen Herrlichkeit wieder heraus ist. Der Park, Mauerumzogen, ist herrlich, der Je-ho bildet in vielen großen und kleinen Krümmungen Seen und Buchten. Das Landschaftsbild wirkt reizend durch die Pagoden, Tempelanlagen und Lusthäuser und dazwischen Damwild und Kühe. Einen großen Teil der 424
2. Mongolei zum Dritten:Über die Große Mauer Richtung Norden
Hirsche hat der Gouverneursohn wegen der Gehörne, deren Extrakt gut gegen Impotenz sein soll[,] abgeschossen. So herrlich das Landschaftsbild, so trostlos das übrige. Verfallene verkommene Herrlichkeit. Nichts ist ganz, nichts ist erhalten, das einzige Bauwerk das aufrecht steht[,] ist die Pagode. Hier liegen Dachreiter, glasierte Ziegel, gestürzte Buddhas bei und in den Hallen herum. Otto würde seine helle Freude haben, wenn ich auch nur eine Kamelladung von den großen Goldlackbuddhas mitbringen würde. Zwei Buddhas für je ein Kamel, denn sie sind so groß wie der in Ottos Halle, mehr ginge allerdings nicht, da würde meine Karawane 807 nicht ausreichen! Alle Lackbuddhas sind rückwärts geöffnet. […] Über die mit 4 Lusthäuschen verzierte sehr solid gebaute Brücke, vielleicht das 808 einzige solide Bauwerk im ganzen Kung, kommen wir zum Theater. Ringsherum laufen noch die hübschen Holzbauten mit den Galerien für die Zuschauer. Das Theater kracht beim ersten größeren Sturm ganz zusammen. Das obere vierte Stockwerk ist schon auf das dritte abgestürzt. – 809 Mache viele Photos.
Überwältigt ist Consten auch von der alten Klosterstadt wenige Kilometer außerhalb Jehols, zu der u.a. ein getreues Abbild des Potala in Lhasa gehört. Beim Gang durch die Klosteranlagen und Tempel notiert er, inzwi810 schen geschult an Grünwedels Werk „Mythologie des Buddhismus“, das zu den Büchern in seinem Reisegepäck gehört, die auf Thangkas und Altären dargestellten Gottheiten. Ein etwa 20 m hoher Maidari mit vielen Armen steht mitten im Tempel, nebst zwei nicht ganz so hohe[n] Begleiter[n]. Die eine Figur stellt einen alten Mann dar, Bart indischer Einfluss. Beide Figuren kann ich in der Eile nicht bestimmen. Auf der ersten Etage aus demselben Rotlack wie der große Maidari, die verschiedene[n] Buddhas mit den verschiedene[n] Handstellungen. Der der dem Maidari genau gegenüber saß[,] ist nicht mehr da. Auf der höchsten Etage Bilder u. Stupa's. Die Decke ist herrlich gemalt. Das ganze überwältigend! In einem Nebentempel Yamantaka Mahakalla und was mit der Tantra zusammenhängt. Ein dritter Tempel enthält die verschiedene[n] Lamas und auch indische Tantraleute. Übrigens wart [sic] auch im Potalatempel Yamantaka mit seiner weiblichen Energie im höchsten sexuellen Erregungszustand dargestellt, sogar die 425
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Lama hatten ein mit tibetischer Schrift bedrucktes Tüchlein den beiden darüber gehängt! Im übrigen Format und Größe anständig. Pater Boul811 dewyn schaute ganz verlegen weg!
3. Unter Warlords, Räubern, Missionaren und Lamas Wohlversehen mit guten Wünschen der belgischen Patres, Briefen und Adressen zieht Consten mit seiner Karawane weiter in nordöstlicher Richtung. Diesmal hat er nur einen Begleitsoldaten der örtlichen Polizei. Denn über Jehol wurde Mobilmachung verhängt. Man rechnet mit einem Angriff der Chunchusen. Der Gouverneur wollte schon seine Sachen in der Missionsstation unterstellen, aber Pater Mullie, der ansonsten mit den chinesischen Behörden auf gutem Fuß steht, hatte abgelehnt. Er fürchtete eine Stürmung seiner Missionsstation durch Räuberbanden. Unterwegs begegnet Constens Karawane einem Trupp Soldaten Zhang Zuolins, des schärfsten Rivalen Chiang Kaisheks nördlich der Großen Mauer, der über eine Armee von 500.000 Mann gebieten soll, im Anmarsch auf Gubeikou. Im Rücken hat er nun eine sich in Auflösung befindliche Armee, und vor ihm scheinen hinter jedem Felsvorsprung, hinter jeder Wegbiegung Chunchusen zu lauern. Eine höchst ungemütliche Situation erwartet Consten im nächsten Dorf. 812
Der Selbstschutz der Roten Speerträger ist im Dorfe. Ich schicke dem Führer meine Karte durch meinen Polizisten. Kurz darauf macht er mir unter dem Vorwand[,] er habe kranke Augen[,] einen Besuch. Er will mich nur in Augenschein nehmen. Sympathischer junger Mann. Um den Bauch hat er einen Patronengürtel, daran eine Mauserpistole und Browning hängen. […] Nachdem wir zusammen Thee getrunken haben, verschwindet er wieder. Sein ihn begleitender Unterführer trug über Pistole und Gürtel eine schwarze Seidenjacke. – Jetzt kann ich auch verstehen, warum einige Male scharf geschossen wurde[,] als ich mit meinem Polizisten angeritten kam. Das sollten Warnungsschüsse sein. Auf den Höhen hielten Posten Ausschau! Das Dorf befindet sich im Kriegszustand 813 mit den Räubern. Das kann ja gemütlich werden!
Consten steht vor einer ersten Bewährungsprobe. Auf einmal ist er ganz in seinem Element, schwingt sich zum Verteidiger des Dorfes auf. Alles soll 426
3. Unter Warlords, Räubern, Missionaren und Lamas
auf sein Kommando hören. Jetzt beginnt für ihn erst das richtige Abenteuer. Das war eine tolle Nacht! – – Kaum hatte ich mich zum Schlafen niedergelegt, als ich geweckt wurde. Ärgerlich fahre ich hoch! Ich will eben den Boy anschnauzen, als er mit feierlicher Handbewegung und halberstickter Stimme mir das eine Wort Chunchuse zuflüstert. Neben ihm stehen Sung und die beiden anderen. Na da soll doch der Teufel dreinfahren. „Im Dorfe?“ frage ich Wassili. „Nein 20 Mann sind auf dem Anmarsch und wollen das Dorf stürmen, weil die Roten Speerträger gestern drei Leute einer anderen Bande getötet haben.“ – Also wieder einmal in die Hosen, fluchend und schimpfend, dass die Banditen mir am Tage so viel Unruhe verursachen und mich nun nicht einmal Nachts in Ruhe lassen wollen, klettere ich in meine Hose, schnalle Taitais Gürtel um, untersuche schnell Parabellum und Browning die schussfertig neben mir liegen. Endlich habe ich Schuhe, Gamaschen und Hemd an! So nun kann es von mir aus losgehen[,] ich habe eine Wut im Leibe – – –! Der schnell herbeigerufene Führer der Roten Speerträger bestätigt mir alles. Schon will ich so wie ich bin auf die Straße, als er mich bittet[,] eines meiner Gewehre mitzunehmen. Also meine Leute haben geplaudert. Na, meinetwegen! Also: „Gewehrkiste hereingebracht.“ Die Leute fliegen nur so. Ja die Angst. „Sämtliche Munitionskisten ebenfalls.“ Das ist leichter befohlen als getan. Wenn die Räuber es eilig haben[,] erwischen sie uns bei der schönsten Arbeit und offenen Munitionskisten. Endlich sind die Magnum gefunden! Die 20 Schuss die immer bereit liegen sollen, hat der Idiotboy so weggelegt, dass niemand sie finden kann! Schnell den Jagdmantel über Patronengürtel mit 50 Magnum darauf, fünf in die Mauser, Pistolen und Messer griffbereit dazu, so jetzt los! Da bittet mich Sung, mein Kamelführer, er und seine zwei Leute wollen auch mitkämpfen, sie seien in Peking bei einem hohen General als Schutzsoldaten gewesen. „Mag sein, mit meinen Gewehren versteht ihr doch nicht umzugehen, bleibt ruhig bei den Sachen, wird die Sache wirklich gefährlich, dann legt mir Munition bereit, Ihr könnt dann meine Pistolen haben.“ – Dann stehe [ich] mit meiner Streitmacht draußen auf die Straße [sic], drei Rote Speerträger mit Gewehre[n] Mod. 71, drei Polizeisoldaten mit demselben Modell, und ein Kerl als Führer mit einem Speer! Hell leuchtet der Mond! 427
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Im Dorf marschiert alles geschlossen hinter mir. Sobald aber der Dorfrand erreicht ist, ich die Leute nach links und rechts auseinanderziehe, wird der Abstand zwischen mir und ihnen immer größer. Endlich bitten sie mich[,] nicht weiter zu gehen da sie das Dorf nicht so weit verlassen dürften. „Na dann nicht.“ Mit dem Glase suche ich die Richtung ab, woher sie kommen müssen. Ein seit einer Stunde abgeschickter Späher ist auch noch nicht zurück. Drüben am Hang glüht ein Lichtpünktchen auf, das ist verdächtig. Jemand hat sich eine Cigarette angezündet. Durch Zeichen erklären mir die Leute, dass es einer der ihrigen ist[,] der dort Posten steht. Nun um das Dorf herum. Köter kläffen fern[,] und das erinnert mich immer wieder an meine lieben Landsleute, sobald es sich um meine Person handelt. – Auch jetzt werden die Schluchten mit dem Glase abgesucht. Dort oben bewegt sich was im Mondschein. – Ein Mensch! – – – Ich lasse einen – scheinbar der angesehenste der Leute – durch [das] Glas sehen. Er nickt, zeigt nach dem Hang, dann auf sich und seine Leute. Also einer der ihrigen. Weiter zum N.W. Ausgang des Dorfes. Irgendwo in der Ferne fallen Schüsse. Eins, zwei – – drei vier – fünf. Alles ist gespannter Erwartung voll, ich gehe zu meinen immer mehr zurückgebliebenen Leuten. Sie zucken die Achseln. Wissen also nicht woher oder von wem die Schüsse kommen können. Da wieder Schüsse. Etwas näher, ein – – zwei drei vier! Wir lauschen! – – Stille – – Da vor uns ganz leise kaum hörbar aus der Richtung[,] woher die Banditen nach den Schüssen zu urteilen kommen müssen. Entferntes Getrappel, leises Rufen. Durch Winke will ich meine Leute verteilen. Sie liegen schon am Straßenrand hinter Steine[n]. Nur der Unteroffizier kniet fünf Schritte hinter mir, wie ich auf dem Wege ohne Deckung. So ist's recht. Überall knacken die Sicherungen. Ich suche etwa drei, vier Minuten irgendetwas, was sich 200 Meter vor uns im tiefsten Straßenschatten fast lautlos nähert, auszumachen. Vergebene Liebesmühe. Jetzt wieder leises Zurufen, Getrampel. Meine Mauser fährt langsam hoch, da legt sich mir eine Hand vorsichtig auf die Schulter. Ich schaue mich um. Es ist der Speerträger. Er schüttelt den Kopf. Also nicht schießen. Meinetwegen ich habe Zeit. Anrufe! – – – Antwort. Chines. Karawane, die nicht weiß, ob das Dorf von Chunchusen besetzt ist. Alles atmet auf. Ich gehe ins Quartier. Kaum dort angelangt[,] bringt der Späher die Nachricht[:] die Chunchusen haben dicht 428
3. Unter Warlords, Räubern, Missionaren und Lamas
bei Ta Miao in dem Dorf[,] wo wir übernachten wollen[,] eine chines. 814 Karawane ausgeplündert. Werte von 600 $ und 300 $ Baargeld geraubt.
Noch mehrmals in dieser Nacht gibt es Fehlalarme. Die Lage ist sehr gespannt. So muss Consten sehen, dass er mit seiner Karawane weiterkommt. Diesmal geben ihm Rote Speerträger das Geleit durch ein Gebiet, wo im 815 vergangenen Winter zwei Patres der Mission Scheut ausgeraubt wurden. Die Wege sind schlecht, aber die Landschaft ist wunderschön. Nur wenige Bauern arbeiten in ihren Feldern. Man kann nicht sicher sein, ob sie nicht vielleicht doch Späher der Chunchusen sind. In der Mittagszeit des 5. Juni erreicht die Karawane eine Passhöhe mit einem halb verfallenen Tempelchen. Die Wände sind mit Namen bekritzelt, und auch Hermann Consten verewigt sich hier. Ein paar Wanderer gesellen sich zu ihm, scheinbar harmlos. „Ich spiele ganz wie zufällig mit meiner Parabellum, und als ich sie auch noch photographieren will, verduften sie“, notiert Consten am Abend in seine schwarze Kladde. Inzwischen ist es schon die zweite, die er mit folgenden Sätzen beginnt: Den ersten Band mit seinen Erinnerungen an die Taitai, mit seinen Wegerlebnissen lege ich in meinen Koffer. Hoffentlich werde ich ihn in 816 Ruhe und Frieden dereinst in der Nähe der Taitai bearbeiten können.
Am Nachmittag des 5. Juni passiert ihm noch ein Missgeschick, das eines Don Quijote, des Ritters von der traurigen Gestalt, würdig ist. Consten glaubt, durch seinen Fernstecher mal wieder Räuber auf den Bergen am Horizont ausfindig gemacht zu haben, fürchtet, sie hätten sich zwischen ihn und seine nachkommende Karawane geschoben. Als er sein Pferd herumreißt, um zurückzureiten, brennt Kara Etzel mit ihm durch, und Consten fliegt in hohem Bogen mit vorgestreckten Armen zwischen Geröll und Gestein auf den Bauch. Hart schlägt Kara Etzel, einen Salto in bester Form ausführend, neben mir auf. Haarscharf fegt sein Hinterteil neben meinem Kopf nieder, schlagen seine Hufe durch die Luft! Im Nu bin ich hoch, da steht auch schon Kara Etzel auf den Beinen. Er glotzt mich dumm und halbbetäubt an. Ein rascher Griff nach dem Gewehr, nichts zerbrochen. Die Knochen sind auch heil, Kara Etzel blutet schwer oberhalb des linken Auges und 429
V. Die letzte Expedition 1928–1929
der Nüstern. Er ist auf den Kopf gestürzt. Mich fasst die Wut, erst bekommt Kara Etzel ein paar Tritte unter den Bauch! Dann die Pistole heraus, Kara Etzel am Zügel, nach oben! Alles hat sich in einigen Sekunden abgespielt. Die Kerle oben sind – sie hatten alles beobachtet – bis auf einen verschwunden. Alle guten Vorsätze sind vergessen. Ich sehe rot. 817 Nur ran an die Schufte.
Als er jedoch in ihrer Nähe angekommen ist und feststellen muss, dass niemand schießt, sondern alle nur dorthin blicken und mit den Fingern zeigen, von wo seine Karawane anmarschiert, wird Consten doch stutzig. Einer der Bauernmilizionäre gibt ihm schließlich durch Handzeichen zu verstehen, dass mit seinen Kamelen etwas nicht stimmt. Ich stelle mich auf einen Stein, so dass man mich sehen muss. Beobachte mit dem Glas. Jetzt haben sie mich auch gesehen. Yang nimmt die deutsche Flagge, hebt sie hoch, senkt sie dreimal. Das heißt: „Komme herunter!“ Sicherlich ist irgendetwas mit den Kamelen geschehen. Also wieder bergab. Diesmal in der Richtung[,] woher wir gekommen sind. Einer der roten Speerträger begleitet mich, die anderen halten den Pass besetzt. Unterwegs überlege ich, wie viel Kamele wohl abgestürzt sein können, denn die Karawane hält gerade auf der gefährlichsten Stelle. Ich zähle nur fünf Kamele – und ich bin das sechste, weil ich die Karawane allein diese Stelle passieren ließ. Langsam setzt sich die Karawane unten in Bewegung. Ich zähle voller Spannung. Sechs, sieben beladene Kamele biegen um den Felsvorsprung – also zwei sind mit ihren Lasten zum Teufel! Da nein! Noch ein Kamel und noch eins schreiten schwer[,] aber unbeladen hinter den anderen her. Das sind die erschöpften oder gestürzten Tiere. 818 Endlich bin ich unten.
Zwei der neun Kamele sind tatsächlich, als sie dem für ihre Sohlen zu scharfen Kleingeröll ausweichen wollten, gestürzt und haben sich blutige Wunden gerissen! Das Gestein ist ganz blutig. Trotzdem hatten sie Glück im Unglück. Wären sie zur Abhangseite hin gestürzt, dann wären sie gleich 50–60 m den Abhang hinabgesaust. Die gestürzten Kamele überschreiten ohne Lasten den Pass, die drei stärksten Kamele kommen und holen die liegen gebliebenen Lasten. Kamelführer Sung und zwei Speerträger bleiben zur Bewachung beim Gepäck, die anderen ziehen mit den beladenen Tieren 430
3. Unter Warlords, Räubern, Missionaren und Lamas
über den Pass, den Consten mit einigen Milizionären der Bauernwehr derweil bewacht. Unten ziehen die ersten Kamele schon wieder weiter, was ihm aber nicht recht ist. Da muss eben Kara Etzel nochmals herhalten. Nach einer halben Stunde habe ich die Karawane eingeholt, Es gibt ein heiliges Donnerwetter. Sofort wird an einer grasreichen Stelle abgeladen, werden die drei Kamele mit den zwei Kameltreibern zurückgeschickt. Ich bleibe mit dem Wassiliboy u. meinem idiotenhaften Beschützer bei den Kamelen und Sachen und vertreibe mir die Zeit damit[,] meine Tagebucheintragungen zu machen. Als Tisch dient eine niedrige Holzkiste, als Stuhl ein Wäschesack. Zur Sicherheit hat man noch einen Mann zu uns herunter geschickt. Er hockt jetzt vor mir und hält die Seiten des Tagebuchs fest, damit der Wind die Durchschreibe-Papiere nicht mit sich fortreißt. Um 6 Uhr höre 819 ich den ersten Kuckuck in Asien rufen.
Vom 6. auf den 7. Juni kann Consten in einer kleinen Station der Mission Scheut übernachten, genießt frisches Brot und selbstgebrautes Bier. Er lässt sich Einzelheiten über die Christianisierung in dem Bezirk berichten. Die belgische Missionsstation unterhält auch ein von Nonnen geleitetes Internat für Kinder getaufter Eltern. Neben der Räubergefahr ist der schlimmste Feind unter den in dem Gebiet arbeitenden Missionaren der Flecktyphus, der viele von ihnen schon dahingerafft hat. Die beiden dort tätigen Patres schenken ihm vor der Weiterreise eine kleine Porzellanvase aus einem der alten Gräber in der Umgebung. Seine Neugier ist geweckt. Die Verpflegung der inzwischen ziemlich abgemagerten Kamele hat der Missionsverwalter, ein Chinese, übernommen „weil ich zu schamlos von meinen eigenen Leuten unter Führung des Sung betrogen werde“. In dessen Begleitung zieht die Karawane in nordöstlicher Richtung immer tiefer hinein in innermongolisches Gebiet. Das einstige Weideland ist bereits stark von chinesischen Siedlungen durchsetzt. Ackerflächen breiten sich aus, wo früher Wälder waren. Consten passiert ein Dorf, in dem Chorčin-Mongolen leben und muss feststellen, dass er mit seinem Chalch-Mongolisch nicht weit kommt, die beiden Dialekte unterscheiden sich „wie Ostpreußisch und Bayerisch“. Seine Absicht, im Nachbardorf in einem Lamakloster zu übernachten, muss er aufgeben, 431
V. Die letzte Expedition 1928–1929
da es dort kein Futter für die Kamele gibt. Wenige Kilometer weiter hat er aber Glück. In den Morgenstunden des nächsten Tages nimmt er sich die Zeit, nochmals zurückzureiten, um sich den kleinen Palast des dortigen Wan (König, Stammesfürst) und das Kloster näher anzuschauen. Eifrig notiert er alles, was er sieht, auch mongolische und mandschurische Inschriften, bis die Wissbegierde des Fremden den Lamas etwas unheimlich wird. Besonders interessieren ihn wieder die Darstellungen tantrischen Inhalts. Am späteren Vormittag des 8. Juni zieht die Karawane weiter, immer noch in nordöstlicher Richtung und landet abends wieder bei belgischen Missionaren. Sie sprechen sogar Deutsch und bewirten ihn freundlich. Neben einer gotischen Kirche hat auch dieses Dorf einen Lamatempel, den sie am nächsten Morgen gemeinsam anschauen gehen. Die Nachrichten aus Hata, Constens nächster, etwa 60 Kilometer entfernten Etappe, klingen nicht gut. Dort hat es in einem Truppenteil des Generals Liu Suifeng eine Meuterei gegeben. In Sorge über seine in der Nacht vorausmarschierte Karawane macht er sich in Begleitung eines Soldaten wieder auf den Weg. Auch drei von Eseln gezogene Wagen der Mission haben sich dem Konvoi angeschlossen. 68 Obo's am Wege, gewöhnlicher Steinhaufen und auf d. Bergen. Schawan-tze R. NNO, H. 680, B. 69,3. Wir reiten wie bisher auch eine von Hügeln umgebene Talebene, in den ein aus NW kommender Geröllstrom vor Ou-la-ing-ze mündet[.] H. 670, B. 69,4; R.NO; Uhr 7.20 vorm. MaiK'ian-in-ze. Uhr 7.30. H. 670; Gebäude aus Lehm, jedes mit einer Mauer umzogen. Ecktürme. Ein besonders großes Gebäude mit hohen schattenden Bäumen hat die Tore vermauert. Die Häuser gleichen hier kleinen Forts, es wird Opium angebaut. Wo Mongolen wohnen, sieht man daran, dass dort alte Bäume wachsen, bei d. Chinesen ist alles kahl,
notiert Consten unter dem 10. Juni. Er passiert mehrere durch hohe Steinmauern geschützte Dörfer. Die Ecktürme einiger Häuser haben sogar Schießscharten. Sie reiten durch ein mächtiges ausgetrocknetes Flussbett, Wege und Felder sind versandet. Überall herrscht große Trockenheit. Schließlich kommt Hata in Sicht. Ankunft innerhalb der Stadt – wir reiten durch das erste Tor. 1 Uhr. Wir werden angehalten, die Soldaten lassen uns aber[,] als ich einfach weiter432
3. Unter Warlords, Räubern, Missionaren und Lamas
reite[,] durch. Beim 2. Tor, dicht bei der Mission, Stopp. Die Posten lassen ohne Ausweis des Kommandanten den Soldaten und die Karre nicht durch. Parlamentieren hilft nichts. Ich reite zur Mission, die Paters regeln 820 alles sofort.
Erneut erlebt Hermann Consten die Gastfreundschaft der belgischen Missionare. Die beiden Patres, Heyns und d’Hondt, sind schon seit Jahrzehnten in China, sie sprechen die Sprache fließend. In der Station ist noch ein dritter, Pater Mommaertz, der an Flecktyphus darniederliegt. Consten geht am nächsten Morgen in die Stadt. In Hata sind sämtliche Läden geschlossen, ein schlechtes Zeichen. Was ihm zusätzlich Sorgen macht, ist Kara Etzel, sein Pferd. Es ist krank, erschöpft, und Consten lässt einen chinesischen Tierarzt holen. Zwei Stunden bangt er um seinen geliebten Rappen, geht sogar in die Kirche zum Gebet; sein Pferd kommt durch. In Hata hatte Consten noch ein chiffriertes Telegramm nach Tientsin geschickt: Expedition glücklich hier eingetroffen! Habe Nachricht Jehol erhalten. Ausführlicher Bericht über Expedition Jehol abgesandt. Lage beunruhigend. Räuberunruhen stören bedeutend. Ohne Verlust durchgekommen. Gefahr gering. In Anbetracht der Umstände habe Reiseweg geändert. Beabsichtige nach Dolonnur zu marschieren. Erwarte nichts von mir zu hören, bis ich Urga erreicht habe. Bitte mich nicht zu vergessen, habe großes Heimweh nach Euch. Bitte drahten Chihfeng Tienchutang. 821 Etzel.
Mehrere Tage hält sich Consten in der Missionsstation von Hata auf. Mit Pater Heyns führt er lange Gespräche über Ausgrabungen und die wissenschaftlichen Arbeiten der flämischen Missionare, vor allem Pater Mullies. Auch hier kann er Grabfunde aus einem Fürstengrab der Kitan bestau822 nen. Ärger gibt es mit dem mitgereisten Verwalter, der plötzlich meint, Consten müsse seine Treiber besser bezahlen. Ohnehin ist er schon auf der Suche nach Mongolen, die ihn weiter begleiten sollen. Er wird das Gefühl nicht los, von seiner chinesischen Mannschaft systematisch übers Ohr gehauen zu werden. Sie kaufen weniger Futter als die Tiere benötigen, meint er, sie schachern über das abgezweigte Geld mit den Herbergswirten, mit denen sie abends Opium rauchend auf dem Kang liegen. Beunruhigt ist Consten über Meldungen, wonach es inzwischen auch bei Tientsin zu 433
V. Die letzte Expedition 1928–1929 823
Kämpfen gekommen sei. Sobald Kara Etzel wieder auf den Beinen ist, bricht er auf. Doch fühlt er sich nun plötzlich selbst nicht gut, hat Kopfschmerzen, fürchtet schon, sich mit Flecktyphus angesteckt zu haben. Auch mit seinen Kamelen scheint es nicht zum Besten zu stehen. Einige haben Druckwunden durch die Transportlasten. Am 15. Juni ist Consten wieder unterwegs, durch das innermongolische Hügelland. Bebaute Felder und Sandsteppe wechseln einander ab. Noch geht es weiter in nördlicher Richtung. Am 18. Juni kommt es in der Nähe eines Dorfes zu einem kurzen Schusswechsel zwischen den Begleitsoldaten und Chunchusen, bei einem anderen Dorf werden Constens Leute für Räuber gehalten. Auch dort fallen Schüsse, doch geht alles glimpflich ab. Es handelt sich nur um Rote Speerträger. Wenig später sieht er wieder Chunchusen, die von den bäuerlichen Selbstschutzmilizen vertrieben werden. Auch die nächsten Tage bleiben unruhig. Selbst seine Begleitsoldaten werden nervös. Im nächsten Ort, Wutancheng, entlässt er sie. Neue, die er anheuern will, verlangen 20 Silberdollar pro Kopf. Ein Verwaltungsbeamter macht ihn mit General Liu bekannt, der sich gerade im Ort aufhält. Dieser typischer Opiumraucher, dabei klug, verschlagen. Nichts militärisches! Kleidung silbergrau chines. Ich erzähle ihm wie ich hier in Wutancheng blockiert bin. Hinter mir, vor mir Banditen! Ferner dass ich morgen die Mongolen in Anspruch nehmen müsse um durchzukommen. Interessanterweise erklärt er mir plötzlich, er wolle 200 Mann vorausschicken um den Weg von Banditen zu säubern! Auch stellt er mir zum persönlichen Schutz 4 Soldaten – Ich habe mir schon das Freuen über etwas[,] was mir versprochen wird[,] abgewöhnt. Abwarten. Grosse Be824 handlung der wundgedrückten Kamele.
Die kranken Kamele werden für Consten zum ernsten Problem. Aus den Druckstellen wurden inzwischen große offene Wunden, die zu bluten und zu eitern beginnen. Er desinfiziert sie mit Chinosol. Außerdem scheint sich das Wetter zu verschlechtern. Im Windschatten der 200 Soldaten des Generals Liu zieht er ungehindert am 21. Juni bei strömendem Regen los. Einer der neuen Begleitsoldaten mit Namen Kao spricht ein bisschen Englisch, das erleichtert die Verständigung. Die Namen der Berge und der Orte, durch die sie kommen, sind jetzt mongolisch. Inzwischen wurden auch 434
3. Unter Warlords, Räubern, Missionaren und Lamas
zwei mongolische Kameltreiber engagiert, Consten verbringt die nächste Nacht bei Mongolen. Vor der Karawane weitet sich das Grasland. Sanddünen schieben sich vor. Am Ufer des Cagaan Muren, des Weißen Flusses, der hier zehn Meter breit ist, begegnet ihm eine Salzkarawane vom Doloon Nuur. Ein vertrauter Anblick aus früherer Zeit. Consten scheint etwas aufzuleben in der vertrauteren Atmosphäre, dennoch bleibt seine Stimmung insgesamt düster. Bin 11 Uhr Tapan! […] Gehe sofort in d. Jamun! Der Wan ist in Peking, sein erster Berater Tsching Tschitschiä eine prächtige Gestalt, der den Titel Sung lin führt, empfängt uns. So müssen die klugen Berater eines Dschingis, Kubelai oder Tamurlan ausgesehen haben. Er trägt eine herrliche grüne Nephritschnalle! Alles was ich wünsche[,] wird mir versprochen. Nur neue Leute kann ich nicht bekommen. Das Hotel ist überfüllt mit schmutzigen mong. Kulis. Zurück z. Jamun! Der uns an d. Kaufmann Tschang Huitang verweist, ein guter Freund des Generals Liu! Wir werden freundlich aufgenommen. […] Während die 200 Mann d. Generals Liu die Banditen i. S. angriffen, bin ich nach NO programmässig durchgeschlupft. […] Ich habe Heimweh nach d. kleinen Heimat u. Taitai und möchte wilde grimme Gedanken verscheuchen. Gedanken zum wahnsinnig werden. Tschang Huitang breitet a. d. Kang das Opiumgerät aus! Er winkt mir zu[,] mich zu ihm a. d. Kang zu legen. Dieses pechschwarze Kraut, das wie eine Träne tropfenweise aus d. Blume d. Vergessens quillt, lockt u. ruft. Vergessen auch nur für zehn Minuten. – – und schon sauge [ich] schlürfend den Rauch tief ein, während Tschang für mich die Opiumpille dreht, auf die Pfeife gesetzt hat und nun mit langer Nadel wieder u. wieder senkrecht durchlöchert. Abends gesellt sich noch 825 ein Dritter dazu! Der Befehlshaber d. mong. Soldaten d. Wan.
„Seelisch bin ich erledigt“, schreibt er in diesen schwierigen Tagen an die Frau seines Karlsruher Bundesbruders Rudolf Herrmann. Ich freue mich nicht mehr der Gefahr, habe immer nur einen Wunsch: Wenn es doch nur einmal ganz vorbei wäre! Wenn doch die Geier einmal über weltvergessener Schlucht kreisten und mir, das Lächeln Buddhas in rosigem Schimmer, 826 die brechenden Augen zum letzten Male leuchten würden.
Mit zwei mongolischen Begleitsoldaten – einer von ihnen ist blond und 435
V. Die letzte Expedition 1928–1929
helläugig wie ein Russe – bricht Consten am 24. Juni wieder auf. Diese Gegend ist von Baarin-Mongolen bewohnt. An den Hängen weiden ihre großen Pferdeherden. Im Yamen des nächsten Ortes Wangyefu erwarten ihn neue Schwierigkeiten. Man will ihn offenbar nicht weiterreisen lassen, hält ihn hin. Neue Leute will man ihm auch nicht geben. Nach stundenlangem vergeblichen Verhandeln gibt Consten zunächst auf, lässt sich im nahegelegenen Lamakloster eine Zelle zuweisen, fühlt sich dort wie ein Gefangener. Herrlicher Blick aus meiner Klosterzelle. Grüne Hügel, blaue Berge leuchtende Wolken d. S-Osts! Grüssen u. winken über d. graue Klostermauer weg. Das einzige chines. Gitterfenster, Papier beklebt zeigt scharf den Umriss des jungen Lamas der mich bedient. So vergeht der Tag in Warten und Hoffen. Glücklich bin ich durch die Banditen durchgekommen und nun soll ich von d. Behörden festgehalten werden!! Es regnet draussen in Strömen, zackiger Leuchtblitz fährt krachend zu Tal! Donner grollt rings durch die Berge und ich – – denke an Taitai! Gute Nacht! – Bin festgehalten, gefangen! – – Keinen Schritt weiter! Ich lache! Keinen 827 Schritt weiter! Ich lache! – Gute Nacht!
Dann folgt ein Katastrophentag, wie ihn Consten bisher noch nicht erlebt hat. Erst geht Kara Etzel mit dem Grauen des mongolischen Begleitsoldaten durch, die beiden Pferde stürmen zur engen Klosterhoftüre hinaus und fegen fröhlich wiehernd durch die Steppe. Mühselig müssen sie wieder eingefangen werden. Dann stellt sich heraus, dass einer der hölzernen Steigbügel Kara Etzels verloren ging. Schließlich begibt sich Consten bei leichtem Regen zu den Kamelen, die gerade bepackt werden, denn er will trotz des Malheurs in jedem Fall los. Plötzlich springen zwei Kamele mit ihren Lasten unerwartet hoch, stürzen ausrutschend krachend nieder, das eine fällt mit ausgespreizten Hinterbeinen zur Erde und reißt sich beim Sturz die Beckengelenke auseinander. Ein schwerer Schlag und noch schwererer Verlust für mich. Ich reite zum Jamun! Neue Verhandlungen. Man will mir meinen Pass herauslocken. Gibt's nicht! Um ein Uhr soll alles i. Ordnung sein. – Wir suchen nach einem Ochsenkarren um die Sachen d. verunglückten Kamels zu verladen. Kao ist unverwüstlich! Karren u. Ochsen sind bald gefun436
3. Unter Warlords, Räubern, Missionaren und Lamas
den! Aber da setzt wieder ein wolkenbruchartiger Regen[,] vermischt mit Hagel ein. Brausend stürzen d. Wasser v. d. baumlosen Bergen. In zehn Minuten ist d. Steppe ein großer See in den sich hunderte Bergbäche brausend mit gelber Flut stürzen! Mir wird bange um meine Sachen. Ich breche d. Verhandlungen im Jamun ab, reite mit Kara Etzel – dem ich d. Reservesattel aufgelegt habe – durch die gurgelnde[n] stürzende[n] Wasser! Erst will er nicht, aber er muss! – Die Leute haben die Sachen nur notdürftig auf's Trockene gelegt. Um uns tönende steigende Flut! Alles wird in Sicherheit vor d. Wassern gebracht. Bei der Untersuchung stellt sich später heraus, dass die Geschichte für den ersten Augenblick schlimmer aussah als sie tatsächlich war. Nachmittags wieder ein schweres Gewitter aus d. N. Diesmal sind die Sachen einigermaßen in Sicherheit. – Ich kehre reumütig i. meine Klosterzelle zurück, die ich morgens voller 828 Aufbruchsgedanken so stolz verließ!
Durch die erzwungene Muße bricht Constens tief verborgene Seelenqual vollends hervor. Sie wiegt wohl noch schwerer als die äußeren Schwierigkeiten. Während der kleine Lamaknabe, der zu seiner Bedienung abgestellt ist, voll kindlicher Wonne die Berge mit Constens Fernglas betrachtet, sitzt dieser in seiner Klosterzelle am Tisch und schreibt auf, was ihn bewegt. Unten i. d. Steppe bellt ein Hund, als dunkeler Scherenschnitt steht Linching in meiner Zellentür. Die Kerze a. meinem Schreibtischchen, vor d. ich mit untergeschlagenen Beinen a. d. Kang sitze, flackert leise hin u. her, tropfen heiße Tränen nieder. Warum weint die Kerze – – – Taitai! Auch mein gestürztes Kamel weinte, weil es sterben muss! – – – Und ich – – –! Denke an alles was hinter mir liegt, an heiße qualvolle Stunden, die beinah das Herz platzen ließen, an Gnadengeschenke, die unglücklicher als glücklich machten, denke an Verlorenes, an Zurückgewonnenes 829 und wieder Verlorenes und – – – weine um Dich – – –!
Nun beginnt erst recht eine sorgenreiche Zeit. Das gestürzte Kamel muss Consten seinem Schicksal überlassen. Ihm den Gnadenschuss zu geben, scheut er. Lieber gibt er jemandem etwas Geld, der es davor bewahren soll, dass es schon im Sterben von Hunden zerrissen wird. Die übrigen Kamele werden bei strömendem Regen beladen. Zwei quietschende Ochsenkarren nehmen die Kisten und Ballen auf, die auch ein kräftiges Rütteln vertragen 437
V. Die letzte Expedition 1928–1929
können. Ein mongolischer Karrenführer, ein großer starker Kerl, der Consten wie ein Landstreicher vorkommt, zieht jetzt mit. Im Yamen hatte man Consten nahegelegt, möglichst zu verschwinden. So quält sich seine angeschlagene Karawane nun durch die verschlammte Steppe in nordwestlicher Richtung weiter. Der Versuch, bei der Klostersiedlung Us Ich neue Kamele zu mieten, misslingt. Am Nachmittag des 28. Juni erreicht er schließlich den Ort Haobutu, wo er mit seiner Karawane wieder einmal die Gastfreundschaft der Scheuter Missionare in Anspruch nehmen darf. Noch ahnt er nicht, dass er hier drei Monate zubringen wird, bevor er weiterziehen kann.
4. Regennächte an den Gräbern der Liao In Haobutu ist Consten zu Gast bei Pater Louis Kerwyn. Noch am Tag der Ankunft macht er aber auch die Bekanntschaft eines anderen belgischen Missionars, Pater Louis Dupont, der die Nachbargemeinde Uniutai (mong. Onniud) betreut. Beide Patres sind ausgesprochene Originale, belesen und witzig zugleich, old China hands, genau wie Joseph Mullie und die übrigen belgischen Patres, die Consten auf seiner Reise ins Land der Mongolen bereits traf. Während Ersterer, mit seinem rotem Bart die flämische Herkunft im Gesicht tragend, der ruhigere, stillere ist, sprüht sein dunkelbärtiger Amtsbruder vor wallonischem Temperament. Wie Consten ist Pater Dupont ein passionierter Jäger, dazu hochmusikalisch und sprachbegabt, Pater Kerwyn dagegen ist eher ein Gelehrtentyp. Mit der Ankunft der Karawane zeigt sich, dass auch das zweite gestürzte Tier verletzt sein muss. Es hat Fieber und frisst nicht, Consten stellt eine faustgroße Druckwunde an seinem Körper fest. Und auch er selbst fühlt sich erschöpft. Am 1. Juli, einem Sonntag, erwacht er mit Fieber und hustet. Bronchitis. Draußen hat sich das Wetter weiter verschlechtert. Zum Regen hat auch noch Hagel eingesetzt in einer Stärke, wie ihn die beiden Patres, wie sie beteuern, bisher noch nicht erlebt haben. Während die übrigen Kamele mit zwei Treibern zur Erholung auf eine 20 Li entfernte Weide geschickt werden, ruht sich Consten erst einmal aus und ordnet seine Sachen. Dann zahlt er seinen Dolmetscher Wassili aus, der ihn schon lange ärgert, schickt ihn fort. Seit ihm Pater Heyns eine grünglasierte Vase aus einem Grabfund 438
4. Regennächte an den Gräbern der Liao
schenkte, interessiert sich Consten für die Grabanlagen der Liao aus der Kitan-Zeit. Schon beim Herritt waren ihm im Steppenboden die Umrisse einer Siedlung aufgefallen. Oberhalb Haobutus verläuft ein alter Grenzwall der Kitan, den er sich gleich am Tag nach der Ankunft näher angeschaut hat. Bei Pater Kerwyn sieht er bemalte Türfüllungen hölzerner Grabhäuser, die aus dem Hügelgrab des Kaisers Daozong (Tao Tsung; gest. 1101 n. Chr.) stammen sollen. Geographie und Geschichte des Baarin-Gebiets, „woran 830 ich so lange gearbeitet habe“, werden zu Gesprächsthemen. Sobald Consten meint, es ginge ihm etwas besser, reitet er mit Pater Dupont den Grenzwall ab, begleitet ihn heim nach Uniutai. Er macht im Steppenboden die Umrisse einer Garnison aus, findet eine zweite Verteidigungslinie und vorgelagerte Basteien, die sich als Hügel in der Landschaft abzeichnen. Die nächsten Tage verbringt er, stark fiebernd, bei Pater Dupont, er schreibt Briefe, arbeitet an seinen Aufzeichnungen, fertigt Karten der Umgebung an. Als sich sein Zustand nicht bessert, lässt er sich Wäsche und Rasierzeug nachschicken. Pater Kerwyn empfiehlt ihm, die restlichen drei, in Peking angeheuerten Leute auch zu entlassen, was Consten tut. Zwei von ihnen tauchen in Uniutai auf, drohen, ihn zu verklagen. Da seine erschöpften und kranken Kamele mindestens vier Wochen zur Erholung brauchen, versucht Consten, bei einem Mongolen neue zu kaufen. Der will ihm aber nur 40 auf einmal überlassen. So viele Kamele braucht er nicht, kann sie auch nicht bezahlen. Der Sohn eines Grundbesitzers aus Haobutu bietet ihm sechs Kamele an. Vielleicht klappt dieses Geschäft. Doch erst einmal beschäftigt ihn die alte Wehranlage in der Steppe mehr. Bei heftigem Sturm macht sich Consten wenige Tage später mit einem ortskundigen Begleiter ins Tal des Cagaan Čuluu auf. Bei einem unweit der Befestigungen gelegenen Berg soll es unter Eichen und wilden Aprikosen eine größere Grabanlage aus der Zeit der Liao-Dynastie geben. Schließlich findet er auf dem jenseitigen Hang vier Gräber. Das Hauptgrab ist geöffnet. Grabräuber hatten den Hügel von oben durchstoßen. Die Gewölbegruft ist, wie Consten bei der näheren Untersuchung feststellt, mit grauen gebrannten Ziegeln ausgemauert. Er nimmt eine genaue Vermessung vor, trägt einen Aufriss der Grabkammer in sein Notizbuch ein. Die Untersuchung der Nebenkammern hebt er sich für später auf. Über die anderen Gräber erfährt er am Abend von Pater Dupont, Chinesen hätten im vergangenen 439
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Jahr versucht, sie zu öffnen. Ein Mann sei dabei verschüttet worden, liege noch immer in dem 1000-jährigen Grab. Wieder einmal ist Consten in Haobutu. Seine Kamele sind weiterhin nicht marschfähig. Ihre Druckwunden, die sie sich immer wieder aufbeißen, wimmeln von Fliegenlarven. Er muss sie reinigen und neu verbinden. Abends entwickelt er seine Filme, verdirbt seine schönen Aufnahmen durch zu langes Wässern, ist wieder verzweifelt, hat Sehnsucht nach Tientsin. Doch schiebt sich erstmals die Erinnerung an Bad Blankenburg, an sein häusliches Glück dort, vor die Bezauberung seiner Begegnung mit der Familie Junkel in Tientsin. Zwei Monate ist Consten nun unterwegs, eigentlich müsste er chinesisches Staatsgebiet längst hinter sich gelassen haben. Nicht ahnend, dass Ethel John Lindgren inzwischen bereits in Ulaanbaatar eingetroffen ist, sitzt er fest. Immerhin, er hat eine Beschäftigung. Montag 16. Juli 28. Graböffnung! Finden Kindergrab ohne Beigaben. Urnengrab, Asche, Urne geht i. Scherben! Drittes Grab enthält kleine Schaale [sic] mit Pfeilspitzen (Nagel). Nachmittags Ochsenkarre mit Sachen[,] die ich brauche[,] aus Haobutu. Einer d. Leute aus Linsichien zurück. Meine weggejagdten [sic] Kameltreiber haben mich bei d. Mandarin in Linsichien verklagt. Behaupten ich hätte sie für 6 Monate angeworben und ihnen zu wenig Geld zur Rückreise gegeben. Verlangen Schadenersatz. Wurden abgewiesen! Sollen in Peking klagen! – Da ich wahrscheinlich eine Gegenrechnung hätte (Schadenersatz für verlegte 831 Kamele! Totes Kamel! Gestohlenes Futter! u.s.w.) –Photogr. Kindergrab!
Consten richtet sich mit seinem Zelt und seiner technischen Ausrüstung nun in der Nähe der Grabanlagen ein und beginnt systematisch zu arbeiten. Er notiert seine Funde aus den bereits geöffneten Gräbern – Münzen, Amulette, Pfeilspitzen und andere Kleinigkeiten – und bereitet für den 19. Juli die Öffnung einer großen Grabanlage vor – aus Anlass des 39. Geburtstages von Taitai, um sich, wie er notiert, durch Arbeit von seinen sehnsuchtsvollen Erinnerungen abzulenken. Doch verraten seine Notizen auch einiges über seinen Sinn für Theatralik. Nachmittags heben wir d. Centnerschweren Steine vom Gewölbe. Steige oder vielmehr lasse mich vom Seil 4 m tief hinab. Durch d. schmale Einsteigeloch fällt grade soviel Licht dass ich die Holzsplitter des Ruhelagers 440
4. Regennächte an den Gräbern der Liao
erkennen kann! Das Grab ist scheinbar leer! Wir graben vorsichtig mit d. Spaten. Finden eine[n] Schädel. Gesicht nach SW gewandt, so wie der Pien-ts'iang verläuft[,] ist auch dies Grab orientiert. NO – SW. […] Schicke d. Leute zurück. Bleibe beim offenen Grab, betrachte d. 1000 Jahre alten Schädel. Sinkender Abend. Mein Mann d. mir Decken u. etwas zum Essen und Trinken bringen soll, kommt u. kommt nicht zurück. Allerlei krumme Gedanken. – – – Wer mag d. Besitzer dieses Schädels gewesen sein? Sicherlich ein Mächtiger, der hier am Grenzwall befahl. Und jetzt – – – Jetzt scheint nach 1000 Jahren wieder die Sonne des Abendhimmels in die Gruft – beleuchtet d. Steine, die sorgsam geschichtet das Gewölbe bildeten. Wer baute die Gruft? Gefangene, Sklaven oder Soldaten? Was für Gedanken mögen durch diesen Schädel gebrausst [sic] sein? – – Auch er liebte, wollte glücklich sein, ward geboren, nahm sich ein oder mehrere Weiber und – – – starb, auch er hasste sicherlich aus tiefem Herzen, war ehrgeizig, wollte mehr leisten u. leistete mehr an Ruhm oder Erwerbssucht als die Anderen, daher auch sein grosses Grab 7 m tief unter der Oberfläche, jede Ecke, ein mächtiger Granitblock als Eckträger d. Gewölbes. Der Eingang durch schwere Steine dicht verrammelt. Überall zwischen den Steinen sorgsam Gras oder Moos gestopft, das nun wie lange rote Bärte zwischen d. Steinen vom Gewölbe hängt! – Wie starb der Mensch, dessen Grabstätte ich wie ein Schakal durchstöbere? – – Etzel tötete seinen Bruder Breda aus Herrschsucht u. um eines Weibes willen! Wer kennt die Vorgänge, die sich in diesem Schädel als Reflexerscheinungen von dem, was wir Seele nennen, abspielten, als er wusste, dass er jetzt sterben werde! Als er wusste, dass er jetzt alles hinter sich lassen musste was er erstrebt und gewollt. Dumme Gedanken – – – Was würden meine Leute sagen, wenn sie mich morgen mit gutem Blattschuss dort unten neben dem kopflosen Skelette, das jetzt noch sich kaum durch im Laufe d. Jahrhunderte darauf gefallene feine Erde vom Boden 832 abhebt, finden würden.
Als sich von zwei Seiten Gewitter über den Berg schieben, packt Consten sein Werkzeug und seine Funde samt seinen „dummen Gedanken“ in den Rucksack. Nur den Schädel lässt er einfach neben dem Grab liegen. Unter Donnergetöse steigt er im rauschenden Regen den Berg hinab. Unterwegs schießt er noch einige Nebelkrähen für den abendlichen Suppentopf und 441
V. Die letzte Expedition 1928–1929
kommt schließlich völlig durchnässt beim Zelt an. Dort kommt gerade einer der Leute von Haobutu mit dem Bettzeug, das ebenfalls völlig durchnässt ist. Also verbringt Consten die Nacht lieber in einer kleinen chinesischen Talsiedlung auf einem verwanzten Kang. Anderentags ist er bereits früh um Sechs wieder am Grab, in das er sich mit einem Strick hinunterlässt. Zu Füßen eines Skeletts findet er zwei braungelb glasierte Vasen, eine Gürtelschnalle aus Eisen, einen zweiten Schädel – und stellt fest, dass ein zweites Skelett genau über dem ersten liegt. Ein Doppelgrab? Aber für wen? Vorsichtig legen wir die Knochen bloß. Die Skelette liegen genau passend über oder vielmehr aufeinander. Fragen tauchen auf! Starb d. zweite Person freiwillig, starb sie durch Zufall gleichzeitig – – –? Beide Leichen lagen unter keinem Netzpanzer nebeneinander. Von d. kupfernen Netz833 panzer fanden wir keine Spur. Also waren sie nach d. Lage d. Skelette mit dem Gürtel dessen Eisenschnalle wir fanden[,] aufeinander gebunden. War d. zweite Person d. Lieblingsfrau, d. Lieblingssklavin oder Sklave, der Lustknabe? Sicherlich starb sie nicht durch Krankheit! Man findet in anderen Gräbern d. Hauptperson zwischen zwei anderen. Sie starben sicherlich nicht an Krankheit gleichzeitig. […] Die Skelette lagen a. d. glattgehauenen Felsen. Holzteile konnte ich darunter nicht finden. Ebensowenig unter d. Vasen, während doch ringsherum d. morschen Holz834 835 teile sogar a. d. Skeletten lagen.
In den nächsten Tagen drängen sich wieder die aktuellen Fragen in den Vordergrund, vor allem die Unsicherheit der Wege. Es kursieren Gerüchte über bewaffnete Banden und herumstreifende Bettlerscharen. Das Land ist in Aufruhr, es kommt zu Hungerrevolten. Vor allem Mehl ist knapp geworden, die reichen Händler haben am meisten zu fürchten. Uniutai ist von 160 Mann umstellt, die den Händler Hotai bedrohen und nach Mehl verlangen. Pater Dupont bietet sich als Vermittler an, vergebens. Man sammelt sich zum Angriff auf Hotais Haus. Dupont kommt kurz in die Mission zurück, nimmt seine Pistole und fordert Consten, der gerade bei ihm ist, auf, sich sein Gewehr zu schnappen und mitzukommen. Unter den Rebellen seien auch 50 Christen, aufgestachelt durch einen eben erst getauften Neuchristen. Beide eilen zu Hotais Gehöft. Ein wirrer Haufen schreiender, gestikulierender Chinesen. Mit einigen 442
4. Regennächte an den Gräbern der Liao
hastigen unerwarteten Sätzen bin ich durch die Menge. P. D. mir zur Seite, Rücken frei. P. D. fordert seine Christen auf wegzugehen, da geschossen würde. Ein christl. Chinese – d. nach meinem Gewehr greift damit ich nicht schießen soll[…], bekam einen Kinnhacken[sic], dass er hinflog. Die Mauser in d. Linken, die Parabellum in d. Rechten – und in drei Minuten war das Gehöft gesäubert[,] in fünf Minuten d. Dorf leer! – Jetzt bewilligten wir d. Bande pro Kopf 1 l Hirse, hören aber heute, dass die armen Teufel nur d. kleinsten Teil erhalten, während die Anführer, d. eigenen Grund u. Boden, Pferde u. Kühe haben, den Hauptanteil 836 einstreichen und mit d. Polizei teilen.
Die Beruhigung ist nur kurz, bald tauchen in der Nähe 400 Leute auf. In Haobutu kommt es zu Überfällen uniformierter Banditen. „Früher hätte mir dieser ganze chinesische Schwindel Freude gemacht“, notiert Consten unter dem 22. Juli, doch nun möchte er am liebsten den ganzen Kram hinschmeißen, er ist in einer „verzweifelungsvollen Stimmung“. Dennoch unternimmt er weiterhin Anstrengungen, wieder aufbrechen zu können. Hotais Sohn will versuchen, in der zwei Tagereisen entfernten Kreisstadt Linsihsien (Linxixian; Linxi) Kamele und neue Leute für Consten zu bekommen. Mit einem Teil seines Expeditionsgepäcks, das er auf Ochsenkarren verladen lässt, zieht er um von Haobutu nach Uniutai, zu Pater Dupont. Er putzt seine Gewehre, repariert seinen Sattel, näht Riemen, lässt sich einen neuen Holzsteigbügel für Kara Etzel machen. Er sortiert seine Grabfunde, trägt sie in ein Verzeichnis ein – 18 Vasen unterschiedlichen Stils hat er inzwischen, Keramikscherben und zahlreiche Münzen unterschiedlicher Provenienz. In der näheren Umgebung sind die Pocken ausgebrochen, es gibt Tote, Impfmaterial fehlt. Consten lässt die Kamele von der Weide holen, ihre Wunden sehen immer noch nicht gut aus. Er muss hart gewordenes faules Fleisch mit dem Jagdmesser wegschneiden. Sein Jod ist inzwischen ausgegangen, so desinfiziert er sie mit einem Gemisch von Pfeffer und Zucker, schließlich mit dem Tabakteer aus seiner Pfeife. Er schreibt lange Briefe nach Europa. Vergeblich wartet er auf Post aus Tientsin. Dass die Postzustellung zwischen Linxi und Hata überfallen und ausgeraubt wurde, beunruhigt ihn besonders, denn er hatte Taitai wieder Durchschriften seiner Journale geschickt. So geht auch der Juli zu Ende, ohne dass er weiß, wann er weiterziehen kann. 443
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Abb. 23: Das Zelt des Einsamen am Cagaan Čuluu, 1928
Der August beginnt mit Regen, neue Kamele sind immer noch nicht in Sicht. So lässt er die alten in der Nähe seines Zeltes weiden, um ihre Wunden besser versorgen zu können. Selbst möchte er nicht mit den Mongolen wegen neuer Kamele verhandeln, da er fürchtet, man könnte ihm den Weitermarsch nach Doloon Nuur blockieren, falls sie nicht handelseinig werden. So zieht Consten vorerst wieder hinaus zu seinem Zelt am Cagaan Čuluu, lässt von seinen Helfern, Arbeitern aus dem Dorf, drei weitere Gräber öffnen. Eines davon scheint das Hauptgrab zu sein. Denn ganz in der Nähe ragt die riesenhafte, aus dem Berg gehauene Skulptur „eines sitzenden bär837 tigen Oberpriesters“ empor. Doch erweist sich seine Annahme als Irrtum. Außer zerbrochenem Geschirr und einem Grabhaus mit unleserlichen Ahnentafeln finden sich wieder nur ein Schädel und ein paar Knochen. Zum Sonntag bleibt Consten allein beim Zelt, die christlichen Arbeiter haben ihren Ruhetag und sind heimgegangen. Sein neuer Kamelmeister mit dem Taufnamen Paul verlässt ihn erst, als Consten sein Kleinkalibergewehr mit Zielfernrohr eingeschossen hat. Den ganzen Tag hat es geregnet, immerhin leuchtet die Abendsonne kurz auf, bis neue dunkle Wolken heranrollen und die ersten Blitze zucken. Er bewundert einen doppelten Regen444
4. Regennächte an den Gräbern der Liao
bogen, die blauen Wolkenschatten über den Hängen und das letzte Rot auf den Bergspitzen, als ihn die Glocke des Leitkamels an seine Pflichten erinnert. Ich treibe d. Kamele langsam dicht z. Zelt heran. Vier große Steine sind schnell gefunden u. herangeschleppt. "Dsok! Dsok! Gleichzeitig zerre ich an d. Nasenstrick d. Kamels d.d. Glocke um d. Hals trägt! Mit Geschrei u. Schnauben kniet es d. Kopf weit vorgezerrt u. fast d. Boden berührend nieder. Schnell d. Strick um d. schweren Stein gebunden. So fertig! No. 2: sein Nasenstrick wird d. niedergeknieten Kamel um d. Hals geschlungen. Ebenfalls fertig! No. 3 muss gleichfalls niederknien. Schreit und streubt [sic] sich, dass d. Wölfe oder Banditen, wenn sie in d. Nähe sind ihre Freude haben! Endlich kniet auch das Tier und d. Nasenstrick ist um d. anderen Stein geschlungen. Sein Schlafkamerad wird ihm am Halse festgemacht! So folgt Paar auf Paar. „Allright“. Als ich aufschaue, fällt d. letzte Sonnenstrahl auf das aus d. Grabe herausgeholte 1000jährige rote Grabhaus – – Alles in Ordnung! Habe meinen ersten Rundgang ge838 macht. Neun Uhr! Lege mich angekleidet schlafen.
Drei Wachrunden macht Consten in dieser Nacht, gegen vier Uhr früh bindet er die Kamele wieder los, lässt sie weiden. Während er rauchend vor seinem Zelt sitzt, schieben sich die nächsten Regenwolken heran. Und die starre Einsamkeit lagert sich schwer um mein Zelt, liegt weit u. breit im Tal, hockt hinter jedem Felsen, lugt aus jedem geöffneten Grab nach d. einsamen Menschen im grünen Zelt. Einsam ein ganzes Leben lang!
In dieser depressiven Stimmung verbringt er die nächsten Tage. Viel arbeiten an den Grabungen kann er nicht mehr. Er streift durch die Berglandschaft am Cagaan Čuluu und hängt seinen trüben Gedanken nach. Mit seinem Gesteinshammer löst er einen faustgroßen Rauchtopas aus dem Fels, den er zu seinen „Schätzen“ legt. Er sieht tiefere Bedeutung in jedem Vogelschrei, vor allem im Krächzen des großen Kolkraben, den abzuschießen plötzlich für ihn Mord wäre. Nein, Kolk, lebe Du von mir aus ruhig weiter. Du sahest hier durch d. Täler u. über d. Höhen, viele Geschlechter Asiens kommen, ziehen u. vergehen. Leb, Du Einsamer, Du Weiser, Du Wotansvogel, dessen Artgenos445
V. Die letzte Expedition 1928–1929
se „Turul“ den Ungarn d. Weg ins ungarische Steppenland zeigte! Lebe, 839 Du Kolk-Rabe – einsam wie ich.
Bei seinen Wanderungen im Gelände stößt Consten auf große Wasserpfannen, ebenfalls aus der Kitan-Zeit, die er näher untersucht und ausmisst. Inzwischen heilen auch die Wunden der Kamele langsam ab. Aber an Aufbruch ist noch immer nicht zu denken. Denn tagtäglich ziehen Gewitterstürme über das Land. Sie lassen zwar die ausgedörrten Steppen über Nacht grün werden, aber die Wege werden unpassierbar. Gemeinsam mit Paul zieht Consten einen zweiten Wassergraben um sein Zelt, nachdem er im Inneren erste nasse Stellen fand. Er macht sein Lager sturmfest, bevor er am 9. August nach Uniutai hinabsteigt, um Kara Etzel, sein Pferd, zu holen. Pater Dupont zeigt ihm einen Brief seines Amtsbruders Daelman, aus dem hervorgeht, dass der Yamen von Linxi eine Untersuchung gegen Consten eingeleitet habe. Er wird verdächtigt, ein verkappter Sowjetsoldat zu sein, rote Propaganda zu betreiben und heimlich Karten zu zeichnen. Dass er Deutscher sei, wolle man nicht glauben. Da er sich mit seinem Dolmetscher Wassili, der ihn möglicherweise angezeigt hat, immer auf Russisch verständigte, klingt der Verdacht durchaus plausibel. Doch darum will sich Consten jetzt nicht kümmern. Er reitet mit Kara Etzel zurück und erlebt in seinem Zelt bei den Gräbern der Liao eine Reihe schwerer Regen- und Sturmnächte. Die beiden Abflussgräben reichen nicht aus, die herabstürzenden Wassermassen zu fassen. In Windeseile wird ein Graben vertieft. Alles muss wasserdicht verpackt werden, vor allem die Gewehre. Gegen Morgen bricht ein neues Unwetter los. Erst gegen Mittag des nächsten Tages springt der Wind um, und alles beruhigt sich. Doch in den Bergen hängt der Nebel, die Sonne kommt kaum durch. Trotzdem reitet Consten nach Uniutai, um sich um den Kamelkauf zu kümmern. Nachts reitet er in dichtem Nebel zurück, verirrt sich beinahe. Die nächste Sturmnacht steht ihm bevor, die Grabung hat er inzwischen ganz eingestellt. Pater Dupont kommt vorbeigeritten, um die Ergebnisse zu begutachten. Gemeinsam packen sie alles zusammen und ziehen mit den Tieren hinunter nach Uniutai. Inzwischen nähert sich bereits der August seinem Ende. Sonntag 26 Aug. 28 Habe hier gestern d. Temperatur nicht gemessen. Max u. Min zeigt heute 21, 6, 18 /Mittags 12 Uhr: 22/19/22. leicht 446
4. Regennächte an den Gräbern der Liao
bewölkt / 24, 17, 17. Regenwolken./ Wie ich gestern feststellte[,] verliess 840 ich B.Blbg. am 25 Aug. vorigen Jahres. Abends 10 Uhr, war ich am 26. in Genua, Coblenz steuerte am 27. Aug. a. d. Hafen v. Genua! Ich bin also ein Jahr heute unterwegs. Was habe ich alles in diesem Jahr erlebt! Up and down!! Down and up! Ich darf u. will heute nicht zurückschauen! Schwierigkeiten Berge hoch. Und glaubte ich mich oben, so stürzte ich ab oder stand vor neuen Gipfeln. – Das schwerste Jahr meines Lebens, seit ich i. d. Vorbereitungen für die Expedition eingetreten bin! Von meiner Frau verlassen, bei Ankunft i. Tientsin unser Geschäft i. Schwierigkeiten, Geldsorgen, politische Sorgen u.s.w. Aber auch Schönes, unendlich Schönes hab ich i. Tientsin gefunden! Taitai, Ottomesserich, Diededa, Enakind – und sonst nur menschliches Gesindel mit wenigen Ausnahmen. – Kamele erholen sich sichtlich! Wenn nur d. Wundnarben be841 haart wären!
5. Schlaraffenbriefe und andere Notizen Um Consten aufzumuntern, lädt ihn Pater Dupont ein, ihn auf einem Ritt nach Linxi zu begleiten, wo er seine Jahreseinkäufe machen wolle. Auch Consten werde dort einiges für seine Expeditionsausrüstung finden, und außerdem könne er General Liu aufsuchen, um sich für die militärische Bedeckung durch dessen 200 Soldaten zu bedanken und sich persönlich zu informieren, was es mit der Klage auf sich habe. Geschwind reitet er nach Haobutu, um sich in seine beste Kleidung zu werfen, kehrt im Vollmondschein nach Uniutai zurück. Allerdings verirren er und Kara Etzel sich im Gebirge, Consten klopft erst mitten in der Nacht an das verschlossene Tor des Missionscompounds. Dupont empfängt ihn mit einem Donnerwetter, wie er es lange nicht erlebt hat, und das Seltsame ist: Die Schimpfkanonade – eine saftige Mischung wallonischer, flämischer und chinesischer Flüche – tut ihm richtig gut. Gemeinsam reiten sie also los, es hat wieder zu regnen angefangen. In Linxi kauft Consten Säcke für die Kamele, Schnaps und Tabak für ihre Treiber, Schreibpapier und allerhand Nützliches für kleinere Reparaturen unterwegs. General Liu empfängt ihn fast schon mit militärischen Ehren. Von den Anklagepunkten ist keine Rede, dafür gibt es neue: Er habe 100 Li entfernt alte Königsgräber geöffnet und dafür Leute aus Uniutai beschäftigt, so lautet der Vorwurf. 447
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Ich konnte Liu nur antworten (P. Daelman übersetzte), dass ich zum ersten Mal gestern 100 Li von Linsihsien entfernt gewesen sei und auf chi842 nesischem Gebiet überhaupt keine Gräber geöffnet habe.
General Liu scheint mit dieser halbwahren Auskunft zufrieden gewesen zu sein. Mehrere Tage bleibt Consten mit Pater Dupont in der Missionsstation von Linxi, deren große neogotische Kirche ihm wie der Kölner Dom vorkommt. Um den 10. September sind sie zurück, und er macht sich an die Vorbereitung seines neuerlichen Aufbruchs. „Liebe gute Taitai!“ schreibt er am 15. September nach Tientsin, „wenn mir nicht das Schicksal im letzten Augenblick einen Strich durch die Rechnung macht, kann ich in vier Tagen aufbrechen.“ 843 Von nun an soll es westwärts gehen, auf Doloon Nuur und das Kloster Monzuk sumä (mong. Molcog süm) zu, das nach Constens Karten bereits jenseits der chinesischen Staatsgrenze am Rande eines großen Dünengebiets in der Nähe der Weideplätze der Dariganga-Mongolen liegen muss. In eineinhalb Monaten hofft er in Ulaanbaatar zu sein, also noch vor dem richtigen Wintereinbruch. Schon werden die Nächte recht kalt. Von Freunden im fernen Deutschland nimmt Consten schon mal vorsorglich Abschied. Seit der deftigen Schelte durch Pater Dupont scheint immerhin sein Humor ein wenig zurückgekehrt zu sein. Also beehrt er die Saalfelder Schlaraffia mit einem Brief, den er seinem Junkermeister, Dr. Arthur Müllejans (Jupp der Rheinbarde), nach Bad Blankenburg schickt. Mein vielgeliebter Jupp! Handschlag und Gruss d. fahrenden Junker Männe zuvor, der hoffet dass Ew. Hochwohlgeborenen Ritterschaft es wohlergehe wie er solches von sich nur teilweise melden kann! Myn letzter reitender Bot' soll morgen mit einer Treckkarre, wo vor zwo vierbeinige Ochsen gespannt seyen, gen Lin-si-chien reiten, er holt von dorten allerley Sach' und Tand für das Mongul, darunter viel gebranntes Wasser, Brantewyn genennet, womit die Mongol und Chinesen sich den Magen innerlich wärmen wenn sie den Brantewyn heiss geschlucket haben. Ich habe – Euer Junker Männe, neue Trampeltiere gekauft, 110 Silberdollar das Stück – sie seyn beinah so kostspielig wie manches zweibeiniges Kamel, tragen aber mehr, wenn das zweibeinige Trampeltier nit grad eine Fraue ist. –[...] Endlich hab' ich auch zuverlässige Leut gefunden, die mitziehen wullen gen Urga. Myn Weg führt von hier aus den Tä448
5. Schlaraffenbriefe und andere Notizen
lern des Zagan Tscholo gen das Hochplateau der Urmitschin-Mongol wohin Ew. fahrend Junkerlein mit syn Ross – Kara Etzel genennet reitet in die fürnehme Burg des Königs – hier Wang genennet – der Urmitschin Mongolen[,] um dort ein zu reiten und syn Vielherrlichkeit den Pantschen-Lama und syn alten Freund, den Abt aller Klöster und Einsiedeleyen – so man Eremiten nennet, – den Kambo-Lama zu begrüssen. Hoffentlich empfanget man Ew. armes dumpes Junkerlyn so wie sich gebühret und verweyset ihn nit an die Tafel der 844 Knechte, Pilger und anderes Gesindel.[...]
In diesem Stil beschreibt Consten über viele Seiten seine Route über Doloon Nuur und das alte Kloster Lama Miao, wo sich Kaiser Kangxi im Jahr 1691 mit Zanabazar, dem ersten der mongolischen Jebtsundampa Chutagts traf, zum Fluss Kerulen (mong. Cherlen). Seinem Schlaraffenfreund verrät „Junker Männe“ außerdem, was er in dem Kloster Molcog süm, das völlig abseits der üblichen Karawanenwege liegt, eigentlich will. Den Kloster-Abt, den frummen Mann, will ich eyniges fragen undt ihm antworten, von wannen und woher Ew. Gnaden fahrend Junkerlyn kummet sind: Ihm bringen Botschaft von synem geistlichen Pabst Pantschen-Lama.
Consten möchte also, wenn man diese Andeutung richtig versteht, dem dortigen Abt als Geheimkurier eine Botschaft des IX. Panchen Lama, Thub845 ten Chökyi Nyima überbringen. Seit er nämlich davon gehört hat, dass der Panchen Lama, der sich schon seit Jahren im Exil in der Mandschurei befindet und sich hauptsächlich in Mukden oder in den Lamaklöstern der Inneren Mongolei aufhält, demnächst die Klöster der Ujumqin (bei Consten: Urmitschin; mong. Üzemčin) besuchen werde, regt sich sein politischer Nerv. Er sieht für sich in der Mongolei wieder eine Aufgabe, wie einst 1911/12. Denn er hat erfahren, dass der hohe Besuch mit der angeblich aufgefundenen Wiedergeburt des 1924 verstorbenen VIII. Jebtsundampa Chutagt zusammenhänge. Der Junge werde dort irgendwo versteckt gehalten, heißt es. Dies ist insofern eine hochpolitische Angelegenheit, als die Äußere Mongolei nach dem Tod ihres letzten geistlichen Oberhaupts eine sozialistische Volksrepublik geworden ist und die dortige Regierung auf Drängen der Komintern die Suche nach einer Wiedergeburt ausdrücklich untersagt hat. Allerdings regte sich Widerstand gegen den Traditionsbruch bei der 449
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Bevölkerung, vor allem natürlich beim lamaistischen Klerus selbst. So wurde insgeheim in der Inneren Mongolei, also auf chinesischem Staatsgebiet, nach einer Wiedergeburt gesucht. In Xi Ujumqin Wangfu, der Residenz des Fürsten (chin. wang; mong. van) dieses mongolischen Stammes, soll in Anwesenheit des Panchen Lama eine Versammlung der innermongolischen Fürsten stattfinden, bei der es u.a. um dieses Thema gehen soll. Während sich die Konföderation von 18 innermongolischen Fürstentümern für den Verbleib im chinesischen Staatsverband ausgesprochen hat, geht es unter anderem auch darum, einige der hohen Lamas der Volksrepublik, die zunehmend unter politischer Repression durch die Mongolische Revolutionäre Volkspartei und die Komintern zu leiden haben, für die Unterstützung 846 der innermongolischen Fürsten zu gewinnen. Um jeden Preis möchte Consten eine Rolle in dem spannungsreichen politischen Spiel übernehmen, das sich Ende der zwanziger Jahre zwischen der Inneren und der Äußeren Mongolei abspielt. Doch er hat große Schwierigkeiten, militärischen Geleitschutz für die Weiterreise zu bekommen, da alle Soldaten für den Empfang des hohen Besuchs abgestellt sind. Entgegen ausdrücklichen Warnungen, die Hauptstadt der Ujumqin während der Anwesenheit des Panchen Lama mit seiner Karawane zu passieren, hat er für sich eine Route ausgearbeitet, die ihm die Chance zur Kontaktnahme mit dem zweithöchsten lamaistischen Würdenträger nach dem Dalai Lama und seiner Entourage ermöglichen soll. Er macht sich nicht nur in unbekanntes Gebiet auf, das auf seinen russischen Generalstabskarten nur als weißer Fleck eingezeichnet ist, er geht auch ein hohes politisches Risiko ein, riskiert seine Verhaftung. Unter dem 20. September notiert er in sein Tagebuch: Schrieb gestern bis tief in d. Nacht Briefe: Reichskanzler Dr. Luther, Staatssekretär a.D. Müller, Taitai, Müllejans, Mie The', Pater Daelman, General Liu, da heute ein Bote reiten sollte. Geht erst morgen ab, da sein Pferd durchgebrannt. – Soeben sind die Begleitsoldaten für Urmitšin eingetroffen. Habe die Verträge mit d. Tischlermeister Pu, dem Grundbesitzer Suen, und dem Arbeiter T'ang unterzeichnet. Morgen gehen d. Kamele nach Haobutu[,] um die dort zurückgelassenen Kisten zu holen. Es 847 wird wieder ernst, ich muss weiter ziehen.
Nach beinahe dreimonatiger Zwangspause bricht Hermann Consten am 22. 450
5. Schlaraffenbriefe und andere Notizen
September von Haobutu auf. Er verabschiedet sich von Pater Kerwyn und Pater Dupont in großer Herzlichkeit. Einen Teil seiner Expeditionsausrüstung stellt er in Uniutai unter, da er seine Kamele entlasten will und die neuen Treiber noch recht unerfahren sind. Pater Kerwyn hatte ihm noch 260 US-Dollar in chinesische Silberdollar umgetauscht. Die Morgentemperaturen bewegen sich bereits nahe am Gefrierpunkt, am dritten Tag gerät die Karawane in stürmische Graupelschauer. Am 26. September verlässt er Uniutai, nicht ohne vorher in der Missionskirche noch für eine glückliche Reise gebetet zu haben. Während seiner Aufenthalte bei den belgischen Missionaren ist Consten ein eifriger Kirchgänger geworden. Die Tagebücher geben aber keinerlei Aufschluss darüber, ob er irgendwann auch zur Beichte gegangen ist. Schon am ersten Reisetag stürzt eines der Kamele unter seiner schweren Last. Den Sturz eines zweiten kann er mit knapper Not verhindern, indem er in Windeseile die Lasten herunterreißt. Der Weg ist schlecht. Zwei weitere Kamele wollen sich legen. Consten ist wieder in Not. Das erste Lager errichtet er noch vor der Weidegrenze der Ujumqin-Mongolen. Es wird eine stürmische und unruhige Nacht. Der neue Aufbruch fängt gut an. In der Hauptstadt der Ujumqin versucht Consten gemeinsam mit Pater Dupont, der ihm nachgeritten ist, noch einmal General Liu zu sprechen und zu schauen, ob er nicht doch noch andere Kamele bekommen kann. Die Vorbereitungen für das große religiöse und politische Ereignis sind in vollem Gange. Vor dem Palast des Wan wurden 50 weiße Jurten für den Panchen Lama und sein Gefolge aufgestellt. Consten hofft, die Ankunft miterleben zu können. Doch im Yamen gibt man sich zugeknöpft. Kamele gibt es nicht! Morgen müssen wir weiter! Ich zeige meinen chines. grossen Pass. Man tut als könnte man kein Chinesisch lesen. Nun 848 zeige ich d. mong. Pässe. Hilft alles nicht! Man will uns nicht nach Chalcha lassen. Der Weg sei gefährlich u.s.w. Schließlich setzen P[ater] D[upont] u. ich d. Durchreise durch! Abends meutern meine Leute. Nun wird P.D. – d. sein Gesicht verliert – fuchsteufelswild. Er schimpft chines. wie man nur Chinesisch schimpfen kann. Jeden Satz schliesst er mit „Hottverdorisch!“ [fläm. Gottverdammt; D.G.]. Er ist halbkrank vor Aufregung. Bekommt aber d. Leute klein! Schlimme Nacht! Wir liegen und sitzen bis Mitternacht um d. Holzfeuer der Jurte, futtern Ham[m]el. Ver451
V. Die letzte Expedition 1928–1929
gebens habe ich mich auf meine Freundschaft mit Kambo Lama berufen. Alles half nicht und spätestens übermorgen trifft er mit dem Pantschen ein. Die Leute wollen[,] da der Wang nicht zu Hause und mit den Soldaten dem Pantschen entgegengezogen ist[,] die Verantwortung nicht tra849 gen!
Bis zur Chalch-Grenze hat Consten noch 300 Li (ca. 250 km) vor sich. Überall sind die Wintervorbereitungen der Nomaden bereits in vollem Gange. Kräftig gebaute Frauen walken „im Rhythmus aktiver Liebe“ (Zitat Consten) Schafwolle zu langen Filzbahnen, mit denen die Jurten von innen gegen den eisigen Wind abgedichtet werden. Noch immer lagert Consten in der Nähe des Ortes, neugierige Lamas in festlichen Gewändern kommen zu seiner Jurte. Einer von ihnen spricht ein wenig Russisch, und Consten unternimmt einen erneuten Versuch, mit seiner Hilfe doch noch an Kamele zu kommen. Das klappt nicht, doch bietet der Mönch sich an, ihn bis zur Grenze zu begleiten. Überschreiten will er sie aber nicht. Er hat Angst. Bei leichtem Schneetreiben ziehen sie Anfang Oktober gemeinsam los. Von seinem Lagerplatz lässt Consten noch einen jungen schwarzen Hund mitgehen. Er nennt ihn Bars, Tiger. Bis Ulaanbaatar wird Bars der Hund nun nicht mehr von seiner Seite weichen.
6. Verhaftung und Verhöre an der Grenze Consten erlebt mit seiner Karawane einen frühen Wintereinbruch mit eisigen Schneestürmen. Er kommt nur langsam voran und muss feststellen, dass seine Karten nicht stimmen. Wo er auf ein Durstgebiet gefasst war, fand er verhältnismäßig viel, wenn auch teilweise salziges Wasser. Auch am nächsten Ort, Baruun Hotchit wangfu, will man ihn im Yamen zurückschicken, fordert ihn auf, eine andere Route zu wählen. Auch hier ist der Wang nicht zu sprechen, da er am Treffen mit dem Panchen Lama teilnimmt. „Schließlich muss ich mir den Weg nach Nordwesten mit der Pistole erzwingen“, notiert Consten unter dem 9. Oktober. Sein Russisch sprechender Lama verlässt ihn hier. Hinter dem kleinen Kloster Dalajt süm, wo er die Nacht im Speiseraum der Mönche verbringt, wird die Gegend immer einsamer. Mit seinen neun Kamelen, dem Hund, drei Chinesen, zwei Mongolen (der eine, ein bärtiger Abaga-Mongole, hatte tags zuvor im Zustand der Trunkenheit Constens Teetopf zerbrochen und musste zur Strafe auf 452
6. Verhaftung und Verhöre an der Grenze
seinem Grauschimmel mitreiten), dem schwarzen (seinem Rappen) und dem weißen Etzel (Consten selbst) ziehen „wir als schwarze bewegliche, langsam ihren Platz verschiebende Punkte“ durch die Steppenödnis auf die Chalch-Grenze zu. Noch eine Nacht verbringt er in Da Lam süm, einem Kloster, dessen neuerrichteter Tempel gerade von chinesischen Künstlern neu ausgemalt wird. Mit dem dortigen Abt unterhält er sich über Grünwedels „Mythologie des Buddhismus“, zeigt ihm sein eigenes Werk, die „Weideplätze“, spricht mit ihm über gemeinsame Bekannte, wie den 1923 verstorbenen Žalchanc Gegeen und über Diluv Chutagt, der eigentlich zu dem Treffen mit dem Panchen Lama erwartet worden war, aber – wie er nun erfährt – vom In850 nenministerium in Ulaanbaatar keine Reisegenehmigung erhalten hatte. Da er selbst auf seine eigenen Karten nicht mehr bauen kann und unterwegs schon mehrmals falsche Auskünfte erhalten hat, lässt sich Consten den besten Weg zum Molcog süm noch einmal genau beschreiben, notiert süm und chijd (Klöster, Einsiedeleien), chudag (Brunnen), chužir (Salzpfannen), ajl (kleine Jurtengemeinschaften). In Mantu süm, einem malerisch auf dem Steilufer des Mantu gol gelegenen Kloster, schlägt er in der Nähe einer chinesischen Handelskarawane sein Lager auf, lässt sich den Tempel zeigen, notiert und fotografiert die religiösen Schätze. Nach ein paar warmen Tagen setzt nun wieder grimmige Kälte ein. Consten übernachtet in der Jurte eines reichen mongolischen Mannes aus dem Stamme der Abaga, dessen Rang durch eine blaue Glaskugel auf der Spitze seiner Kopfbedeckung deutlich wird. „Unser Lama scheint sehr vertraut mit der Hausfrau zu sein“, bemerkt er abends in seinem Journal und knüpft daran einige lose Betrachtungen über Sinn und Unsinn des Zölibats im buddhistischen Mönchstum und die Rolle der Wanderlamas bei der Durchseuchung der Mongolei mit Syphilis. Nachts heulen bei Schneesturm die Wölfe um das Lager. Wieder ergreift ihn der Katzenjammer. Er denkt an Taitai und dass es nunmehr ein Jahr her ist, seit er ihr in Tientsin erstmals begegnete. Er lässt dieses Jahr Revue passieren, die Bilanz ist negativ: „Kummer, Leid, Sorge und ein ganzes Maßvoll der Demü851 tigungen. Weiter nichts!“ Einzig Taitai machte es für ihn lebenswert. In der Nacht träumt er, der Panchen Lama und der Kambo Lama hätten ihn aufgefordert, seine Reise fortzusetzen. Also zieht er mit seinen Kamelen 453
V. Die letzte Expedition 1928–1929
durch hügeliges Steppengelände in nordwestlicher Richtung weiter auf die Grenze zu. Um uns d. weite einsame Steppe. Ich suche den Brunnen Elesu-huduk, da d. Tiere seit zwei Tagen nicht getränkt wurden, den wir 12.20 Uhr erreichen. Photo. 12.45 Uhr R N weiter. Um uns Hügel. Hügelhöhe 1320. B 64.2. Im S. am Horizont Dürböten-ol, davor liegen die Hotschir ol. Um ein Uhr Jurten. Abaga-Mongolen. Photo. Äusserst freundlich, haben aber Angst, mich zur Daringanga-Chalcha-Grenze zu begleiten. Ich verstehe die Angst nicht! – H 1330. B 64,3. Wind NW. Sonne. Photo, Uhr 1.30. weiter! Ein Mann begleitet uns. R. WN.W. Sein Herr bittet [-] er kommt uns nachgeritten – mich, dafür zu sorgen, dass er zurück kann u. ihm kein Leid geschieht. Ich verspreche es. Was soll nur d. Angst! Zwei Uhr: i. W. am Horizont Tschili-bogdo-ol, davorliegend die Hügelketten des Hurätétologoi / 2.10 Uhr vor uns i. NW. glänzend wie ein See das Zaidem-Becken [mong. für Salzsumpf]. Zur Rechten sehen wir Ihen-Elesu und im W als blauer Gebirgszug Daringen [Dariganga] bogdo-ol. Um 3 Uhr erreichen wir d. Zaidem Chutschir-Becken. Eine Chudsir-Fläsche[,] die i. d. R von S – NW – W sich erstreckt, wir weiter n. W. H 1270 B 64.4 ½ / Im S.W. am Horizont Ondür ol, eine Hügelkette, d. i. d. R O – W verläuft. / Wir kreuzen 3.15 Uhr wieder den Bandita-gegen [Bandida Gegen] Weg u. ziehen gen W./ 3.30 Uhr überschreiten wir die Grenze Dariganga – Chalcha und erreichen 4.20 Uhr den Urton und Militärposten Hogun 852 Dschaktan H 1260 B 65 – – – und werden angehalten – – gefangen – –
Nun erkennt auch Consten die Gefahr, in die er sich, seine Begleiter und seine Karawane gebracht hat. Entlang des gesamten ostmongolischen Grenzabschnitts ist Alarm ausgelöst. Nachts patrouilliert ein mit Maschinengewehr bewaffneter Posten um seine Jurte. Am Tag nach ihrer Verhaftung werden die illegalen Grenzgänger von einer mongolischen Militäreskorte in Richtung des weiter nordwestlich gelegenen Klosters Monzuk sumä (Molcog sūm) abgeführt. Noch hofft Consten, dort Briefe und Anweisungen vorzufinden, die ihm die Weiterreise ermöglichen. In fehlerhaftem Englisch notiert er Telegramme an Curt Alinge in Ulaanbaatar und an das Deutsche 853 Generalkonsulat in Tientsin, bittet den Grenzposten um Weiterleitung. Unterwegs registriert und notiert er Orientierungspunkte in der Landschaft. 454
6. Verhaftung und Verhöre an der Grenze
In der Nacht zum 21. Oktober passiert die Gruppe das Kloster, das er in seiner Vorstellung bereits zu seinem ganz persönlichen „Tempel des Lebens“, d.h. zu dem Ort hochstilisiert hatte, an dem sich sein Schicksal entscheiden werde. Consten erkennt noch, dass Lamas gelaufen kommen, aber seine Eskorte zieht achtlos vorbei, trifft morgens um halb sechs in der kleinen Jurtensiedlung Narim Buluk (Narijn Bulag) ein, wo man ihn im Yamen einem ersten Verhör unterzieht. Während Kara Etzel und die Kamele auf eine Weide getrieben werden, hat man für Consten in der Nähe der Dienstbaracke eine Jurte aufgestellt, wo er erst einmal schlafen kann. Wenige Stunden später das nächste scharfe Verhör durch einen jungen Kommissar, Luvsan Navaan. Von Briefen oder Anweisungen Consten betreffend ist nichts bekannt, auch seine Telegramme hat man nicht abgeschickt. Da er keine gültigen Einreisepapiere vorweisen kann, steht er automatisch im Verdacht, ein ausländischer Spion zu sein. „Bin auf alles gefasst“, notiert er unter dem 22. Oktober in seine kleine schwarze Kladde. „Vorbereitet Co854 cain. Ruhig, Verhör, Verhandlung.“ Einziger Lichtblick in der verfahrenen Situation sind einige Russen, die als Aufkäufer und Händler in der nahen Grenzsiedlung leben, sowie der Dolmetscher Baldanov, ein Burjate. Der eine Russe mit Namen Abraham Rabinovič lädt Consten zum Abendessen ein. Er war während des Ersten Weltkriegs in deutscher Kriegsgefangenschaft in Gommersheim gewesen. Nun lebt er als Leiter einer Filiale der Mongolischen Zentralkooperative (Moncencop) in Narijn Bulag mit seiner Frau und Söhnchen Žurka. Der Jüngere der Gruppe, Salomon Gorodeckij, bietet in einer zum Laden umfunktionierten Jurte sowjetische Konsumgüter für die Nomaden an – gute und preiswerte Ware, wie Consten bei einem ersten Ladenbesuch feststellt. Dann gibt es noch den Buchhalter Konstantin Kočetov und den Chauffeur Semin, der das Auto der Russen fährt. Sie alle sind überzeugte Sowjetbürger, haben auf der Seite der Bol’ševiki am Bürgerkrieg teilgenommen, sind aber, wie Consten ins Tagebuch notiert, „gute, ehrliche Menschen“. So vergehen die ersten Tage seines unfreiwilligen Aufenthaltes in einer zugigen Jurte im Niemandsland zwischen Verhören und zaghaften Versuchen, trotz aller Widrigkeiten die Weiterreise in die Wege zu leiten. Doch Constens chinesische Begleiter streiken, sie wollen um jeden Preis zurück über die Grenze nach China, beklagen sich im Yamen von Narijn Bulag bit455
V. Die letzte Expedition 1928–1929
ter über den Deutschen, der sie mit vorgehaltener Waffe zum Mitkommen gezwungen habe. Während Consten weiter auf Antwort aus Ulaanbaatar wartet, schreibt er noch einen Brief an Volksbildungsminister Erdene Batchaan, in dem er seine Lage schildert und um ein ministerielles Machtwort bittet. Sein Tagebuch führt Consten nur noch heimlich weiter, damit man es ihm nicht beschlagnahmt. Ihn überkommt wieder heftiges Heimweh, diesmal nach Emma. Mittwoch 31. [Oktober]. Noch immer keine Erlaubnis aus Ulan Batre. Was soll werden! – Heimweh! Entsetzliches Heimweh u. draussen heult der Sturm! Ich bin krank! Denke unendlich viel an Emmele! Warum? Warum? Jetzt schon 1 J[ahr] 8 M[onate] seit sie mich verlassen! Die Zeit flieht! Warum das alles! u. ich i. d. Mongolei! Warum? – 6 Uhr. Und wie855 der ein Tag vorbei und wieder kommt eine Nacht – – – ! Jeder Pferdegalopp lässt mich auffahren! […] Donnerstag 1. November 1 Uhr Mittag Schneesturm. Ich liege i. meiner dunklen Jurte u. friere. […] ½ 6 Uhr Sturm lässt etwas nach. Schneewehen zwischen den Lasten. Jurten als Schneehäuser. Werde nicht klug! Wahrscheinlich direkt nach Urga – Es ist so kalt i.d. Jurte dass die Kerze nach Innen brennt. ½ 7 Uhr. Um d. Jurte heult u. bellt Bars d. Hund. K. E. ist draussen b. d. Heerde. Armer Kerl! Freitag 2.Nov.28 Immer noch keine Nachrichten aus Ulan Batre. Was soll das bedeuten. Welche Intrigen. Kalt! Wind! […]
Consten gibt ein weiteres Telegramm an Erdene Batchaan auf, nicht ahnend, dass dieser und nicht er das Opfer politischer Intrigen geworden ist, dass der Volksbildungsminister auf dem gerade stattfindenden VII. Parteitag der MRVP zur Zielscheibe scharfer ideologischer Kritik wurde, dass er 856 dabei ist, sein Regierungsamt zu verlieren. Consten selbst kämpft derweil gegen die zunehmende Kälte, indem er die Expeditionskisten rund um seine Jurte stapelt und die Löcher in der Jurtenwand mit Filzstücken zu stopfen versucht. Er kämpft gegen die wachsende Angst seiner chinesischen Karawanenleute und gegen sein eigenes Heimweh nach Bad Blankenburg und Saalfeld. Erstmals klingt in seinen Grübeleien so etwas wie Reue über eigenes Fehlverhalten durch. Warum ich nur soviel an E. denken muss!! Immer wieder rechne ich die 456
6. Verhaftung und Verhöre an der Grenze
Deutsche Zeit! Denke was d. Leutchen d. ich liebgewonnen, machen. Und wieder verging ein Tag und wieder kommt die Nacht. Und immer noch keine Entscheidung. […] Die Löcher im alten Filz glühten mich d. ganzen Tag an! Blankenburger Bilder tauchen auf. Jupp, Schmelzer, der Doktoren-Tisch, Bietler u.s.w., Strölinchen, Gebhardt, meine Wohnung, mein Heim[,] u. ich bin hier gefangen. K. E. der arme Kerl draussen beim Ta857 bun. Kamele dick[,] rund[,] fett. Mein Petrol[eum] wird langsam alle, was dann werden soll[,] weiss ich nicht. Aber eines weiss ich: man soll nie – wenn zwei Menschen sich einst alles waren, durch Gewohnheit stumpf wurden, bei Unstimmigkeiten schlafen gehen[,] ohne dass eines d. anderen ein liebes Wort sagt. Die menschl. Zunge ist stets zum Bösen, 858 selten zum Guten geneigt.
Vom Grenzkommandanten erfährt Consten, auf Anordnung der Polizei für Innere Sicherheit werde er bis zur endgültigen Entscheidung des Ministerrats in Ulaanbaatar, was mit ihm zu geschehen habe, weiter an der Grenze festgehalten. Immerhin stellen die Soldaten für ihn in der Nähe der Russen eine andere Jurte auf. Sie ist geräumiger und lässt sich beheizen. Argal, getrockneten Mist als Heizmaterial, sollen seine Leute allerdings selbst in der Steppe suchen, oder er muss es kaufen. Die Russen helfen ihm, und erstmals fühlt er sich in seiner warmen Jurte einigermaßen wohl. Sambuu, ein Nomadenjunge, soll bei ihm nun täglich einheizen und für ihn kochen. Consten verbringt die Tage des Wartens mit Wäsche waschen, Gewehrputzen und gelegentlichen Besuchen bei den Russen. Er macht sich ernste Sorgen um sein Pferd Kara Etzel, dem es schlecht auf seiner Weide geht. Die Auseinandersetzungen mit den chinesischen Karawanenleuten nehmen mit jedem Tag an Schärfe zu. Nachts kramt er schlaflos in seinen Kisten, versucht in den mitgebrachten Büchern zu lesen und grübelt über seine vertrackte Lage nach. Und immer wieder kreisen seine Gedanken um Emma, die verlorene Liebe, und um das heitere abendliche Beisammensein der Saalfelder Schlaraffen. Am 18. November wird Consten noch mal zum Yamen einbestellt, man interessiert sich genauer für seine Ausrüstung, vor allem für Waffen und Munition, seine Messgeräte und Fotoapparate. Beschlagnahmt wird aber nichts. Man behandelt ihn durchaus mit Respekt. Schließlich gibt man seinen chinesischen Leuten den Laufpass. Consten muss sie auszahlen und 457
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Abb. 24: Constens „Gefängnisjurte“, mit Expeditionsgepäck, bewacht von Bars, dem Hund, 1929
ziehen lassen. Er hält es für Wahnsinn, dass sie bei Schnee und Eiseskälte zurückkehren wollen nach China. Die Russen bestätigen ihm in einer eidesstattlichen Erklärung, dass die Chinesen aus freien Stücken und in eigener 859 Verantwortung gegangen sind. Consten schreibt an Pater Dupont und bittet, ihm Bescheid zu geben, sobald die Drei gesund zurückgekehrt sind. Er selbst aber sitzt weiterhin fest, für unbestimmte Zeit. Abends betrinkt er sich bei den Russen. Immerhin hat er in Kočetov einen Schachpartner gefunden. Und der Burjate Baldanov erweist sich als ein zunehmend interessanter Zeitgenosse, der sich für afrikanische Zwergvölker interessiert, in Asien gut Bescheid weiß, der von der Taiga erzählt, Tibetisch lesen und schreiben kann – er hat die Sprache bei Agvan Doržiev, dem einstigen Chefdiplomaten des Dalai Lama, studiert, dem auch Consten einst begegnete. Sogar mit Kommissar Luvsan Navaan, den er anfangs für „verschlagen“ hielt, hat sich Consten inzwischen angefreundet. Er schenkt ihm ein chinesisches Schnapskännchen, dafür wird er von ihm mit Argal zum Heizen versorgt. Und schließlich taucht noch Dr. Gončig, ein mongolischer Arzt, auf, der auch, wie er sagt, einige Zeit in Deutschland verbrachte. Er ist zur Bekämpfung der Syphilis in der Region eingesetzt. In den Nächten 458
6. Verhaftung und Verhöre an der Grenze
suchen Consten gelegentlich Träume heim, deren Sinn er zu deuten sucht. „Sah im Traum ein Logengebäude“, notiert er unter dem 24. November. Dort habe er mit Mühe die Aufschrift entziffern können: Jeder muss für die Folgen seiner Handlungen aufkommen. „Gilt das mir??“ fragt er sich. Doch vertieft er den Gedanken nicht und vermeidet die Antwort. Ausgiebiger beschäftigt ihn, dass er endlich Kara Etzel auf die Weide der Russen geben und sich persönlich darum kümmern kann, dass sein abgemagertes Pferd wieder zu Kräften kommt. Der November endet in eisigen Stürmen, ohne dass irgendeine Nachricht aus Ulaanbaatar eingetroffen ist. Erst Anfang Dezember erfährt er Neues aus der Hauptstadt. Höre heute dass in Urga Ministerrat gewesen sein soll, wo auch meine Sache verhandelt wurde. So erzählt ein Soldat, der von Urga gekommen ist, er habe aber das Resultat nicht erfahren! (??) Die Leute wissen mehr 860 als sie mir sagen wollen! Warum?!
Immerhin scheint in Constens Angelegenheit allmählich Bewegung zu kommen. Er schwankt zwischen Hoffnung und Misstrauen. Die Russen raten ihm, in jedem Fall vorerst zu bleiben, da ein Aufbruch nach Ulaanbaatar mitten im Winter für ihn den sicheren Tod bedeuten würde. Die verschneiten Wege seien gefährlich und teilweise selbst für Mongolen nicht zu erkennen. In den Nächten heulen die Wölfe mit dem Schneesturm um die Wette, als würden sie die Warnung unterstreichen wollen. So muss Consten seine innere Ungeduld zähmen und sich anderweitig die Zeit vertreiben. Schöner Wintermorgen. Gehe mit Bars zu Kara Etzel. Der kommt nicht. Nach Hause. Bars bleibt beim Hammelschlachten. Backe seine Keks! Sambuu hilft. Dann Plaudern mit Baldanow. Der weiss mehr als er sagt! D. Jurte voller Fett u. Argalrauch vom Backen! Schöner klarer Wintertag! Rasendes Heimweh! Heute geht die Sonne 4.15 unter! Wir haben jetzt in 861 Deutschland Blbg u. Saalfeld ¼ 9. Und heute sippen sie. Ob sie an mich denken! Wenn sie das Lied des Fahrenden singen! Jupp sing! Die Sache ist brenzlich „Wir fahren gen …!“ Heimweh nach Menschen die ich liebgewonnen. Nachts quälen mich schwere Träume! – Um 4 Uhr ruft mich Baldanow. Wir unterhalten uns über Tibet, Ethnographe, wissbegierig. Schade um den Mann. Er schreibt gut tibetisch! Um sechs Uhr in meiner Jurte, Feuer anzünden! Habe getrocknetes Schwarzbrod von Baldanow 459
V. Die letzte Expedition 1928–1929 862
erhalten (Suchari). Ich lese! Hohe Jagd! Die Nacht ist längst hereingebrochen. Myriaden glitzernde Sterne funkeln vom Himmel herab über Narim Buluk. Ruhe, unheimliche Steppenruhe! Ich sitze in der Jurte, das Eisenblechöfchen glüht, gibt Wärme. Bars liegt auf dem Zeltteppich, der als Türvorhang gegen die durchdringende Kälte dient und schnauft wonniglich! Hat er sich doch beim Hammelschlachten fett gefressen. Jetzt fährt er wütend aus seinem Versteck! Wütendes Kläffen, andere Hunde fallen ein. Kamele schreien! Wildes Gebell schallt durch die Nacht. Wölfe!! Allmählich erstirbt das Heulen und Gekläff. Bars trabt knurrend über den hartgefrorenen Boden, legt sich auf seinen Teppich vor der Tür. Immer noch wütend knurrend und wimmernd. Das Kamelgeschrei verstummt! Stille Nacht liegt weit und breit über die finstere verschneite 863 Steppe[sic], die mir als Gefängnis dient. […]
Endlich am 12. Dezember die erlösende Nachricht. Der Grenzkommandant eröffnet Consten, „dass ich frei sei und als Gast der mongolischen Regie864 rung in Ulan Batre willkommen sei.“ Gemeinsam mit den Russen feiert er die gute Nachricht bei Wurst, Hering, rotem Kaviar und reichlich Schnaps. Selbst Bars der Hund bekommt zur Feier des Tages eine Extraportion gekochten Schafsmagen. Die Freunde schenken ihm val’niki, sibirische Filzstiefel, für die Weiterreise. Mit den Mongolen geht er auf Hasenjagd. Er hat wieder Lust zu fotografieren, macht Aufnahmen von seiner verschneiten Jurte, von Baldanov und Kommissar Luvsan Navaan, in dessen Dienstjurte statt des buddhistischen Hausaltars ein gewebter Gobelin mit dem Porträt Lenins die Andachtsecke schmückt. Längst sind die Zeichen der neuen Zeit bis in den letzten Winkel des Nomadenlandes vorgedrungen. Schon nach wenigen Tagen weicht Constens Zuversicht wieder der Verzweiflung, da angesichts der winterlichen Wetterverhältnisse an einen baldigen Aufbruch nicht zu denken ist. Auch geht es seinen Kamelen schlecht. „Ob man wohl in Deutschland an mich denkt?“ sinniert er am Tag 865 vor dem Heiligen Abend. „In Tientsin sicherlich nicht!“ Seit Monaten hat er nichts mehr von der Familie Junkel gehört. Nur noch selten denkt er an Taitai und ihre Kinder. Am Weihnachtstag isst er das Gebäck, das ihm Grete Strölin noch nach China geschickt hatte. Er fragt sich, ob sie wohl noch in seiner Wohnung in Bad Blankenburg lebt. Auch von ihr hat er seit Monaten keine Nachricht. Dafür setzt er sich hin und schreibt ihr einen 460
6. Verhaftung und Verhöre an der Grenze
Abb. 25: Selbdritt mit Lenin: Grenzkommissar Luvsan Navaan und sein burjatischer Schreiber Baldanov, 1929
langen Brief. Seine Weihnachtsgedanken aber wandern zu einer anderen Frau. Zünde 4 Kerzen und die Lampe an! So Weihnachten! Gedanken, Erinne866 rungen. Emmy. Arbeite bis ½ 2 Uhr nachts. […] Eisige Kälte.
Am Tag nach Weihnachten beginnt er seine Sachen zu ordnen und neu zu packen, misst wieder täglich die Temperaturen. Noch zeigt das Thermometer -30°, doch wird es langsam wärmer. Die eisige Neujahrsnacht verbringt er mit Abraham und Salomon. Es war ein gar eigentümliches Gefühl als ich in der Neujahrsnacht unter der im Winde knatternden roten Sowjetfahne, die über die [sic] russ. Handelsstation weht[,] dem lebensgroßen gewebten Bilde Lenins gegenüber[,] das in der Jurte der Russen bekränzt hing, den ersten Trinkspruch auf das neue Jahr ausbrachte! – „Neues Jahr! Neues Glück! Wer's nicht erhascht, dem bricht's 867 das Genick!“
Auf den 2. Januar träumt er von Emmas Wiederverheiratung. „Sah Girlanden von einer Hotelwohnung bis zur Kirche. Wunderte der kirchl. 461
V. Die letzte Expedition 1928–1929 868
Trauung!“ Kurz vor Weihnachten hatte er ihr noch geschrieben, ohne zu wissen, ob sie seine flehentlichen Briefe überhaupt noch zur Kenntnis nimmt. Nachdem auch die erste Januarwoche vergangen und immer noch nicht abzusehen ist, wann er aufbrechen kann – nicht zuletzt deshalb weil inzwischen ein weiteres seiner Kamele eingegangen ist –, sucht er nach einer Möglichkeit, im Auto nach Ulaanbaatar mitgenommen zu werden. In diesen ersten Januartagen findet er auch Zeit, in Begleitung von Dr. Gončig das Kloster Monzuk sumä (Molcog sūm) aufzusuchen. Auf den ersten Blick ist er beeindruckt. Neben einer chinesischen Tempelhalle besitzt die Klosteranlage zwei Gebäude im tibetischen Stil. Monzuk sumä sieht durch geschickte Ausnutzung des ansteigenden Terrains mit seinen Bauten imposant aus. Das letzte Gebäude wirkt turmartig, von der Steppe aus gesehen. Dabei sind die beiden tibet. Gebäude würfelartige niedrige Hallen. Ringsherum ist Sandwüste, bis Altin obo (Klos869 ter) 15 km weiter n[ördlich]. Monzuk sumä findest Du auf meiner Karte, schreibt Consten wenige Tage später an seinen „Schwiegervater“ nach Budapest. Aber er schien dennoch etwas enttäuscht gewesen zu sein. Der 870 Tempel, den er „seit Monaten mit dem Kompass angepeilt“ hatte, erwies sich nicht als der „Tempel des Lebens“, nach dem er gesucht hatte, als der „Tempel der buddhistisch-lamaistischen Verheißungen, von dem die Sage geht“, dessentwegen er von dem üblichen Karawanenweg abgewichen und beim Grenzübertritt verhaftet worden war. Er fand dort zwar einen Lama, der bereit war, ihm wahrzusagen, was ihn in Ulaanbaatar erwartete, aber: „Viel Rederei u. Besprechungen, die nicht gut und nicht schlecht enden. 871 Mittelmäßig!“ So nimmt er erneut Zuflucht zu Alkohol und Opium, schreibt im Opiumrausch einen weiteren langen Brief an die Frau seines Bundesbruders Herrmann, öffnet ihr die dunklen Abgründe seiner Seele. Also ich rauch Opium um zu vergessen: das was eine Frau mir in der Heimat angetan, und es ist paradox wie das Opiumrauchen selbst – um Ihnen[,] verehrte gnädige Frau[,] und meinem lieben Bundesbruder, Ihrem Manne schreiben zu können. – Man sieht alles leichter, wenn man das Kraut des Vergessens raucht oder trinkt – wie der Chinese sagt. – Ich merke nicht die Kälte, grinsende, lähmende, hinkende Kälte, die durch den Filz der Jurte kriecht, hämisch lachend sich die Pfoten und Hände in der trüb flackernden Flamme des 462
6. Verhaftung und Verhöre an der Grenze
Feuers wärmt. Unter dem strahlenden Druck der Frau Kälte zuckt und leckt die glühende grünblaue Flamme zurück. Angeekelt! – Wie das Weib vor dem Manne, den sie nicht liebt. Angeekelt! … Ihre Wärme droht zu erlöschen! – Übrigens gnädige Frau, man merkt an unserem Christentum, dass es im heissen Morgenland seinen Ursprung hat, dort ist die Hölle mit der verzehrenden Glut des Erdfeuers gefüllt, während den Mongolen u. Tibetern als schlimmste Hölle die Kältehölle geläufig ist! – Also so schwer es mir fällt – ich bleibe lieber auf meinem Feldbett liegen und schreibe Ihnen zwischen jeder einzelnen Pfeife einige Zeilen, so muss ich doch der hellen Flamme gegen die nachtschwarze schwere Kälte zu Hilfe kommen. – Selbsterhaltungstrieb – – Sonst erfriere ich trotz des Opiums. Ich habe -25° Cels. in der Jurte und die Frau Kälte ist gar nicht zurückhaltend. Sie umfängt mich mit ihren Eisarmen. Sie ist – ich liege wieder und die ruhig brennende Flamme der Opiumlampe täuscht mir vergebens Wärme vor – gar nicht zimperlich. Siegreich mit Hände[n] und Pfoten unter dem Pelz aus Dseren-Antilopenfellen. Presst den Körper an sich in wilder Kältenlust, und damit nicht genug[,] zuckt sie durch's warme Menschenfleisch bis ins Mark der Knochen. Sie rieselt als Frostschauer durch das träger fließende Blut. – Vielleicht gibt es ein [sic] Liebesschauer der Kälte. Vielleicht! – – – Ich rauche! – Liebesschauer der Kälte, der kalten Frau – Vergessen – 872 vergessen können. Was ich alles auf dieser Expedition durchgemacht.
Ihr schildert er in allen Details die tausend Missgeschicke auf seiner Weiterreise vom Cagaan Čuluu, von wo er ihr das letzte Mal geschrieben hatte – schon damals, „um Abschied zu nehmen“ und sich aufzumachen in Richtung des weißen Flecks auf seinen Landkarten. „Unbekanntes Land! – – Weißer Fleck! – – Das reizt, das winkt! – ‚Komm! Komm!“ Nun befindet er sich mitten in diesem „weißen Fleck“, der sich ihm, statt als „Land der Verheißung“ und „Tempel des Lebens“, als „Kältehölle“ offenbart. Wärmend ist einzig das menschliche Verhalten der Russen, die seine Klischeevorstellungen von Bolschewismus und Judentum ins Wanken bringen. Kara Etzel war von den Sowjetleuten – darunter zwei Juden – mit gekochter Hirse gefüttert. Diesen Leuten danke ich viel. Die Bolschewiken sehen in mir nur den hilfsbedürftigen Menschen. Dort unter dem Schutz der Bolschewikenhandelsflagge trank ich wieder zum ersten Mal klaren 873 Thee, aß sauberes frischgebackenes Brod. 463
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Schon auf seinen frühen Mongolei-Reisen hatte sich Consten gern mit dem „Ewigen Juden“ verglichen, der immer wieder zum Aufbruch und Wandern verdammt sei. Nun sieht er sich auch noch als „armen Vaganten, der nach 874 dem Tempel des Lebens sucht“ und nicht weiß, ob er ihn je finden wird. Immerhin spürt er ein wenig von der Einmaligkeit der Begegnung mit seinen Bewachern. Hätte man ihn im Oktober einfach passieren lassen, dann wäre er achtlos an diesen Menschen vorbeigezogen. Er hätte keine Einblicke in den Alltag eines einsamen Grenzpostens im Niemandsland zwischen der Mongolei und China gewonnen, hätte ihr hartes Leben nicht teilen dürfen, ihre tiefe Menschlichkeit nicht schätzen gelernt. Er bricht also wieder auf, macht Abschiedsbesuche bei Kommissar Luvsan Navaan und den anderen Mongolen, bei den Russen. Er übergibt Geschenke, bedankt sich für alle Hilfe. Schwer fällt ihm der Abschied von seinen Tieren, vor allem von Kara Etzel, den er der Obhut des Chauffeurs Semin anvertraut. Einzig Bars der Hund, der durch nächtliche Balgereien mit Wölfen an den Pfoten verletzt ist, wird ihn begleiten. Als er Narijn Bulag am 23. Januar 1929 verlässt, ist es wieder klirrend kalt geworden. Bis zu dem Punkt an der Steppenpiste, wo die Autos halten, muss sein Expeditionsgepäck auf sieben von Kamelen gezogenen Karren über knapp 200 Kilometer durch verschneiten Wüstensand transportiert werden. Sie kommen in dem schwierigen Dünengelände nur langsam voran. Consten reitet durch 20 cm tiefen Schnee neben der Karrenkarawane her. Kurz vor dem Aufbruch hatte ihm Kočetov noch berichtet, dass die mongolische Regierung gestürzt worden sei und nur noch um die Stellung Erdene Batchaans, des Volksbildungsministers, gekämpft würde. Neue Leute mit sowjetischen 875 Instruktoren hätten in Ulaanbaatar die Macht übernommen. Am 29. Januar 1929 erreicht Consten mit Erfrierungen an Gesicht und Händen Chošuu Chudag, den Punkt, wo ihn die Autos erwarten sollten. Doch sind sie, wie er von dem dortigen Stationsleiter der sowjetischen Auf876 kaufgesellschaft Stormong hört, schon seit zwei Stunden fort. Er muss sich also einige Tage gedulden, bis wieder Kraftwagen kommen, die ihn und sein Gepäck samt dem stark hinkenden Bars mitnehmen können. Immerhin kann er bei dem Stationsleiter übernachten und erstmals seit Monaten ohne Filzstiefel, Pelz und wattiertes Unterzeug schlafen. Er kann sich waschen und rasieren. Nach zwei Tagen kommt ein Auto, dem er einen 464
6. Verhaftung und Verhöre an der Grenze
Teil seiner Ausrüstung mitgeben kann. Der Chauffeur kennt Dr. Andor Roth, gebürtiger Ungar und Büroleiter der Deutsch-Mongolischen Handelsgesellschaft (Sitz: Tientsin) in Ulaanbaatar. Ihm soll er die Sachen samt einem persönlichen Brief übergeben. Auch für Curt Alinge, den deutschen Mittelsmann bei den mongolischen Behörden, gibt er einen Brief mit, in dem er bittet, ihm eine Unterkunft zu besorgen. Seiner Auftraggeberin Ethel John Lindgren hat Hermann Consten, wie schon während der gesamten, von Verzögerungen betroffenen Reise nach Ulaanbaatar, nichts mitzuteilen. Bis wieder ein Transportauto kommt, vertreibt er sich die Zeit, indem er Kranke in ihren Jurten besucht und ihnen von seinen Medikamenten gibt. Bei den Nomaden bittet er einen Schamanen um Weissagung und notiert präzise, was während der Zeremonie geschieht: wie der Schamane seine mit Amuletten behangene Kleidung anlegt, den mit Uhufedern geschmückten Schamanenhut aufsetzt, zum Klang von Glöckchen und Trommel tanzend und singend in Trance gerät. Consten stellt fest, dass der Gesang altaisch ist. Schlegel und Trommel wirft der Schamane schließlich von sich, er greift zu zwei chinesischen Schwertern, mit denen er wild in der Luft fuchtelt. Dann richtet er die Schwerter rasselnd und schnaubend auf seinen eigenen Körper. Sein Weib u. eine andere mong. Schöne treiben ihm das eine Schwert mit wuchtigen Hammerschlägen i. d. Leib. Die Frau schlägt mit d. schweren Eisenhammer, während die andere d. Schwert unterhalb des Griffes hält – der Schamane schnaubt u. stöhnt rasselnd, tanzt dann mit dem aus d. Leib herausragenden Schwert um d. Feuer, man öffnet die Türe[,] er tritt heraus, seine Frau schlägt die Trommel. Draussen Schnauben und Stösse der Wut. Man reicht ihm einen[,] dann den zweiten Lappenumwundenen schmalen Leuchter hinaus, die wahrscheinlich irgendeine Flüssigkeit enthalten. Frau schlägt wieder Trommel. Schaman kommt tanzend mit herausgezogenem blutigen Schwert i.d. Jurte, fuchtelt darin herum. Weiber nehmen einen Finger voll Blut, schmieren diesen unterhalb der Kehle auf die Brust. Schaman trommelt. Hin und herwerfen. Weissagt singend während d. Trommel. Weissagt mir. Gutes Gelingen. Sehe d. Pantschen 877 u. vielleicht d. Dalai Lama. Reise bisher nicht glücklich, jetzt sehr gut.
465
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Am nächsten Tag kommt der Schamane zu dem wieder ernüchterten Consten, um sich sein Trinkgeld für die Séance abzuholen. So recht scheint Consten nicht zu glauben, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Deshalb sucht er wenige Tage später, nachdem er zu seinem Schrecken erfahren hat, dass seine Sachen nicht zu Dr. Roth gelangt sind, sondern in Ulaanbaatar beim Zoll liegen, ein in der Nähe gelegenes Kloster auf, in dem ein bekannter Chuvilgaan, die Wiedergeburt eines hohen Lamas, leben soll. Dieses Kloster Dalaj Van Chijd – die Mongolen nennen es Daš Chongor – verehrt L’lamsrin (Žamsran, Beg-ts’e), den alttibetischen Kriegsgott, der nach der Legende von einem Dalai Lama zum Buddhismus bekehrt wurde. Als höchste Schutzgottheit der Mongolei verkörpert er die Konversion der einstmals 878 kriegerischen Mongolen zum Lamaismus. Doch der Chuvilgaan wohnt jetzt woanders. So muss er sich selbst weiter mit nicht beantwortbaren Fragen quälen. In der Nacht zum 10. Februar feiert Consten mit den Mönchen des Klosters Cagaan Sar den „Weißen Mond“, wie das mongolische Neujahrsfest genannt wird. Alle Tempelgebäude sind hell erleuchtet. Es brennen große Cagaan-Sar-Feuer. Hohe Lama nehmen nach und nach ihre Plätze ein. Rot aufleuchten im Feuerschein die Rücke[n], legen darüber den gelben Mantel. Kambo Lama; Gabala, Bumba mit Pfauenfeder. Kleine Handtrommel ganz Fell. Phantastisches Bild. Feuerschein bis zur Decke. Die niedrigen Lamas verschwinden im Halbdunkel. Dort 4 Tempelwächter mit Kupferbeschla879 genen u. Hadakbehangenen Stöcke[n] sehen auf Ordnung. Handbewegung der Lamas Wellenförmig. Mit dem Kiel der Pfauenfedern einige 880 881 Tropfen aus der Bumba in die Gabala. Linke Hand mit Mittelfinger Gabala, dann beide Hände innere Handfläsche [sic] nach oben. Spritzen des Tropfens von der linken Hand nach aussen (innere Handfläsche d. Gesicht zugekehrt) durch Wippen des Mittelfingers. – Dann Bewegung der Finger (linke Hände i. d. rechten Stellung) nach der inneren Handfläsche als ob er mit allen Finger jemanden auf sich zuwinken wolle. – Hinauf wieder wellenförmige [Bewegung] der Finger i. d. d. Handrücken nach aussen gedreht wird und den der Finger mit d. Zeigefinger zuerst wieder nach innen gedreht werden. Lange Trompeten dröhnen durch die Nacht. Der Lama[,] bei dem ich gestern zu Besuch war[,] erscheint. 882 Trompeten, Trommeln erdröhnen. Man hilft ihm auf seinen Sitz. 466
6. Verhaftung und Verhöre an der Grenze
Nach der nächtlichen Feier, die ihm Erinnerungen an seinen Besuch in Uliastaj 1912, an die Begegnungen mit Žalchanc Gegeen und Diluv Chutagt lebendig werden ließen, überkommt ihn erneut die Verzweiflung, denn zwei Jahre ist es her, dass Emma ihm mitgeteilt hatte, sich von ihm trennen zu wollen. So geht er am Neujahrstag erneut zum Kloster, um jemanden zu finden, der ihm weissagen kann. Schließlich erklärt sich ein alter Lama bereit, dem hartnäckigen Fremden das Orakel zu stellen. Consten hat neun Fragen. Über die Antworten dürfte er nicht gerade beruhigt sein. Später wird er feststellen, dass einige zutreffen, andere nicht. 1) Frage: Wie werden meine Angelegenheiten in Urga sein und endigen. (Langes Berechnen[,] Nachschlagen in kleinem und grossen Buch.) Antwort: sehr gut. 2) Frage: Ich habe viele Freunde in Urga. Werden die mir behilflich sein. Oder die neue Regierung. (Nachschlagen i. d. Büchern.) Antwort: Auf den Du am meisten rechnest, kann Dir ganz und gar nicht helfen. Da er ein ganz einfacher Mensch ohne Einfluss geworden ist. Trotzdem wird alles sehr gut für Dich sein. 3) Frage: Werde ich lange in Urga bleiben und weiter reisen oder schnell nach Hause zurückfahren? Antwort: Deine Geschäfte in Urga werden sehr gut sein und Du wirst ungefähr noch ein Jahr auf mong. Erde leben. 883 4) Ich soll einen Towarisch in Urga treffen, ist er noch da? Antwort: Es geht ihm scheinbar gut[,] aber er ist höchstwahrscheinlich nicht in Urga. 5) Werde ich Briefe in Urga vorfinden. Antwort: Deine Briefe sind hinter Dir. Ich verstehe das nicht, aber Briefe in Urga wirst Du kaum finden. 6) Wie geht es zu Hause? Sehr gut. 7) In Tientsin ist eine Frau, die mir sehr nahe steht. Was ist mit dieser Frau? Ist sie gut und ehrlich zu mir. (Nachschlagen i. d. Buch!) Antwort: Du willst mich wohl irre führen und auf die Probe stellen? Erwidere: Nein, daran habe ich kein Interesse. Warum glaubst Du, dass ich Dich irre führe. Antwort: Das ist unmöglich. Ich lese nur schlechtes über d. Frau zu Dir. Die Frau ist schlecht. Sehr schlecht. 8) Ich habe Geld nach Urga überwiesen. Ist das Geld noch da? Antwort: Das Geld hat der Mann der mong. Regierung übergeben. Du wirst Schwierigkeiten haben es zu erhalten. 9) Eine Frau die mir in Deutschland sehr nahe stand und auch die Mon467
V. Die letzte Expedition 1928–1929
golei genau kennt, was ist mit ihr. Ist sie verheiratet und wie geht es ihr. Antwort: Du willst mich wieder irreführen und ich finde nichts über die884 se Frau. Wenn nicht[,] dann existiert sie nicht mehr.
7. Wiedersehen, Ärger und Abschiebung Endlich sind zwei Wagen eingetroffen, auf denen es noch Platz für Consten samt Hund und das restliche Expeditionsgepäck gibt. Am 12. Februar brechen die stark überladenen Dodge-Autos auf in Richtung Cecen Chan (heute Öndörchaan). Der Cherlen, einer der großen Flüsse der Mongolei, an dieser Stelle etwa 25 Meter breit, ist noch zugefroren. Das Stadtbild der Siedlung wird beherrscht von dem im chinesischen Stil errichteten Fürstenpalast. Noch wenige Jahre zuvor gehörte er einem der mächtigsten Fürsten der Chalch-Mongolen. Jetzt beherbergt er die Transportstelle und die Chauffeurswohnung, wo auch die Reisenden in engen Kabinen übernachten können. Zwei Tage später, am 14. Februar sieht Consten den Bogd Uul, einen der „Hausberge“ Ulaanbaatars am Horizont, kurz darauf erreichen die Wagen die große Karawanenstraße und die Telegrafenlinie, die von Kalgan her durch die Mongolei führen. Am Nachmittag werden sie am Checkpoint der mongolischen Hauptstadt gestoppt. Passkontrolle. Consten muss sein Gepäck in den Zoll tragen. Mit Bars an der Leine und einem kleinen Ruck sack mit dem Nötigsten lässt er sich zu Andor Roth fahren. Fast auf den Tag genau neun Monate nach seinem Aufbruch in Peking ist er – ohne die Karawane, aber immerhin mit einem Großteil der Ausrüstung – endlich dort angekommen, wo die eigentliche Forschungsreise mit der jungen USWissenschaftlerin Ethel John Lindgren erst beginnen sollte. Nicht nur sein Plan wurde durch all die widrigen Umstände auf seiner Reise nach Ulaanbaatar gründlich durchkreuzt. Auch ihr Vorhaben konnte deswegen nicht realisiert werden. Beim Gedanken, was ihn nun erwartet, ist ihm unbehaglich. In Lindgrens nicht minder prekäre Situation hineinversetzen kann oder will er sich jedoch nicht. Constens Tagebuch vermerkt nur noch stichwortartig viele Laufereien und Ärger: mit dem Zoll, der sein Gepäck filzt und vorerst nicht herausgibt; mit Curt Alinge, den er als „komischer Kauz und rechthabriger Einzelgänger“ charakterisiert; vor allem aber mit Ethel J. Lindgren, die wider Constens Erwarten doch in Ulaanbaa468
7. Wiedersehen, Ärger und Abschiebung
tar ist und ihn über die Gründe für sein langes Ausbleiben zur Rede stellt. Dies empört ihn. I. L. erscheint mit Alinge. Theater! Erklärt Expedition für beendet. Allright. [Sie] ist ausgewiesen. Scharfe Auseinandersetzung mit A.[linge]. Höre v. R.[oth] über die mong. burät. Verfehlungen v. I.[Ethel]. Daher ausgewiesen. – Allerhand Lüge. [Ich] wäre im Aug.[ust] in Kalgan im Auto gesehen worden. u.s.w. I. ist angeblich deshalben nach Peking gefahren. Hat durch Haenisch Erkundigungen bei der Botschaft eingezo885 886 gen. Sie will morgen weg. [Ich] soll Exped.gepäck Alinge übergeben.
Dass ein Teil des Expeditionsgepäcks in der Inneren Mongolei zurückblieb, verschweigt Consten. Der Gedanke, die Sachen an Alinge übergeben zu müssen, der sicher mit spitzem Bleistift jeden einzelnen Posten abhaken und über jedes fehlende Stück Rechenschaft verlangen wird, bereitet ihm tiefes Missbehagen. Mehr als 60 Briefe für Consten haben sich bei Curt Alinge angesammelt. Von Taitai befindet sich keiner darunter, dafür aber eine „Hiobsbot887 schaft aus Aachen“ – die Mitteilung über den Konkurs der Adler Brenn888 und Brauerei Hermann Consten – und ein Schreiben Grete Strölins, das auch aus Bad Blankenburg keine guten Nachrichten zu enthalten scheint. Constens Katastrophe ist also komplett. Er fühlt sich krank und elend. Erst nach Tagen sieht er sich in der Lage, mit dem Zoll über die Auslösung des Expeditionsgepäcks zu verhandeln. Er sucht das Komitee für Schrifttum auf, trifft seinen Gründer und Leiter, Prof. Žamsrano Ceveen, zeigt ihm einige Objekte aus den Gräbern der Liao. Er sei begeistert gewesen, notiert Consten unter dem 28. Februar. Dies macht ihm Hoffnung, seine Expedition an den Bajdrag doch noch genehmigt zu bekommen. In Begleitung Žamsranos spricht Consten beim Außenministerium vor, wo man einen schriftlichen Bericht über seine geplante Reise verlangt. 889 Und schließlich sieht er auch Erdene Batchaan wieder, der inzwischen sein Ministeramt verloren hat. Er ist, wie ihm das Orakel zutreffend prophezeit hatte, ein einfacher Mensch ohne jeden Einfluss geworden. Einzelheiten über seinen Eindruck oder den Inhalt ihrer Gespräche vertraut Consten seinem Tagebuch nicht mehr an. So lässt sich nicht abschätzen, inwieweit ihm der Exminister Details seiner damaligen politischen Schwie469
V. Die letzte Expedition 1928–1929
rigkeiten überhaupt mitgeteilt hat. Später ging Consten jedenfalls irrtümlich davon aus, Erdene Batchaan sei nach seiner Verhaftung erschossen 890 worden. Tatsächlich aber wurde der einstige Volksbildungsminister 1937 in die Sowjetunion deportiert, wo man ihm, wie vielen anderen mongolischen Opfern der nach dem VII. Parteitag der MRVP erfolgten Säuberungen, den Prozess machte. Immerhin dürfte Consten angesichts der politischen Lage, wie er sie im Frühjahr 1929 in Ulaanbaatar, wenn auch nur flüchtig, mitbekam, geahnt haben, dass E. Batchaans Politik der Entsendung von Schülern und Berufspraktikanten nach Deutschland und Frankreich, seine Orientierung an Schulmodellen des westlichen Auslands, seine direkten Kontakte zu deutschen Wissenschaftlern und Forschern dem NKWD und den linksradikalen Kräften innerhalb der MRVP schon länger 891 ein Dorn im Auge gewesen sein mussten. Zwar schien sich der Volksbildungsminister gerade wegen des durchschlagenden Erfolges seiner Bildungspolitik noch am längsten gegen die Breitseite der Kritik von Links behauptet zu haben. Doch sollten ihm seine Westkontakte letztlich zum Verhängnis werden. E. Batchaans Enkelin, die mongolische Sozialwissenschaftlerin und Humboldt-Stipendiatin Dr. A. Saruul, die an einer Biografie ihres Großvaters arbeitet und im Sonderarchiv des mongolischen Geheimdienstes Einblick in die erst im Jahr 2005 aus Moskau überstellten Prozessakten nehmen konnte, fand heraus, dass in dem gegen ihren Großvater angestrengten Schauprozess unter anderem seine Verbindung mit Prof. Erich Haenisch, besonders aber mit Hermann Consten zu den Anklagepunkten gehörten, die zu seiner Verurteilung geführt hatten. Einer der Belastungszeugen des NKDW stellte E. Batchaans Deutschlandkontakte in einen größeren historischen Kontext und belegte damit zugleich, dass Hermann Constens Aktivitäten zugunsten des Deutschen Kaiserreichs im Zusammenhang mit der ersten Unabhängigkeitserklärung der Mongolei 1911/12 in Moskaus Geheimdienstkreisen nicht vergessen waren. Der Zeuge sagte dem Dokument zufolge u.a. aus: Auf diese Weise konnte die Stärkung der Kulturbeziehungen in die engen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Deutschland und der MVR einbezogen werden, nach denen die Deutschen schon seit
470
7. Wiedersehen, Ärger und Abschiebung
1912 strebten, als der Sondernachrichtenagent Consten als Erster in die 892 MVR reiste.
Dass Consten schon damals „auf eigene Faust“ gehandelt und die Reichsregierung mit Rücksicht auf ihr Verhältnis zu Russland und China eine offizielle Anerkennung der Mongolei immer vermieden hatte, spielte in dieser Argumentation keine Rolle mehr. Erdene Batchaan starb schließlich am 6. Januar 1942 in einem Straflager bei Vjack an Krankheit und Erschöpfung. Zurück ins Jahr 1929. Was Hermann Consten nach bald 17 Jahren Abwesenheit in Ulaanbaatar, das er immer noch lieber Urga nennt, an Veränderungen im Stadtbild registriert, notiert er im Tagebuch nur beiläufig. Das einzige, was ihm aufgefallen zu sein scheint, sind eher vertraute Szenen, wie er sie auf dem Weg zum Gandan-Kloster erlebt: „Dasselbe Bild d. pis893 senden Lamas wie 1912. Glatteis von Urin.“ Doch spiegelt sich die veränderte Stadt in seinen Fotos. Unter die Mongolen in ihrer traditionellen Kleidung haben sich moderne Sowjetmenschen in Motorradkluft gemischt. Neben Pferden, Kamelen und Ochsenkarren holpern Autos über die von Schlaglöchern übersäten Wege der Stadt. Züün Chüree, den Choijin Lam (Tempel des Staatsorakels) wie auch den Palast des Bogd Chan im Süden der Stadt sieht er wieder. Wo einst der Majdar-Tempel gestanden hat, wölbt sich jetzt die grüne Kuppel des Volkshauses. Dort tagt nicht nur der Volkskongress oder werden Theaterstücke gespielt, auch erste Schauprozesse gegen missliebige Politiker haben in dem angeblich von einem deutschen Ingenieur errichteten Versammlungshaus schon stattgefunden. Consten erlebt das Majdar-Fest, eine der letzten großen religiösen Feiern vor dem Vernichtungsschlag der neuen Machthaber gegen den Lamaismus. Am 1. März beobachtet er mit der Kamera einen der jetzt populären Massenaufmärsche. Mehrstöckige Häuser wurden gebaut, neue Straßen angelegt, Stromleitungen gezogen, Fabrikbetriebe errichtet. Dass etliche deutsche Ingenieure und andere Fachleute aus dem Westen an Ulaanbaatars Modernisierung beteiligt sind, scheint ihn jedoch nicht näher zu interessie894 ren. Während die täglichen Besuche und fruchtlosen Gespräche im Komitee für Schrifttum ihn langsam ermüden und er seine Hoffnung auf Genehmigung der archäologischen Expedition an den Bajdrag schwinden sieht, geht
471
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Abb. 26: Aufmarsch zum 1. März, im Hintergrund das neue Volkshaus von Ulaanbaatar, 1929
der Ärger mit Alinge erst richtig los. Der verkehrt nur noch schriftlich mit Consten, drängt im Auftrag Miss Lindgrens auf baldige Herausgabe des Expeditionsgepäcks, verlangt Vorlage der Einzelabrechnungen und die Erstattung seiner eigenen Unkosten für Behördengänge, Porto und Übersetzerleis895 tungen. Alinge setzt ihm eine Frist. Consten reagiert unwillig, lässt die Frist verstreichen. In seinem neuen ungarischen Bekanntenkreis um Andor Roth und den Ingenieur Joseph Geleta blüht derweil der Klatsch. Alinge ver896 breite, Consten habe früher Constein geheißen, wird ihm zugetragen. Miss Lindgrens angebliche Affären mit burjatischen Intellektuellen glaubt 897 Consten nur allzu gern. Im März befasst sich der mongolische Ministerrat noch einmal mit dem Fall Consten. Der hat zuvor an das Deutsche Generalkonsulat in Tientsin telegrafiert: Erbitte dringend Hilfe u. Freigabe beschlagnahmtes Expeditionsgepäck über hiesige Sowjetgesandtschaft [stop] Alinge ohne Einfluss [stop] seine 898 Intervention zwecklos [stop] Consten
Immerhin erreicht er, dass nun Andor Roth vom Generalkonsulat offiziell beauftragt wird, für Consten tätig zu werden und seine Beziehungen zu 472
7. Wiedersehen, Ärger und Abschiebung
mongolischen Sicherheitspolizei- und Regierungsstellen wie auch zur Komintern spielen zu lassen. Tatsächlich erhält Consten die Zusage der 899 baldigen Freigabe der Expeditionsausrüstung. Doch hat das Komitee für Schrifttum derweil Constens chinesischen Reisepass übersetzen lassen und festgestellt, dass darin weder von einer Genehmigung zu archäologischen Grabungen noch zur Durchführung einer begleiteten Expedition die Rede war. Seine Grabungstätigkeit in der Inneren Mongolei war also illegal, man möchte sich an seinen Schätzen aus den Gräbern der Liao nicht die Finger verbrennen und zusätzlichen Ärger mit China heraufbeschwören. Consten selbst vermutet einen Übermittlungsfehler des Deutschen Generalkonsulats bei der Beantragung seiner Reisegenehmigung. Er bietet an, umgehend nach Tientsin zu reisen, um die Genehmigung nachträglich einzuholen. Doch spürt er, dass ihm dies alles nichts mehr nützen wird. Am 19. März wird Consten ins Außenministerium bestellt, um seinen Ausweisungsbefehl entgegenzunehmen. Mit dem nächsten abgehenden Kraftwagen soll er aus Ulaanbaatar verschwinden. Immerhin gestattet man ihm, noch nach Dariganga zurückzureisen, dort seine Kamele zu verkaufen, um dann über Zamyn Üüd das Land in Richtung China zu verlassen. Anderentags werden seine Sachen freigegeben. Nur den ersten Band seiner „Weideplätze der Mongolen“ sieht er nicht wieder. Der steht heute in der 900 Mongolischen Staatsbibliothek. Consten vertraut das Expeditionsgepäck bis auf weiteres Andor Roth an. Alinges immer drängender werdende Briefe auf Herausgabe der Miss Lindgren gehörenden Sachen ignoriert er. Am 28. März reist er ab. Im Zoll, wo man sein persönliches Gepäck noch einmal gründlich filzt, erscheint Curt Alinge. Er droht, ich schmeiße ihn zum Zoll hinaus. Abzieht wie geprügelter 901 tückischer Hund.
Am 4. April trifft Consten nach mühseliger Autofahrt durch die Steppe, ohne seine Kamele wiedergesehen zu haben, in Kalgan ein. Wassili, sein Dolmetscher aus Peking erwartet ihn, hilft ihm bei der Erledigung der Pass- und Zollformalitäten, bringt ihn in ein Hotel, „wo die ganze Nacht der Foxtrott tobt“. China hat den gestrandeten Expeditionsleiter wieder. Am 8. April trifft er in Peking ein, steigt – als ob er immer noch im Gelde schwimme – im Luxushotel Wagon de Lits ab, wo ihm ausgerechnet der 473
V. Die letzte Expedition 1928–1929
große Star unter den europäischen Forschungsreisenden, Sven Hedin, über 902 den Weg läuft. Als nächstes sucht Consten die Deutsche Gesandtschaft auf, spricht mit Kanzler Scharffenberg über seine verfahrene Situation, seine Geldschwierigkeiten. Auch was er dort erfährt, stimmt ihn nicht froh. Ethel John Lindgren hatte nach ihrer Ausweisung aus der Mongolei in der Gesandtschaft vorge903 sprochen, ihr Anwalt in Tientsin hatte geschrieben. Auch das Generalkonsulat in Tientsin ist über den Vorgang informiert. Immerhin will Scharffenberg helfen. Seine Familie lädt Consten zum Essen ein. Tags darauf fährt er nach Tientsin zur Familie Junkel. Das Entzücken über die Freude der Kinder währt nur kurz, das Wiedersehen mit Taitai und Otto Messerich Junkel ist getrübt. Consten präsentiert seine Grabfunde, stößt aber auf Zurückhaltung. „Das Gift Alinge wirkt im Konsulat, bei M. u. T. – Gemeinheit“, notiert er am 10. April. „Schreibe I. L. und ihrem Rechtsanwalt.“ Tientsin 15.4.1929 Sehr geehrtes Fräulein Lindgren! Nach Rücksprache mit dem Deutschen Generalkonsulat teile ich Ihnen folgendes mit: Die Expeditionssachen, soweit diese Ihnen gehören, habe ich bei der Deutsch-Mongolischen Handelsgesellschaft deponiert. Diese Deponierung geschah 1) weil mir der Chef der GPU (der Ochrana)[,] Hansen[,] in Gegenwart zweier Zeugen, die beide zur Zeit in Tientsin anwesend sind, mitteilte: „Die Expeditionssachen werden von uns aus sofort beschlagnahmt, wenn Sie die Sa904 chen Alinge übergeben. Es ist besser Sie schneiden den Sattel und die übrigen Sachen in Stücke.“ 2) müsste dann der Zoll für die zollfrei hereingekommenen Sachen nachgezahlt werden. Wie hoch sich die Strafe für jedes einzelne Stück beläuft kann man nicht genau Sachen [Randvermerk Lindgren] ? Sagen? Copyist’s comment. 3) Ferner wurde mir von informierter Seite mitgeteilt, dass Herr Alinge demnächst ebenfalls ausgewiesen wird. Dieselbe Mitteilung wurde auch dem Deutschen Generalkonsulat gemacht. Herr Hansen sprach auch über die Gründe Ihrer Ausweisung – ebenfalls vor beiden Herren. Diese Gründe liegen zum größten Teil auf einem ganz bestimmten, Ihnen vertrauten Gebiet. Aus Rücksicht möchte ich sie, da sie privater Natur sind, nicht niederschreiben, umso mehr als mir persönlich daran liegt, die ganze Angelegenheit so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen, und zwar auf friedlichem Wege, ohne dass ich gezwungen werde, auch mei474
7. Wiedersehen, Ärger und Abschiebung
nerseits mit Klagen und Material die amerikanischen Behörden zu belästigen. Ich bitte Sie deshalb, mir Tag und Stunde zu bestimmen, wo ich Sie sprechen [kann]. Bei dieser Aussprache hoffe ich, dass wir uns friedlich einigen werden. Hochachtend Consten. [Anfügung Lindgren:] This is certified to be a correct copy of the letter received 905 by me today the 23rd of April (gez. E. J. Lindgren).
Wieder wird Hermann Consten krank. Diesmal sind es die Nerven. Am Abend des 16. April macht ihm Taitai Vorwürfe, weil er einer offenen Aussprache mit ihrem Mann ausweiche. Consten sieht sich außerstande zuzugeben, dass er das Ehepaar Junkel von Anfang an über das Expeditionsvorhaben getäuscht hat. Lieber erklärt er schroff, am nächsten Tag abreisen zu wollen. Tatsächlich macht er sich er am folgenden Morgen nach nur kurzer Aussprache zum Tientsiner Bahnhof auf und nimmt den nächsten Zug nach Peking. Durch den Vertrauensbruch ist Hermann Constens wunderbare Freundschaft mit den Junkels am Ende. Ob ihm auf der Rückfahrt nach Peking jener seltsame Traum wieder einfiel, den er am Morgen nach der Befragung des Orakels im Kloster Daš Chongor in sein Tagebuch notiert hatte? Sah Taitais Ring winzig klein und fahl, wertlos! Ich fand ihn in seinem gewöhnlichen Aussehen irgendwie im Pelz, dann wurde er klein! Wenn ich ihn zeigte, wuchs er zu seiner gewöhnlichen Größe, war aber ohne Glanz. Amerikan. Ladies sahen ihn an und zeigten mir darauf Rosenquarz u. Rauchtobas [sic] Blöcke. Alle glaubten der Ring wäre durch Mechanismus zu vergrößern. Ein Herr öffnete die Ringseite und fand dort ein grosse[s] Photo [einer Person], die wie ein bärtiger Landsturmmann aussah. Dabei das Bild der Muttergottes Emmy ähnlich und darunter geschrieben[:] zwischen Drau und Theiss – –? Was will das wieder bedeu906 ten! Sah Emmy in Ungarn –?
Constens Versuch, Ethel John Lindgren und ihr gemeinsames Expeditionsvorhaben im Nachhinein zu diskreditieren, scheiterte letztlich an den harten Fakten, die Curt Alinge wenige Wochen später auf 20 eng mit Schreibmaschine geschriebenen Seiten plus Anhang der Deutschen Gesandtschaft 907 in Peking zur Kenntnis gab. Ausführlich beschrieb Alinge seine Amtshilfe bei der Bewilligung der Einreiseerlaubnis für Consten, die Rücksendung 475
V. Die letzte Expedition 1928–1929
der Papiere durch das Generalkonsulat wegen Constens bereits erfolgter Abreise. Wochenlang sei seine Ankunft am vorgeschriebenen Grenzübergang Zamyn Üüd (Ude) vergeblich erwartet worden. Erst im Oktober habe er erfahren, dass Consten an einem Punkt Sajchan Chudag (Saihen Huduk) über die Grenze wollte, doch habe man auf den Karten nicht feststellen können, welche Stelle er meinte. Nachdem er von Constens Festnahme erfahren habe, habe er alles in seinen Kräften Stehende getan, die Erlaubnis für seine Weiterreise nach Ulaanbaatar zu erwirken. Am 14. Februar traf Consten mit Kraftwagen hier ein und stieg bei Herrn Andor Roth (ungarischer Staatsangehöriger), dem Geschäftsführer der Deutsch-Mongolischen Handelsgesellschaft, ab, da, wie Consten später behauptete, der Chauffeur meine Wohnung nicht habe finden können. – Inzwischen war viel Unerfreuliches über ihn zu meiner Kenntnis gekommen. Bereits bei meiner Eingabe zwecks Erlangung des mongolischen Visums für „den bekannten Forscher“ im April v. Js. hatte ich den Eindruck, dass man auf mongolischer Seite dem wissenschaftlichen Wert der „Forschung“ Constens skeptisch gegenüberstand. […] Die Urteile aller […] hier eintreffenden Reisenden, die Consten persönlich kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hatten, stimmten darin überein, dass Consten unerhört zu übertreiben pflege, seine Äußerungen daher mit größter Vorsicht aufzunehmen seien, seine Tätigkeit als wissenschaftlich wertvoll kaum zu betrachten sei. Die bemerkenswerte Übereinstimmung dieser absprechenden Urteile veranlasste mich schließlich, selbst in Deutschland Erkundigungen über Consten einziehen zu lassen. Die Auskünfte lauteten vernichtend. Insbesondere steht fest, dass Consten schwer verschuldet 908 ist und die Person, die ihm die Wirtschaft führt, in den dürftigsten finanziellen Verhältnissen, von Gläubigern bedrängt, zurückgelassen hat. Ein seinem Bruder in Aachen gehöriges Unternehmen, schreibt mein Informant, habe seine Zahlungen eingestellt, sodass Consten „jetzt endlich 909 genötigt sein werde zu arbeiten“.
Dann, so berichtet Alinge weiter, habe ihn Anfang Februar Miss Lindgren aufgesucht und ihm mitgeteilt, dass (1) das gesamte sich bei Consten befindliche Expeditionsgepäck (mit wenigen ihm gehörigen Ausnahmen) aus ihrem Gelde gekauft und ihr 476
7. Wiedersehen, Ärger und Abschiebung
Eigentum sei; (2) die gesamten Reisekosten Constens von Bad Blankenburg über Genua nach Shanghai (einschließlich Getränken an Bord) sowie auch die gesamten Kosten seiner Fahrten und seines Aufenthaltes in China einschließlich Weiterreise nach der Mongolei von ihr bezahlt bez. bevorschusst seien; (3) das Verhältnis Constens zu ihr in einem am 20. April v. Js. in Peking geschlossenen Vertrage fixiert sei, dessen Original sie mir überreichte und der sich noch jetzt in meinen Händen befin910 det.
Da ihre Abreise aus der Mongolei kurz bevorstand, habe ihm Miss Lindgren Vollmacht erteilt, die Ausrüstung entgegenzunehmen und dem Komitee für Schrifttum bis zu ihrer eventuellen Rückkehr in Verwahrung zu geben. Sie habe ihm weitere Angaben über Consten gemacht, die seinen eigenen negativen Eindruck vertieft hätten, so Alinge. Sein erster persönlicher Eindruck habe die Angaben Dritter über Constens „bramarbasierendes Wesen“ voll bestätigt. Er war sicher noch nicht fünf Minuten in meiner Wohnung, als ich erfuhr, dass der frühere Reichskanzler, Herr Dr. Hans Luther, sein „bester Freund“ sei […]. Vor seiner Abreise von Deutschland habe er sich bei dem Herrn Reichspräsidenten zum Abschiedsbesuch angemeldet, habe aber schließlich infolge einer Grippeerkrankung seinen Besuch wieder abgesagt, um „den alten Herrn nicht anzustecken“. Gleichgültig, welche prominentere Persönlichkeit im Laufe des Gesprächs gestreift wurde, Consten stand mit ihr auf mehr oder weniger vertrautem Fuße; im Kriege war er Generalstabsoffizier gewesen und hatte als solcher Missionen von weitreichender Bedeutung zu erfüllen. Befragt, weshalb sich seine Ankunft so lange verzögert habe, erklärte er, „von Räubern umstellt“ gewesen zu sein, von denen er so viele erschossen habe, dass er es für angezeigt gehalten hätte, die Zahl der Toten seinem Tagebuch nicht einzuverleiben. Über seine – von ihm selbst hervorgerufene – Festhaltung in Narijn Bulag zeigte er sich äußerst empört und sprach von Repressalien und ähnlichen phantastischen Dingen; denn er sei nach der Mongolei auf Einladung des früheren Kultusministers Batchaan sowie des Wissenschaftlichen Komitees gekommen – eine offenbare Unwahrheit, wie sich 911 aus der Geschichte seines Verhältnisses zu Fräulein Lindgren ergibt. 477
V. Die letzte Expedition 1928–1929
Consten habe ihm außerdem erklärt, er wolle sich nur kurz in der Mongolei aufhalten und sobald als möglich nach Peking zurückkehren, um sich von da über Turkestan nach Tibet zu begeben, wohin er von Lamas eingeladen sei. […] Von Fräulein Lindgren war während des ganzen mehr als zweistündigen Gesprächs mit keiner Silbe die Rede, ich hörte nur immer von „meinen Kamelen“, „meiner Karawane“, „meiner Expedi912 tion“.
Da Miss Lindgren bei Constens Eintreffen noch in Ulaanbaatar gewesen sei, so Alinge in seinem Bericht, hätten sie Consten gemeinsam aufgesucht. Miss Lindgren hätte ihm fristlos gekündigt. Von seiner Reise nach Tibet sei danach keine Rede mehr gewesen, vielmehr habe Consten von ihr die „Vergütung des Reisegeldes nach Deutschland über Suez“ erbeten und ihr zu verstehen gegeben, dass er noch offene Forderungen habe. Sie habe ihn daraufhin aufgefordert, ihr seine Endabrechnung aus Deutschland zu schicken. Dann schildert Alinge in aller Ausführlichkeit Constens weiteres Verhalten in Ulaanbaatar, die Nichtbeantwortung seiner Briefe und andere Unhöflichkeiten, Constens Nichtachtung der in Ulaanbaatar anwesenden deutschen Fachleute, seinen Umgang mit Leuten wie Joseph Geleta, die angeblich deutschen Interessen in der Mongolei schadeten. In dem Zusammenhang zitierte Alinge eine Äußerung Prof. Erich Haenischs, die wohl seine – irrtümliche – Vermutung genährt hat, Consten selbst sei jüdischer Abstammung. Der Verkehr Constens war vorzugsweise ungarisch und semitisch eingestellt, sodass wohl Herr Prof. Dr. Haenisch recht hatte, als er, letzten Sommer von mir über seine Ansicht betreffs Consten befragt, äußerte, dies sei ein „fremdstämmiger Herr“, über den er sich im übrigen lieber 913 nicht äußern wolle.
Selbst Constens Gastgeber Andor Roth sei auf Distanz gegangen, nachdem Consten ihn in große Verlegenheit gebracht hatte. Consten hatte behauptet, von der chinesischen Regierung eine Sondererlaubnis für Ausgrabungen in der Inneren Mongolei zu besitzen, und Herr Roth hatte, auf Veranlassung Constens, vorgeschlagen, dass die Ergebnisse solcher Ausgrabungen für das hiesige Wissenschaftliche Komi478
7. Wiedersehen, Ärger und Abschiebung
tee nutzbar gemacht werden sollte[n]. Bei Nachprüfung der Papiere Constens stellte sich jedoch heraus, dass er keine derartige Erlaubnis be914 saß, sondern nichts als einen gewöhnlichen Hu-chao, der überdies be915 trächtlich überfällig war.
Roth habe ihm, Alinge, erklärt, 95 Prozent dessen, was Consten sage, müsse man als unwahr abziehen. „Die Frage ist nur immer, welche fünf Prozent man eventuell als richtig stehen lassen kann.“ Vermutlich bezog sich Constens kryptischer Tagebucheintrag vom 16. März: „Missverständnis, Indiskretion. Roth ärgerlich und das mit Recht“ auf diesen Vorfall. Und schließlich schildert Alinge den unerquicklichen Auftritt im Zollamt bei Constens Abreise am 28. März aus seiner Sicht: Ich trat auf Consten zu und fragte ihn: „Herr Consten, warum haben Sie mir eigentlich das Eigentum von Fräulein Lindgren nicht herausgegeben?“ Antwort: „Weil ich das mache, wie ich Lust habe.“ Darauf ich: „Das ist unerhört. Man sollte Sie wegen Ihres ganzen Verhaltens mit der Reitpeitsche über das Gesicht schlagen. Ich habe Sie dem Konsul gemeldet, und Sie werden keinen freundlichen Empfang in Tientsin haben.“ Darauf Consten brüllend: „Sie auch nicht, mein Lieber! Wir kennen Sie jetzt; ich weiß alles, ich weiß jetzt, was Sie für einer sind.“ Darauf ich: „Sie werden einen Prozess in China haben.“ Hierauf Consten (brüllend wie ein Stier): „Sie auch!! Ich weiß alles.“ Ich fragte jetzt: „Was meinen Sie damit?“ – „Das werden Sie schon sehen. Ich weiß alles.“ Das wahnsinnige, unwürdige Gebrüll Constens hatte inzwischen die Aufmerksamkeit der in der Nähe herumstehenden Chinesen und Mongolen erregt, sodass ich mich bereits entfernte, aber Consten brüllte, rasend vor Wut, fast möchte ich sagen, blökte noch hinter mir her: „Sie.... Sie.... Sie sind ja größenwahnsinnig!“ Ich war inzwischen um die Ecke gebogen, bestieg mein 916 Pferd und ritt davon.
Alinges Fazit gipfelte darin, Consten als einen gemeingefährlichen Menschen zu bezeichnen, der „vor nichts zurückschrecken wird, wenn er seine Interessen bedroht glaubt“. Mit dem abschließenden Satz „Vielleicht bildet er ein dankbares Objekt für den Psychiater“ hat er insofern einen Punkt getroffen, als Constens Aufzeichnungen und Briefe während dieser Reise hinreichend Aufschluss darüber gaben, was sich hinter all seiner Wichtigtuerei 479
V. Die letzte Expedition 1928–1929
verbarg: Einsamkeit und Depression, ein gestörtes Selbstwertgefühl und die Unfähigkeit, an die eigentlichen, tieferen Ursachen seiner Probleme zu gelangen. Die Schwierigkeiten, denen Hermann Consten auf seiner Reise begegnete, warfen ihn ein ums andere Mal auf sich selbst zurück, ließen ihn erstmals überhaupt die Frage nach dem Warum stellen, verwiesen ihn in seinen Träumen auf seine persönliche Verantwortung, zwangen ihn zum Nachdenken. Die Wintermonate als Gefangener im mongolisch-chinesischen Grenzgebiet zeigten ihn vor allem auch als einen Gefangenen seiner selbst.
480
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950 1. Mittellos in Peking – Überleben als Reitlehrer Wieder einmal hat Hermann Consten alles verspielt. Nun steht er in Peking buchstäblich mit leeren Händen da, ist auf Hilfe angewiesen. Zunächst einmal muss er sich darüber klar werden, was er nun tun soll. Nach Deutschland zurückkehren? Dann müsste ihm die Gesandtschaft wohl das Geld für die Rückreise vorstrecken. Aber was erwartet ihn in Deutschland? Wovon soll er in Zukunft dort leben, wenn die wichtigsten seiner bisherigen Geldquellen, die regelmäßigen Überweisungen aus Aachen und Budapest, für immer versiegt sind? Trotz des brennenden Heimwehs, das ihn in den letzten Monaten quälte, erscheint es ihm dann doch besser, vorerst in Peking zu bleiben, sich irgendwie durchzuschlagen und auf bessere Zeiten zu hoffen. Auch hält ihn die Idee, seine Mongolei-Expedition irgendwann doch noch realisieren zu können, in Peking. Für den besonderen Charme der alten Kaiserstadt, die in der seit Jahrzehnten von Unruhen erschütterten Chinesischen Republik fast noch wie eine Insel der Ruhe wirkt, dürfte Consten ebenfalls nicht unempfänglich sein – Gründe genug also, um zu bleiben. Fürs Erste kann er auf Unterstützung durch seinen kleinen deutschen 917 Bekanntenkreis in Peking rechnen. Die Familie Bertram, von wo er vor Jahresfrist mit seiner „Todeskarawane“ (Zitat Consten) aufgebrochen war, nimmt ihn in ihrem schönen Bungalow in Paomachang auf. Auch der Re918 präsentant der Luft-Hansa, Wilhelm Schmidt, die Diplomatenfamilie 919 920 Scharffenberg, das Ehepaar Sterz und einige andere kümmern sich um ihn, versorgen ihn mit dem Nötigsten – Geld, Essen und Kleidung. Vor allem aber steht die Gesandtschaft hinter ihm. Wohl nicht zuletzt auch in dem Wissen um seine einflussreichen Gönner in Berlin, lässt es der neue Gesandte, Herbert von Borch, sogar auf einen Rüffel gegenüber Generalkonsul Betz in Tientsin ankommen. Dieser hatte sich Anfang Juni 1929 geweigert, einen Antrag Constens auf einen neuen Inlandsreisepass für die Provinzen nördlich der Großen Mauer durch den zuständigen Tientsiner Fremdenkommissar abstempeln zu lassen. Consten hatte nämlich ein Schreiben von Pater Dupont erhalten, mit der Bitte, bei nächster sich bietender Gelegenheit nach Uniutai zu kommen oder jemanden zu schicken, um die in der Mission deponierten Teile der Expeditionsausrüstung abzu481
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950 921
holen, die er seinerzeit nicht mehr in die Mongolei mitgenommen hatte. Betz war wegen der vielen Scherereien, die ihm Consten durch seinen überstürzten Aufbruch ohne mongolischen Pass, die Änderung seiner Reiseroute, sein Verschwinden und den Streit mit Curt Alinge und Ethel J. 922 Lindgren verursacht hatte, ganz offensichtlich verärgert. Wie jedenfalls in der Akte „Expedition Consten“ befindliche Dokumente belegen, äußerte Betz gegenüber der Gesandtschaft in Peking Bedenken, den von Consten beantragten Reisepass ausstellen zu lassen und lieferte dazu folgende Begründung: Die chinesischen Behörden warnen noch immer regelmäßig vor Reisen in Jehol, Suiyuan, Chahar, Kansu und der Inneren Mongolei wegen Räuberund Aufstandsgefahr. Nach den mit Consten auf seiner Reise nach Urga gemachten Erfahrungen bestehen Zweifel darüber, dass er wirklich ernsthafte wissenschaftliche Zwecke verfolgt. Auch dürften ihm die Geldmittel 923 zur Ausführung derartiger Reisen fehlen. Er lebte hier wie in Peiping von der Gastfreundschaft seiner Landsleute. Mit der Amerikanerin Miss Lindgren, die die Kosten der Consten’schen Expedition von Berlin bis Urga getragen hat, hat Consten sich überworfen, sodass es fraglich ist, ob ihm von dieser Stelle die seinerzeit zugesagten Kosten der Heimreise noch gezahlt werden. Über eigene Geldmittel soll Consten nicht verfü924 gen.
Doch der Gesandte reagierte kühl mit dem Hinweis, es doch lieber den chi nesischen Behörden zu überlassen, Reisen von Ausländern in gefährdete Gebiete zu unterbinden. Für die deutschen Dienststellen in Ostasien gelte noch immer die Anweisung aus Berlin, Consten bei der Verfolgung seiner 925 Ziele Hilfe zu leisten. Am 27. Juni hält Hermann Consten seinen neuen Pass in Händen – nicht ahnend, dass just an diesem Tag Vertreter der Sowjetunion und der Mongolischen Volksrepublik in Ulaanbaatar einen Geheimvertrag unterschreiben, der sein „Schicksalsland“ auf unbestimmte Zeit jedem weiteren Zugang durch Angehörige des „kapitalistischen Aus926 lands“ verschließt. Zwischenzeitlich war Alinges 20-seitiger Bericht über Constens Verhalten gegenüber Miss Lindgren und ihm in Peking eingetroffen. Die Gesandt927 schaft reichte die Beschwerdeschrift samt Anlagen dem Generalkonsulat 482
1. Mittellos in Peking – Überleben als Reitlehrer
Tientsin zur Kenntnisnahme weiter. In seiner Rückantwort bat Betz um Weisung, „ob seitens der Gesandtschaft eine Informierung des Auswärtigen Amts aufgrund des dort vorhandenen Materials, das gegebenenfalls von 928 hier aus ergänzt werden könnte, beabsichtigt ist“. Doch stellte es v. Borch dem Generalkonsul anheim, einen solchen Bericht „auf Grund der anscheinend dort vorliegenden umfangreicheren Informationen“ selbst zu schreiben und über ihn nach Berlin weiterzuleiten. Er selbst befand jedenfalls, 929 das Elaborat Alinges sei zur Weiterleitung an das AA „kaum geeignet“. Da sich ein solcher Bericht des Generalkonsulats Tientsin in der Akte „Expedition Consten“ nicht mehr fand, ist davon auszugehen, dass er wohl unterblieb. Consten jedenfalls bricht im Juli 1929 nach Norden auf und unternimmt einen „Autoritt“ – wie es Pater Dupont in seinem in köstlichem, mit flämisch-französischen Einschüssen durchsetztem Deutsch verfassten Einla930 dungsbrief treffend formuliert hatte. Auf dem Weg nach Jehol wimmelt es von Soldaten – Kavallerie-Einheiten der Nationalrevolutionären Armee Chiang Kaisheks. Diesmal reiten auch sie nach Norden. Sie sollen dem 931 „Jungen Marschall“, General Zhang Xueliang, mit dem sich Chiang Kaishek nach seinem Bruch mit den Kommunisten verbündet hatte, um seine Macht in Nordchina zu festigen, gegen den drohenden Einmarsch der Russen in der Mandschurei beistehen. Chinesische Truppen hatten im Mai 1929 das sowjetische Generalkonsulat in Harbin besetzt und etliche Sowjetbürger gefangen genommen, das Telegrafensystem der von den Russen kontrollierten Ostchinesischen Eisenbahn wurde beschlagnahmt, das russische 932 Bahnpersonal kurz darauf entlassen. Trotz vieler Kontrollen und schlechter Straßenverhältnisse und ungeachtet der Kriegsgefahr, zieht es Consten nach Haobutu und Uniutai, um wenigstens den dort lagernden Teil der Expeditionsausrüstung wieder in seinen Besitz zu bringen, bevor sich die Lage weiter verschärft. Die auf einem in Constens letztem Expeditionsjournal einliegenden Zettel notierte Liste der Kisten, Koffer, Ballen, Zelte und anderer bei den Scheuter Missionaren deponierter Materialien belegt, dass es sich teils um persönliche Habe handelte – seine alte Kamera- und Filmausrüstung aus der Vorkriegszeit zum Beispiel –, teils um Gegenstände, die eindeutig zur Ausrüstung der Lindgren-Expedition gehörten, darunter mehrere amerikanische Reitsättel, 483
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
Steigbügel und Zaumzeug, Zelte, Matten, Tische und Stühle, Rettungsringe 933 und Medizinkoffer. Der andere, in der Mongolei verbliebene Teil der Ausrüstung sollte – bedingt durch den Abbruch der diplomatischen Beziehungen Chinas zur UdSSR am 17. Juli 1929, den Ausbruch der Kampfhand934 lungen und die Schließung der mongolisch-chinesischen Grenze – erst 1931 in Kalgan an Ethel J. Lindgren übergeben werden. Sie ließ Consten wenig später einige persönliche Dinge, darunter die kleine kupferne Druckplatte seiner auf Consten Bey lautenden Visitenkarte aus der Zeit seiner Kriegszusammenarbeit mit Enver Pascha, über die deutsche Gesandtschaft 935 zustellen. Consten sollte seinerseits 1931 weniger Veranlassung denn je sehen, die im Sommer 1929 von ihm sichergestellten Ausrüstungsteile ebenfalls an die rechtmäßige Besitzerin auszuhändigen. Denn in der Zwischenzeit war ihm die rettende Idee gekommen, sie könnten den Grundstock für eine neue Existenz bilden. Auch war er überzeugt, dafür längst bezahlt zu haben. Lindgrens Anwalt nämlich hatte, nach mehrmaligen vergeblichen Versuchen, Consten in Peking oder Tientsin persönlich zu sprechen, ihm noch im 936 April 1929 über die Deutsche Gesandtschaft rechtliche Schritte angedroht und ihn schließlich mit einer Schadensersatzklage wegen Vertragsbruchs und Nichtherausgabe der Expeditionsausrüstung konfrontiert. Da er sich selbst keinen Anwalt leisten konnte, war Consten wohl keine andere Wahl geblieben als Zahlung zu leisten. Die geforderte Summe – ihre Höhe ist nicht bekannt – musste er sich irgendwie beschaffen. Hilfe suchend wandte er sich an seine Freunde in Deutschland. Nun schlug die Stunde Margarete Strölins, die noch immer Constens Wohnung in Bad Blankenburg hütete. Sie beriet sich mit seinen thüringischen Bekannten und setzte eine Hilfsaktion in Gang. Die Saalfelder Schlaraffen spendeten Geld, und auch seine Bundesbrüder Wolman und Herrmann sammelten Spenden unter den Karlsruher Arminen. Insgesamt 700 Reichsmark konnte Frau Strölin nach Peking überweisen. Consten dankte u.a. mit einem langen Brief an den Ehrenrat der Arminia, der den Burschenschaftern 1930 in ihrem Mitteilungsblättchen zur Kenntnis gegeben 937 wurde. Darin schilderte er noch einmal ausführlich seine Erlebnisse während der gescheiterten Expeditionsreise. Der Text ist insofern aufschlussreich, als sich an ihm exemplifizieren 484
1. Mittellos in Peking – Überleben als Reitlehrer
lässt, in welcher Weise sich Geschehnisse verändern können, wenn sie einen Filter der Tatsachenverdrehung passiert haben. Ob Consten dies mit Bedacht tat oder ihm sein Unterbewusstsein, wie wohl häufiger der Fall, einen Streich spielte, ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Es sei denn, Consten hätte sich in sein eigenes Urteil über Lügner und das Lügen mit einbezogen. „Der Durchschnittsmensch“, so schrieb er in einem seiner späteren Briefe an Grete Strölin, „lügt unbewusst aus Angst und Wich938 tigtuerei“. Wie auch immer, hier soll es nicht um eine moralische Wertung oder Verurteilung gehen, die schnell und billig zu haben wäre, sondern um ein Sich-hinein-versetzen-können in eine solche Persönlichkeitsstruktur, um den Versuch, das Phänomen des „lögenhaft to vertellen“ nachzuvollziehen. So zitierte einer von Constens Pekinger Bekannten, der Schriftsteller Karl Heinz Abshagen, die plattdeutsche Definition für Leute 939 wie Consten durch einen Onkel. Nun aber zu Constens Bericht für die Arminen: Einige durchaus brenzlige Episoden während seiner Reise durch die Innere Mongolei hat er in dem erwähnten Brief noch zusätzlich dramatisiert und ausgeschmückt. Seine gelegentlichen Begegnungen mit echten oder vermeintlichen Chunchusen wurden dabei zu „täglichen schweren Kämpfen“ mit den Räuberbanden; in den Kämpfen seien „einige meiner Chinesen, Mohammedaner“ sogar umgekommen, erklärte er. Dies können jedoch keineswegs die Leute aus Constens Tross gewesen sein, sondern allenfalls gewöhnliche Dorfbewohner. Andere Situationen wiederum wurden – legt man die Einträge in seinen Tagebüchern als zutreffend zugrunde – völlig anders dargestellt als sie sich abgespielt hatten. So behauptete er wider besseres Wissen, seine drei Kameltreiber, die mit ihm die mongolische Grenze überquert hatten, seien von dem dortigen Grenzposten gezwungen worden, nach China zurückzukehren und anschließend in der Winterkälte umgekommen. Dabei hatte sich Consten von den drei Russen in Narijn Bulag doch noch ausdrücklich bescheinigen lassen, die Chinesen seien freiwillig zurückgegangen; ihr „Umkommen“ war lediglich eine Befürchtung seinerseits gewesen, dass dies passieren könnte. Von Pater Dupont wusste er inzwischen aber, dass sie wohlbehalten zurück waren. Schwere Vorwürfe erhob Consten auch gegen die Zollbeamten von Ulaanbaatar: Mein Aufenthalt in Urga war ein Martyrium. Meine Sachen wurden in 485
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
der mutwilligsten Weise vernichtet, meine Filmaufnahmen in infamer Weise einfach zerstört. Täglich gab es immer wieder neue Chikanen [sic] 940 der GPU, der alten Ochrana. Verhöre, Untersuchungen!
Im Reisejournal finden sich Einträge zu Constens Fotomaterial von der Expedition, die belegen, dass nichts davon zerstört worden ist. Er hatte es nach der Freigabe des Gepäcks dem in Ulaanbaatar lebenden Fotofachmann Schonauer – vermutlich ein Österreicher – zur Entwicklung gegeben und holte es unmittelbar vor seiner Abreise bei ihm ab. „Bei Schonauer ein großer Teil der Bilder gut“, schrieb er unter dem 21.3.1929. Seine in Ulaanbaatar gemachten Aufnahmen entwickelte Consten selbst. Sie waren eben941 falls gut, wie er tags darauf notierte. Sehr wohl aber hatte er während seines Aufenthaltes in Haobutu einen Teil der Aufnahmen, die er von seinen Ausgrabungen am Cagaan Čuluu gemacht hatte, nach dem Entwickeln 942 zu lange gewässert und dadurch selbst verdorben. Das noch vorhandene, teilweise sogar hervorragende Bildmaterial bildete schließlich, fast 80 Jahre später, den Grundstock für die Consten-Fotoausstellung 2005. Wohlweislich verschwieg er in seinem Bericht die Freigabe des beschlagnahmten Gepäcks und sein Vertragsverhältnis mit Miss Lindgren. Aufschlussreich war seine Begründung, weshalb er in China bleiben wollte. „Ließ ich mich nach Hause schicken, so war mein Ansehen hier in Asien und bei den Behörden für immer dahin“. Hielte er durch, so habe er wenigstens eine kleine Aussicht, „anderthalb Jahre wissenschaftliche Arbeiten“, seine Sachen, d.h. seine Ausgrabungsgegenstände, zu retten und sei943 nen „wissenschaftlichen Ruf nicht zu schädigen“. Gottlob Mayer, Lektor des Union-Verlags Stuttgart und offenbar ein glühender Verehrer des Schriftstellers Hermann Consten, erkundigte sich im Januar 1930 bei der Gesandtschaft besorgt nach dem Verbleib und Ergehen seines Autors und Mitarbeiters der Publikationsreihe „Buch für 944 Alle“. Consten hätte auf Briefe und Telegramme bislang nicht geantwor945 tet. Dr. Wilhelm Arning, der nach dem Tod von Ernst Fabarius 1927 die Leitung der Kolonialschule Witzenhausen übernommen hatte, machte sich ebenfalls Gedanken über Constens Schicksal, nachdem er von einem Saalfelder Bekannten davon gehört hatte. Er wollte, um ihm zu helfen, seine Verbindungen zu einer Persönlichkeit spielen lassen, die – nach einer unrühmlichen Rolle als engster Mitstreiter Erich Ludendorffs und Adolf Hit486
1. Mittellos in Peking – Überleben als Reitlehrer
lers beim Putschversuch 1923 in Bayern – inzwischen als Militärberater zu Chiang Kaishek nach Nanking gewechselt war: zu Oberstleutnant a. D. 946 Hermann Kriebel. Vielleicht hatte Kriebel ja eine Verwendung für Consten. Um zuvor jedoch genaueres über Constens Schicksal und seinen Verbleib zu erfahren, wandte sich Arning als erstes an Margarete Strölin – und erfuhr von ihr eine weitere Variante der Geschichte von der missglückten Expedition: Sie begann damit, dass Consten zeitweise von der chinesischen Nordarmee gefangen gesetzt worden sei. Weiter schrieb sie an Arning: Später wurde Dr. Consten von Mongolen hoch oben im Gebirge ½ Jahr gefangen gehalten. Nur zwei russischen Handelsjuden verdankt er, dass er frei u. nach Urga kam. Dort wartete eine Schwedin auf Dr. Consten, die an der Expedition mit teilnahm. Selbige Dame hat sich das ½ Jahr in Urga viel zuschulden kommen lassen u. wurde, als Dr. Consten in Urga ankam, als spionageverdächtig nach Tientsin geschickt. Da Dr. Consten nun mit ihr doch zusammen die Expedition machte, ereilte ihn dasselbe Schicksal. […] Die Dame hatte dann noch Dr. Consten einen Prozess angehängt u. ihn für das Misslingen der Expedition u. die beschlagnahmten Ausrüstungsgegenstände verantwortlich gemacht. Da Dr. Consten kein Geld hatte sich einen Anwalt zu nehmen, so 947 verlor er natürlich.
In Peking lebe Consten jedoch ganz unbehelligt, fuhr Frau Strölin fort. „Er bittet allerdings immer, dass man ihm nichts über Politik usw. schreibt, wegen der Russen“. Und sie fügte noch an: „Weshalb Dr. Consten die Russen fürchtet, weiß ich nicht, wohl noch eine Sache von dem Weltkrieg her.“ Wohl in Zusammenhang mit dem Bestreben, Arning zusätzliche Informationen zu seinen Überlegungen zu liefern, wie man Consten am besten helfen könnte, hatte sie eine Truhe in Constens Bibliothek geöffnet und war über ihren Inhalt einigermaßen erschrocken gewesen. Sie schrieb Consten vorsichtshalber, ob der Inhalt nicht doch zu brisant sei, um weiterhin aufbewahrt zu werden. Auch hielt sie ihn auf dem Laufenden, was sie inzwischen für ihn unternommen hatte. Consten reagierte unwirsch. Du regst Dich über den Inhalt der Truhe beim Öffnen auf. Es sind meine Kriegsberichte als Chef der Nachrichtenabteilung des Generalstabs des Feld948 heeres für den Balkan. Ich gab die einlaufenden Nachrichten über die oberste Kriegsleitung nach Berlin weiter. Das übrige was Du da glaubst und an487
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950 949
nimmst ist unrichtig. Ich habe diese Berichte sorgsam aufgehoben, um eines Tages Material zur Veröffentlichung zu haben. Der Inhalt ist weder aufregend 950 noch gefährlich. Du hast dein Testament gemacht. Allright.
Das „Allright“ hatte Consten offenbar dem unverwüstlichen Pater Dupont abgelauscht, der es ebenfalls gerne und häufig anwandte, wenn ihn unheiliger Zorn packte. Zu Arnings Überlegung, sich an Kriebel zu wenden, teilte ihr Consten mit, er habe selbst bereits Fühler in dieser Richtung ausge951 streckt. Kriebel sei inzwischen abberufen und durch Generalleutnant a.D. 952 Georg Wetzell ersetzt worden. Er selbst habe sich inzwischen längst mit Herrn von Zanthier in Verbindung gesetzt, der von Chiang Kaishek als Zivilberater für Landwirtschaft engagiert worden sei. Von Zanthier suchte einen Berater für die Mongolei, da die chinesische Regie953 rung ihre Interessen in der Mongolei nicht aufgeben will. Obwohl Freunde von mir persönlich in Nanking resp. Shanghai bei v. Zanthier waren, war die Sache vergebens. Zanthier hat keinen Einfluss, wie deutsche Offiziere den Chinesen gegenüber überhaupt ohne jeden größeren Einfluss sind. Die Sache hat nur Hand und Fuß, wenn die deutsche Industriegruppe, die Bauer und Kriebel 954 955 hinausgeschickt haben, mir helfen [sic].
Es wäre besser gewesen, so Consten in seinem Brief an Grete Strölin, sie sie hätte sich erst mit Gottlob Mayer vom Union-Verlag in Verbindung gesetzt. Der solle gemeinsam mit Arning etwas unternehmen. Wenn Arning und Mayer die Sache in die Hand nehmen, so kann ich entweder meine Expedition zu Ende führen, oder als Berater der chinesischen Regierung für die Mongolei in der Nähe meines Spezialgebietes bleiben und leben. – 956 Im übrigen hat Gottlob Mayer genaue Berichte über meine Reise.
Ihm allein, so Consten, habe er die „volle Wahrheit“ über seine Expedition anvertraut. Mayer verspreche sich von seinem Vorhaben, falls ihm die Durchführung noch gelinge „das Größte, was seit langer Zeit geschehen 957 ist“. Selbstverständlich werde dann die Deutsche Kolonialschule nicht leer ausgehen. Auch dann nicht, wenn er als Mongolei-Berater der chinesischen Regierung tätig werden könne. „Ich wäre dann wohl auch in der 958 Lage, später manchen jungen Kameraden hier draußen zu helfen.“ Für Margarete Strölin war es neu, dass Gottlob Mayer über Constens 488
1. Mittellos in Peking – Überleben als Reitlehrer
Schicksal und seine Pläne genau unterrichtet war. Immerhin stellte die treuherzige Sachwalterin der Constenschen Angelegenheiten unverzüglich den Kontakt zwischen Arning und Mayer her. Arning erbat nun von Mayer Einzelheiten über Constens Pläne, um sich dann an Kriebel wenden zu können. Dieser befinde sich offenbar doch noch „im vollen Besitze seines 959 Einflusses“. Mayer antwortete umgehend, nannte Constens Lage „menschlich ergreifend“ und „hilfsbedürftig“, denn er habe nach dem Scheitern der Expedition „durch die Überfälle von räubernden früheren Soldatenbanden“ nur sein Leben retten können. Nach seiner Einschätzung war 960 Consten unverschuldet in Not geraten. Sein Versuch, über die Studienkommission des Reichsverbandes der Deutschen Industrie (RDI) der Mili961 tärmission in Nanking empfohlen zu werden, sei ohne Ergebnis gewesen. Wenn nun Herr Dr. Consten, der genaue Kenner der Mongolei, dort einen Posten als Mitarbeiter des Herrn von Zanthier erhalten könnte, wäre er wie kaum ein zweiter in der Lage, die Interessen der deutschen Industrie dort zu 962 vertreten. Schon in der Einleitung seines oben angeführten Mongolenwerkes schildert er sein Eintreten für den deutschen Handel unter den Chalch-Mongolen, mit denen ihn noch heute gute Beziehungen verknüpfen. Ein solcher Mann darf nicht untergehen, schon weil er in der von allen Weltmächten umstrittenen Mongolei ein Stützpunkt der deutschen Industrie und des deutschen 963 Handels werden könnte.
Der Stuttgarter Verlagslektor war von Consten ganz offensichtlich nicht darüber informiert worden, dass in den vorangegangenen Jahren deutsche Industrie- und Handelsvertreter wie auch Fachberater in der Mongolei tätig gewesen waren, und zwar auf der Basis einer direkten Wirtschaftsvereinbarung zwischen dem Deutschen Reich und der Mongolischen Volksrepublik. Auch dass die Deutsch-Mongolische Handelsgesellschaft (Tientsin) ein Büro in Ulaanbaatar unterhielt, schien ihm ebenso wenig bekannt zu sein wie die Tatsache, dass diese Zusammenarbeit aufgrund des ideologischen Kurswechsels 1928/29 vom Regime in Ulaanbaatar eingestellt worden war. Kam hinzu, dass Consten selbst schon 1923 in seinen Denkschriften für Asmis und Gipperich Skepsis gegenüber den Aussichten einer landwirtschaftlichen Entwicklung der Mongolei durch ausländische Experten geäußert 964 hatte. Jedenfalls war Mayer überzeugt, Consten sei mit den mongoli489
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
schen Verhältnissen so vertraut, „wie wohl zur Zeit nur wenige Deutsche“. Eine Intervention zu seinen Gunsten würde ihm in seiner jetzigen Lage sehr helfen, … aber nicht nur ihm allein, sondern auch der deutschen Industrie, dem deutschen Handel, der deutschen Wissenschaft und der Forschung, denn das Wirken dieses erfahrenen Mannes in der Mongolei wäre zweifellos auch geeignet, das deutsche Ansehen in diesem großen Gebiet zu stärken, dessen Durchdringung Sowjetrussland mit allen Mitteln seiner unterirdischen Geheimtätigkeit anstrebt. Neben diesem wirtschaftspolitischen Ziel wäre aber Herr Dr. Consten noch in der Lage, sein hochbedeutsames kulturgeschichtliches Forschungsziel 965 im Auge zu behalten.
Dieses „hochbedeutsame Ziel“ konkret zu benennen, sah sich Gottlob Mayer jedoch außerstande: Leider hat Herr Dr. Consten mir hinsichtlich des letzteren strengste Verschwiegenheit auferlegt, so dass ich mich darüber nicht so äußern darf, wie ich es gerne Ihnen gegenüber zur Unterstützung meines Ersuchens getan 966 hätte.
Nicht nur Wilhelm Arning dürfte über diese Auskunft enttäuscht gewesen sein, auch die Autorin hätte es begrüßt, endlich einmal aus berufenem Munde zu erfahren, welches das geheimnisumwitterte Projekt war, um dessentwillen Hermann Consten so viele Strapazen und „Demütigungen“ auf sich genommen hatte und weiter in Peking ausharrte. So bleibt es bei der auf den bereits genannten Indizien fußenden Vermutung, dass es sich um die Ausgrabung des von Consten in seinen „Weideplätzen“ erwähnten Fürstengrabs am Bajdrag und des benachbarten Gräberfeldes gehandelt haben musste, das ihm die russischen Goldgräber 1912 gezeigt hatten. Zum Schluss seines Briefes empfahl Mayer noch, Arning möge Consten auch der 967 Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft empfehlen, der erhebliche Beträge für Forschungszwecke zur Verfügung ständen. Doch, wenn Consten an diese Mittel herankommen wollte, dann hätte er sein Projekt schon genau vorstellen müssen. Die Notgemeinschaft unterstützte z.B. einige der deutschen Wissenschaftler, die in den Jahren 1927 bis 1935 mit der HedinExpedition unterwegs waren und konkret definierte Einzelprojekte durch490
1. Mittellos in Peking – Überleben als Reitlehrer
führten; unter ihnen befanden sich akademische Koryphäen wie die Profes968 soren Ferdinand Lessing und Erich Haenisch. Bis in den Herbst 1930 hinein ist Constens Lage in Peking unverändert prekär. „Herr Dr. schreibt recht niedergeschlagen“, berichtet Margarete Strölin nach Witzenhausen, „ist wieder im Zweifel, ob es wohl jemals Hilfe 969 für ihn gäbe.“ Arning wendet sich nun auch direkt an Herrn v. Zanthier, bei dem er sich zuvor schon für den Einsatz von Kolonialschülern beim ländlichen Aufbau Chinas stark gemacht hatte. Er bittet ihn, für den Fall, dass er selbst keine Verwendung für Consten habe, sich bei Oberstleutnant Kriebel für den in Peking Gestrandeten einzusetzen. Nicht ahnend, dass es zwischen den zivilen deutschen Beratern Chiang Kaisheks und den Militärberatern gerade wegen des politisch vorbelasteten Kriebel zu erheblichen 970 Spannungen gekommen war, beruft er sich in diesem Zusammenhang auch noch auf seine enge Bekanntschaft mit Kriebel aus der „gemeinsamen 971 Arbeit für die Bewaffnung des Bürgertums gegen den Marxismus“. Arning schreibt auch noch an einen anderen Haudegen aus der einstigen Seilschaft der bayerischen Freikorpskämpfer, Forstmeister Georg Escherich, und bittet ihn, er möge seinen Brief an Kriebel nach Nanking weiterleiten, 972 da er dessen Adresse nicht kenne. Consten schaltet sich zwischenzeitlich selbst in die lebhaft gewordene Korrespondenz um seine Person ein. Zunächst einmal bedankt er sich bei Arning für dessen Einsatz. Seine Lage – „man kann es ruhig ein schäbig glänzendes Elend nennen“ – werde sich sicher auch wieder einmal ändern, möglicherweise ja auch dank Arnings Hilfe. Von Zanthier verspreche er sich aber nicht allzu viel, da dieser „in Bezug der Personalfrage beschränkt und ängstlich“ sei. Kriebel und dessen Frau kenne er flüchtig „aus der bös aufgeregten Zeit Münchens“. Was nun mich selbst betrifft so kenne ich politisch, wie volkswirtschaftlich die Mongolei so genau wie wohl kaum ein anderer Deutscher. Ich spreche hier nicht nur von der sogenannten „Äußeren Mongolei“, sondern auch von der Inneren Mongolei, die ich noch vor 1 ½ Jahren durchzogen habe. – Seien Sie versichert, dass wenn ich wieder im Sattel sitze, oder besser gesagt, aus dem Strudel[,] der mich hinuntergezogen hat[,] wieder herauskomme, ich meine alte 973 Schule in Witzenhausen, der ich soviel verdanke nicht vergessen werde.
491
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
Die Bemühungen seiner Freunde in Deutschland, Consten aus seiner Notlage herauszuhelfen, ziehen sich noch weit bis in das Jahr 1931 hinein. Auch wenn er sich immer wieder am Rande der Verzweiflung bewegt und in Peking „unterzugehen droht“, wie es Gottlob Mayer zu Jahresbeginn in einem Brief an Arning nochmals voller Sorge an die Wand malt, so scheint Consten doch angefangen zu haben, sich in seinem „schäbig glänzenden Elend“ irgendwie einzurichten. Mit Hilfe der Pekinger Freunde hat sich für ihn immerhin eine Beschäftigung gefunden, die ihn nicht vollends unter die Räder kommen lässt. Zunächst lebt er äußerst bescheiden in der Nähe des Chien Men, des südlichen Einfallstors in die ehemalige Hauptstadt, etwa in der Gegend, wo sich bis vor wenigen Jahren noch der Pekinger Hauptbahnhof befand. Schließlich kann er ein kleines, etwas heruntergekommenes Anwesen im Südosten der Tatarenstadt, zwischen dem Gesandtschaftsvier974 tel und dem alten Observatorium beziehen. In Lao Chien Yü, einem typischen Pekinger Wohnviertel mit mauerumschlossenen Hutong – schmalen, ungepflasterten Gassen – richtet sich Consten in dem ganz am Ende einer unscheinbaren Sackgasse gelegenen Anwesen Nr. 16, genannt Pao Chan Ta Miao (Großes Kanonengießer-Kloster), mit einigen Mongolenponies einen Reitstall ein. Gegen eine geringe Futtermiete können auch Gäste und ausländische Touristen hier bei ihm ihre Pferde unterstellen. Mit Hilfe eines mafu, eines Pferdeknechts, betreut Consten die Tiere und bewegt sie täglich in der Frühe für ihre Besitzer auf dem Glacis, dem nach dem Ende des Boxeraufstands angelegten freien Schussfeld rund um das Gesandtschaftsviertel. Bald bietet er auch Reitstunden und Ausflüge zu Pferd in die Umgebung an; sie werden vor allem von den Ehefrauen der in Peking lebenden ausländischen Diplomaten und Geschäftsleute wie auch von der Schuljugend der deutschen Gemeinde gern wahrgenommen. Hermann Consten sitzt also wieder im Sattel – vorzugsweise dem mexikanischen Cowboysattel. Auch wenn dieser eigentlich Ethel J. Lindgren beziehungsweise Curt Alinge ge975 hört, dem sie ihn für seine Dienste in Ulaanbaatar versprochen hatte, und er sich vorerst nur im Großraum Peking bewegen kann, hilft ihm die neue Betätigung, irgendwie über die Runden zu kommen. Im Laufe des Jahres gesellt sich zu dem einsam lebenden, langsam alternden Junggesellen Con laoye – „Alter Herr Con“ – noch eine Meute mongolischer Windhunde, wie 492
1. Mittellos in Peking – Überleben als Reitlehrer
sie einst für die kaiserlichen Jagden der Mandschurenherrscher der Qing gezüchtet wurden. Im Mai 1931 erhält Arning einen langen Brief von Kriebel aus Hangzhou, wohin dieser nach seiner Ablösung als Leiter der deutschen Militär976 mission durch Oberst Wetzell offenbar versetzt worden war. Kriebel teilt ihm mit, er werde versuchen, Consten über die Gesandtschaft zu erreichen, denn: Aus ganz gewissen Gründen glaube ich annehmen zu können, dass man sich in China sehr über die Verhältnisse in der Mongolei interessiert. Denn bei den zur Zeit in Moskau stattfindenden Verhandlungen über die chinesische Ostbahn wollen die Chinesen nach Zeitungsberichten auch die Frage der Mongolei und der sowjetrussischen Umtriebe dort aufs Tapet bringen. Es interessiert sich sowohl die Nankingregierung für diese Frage als auch die Regierung in der Mandschurei, diese natürlich nur soweit die mandschurisch-mongolische Grenze in Frage kommt. Denn die Nankingregierung hat die Zügel fest in der Hand und macht die chinesische Außenpolitik allein ohne Chang Hsue Liang 977 [Zhang Xueliang]. Ich will also sehen, was sich machen lässt.
Sowohl Arning als auch Mayer unterrichten Consten umgehend über diesen Hoffnungsschimmer. Consten reagiert auf Mayers Brief erst im Juli 1931, um mitzuteilen, dass sich diese Hoffnung wieder zerschlagen und ihn „die Mutlosigkeit der grauen Not“ weiterhin fest im Griff habe. Von Kriebel und Nanking habe ich nie etwas gehört. Vielleicht haben die Leute jetzt grade die Hände einmal wieder voll Arbeit, die roten Banditen und wi978 derspenstigen Generale niederzukämpfen.
Dass sich auch im Norden die Lage erneut zuzuspitzen beginnt, erwähnt Consten in seinem Brief zwar nicht, wohl aber den Abschuss der Eurasia II über mongolischem Staatsgebiet Anfang Juli 1931. Die Maschine flog für ein im September 1930 gegründetes chinesisch-deutsches Joint Venture, an dem die Deutsche Luft-Hansa AG zu einem Drittel beteiligt war. Die LuftHansa stellte die in China stationierten Postflugzeuge, zwei Ju F 13 und zwei Ju W 33, samt deutscher Besatzung. Die Maschinen verkehrten seit Mai 1931 zweimal wöchentlich auf der etwa 2.500 Kilometer langen Strecke zwischen Shanghai und Manzhouli, mit Zwischenstopps in Nanking, Tsi493
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
nan, Peking und Linxi. Von Manzhouli wurde die für Europa bestimmte Post auf der Transsib bis Irkutsk weiterbefördert, von dort mit einer sowjetischen Luftfrachtgesellschaft nach Moskau und mit dem deutsch-russischen Luftfahrtunternehmen De-Ru-Luft nach Berlin geschafft, von wo aus sie in andere Hauptstädte Europas verteilt wurde. Eurasia-Pilot Hannes Rathje hatte auf dem von Consten erwähnten Unglücksflug die Maschine noch notlanden können, sein Bordmonteur Otto Kölber war bei der Beschießung durch mongolische Grenzposten in den linken Unterschenkel getroffen worden und blutete heftig. Beide Besatzungsmitglieder hatte man an der Abschussstelle in der Nähe des Bujr Nuur, eines Steppensees im äußersten Osten der Mongolischen Volksrepublik, verhaftet und den verletzten Kölber in das nächste, 400 Kilometer entfernte Hospital gebracht, wo ihm das Bein oberhalb des Knies amputiert werden musste. Anschließend landeten die beiden Piloten im Gefängnis. In Ulaanbaatar wurde ihnen dann vor dem Mongolischen Volksgerichtshof 979 ein spektakulärer Prozess gemacht. „Sie sehen, die Mongolen der Äußeren Mongolei versuchen, ihre nicht anerkannten Hoheitsrechte energisch zu wahren“, lautet Constens sarkastischer Kommentar zu dem ernsten Zwischenfall, der einen scharfen Protest seitens der Reichsregierung und einigen Wirbel in der deutschen und internationalen Presse auslöste. Die Vollstreckung der gegen Rathje und Kölber verhängten mehrjährigen Haft konnte dank diplomatischer Intervention immerhin verhindert werden, zehn Wochen Untersuchungshaft in dem berüchtigten Gefängnis von Ulaanbaatar jedoch nicht. Die Teilstrecke wurde eingestellt und eine Alternativroute über Urumqi in Betrieb genommen. In Zusammenhang mit dem Zwischenfall erwähnt Consten gegenüber Mayer eher beiläufig, er selbst habe am 31. Mai am Erstflug der Eurasia II auf der 1.200 Kilometer langen Teilstrecke Peking–Manzhouli teilgenommen. Die einmalige Gelegenheit, die Große Chinesische Mauer, die Innere Mongolei und den Ostzipfel der Äußeren Mongolei aus der Luft zu betrachten, hatte wohl Wilhelm Schmidt, Mitbegründer und Geschäftsführer der Eurasia, dem gelernten Geographen und Kartographen Consten verschafft, mit dem ihn inzwischen eine enge Freundschaft verband. Von dem denkwürdigen Ereignis – es war wohl Constens erster Flug überhaupt – fand sich ein Foto im Nachlass. Die uniformierte Person ohne Rangabzeichen, 494
1. Mittellos in Peking – Überleben als Reitlehrer
Abb. 27: Consten mit einem deutschen Militärberater vor der Eurasia II auf dem Flugfeld von Peking, 1931
die vor der Junkers-Maschine auf dem Pekinger Flugfeld an Constens Seite steht, ist vermutlich einer der inoffiziellen deutschen Militärberater, die an Pekings Kriegsakademie unterrichteten. Für Consten war dieser Flug gewiss einer der wenigen Lichtblicke in seiner „grauen Not“, und er schließt seinen Brief an Mayer mit dem Satz: „Ich lebe wie ein einsamer Wolf, aber ich lebe.“ Mayer wiederum glaubt gegenüber Arning dennoch die Befürchtung äußern zu müssen, Consten könnte in Peking eines Tages „über Bord gehen“.
2. Zwischen Hutong und Hakenkreuz Ganz ist die Gefahr, dass Hermann Consten irgendwann tatsächlich „über Bord“ gehen könnte, nicht gebannt. Die Flucht in den Alkohol wird immer mehr zum Problem und Gradmesser seiner Verzweiflung. Seinen Freunden fällt auf, dass Consten gelegentlich etwas wunderlich wird, dass er stark zwischen euphorischen und depressiven Gemütszuständen hin und her schwankt. Doch im großen Ganzen hat er sich wohl mit seiner Lage abgefunden. Die gemeinsamen Ausritte zum Sommerpalast und in die Westberge, die Wochenenden in Paomachang, auch eine Autofahrt mit der Familie 495
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
Scharffenberg an Ostern 1931 zu dem alten Exerzierplatz des Kaisers Qianlong und den Ming-Gräbern, mit den Schmidts wenig später an die Große Mauer beleben ihn wenigstens für kurze Momente. Es gibt in und um Peking viel Interessantes zu sehen und zu erkunden. Consten beginnt, sich mit der reichen Geschichte Pekings und seiner Umgebung zu befassen. Er besucht die Mönche im Lamatempel, wird näher mit ihnen bekannt, nimmt an ihren Ritualen teil, bringt seine Freunde zu ihnen. Renate Scharffenberg, Tochter des Botschaftskanzlers, erinnerte sich noch im hohen Alter, wie sie als Elfjährige dorthin mitgenommen wurde: Unvergesslich ist mir ein Besuch im großen Lamatempel in der Stadt – ein Freund unserer Familie, Hermann Consten […], nahm meine Mutter und mich mit zum ihm befreundeten Abt des Tempels, einer Ehrfurcht gebietenden Erscheinung – wir tranken Tee, ganz ungewohnt salzig und 980 gebuttert – nicht dass es mir geschmeckt hätte.
Constens Sprachbegabung und Kontaktfreude machen es ihm leicht, sich rasch einen kleinen chinesischen Wortschatz zuzulegen, der für die Verständigung mit Händlern und Pferdeknechten allemal ausreicht. Auch eine gewisse Kenntnis der Schrift und Grammatik eignet er sich im Laufe der Zeit an. Durch die Reiterei, durch Einladungen zu Botschaftsempfängen und Abendessen hat er einige Abwechslung, erweitert sich sein Bekanntenkreis. „Vor einigen Tagen habe ich eine unmittelbare, durch einen früheren Kolonialschüler überbrachte Nachricht über unseren Freund Dr. Consten erhalten“, schreibt Arning kurz vor Weihnachten 1931 an Gottlob Mayer nach Stuttgart. Kurz vor seiner Rückkehr nach Deutschland sei jener Herr bei einer Abendgesellschaft auf Consten gestoßen. „Dieser hat im äußeren Aussehen, sowohl was seine Kleidung wie seinen Ernährungszustand anbelangt, einen durchaus normalen und zufriedenstellenden Eindruck gemacht“, so Arning weiter. Von anderer Seite habe sein Bekannter aber gehört, „dass Consten sich pekuniär sehr schlecht stehe und nur schwer 981 durchringen könne“. Dieser Eindruck wird bestätigt durch Hertha Bälz-Wermbter, deren Mutter Hertha, geb. Basel, als junges Mädchen 1931 zusammen mit anderen Jugendlichen der deutschen Gemeinde in Peking an einem Reitausflug Constens nach Fanshan teilgenommen hatte. Sie erinnerte sich noch 2008 496
2. Zwischen Hutong und Hakenkreuz
an Gespräche in der Familie über Constens damalige Lage. „Es ging ihm in dieser Zeit finanziell nicht gut, und er bekam neben finanzieller Unterstüt982 zung wohl auch ab und zu Kleiderspenden.“ Constens Name fand sich, wie sie ferner mitteilte, ab 1931 häufiger im Gästebuch ihrer Großeltern – der Großvater Friedrich W. Basel arbeitete als Architekt in Peking. So verlebte Consten u.a. Silvester 1932/33 in froher Runde im „Baselsberghaus“, dem Sommerhaus der Familie Basel in den malerischen Westbergen. Dass er Anfang der dreißiger Jahre mehrmals Weihnachtsfeste bei der Familie Scharffenberg verbracht hat, daran erinnerte sich Dr. Renate Scharffenberg gegenüber der Autorin noch im Jahr 2010. In ernster Sorge, Consten könnte in seiner Verzweiflung die Brücken zu seiner Heimat gänzlich abgebrochen haben, reagiert Mayer erleichtert auf Arnings Auskunft. Seit dem Sommer 1931 habe er von Consten nichts mehr gehört, schreibt er. Auf eine Reihe von Vorschlägen „zur Verwertung seiner reichen Kenntnisse“ habe dieser bisher nicht reagiert. Den hiesigen Rundfunk habe ich für ihn interessiert, und ich konnte Herrn Dr. Consten die Bitte übermitteln, einige Vorträge auszuarbeiten und zu übersenden, die sofort honoriert würden. Ich hegte auch die Hoffnung, dass er über die Überschwemmung des Yangtsetals mir einen von einer höheren Warte aus geschriebenen Beitrag schicken würde, einen 983 weiteren über die Japaner in der Mandschurei, die ich ihm beide gerne sofort honoriert hätte. Ich weiß aber nicht einmal, ob das letzte Honorar, das ich ihm vor vielen Monaten durch eine Bank überweisen ließ, überhaupt in seinen Besitz gelangt ist,
so Mayer in seiner Antwort an Arning. Er habe den Eindruck gewonnen, der tägliche Kampf ums Dasein absorbiere Constens ganze Kraft und mache ihm das Schreiben auf längere Sicht unmöglich. Und er schließt mit den Sätzen: In die Mongolei wird Herr Dr. Consten wohl kaum mehr zurückkehren können. In der Nähe seiner Fundstelle graben jetzt die Amerikaner und 984 ernten die Erfolge, die ich Herrn Dr. Consten von Herzen gegönnt hätte.
Constens Interesse an der aktuellen politischen Entwicklung, sowohl in China als auch im Deutschen Reich, war in den Jahren seiner Existenzkrise ungebrochen. Durch Paul Scharffenberg und die deutschen Firmenvertreter konnte er 497
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
sich so ziemlich auf dem neuesten Stand halten, sowohl über die Bürgerkriegssituation in China, über die von Japan besetzte Mandschurei und den japanischen Vormarsch durch Nordchina bis hinunter nach Shanghai, als auch über die anhaltende wirtschaftliche Not im Deutschen Reich und den wachsenden Einfluss der Nationalsozialisten dort. Sogar in China war die Auslandsorganisation der NSDAP ab etwa 1931 aktiv. In Hankou und Shanghai waren erste NS-Gruppen entstanden, die unter den dort lebenden China-Deutschen für die nationalsozialistische Sache agitierten und die di985 plomatischen Vertretungen zunehmend unter Druck setzten. Während die deutschen Geschäftsleute in Peking, die Gesandtschaftsangehörigen sowieso, diese Entwicklung eher reserviert betrachteten, schien Hermann Consten ihr einiges abzugewinnen. Als jedenfalls Adolf Hitler am 30. Januar 1933 im fernen Berlin von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt wurde, war Constens Aufnahmeantrag in die NSDAP bereits unterwegs. Schon zwei Tage später, am 1. Februar 1933, wurde er als Mitglied Nr. 1548469 re986 gistriert. Fortan sah man ihn häufiger „in brauner Montur und mit wehender 987 Mongolenpeitsche“ auf dem Glacis oder der Legation Street reiten. Neben der schwarz-weiß-roten Reichshandelsflagge wehte bei besonderen Anlässen auch schon mal die Hakenkreuzfahne über seinem Hutong. Im Deutschen Club führte er an so manchen Abenden das große Wort und rührte die Werbetrommel für den „Führer“. Allzu ernst scheint man in der deutschen Gemeinde Pekings derlei Aktivitäten auch nach dem Ermächtigungsgesetz, der im Laufe des Jahres 1933 einsetzenden Gleichschaltung der staatlichen Institutionen und der politischen Verfolgungen Andersdenkender zunächst nicht genommen zu haben. Wie es seine Art war, handelte Consten auch in NS-Angelegenheiten „auf eigene Faust“. In dem Kreis Gleichgesinnter, die sich vor allem wohl durch ihre Trinkfestigkeit aus988 zeichneten, fungierte er als „Ortsgruppenleiter Peking“. Dass in Berlin längst ein schärferer Wind wehte, bekam er bald zu spüren. Im Laufe des Jahres 1934 fand ein Personalwechsel in der Leitung des deutschen Hospitals statt, das im Gesandtschaftsviertel lag und, was die ärztliche Versorgung betraf, einen sehr guten Ruf in Peking genoss. Es kam ein Dr. von Wolff als ärztlicher Direktor. Er war zugleich Angehöriger der SS und hatte seitens der Auslandsorganisation der NSDAP den Auftrag 498
2. Zwischen Hutong und Hakenkreuz
Abb. 28: Consten mit „Leichtfuß“ auf dem Glacis vor dem Gesandtschaftsviertel in Peking, um 1933
erhalten, die Ortsgruppe Peking zu übernehmen. Hermann Consten ließ sich nicht so ohne Weiteres zur Seite schieben, sondern beanspruchte den 989 Posten für sich, „weil ich den Laden hier gegründet habe“. Bei der Abstimmung unterlag er jedoch, was ihn tief kränkte und seiner Begeisterung für den Nationalsozialismus einen Dämpfer verpasste. Begegnete ihm sein Erzrivale im Deutschen Club, muss es wohl des öfteren zu heftigen Wortwechseln, ja Beleidigungen gekommen sein. Jedenfalls kolportierte man in der deutschen Gemeinde eine Geschichte, die zeigt, dass sich auch Herr Dr. von Wolff nicht alles gefallen ließ. Eines Abends, so beschreibt es der eng mit der deutschen Schule in Peking verbundene mongolische Prinz Ce Shaozhen (Cedendorž, genannt Georgi Palta) in seinem Büchlein „Flaneur im alten Peking“, habe Wolff Hermann Consten im Deutschen Club öffentlich geohrfeigt. Dieser habe den SS-Arzt daraufhin zornentbrannt zum Duell gefordert. Doch Wolff habe nur kühl erwidert, mit jemandem, der nicht einmal einen akademischen 990 Grad besitze, werde er sich nicht duellieren. Die Demaskierung in Ge499
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
genwart einer stumm der Szene beiwohnenden Herrenrunde muss dem Reitstallinhaber und Privatgelehrten „Dr.“ Hermann Consten schlagartig allen Wind aus den Segeln genommen haben. In dem Moment muss es ihm geradezu wie Schuppen von den Augen gefallen sein: Alle Deutschen in Peking vermuteten längst, dass er sich seinen Doktortitel selbst verliehen hatte. Folglich würden sie viele seiner Geschichten über seine Abenteuer und die engen Kontakte zu wichtigen Persönlichkeiten der hohen Politik in Europa und Asien ebenfalls für reine Erfindung halten. Für sie war er, mit anderen Worten, nichts als Münchhausen und Karl May in einer Person, ein Schwindler und Hochstapler, eine „absonderliche Figur, die sich ‚Dr. C.’ 991 nannte.“ – ein für ihn unerträglicher Gedanke. Nun also war der Kaiser nackt. Hätte es nicht die Kinder gegeben, die weiter zum Reiten kamen und 992 seinen Abenteuergeschichten mit Entzücken lauschten, hätte er sich nur noch umbringen können. An dem verbalen Tiefschlag Dr. v. Wolffs hat Consten lange zu knabbern. Nach dem unerquicklichen Vorfall lässt er sich eine Zeitlang nicht mehr im Deutschen Club blicken. Als er eines Tages schließlich doch wieder dort auftaucht, ist er ein Anderer geworden: ein Mann ohne Doktortitel und ohne Parteibuch. Dass Hermann Consten seinen akademischen Titel stillschweigend abgelegt hat, offenbart das Adressbuch des Deutschtums in Ostasien (ADO) für 1934/35, das ihn nur noch als „Privatgelehrten“ führt. Sein Austritt aus der NSDAP wird unter dem 10. Mai 1935 in die zentrale 993 Mitgliederkartei in Berlin eingetragen. Constens spätere Frau, Eleanor von Erdberg, die ihm gerade in jenen Monaten der tiefsten Beschämung seiner Mannesehre erstmals begegnet ist, teilt in ihren Lebenserinnerungen eine andere Version bezüglich Constens NSDAP-Mitgliedschaft mit. Sie lautet: 1933 wurde die vaterländische Vereinigung, in der Consten in Thüringen aktiv gewesen war, von den Nationalsozialisten geschluckt und er damit automatisch Parteimitglied. Dies beunruhigte ihn nicht sonderlich; er war nun viele Jahre nicht in Deutschland gewesen und wusste über Taten und Ziele der Partei nur das, was nach China drang – und das schien damals unterstützenswert. Kaum aber wurden die Maßnahmen gegen die Juden bekannt, stellte er seine Organisationsarbeit für die Partei ein und erklärte seinen Austritt. Die Antwort lautete: „Man tritt nicht aus 500
2. Zwischen Hutong und Hakenkreuz
der Partei aus; man wird aber hinausgeworfen.“ Das bedeutete, dass kein Deutscher mit Etzel verkehren durfte; kein Verlag durfte ihn drucken. Erstere Anweisung wurde nur von wenigen befolgt, und auch von denen nicht lange; die zweite war für ihn bitter, weil er durch schriftstellerische Arbeiten weiterhin Geld zu verdienen gehofft hatte. In dieser Lage lernte 994 ich ihn 1934 kennen.
Ob Hermann Consten tatsächlich zeitweise mit einer Kontaktsperre und mit Publikationsverbot belegt worden ist oder, wie Gottlob Mayer wohl zu Recht vermutete, wegen all der Schicksalsschläge, die ihn schon seit 1927 fest im Griff hatten, unter einer Schreibblockade litt, wird sich nicht mit letzter Klarheit beantworten lassen. Immerhin war sein Roman „Der rote 995 Lama“ noch 1936 im deutschen Buchhandel erhältlich. Wohl aber sind vaterländische Vereinigungen wie der Stahlhelm erst ab dem August 1934 996 gleichgeschaltet worden, als Consten längst Parteimitglied war. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass er sich nach seinem Austritt von einem Parteigänger zu einem erklärten Gegner des Naziregimes gewandelt hätte. Dass ihn die Parteileitung in Berlin als „politisch unzuverlässig“ eingestuft hat und seine sonstigen Aktivitäten zeitweise observiert 997 wurden, ist aber anzunehmen. 998 Obwohl auch von ihm antisemitische Äußerungen überliefert sind, teilte Consten sicher nicht den rassistischen Furor, mit dem Adolf Hitler gegen das europäische Judentum vorging. Nicht zuletzt seine positiven Erfahrungen mit den jüdischen Sowjetbürgern während seines Zwangsaufenthalts an der mongolisch-chinesischen Grenze, vielleicht auch seine SelbstIdentifikation als ein zum Umherwandern in der Welt verdammter „Ewiger 999 Jude“, dürften ihn wohl zu einem differenzierteren Urteil bewogen haben. Aber dass er Hitlers totalitäre und kriegstreiberische Politik auch weiterhin guthieß, dafür finden sich durchaus Belege in seiner Korrespondenz mit Margarete Jacobi-Müller (Strölin) aus der zweiten Hälfte der 30er Jahre. Insofern sind Zweifel angebracht, dass den Pekinger Deutschen jeglicher Umgang mit Consten von höherer Stelle untersagt war. Sehr wohl aber mag es nach dem Zwischenfall im Deutschen Club und Constens Parteiaustritt Versuche seitens des Ortsgruppenleiters gegeben haben, ihn systematisch auszugrenzen. In der deutschen Gemeinde herrschte aber offen1000 sichtlich alles andere als ein fanatischer Nazismus. In den vierziger Jah501
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
ren unterhielt das Ehepaar Consten-Erdberg sogar ausgesprochen freundschaftliche Beziehungen zum Nachfolger Dr. von Wolffs als NSDAP-Ortsgruppenleiter.
3. Eleanor und Etzel – ein ungleiches Paar wagt die Ehe An einem Oktobertag des Jahres 1934 erhält Hermann Consten Besuch von einer unbekannten jungen Dame. Sie ist dunkelhaarig, großgewachsen und sehr mager, sie überragt ihn um Haupteslänge. Unbedingt schön ist sie nicht, dafür ist ihre Nase zu markant. Aber sie hat ausdrucksvolle dunkle Augen. Sie trägt einen grünen Mantel mit passendem Hut – ein Hut, der ihm missfällt. Sie stellt sich vor, fragt etwas schüchtern nach einer Reitmöglichkeit. Er erwidert grob: „Können Sie denn überhaupt reiten?“ Sie bejaht. So bestellt er sie für den nächsten Morgen. Sie erscheint zur vereinbarten Stunde. Consten hat „Floh“ gesattelt, einen kurzbeinigen Passgänger, unter Peking-Deutschen auch „Schaukelstuhl“ genannt, den zu reiten für die junge Dame etwas ungewohnt ist. Aber sie sagt nichts. Entlang der alten Pekinger Stadtmauer reitet er ihr auf seinem Schimmel „Zagaan“ voraus. Schweigend passieren sie eine der gewaltigen Toranlagen und kehren gegen Ablauf der Stunde längs des äußeren Wassergrabens zurück. Während des ganzen Ritts wechselt er mit ihr kein Wort. „Ich war ein wenig be1001 leidigt“, schreibt Eleanor von Erdberg in ihren Memoiren über ihre erste 1002 denkwürdige Begegnung mit Hermann Consten. Als sie trotz heftigen Muskelkaters am nächsten Morgen – ohne Hut – wieder zum Reiten erscheint, ist er schon freundlicher. Was war ihr an ihm als Erstes aufgefallen, als sie, nur einen Tag nach ihrer Ankunft in Peking, mit einer Riksha vor dem großen Tor seines ummauerten Anwesens gehalten und den Hof „mit Ställen und Misthaufen, Bäumen, Pferden und Hunden und einem dreiteiligen Wohnhaus im Hintergrund“ betreten hatte? An dem kleinen, weißhaarigen Mann, der ihr da in Reithosen und Stiefeln entgegenkam? „Ein loses Halstuch war mit einer Nadel aus grüner Jade zusammengehalten.“ Ihr hat dies gefallen, denn sie liebt Schmuck, auch an einem Mann. Was ihr noch gefällt, zeigt sich im Laufe der nächsten morgendlichen Ausritte: Consten kennt Pekings Umgebung, die vielen Tempel und Grabanlagen und weiß zu allen eine Geschichte zu erzählen. Für die 27-jährige Harvard-Absolventin und angehen502
3. Eleanor und Etzel – ein ungleiches Paar wagt die Ehe
de Kunstwissenschaftlerin, die im Rahmen ihres Postdoc-Studiums in Kyoto und Tokyo einige Wochen in Peking für vergleichende Studien chinesischer und japanischer Kunst verbringen möchte, ist der kenntnisreiche, etwas ruppige ältere Mann ein geradezu idealer Begleiter. Für ihn jedoch dürfte ausgerechnet ihr akademischer Hintergrund wie auch die amerikanische Herkunft – ihre Mutter ist Amerikanerin – ein Problem sein. Hatte nicht schon einmal der Besuch einer jungen, brillanten US-Wissenschaftlerin ihn ins Verhängnis gestürzt? Leidet er nicht noch immer an den Folgen? Es war sicherlich nicht nur das grüne Hütchen, das ihn störte, verstörte. Doch scheint sich seine Sorge, es könnte sich ein ähnliches Debakel anbahnen, wie es ihm mit Ethel J. Lindgren widerfahren ist, relativ rasch zu legen. Denn dieses Fräulein von Erdberg gehört anscheinend nicht zu der Sorte, die Erkundigungen über den „Mann mit Vergangenheit“ einzieht, um sie eines Tages gegen ihn zu verwenden. Sie stellt ihm zwar allerhand kluge Fragen, hört ihm aber auch mit wachsender Begeisterung zu. Sie isst tapfer den Teller Haferbrei auf, den er ihr allmorgendlich vorsetzt, nachdem er herausbekommen hat, dass sie nüchtern zur Reitstunde erscheint. „Dieser Frühstückszwang war wohl auf beiden Seiten das erste, noch unbeachtete Zeichen einer gegenseitigen Sympathie“, schreibt Eleanor 1003 von Erdberg in ihren Lebenserinnerungen. Sie ist auch keine Tochter aus reichem Hause mit dicken Dollarbündeln in der Tasche, sondern in ihren Ansprüchen eher bescheiden. Dafür besitzt sie eine ordentliche Portion Humor und Gelassenheit, dazu einen ausgeprägten Sinn für die Schönheit der kleinen, einfachen Dinge und für den morbiden Charme des Verfalls, der einem im Peking der 30er Jahre auf Schritt und Tritt begegnet. Consten kannte von allen anderen vergessene Tempel, unter deren lecken Dächern längst beschädigte buddhistische Figuren dahinmoderten, deren Türen die Bauern in ihren Herdfeuern verbrannt hatten; Gras wucherte über den Ziegeln und den Bodenplatten. Eine verwitterte weiße Marmorstele trug noch den Namen des Kaisers, unter dessen Schirmherrschaft der Tempel das letzte Mal in guten Zustand versetzt worden war; nun fand sich kein Stifter mehr. […] In den Höfen der großen Grabanlagen schnitten die Frauen das dichte Gras und trugen es nach Hause für ihr Vieh. Die Wege waren zugewachsen; kein Pilger beschritt sie mehr. 1004 Aber Consten kannte sie. 503
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
Bald ist es mit den Morgenritten nicht mehr getan. Rikshafahrten und Gänge in die Stadt schließen sich an. Die gemeinsamen Ausflüge werden länger, dauern manchmal den ganzen Tag. Er war mir der ideale Führer, weil ihn alles interessierte, weil er über erstaunlich viele Plätze Bescheid wusste und weil er nicht nur auf alles einging, was ich sehen wollte, sondern mir viel mehr erschloss, als ich zu se1005 hen erwartet hatte.
Als sie bei Winterbeginn nach Japan zurückkehren muss, ist Hermann Consten wieder zu Etzel geworden. Seinen Spitznamen findet sie viel passender als den Taufnamen Hermann. Mit Eleanor von Erdberg hat eine Frau die Szene betreten, die Hermann „Etzel“ Constens beschädigte Seele wieder zum Leben erweckt, die gerissene Saiten in ihm wieder zusammenknüpft und zum Klingen bringt, die an seinen „guten Kern“ rührt. Er blüht auf. Briefe gehen hin und her, und als sie im Frühjahr 1935 ein weiteres Mal nach Peking kommt, steht er am Bahnhof, um sie abzuholen. Es folgen weitere Ausflüge, die manchmal auch über Tage gehen, mit gemeinsamen Übernachtungen bei Bauern und Mönchen tief in den Bergen, wo Ausländer höchst selten auftauchen. Schon bei ihrem ersten Besuch hat Eleanor von Erdberg feststellen können, dass Consten ein hervorragender Fotograf ist, dass etliche der Tempelruinen, die er aufgenommen hat, im Jahr darauf schon nicht mehr existieren. Vielleicht steht noch der Rumpf einer buddhistischen Skulptur unter freiem Himmel, dessen Kopf bei den Antiquitätenhändlern gelandet ist oder sogar schon das Wohnzimmer eines reichen Ausländers schmückt. Eine Auswahl seiner Fotos nimmt sie mit nach Japan, lässt vergrößerte Abzüge machen, nimmt anhand der einschlägigen Fachliteratur Datierungen der Bauten und Kultfiguren vor, stellt diese Sammlung ihrem Institut, der Orient-Abteilung des Fogg Art Museums in Harvard, zur Verfügung, wo sie sich vermutlich noch heute befindet. Gegen Ende ihres zweiten Peking-Besuchs macht ihr Consten einen Heiratsantrag im doppelten Konditional: „Wenn ich wieder zu Geld kommen könnte, würdest du mich dann heiraten?“ Sie antwortet „mit einem zögernden Nein“, nicht weil sie Wert auf eine finanzielle Basis legt, die er ihr wahrscheinlich niemals mehr würde bieten können, auch nicht weil ihr der Altersunterschied von beinahe 30 Jahren dann doch ein bisschen zu 504
3. Eleanor und Etzel – ein ungleiches Paar wagt die Ehe
Abb. 29: „Zur Erinnerung an Pao tschang ta miao und an seine Bewohner. Oktober 1934. Etzel“. Widmung f. Eleanor von Erdberg auf der Rückseite.
groß erscheint. Aber sie braucht Abstand zum Nachdenken, möchte erst 1006 selbst auf festen Füßen stehen, ihre Forschungsarbeit abschließen. Etzel war ein Abenteurer – nicht im schlechten Sinn des Wortes. Alles, was er in seinem Leben erlebt hatte, alles, was ich in Peking durch ihn erlebt hatte, war Abenteuer. Ich hatte ihm vertraut, und es war alles gut aus1007 gegangen. Aber konnte man so sein ganzes Leben führen?
Dieses war die Frage, die sie sich stellte. Mit dem gesellschaftlichen Hintergrund, den sie besaß, musste sie diese Frage verneinen. Auf jeden Fall hält sie liebevoll Kontakt, schreibt Briefe, schickt lyrische Evokationen ihrer gemeinsamen Pekinger Glücksmomente. Wir ritten unter Weiden am Kanal. Herbstlich neigten sich die Lotosblätter. 1008 Eine Krähe saß auf weißem Totenmal.
505
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
Er antwortet, schickt ein Erinnerungsfoto. Schließlich bittet sie ihn, nach Japan zu kommen. Sie möchte ihn teilhaben lassen an ihrer Liebe zu einem Land, seiner Geschichte und Kultur, das zwar vieles mit China verbindet, das aber dennoch – zusätzlich befruchtet durch Korea – etwas ganz Eigenes, unverwechselbar Japanisches hervorgebracht hat. Und sie möchte, allen Bedenken zum Trotz, das Wagnis einer Ehe mit Hermann Consten eingehen, Ja zum gemeinsamen Abenteuer sagen. Ohne zuvor alle formalen Hindernisse aus dem Weg geräumt zu haben – vor allem bereitete ihr, mit Vorfahren diesseits und jenseits des großen Teichs, die Beschaffung der von deutscher Seite verlangten Ariernachweise einige Mühe –, heiraten die beiden im März 1936 in der kleinen katholischen Kirche von Kamakura. Einzige Gäste sind der US-Konsul und seine Nichte als Trauzeugen und ein deutsch-jüdisches Musikerpaar, das in Japan im Exil lebt. Gefeiert wird in ihrem winzigen hanare, dem Gartenpavillon eines hübschen Anwesens in Kamakura, das ihr Bekannte für ihre Studienaufenthalte in Tokyo zum Wohnen überlassen haben. Etwa neun Monate verbringt Hermann Consten in Japan. Gemeinsam mit seiner jungen Frau reist er durch das Land, besucht Orte von besonderer Schönheit wie Nikko, Nara und Kyoto, genießt mit ihr die Heiterkeit der Tempel- und Schreinfeste, lernt ihre Freunde und Lehrer kennen, vertieft sich in die Geschichte des Landes, nimmt neue Anregungen Abb. 30: Eleanor von Erdberg als Braut. Kamakura (Japan) 1936 auf. Er bekommt sogar wieder Lust zu schreiben. 506
3. Eleanor und Etzel – ein ungleiches Paar wagt die Ehe
Liebe Ströline! 28. Aug. 1936, Kyoto Mein Boy hat mir endlich Deine Briefe hier nach Japan nachgeschickt. So erfahre ich, dass Du während meines Aufenthaltes in Japan geheiratet hast und recht, recht glücklich bist. Das freut mich von ganzem Herzen. u. ich wünsche Dir u. Deinem Manne alles Schöne u. Gute in Eurer Ehe – was Ihr Euch nur wünschen könnt. […] Ich selber bin seit Weihnachten 1935 hier in Japan gewesen, um ein neues Buch zu schreiben und zwar über die Zeit von 1159–1189 n. 1009 Chr. als Vorspiel zu dem Mongoleneinfall unter Kublai Khan in Japan. Ob das Buch aber je einen Verleger findet ist mehr wie fraglich. […] Wenn es Dir irgendwie möglich ist, so schicke mir alles was an Manuskripte [sic] noch in Deinen Händen ist[,] als Drucksache zu. Alles das, was ich darin in jahrelanger Arbeit niedergelegt habe, vermisse ich hier sehr. Existiert meine Kartei über die Mongolei noch? Ich bin gerne bereit, Dir die Unkosten für die Drucksachen zu ersetzen. Von hier aus gehe ich für ganz kurze Zeit nach Korea u. bin, wenn Du diesen Brief erhälst [sic] wieder in Peking. […] Übrigens sind die Japaner riesig stolz auf ihre Erfolge in Berlin. Die Eröffnung der Olympischen Spiele konnte man hier morgens um 6 Uhr klar im Radio im Lautsprecher hören und es schmiss einen fast um als über den Platz vor meiner Wohnung „Deutschland Deutschland über alles“ und das Horst-Wessel-Lied wegbrauste. Die Bildwiedergaben der Olympischen [Spiele] im Kino waren vorzüglich. Grüsse Deinen Mann recht herzlich von mir u. alles Liebe u. Gute 1010 Euch beiden Euer Consten
Dass er selbst in eben jener Zeit in Japan auch geheiratet hat, wird er der Freundin und Hüterin seiner in Thüringen zurückgebliebenen Schätze erst 1011 zwei Jahre später mitteilen. Als ihr Stipendium in Ostasien abgelaufen ist und sich für sie in Harvard keine feste Stelle abzeichnet, beschließen Eleanor und Etzel Consten, vorerst in Peking zu leben. Bevor sie im September 1936 gemeinsam nach China zurückkehren, setzen sie von Shimonoseki aus noch mit einer Fähre nach Korea über, besuchen die Kunstsammlungen, Klöster und Tempel der von Japan annektierten Halbinsel. Bei der Ankunft in Peking muss Consten mit Entsetzen feststellen, dass der Hausboy die Tiere fast hat verhungern lassen. Mit dem Geld, das ihm monatlich für Futter und Pflege überwiesen worden war, hatte er drei Rikshas angeschafft, die er gegen Geld an Kulis 1012 vermietet hatte und sich so ein einträgliches Geschäft aufgebaut. Auch 507
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
hatte er seine Familie in Constens Haus geholt und auf dessen Kosten glänzend versorgt. Erst nachdem die Pferde zu Kräften gekommen sind, kann Consten seinen Reitbetrieb wieder eröffnen. Nur zwei seiner mongolischen Hunde, eine Hündin und ein Rüde, sind noch zu retten. Mit ihnen baut er seine Windhundezucht neu auf. Während er sich um die Erholung der Tiere kümmert und den Abt des Lamatempels bittet, ihm ehrliche Hilfskräfte zu schicken, damit er den ungetreuen chinesischen Hausboy und seinen Clan endlich hinauswerfen kann, richtet Eleanor das ziemlich heruntergekommene Wohnhaus her. Sie streicht Wände und sorgt dafür, dass der seit Jahren abgestellte Strom wieder funktioniert. Auf Auktionen hatte Consten bereits einige chinesische Sitzmöbel, Schränke und Vitrinen ersteigert; sie macht neue Polsterbezüge, näht Kissen und Vorhänge aus Batik-Stoffen, die sie in einer Bauernwerkstatt entdeckt hat, richtet die Räume mit seinen und ihren persönlichen Dingen ein und schafft so allmählich mit wenig Geld eine ausgesprochen wohnliche Atmosphäre. „Ich selber bin hier ganz chinesisch eingerichtet“, schreibt Consten an Grete. Fast alle Möbel sind aus Rotholz, das eine Farbe zwischen glänzendem Schwarz und Rotbraun hat. Ich spreche jetzt von Schreibtisch, Stühle, Büffet u.s.w. Mein Esszimmer ist von Kampferholz mit schweren, kaum hebbaren Stühlen. Ich habe das alles vor Jahren in einer Auktion gekauft. In Deutschland würde so eine Einrichtung unerhörtes Geld kosten, hier kostet sie genau ein Drittel des gewöhnlichen europäischen Plunders. Ich werde Dir nächstens 1013 einmal Photos von dem „Inneren Haus“ schicken.
Auch wenn sie den Grund, die Existenz einer okusan, einer „Herrin des In1014 neren“, noch immer nicht kennt, dürfte der Freundin in fernen Deutschland aufgefallen sein, dass Constens Briefe jetzt ganz anders, viel herzlicher klingen als sonst. Die düstere Stimmung scheint verflogen; er scheint sich ehrlich an ihrem neuen Eheglück zu freuen und ist von überschwänglicher Dankbarkeit für alles, was sie ihm an Fotos und Büchern schickt. Dankbarkeit, weil sie das zusammenhielt, was ihm im fernen Deutschland noch an Besitz verblieben war. Dankbarkeit auch für ihre Treue – und sogar ein wenig Einsicht in eigene emotionale Defizite. Ja, liebe Ströline, ich freue mich immer u. immer wieder, wenn ich etwas von 508
3. Eleanor und Etzel – ein ungleiches Paar wagt die Ehe
Dir höre. Du warst für zehn lange schwere Jahre das einzige Band, das mich noch mit der Heimat verband und das, durch Deine liebe Anhänglichkeit ge1015 schützt, von mir nicht auch zerrissen wurde.
Consten bekennt sich zu einer an ihm bislang nicht zu beobachtenden Bescheidenheit. „Was draußen auch glänzen mag, es ist im Grunde doch nur Plunder“, lässt er Grete wissen. Von ihm kommen nun chinesische Jäckchen, Seidenstoffe und Schmuck. Er tauscht sich mit ihr ausgiebig über Erfahrungen mit Dienstboten aus, kommentiert Japans Bewerbung für die nächsten Olympischen Spiele und die Aussichten, dass eines Tages KdF1016 Schiffe nach Japan reisen könnten, um deutsche Olympia-Fans dorthin zu bringen – wenn die politische Lage in Fernost dies zuließe. Aber, aber! Ich fürchte, Russland resp. die Sowjets [machen] aus dem Olympiade-Tokio-Projekt eine schillernde Seifenblase, die zerplatzt, wenn der ferne Geschützdonner in der Mandschurei und in der Straße von Tsushima über die 1017 Meere grollt - - -
Noch scheint in Peking nichts das junge Idyll zu stören. Eleanor lernt Chinesisch ziemlich rasch, denn ein Großteil der Schriftzeichen ist ihr vom Japanischen her und durch ihr Studium der ostasiatischen Kunst längst vertraut. Bald bildet sich ein gemeinsamer Freundes- und Bekanntenkreis aus Diplomaten, Literaten, Gelehrten und Kunstsammlern, zu dem sich, neben Amerikanern, Belgiern, Briten und Franzosen, nach und nach auch wieder einige Deutsche gesellen. Sie alle verbindet nicht nur die Reiterei, sondern auch die Liebe zur chinesischen Kultur und Kunst, Offenheit und Neugierde für alles Fremde. In der kleinen Gemeinde der Peking-Deutschen, in der jeder jeden kennt, hat sich schnell herumgesprochen, dass Eleanor von Erdberg und Hermann Consten inzwischen geheiratet haben. Zwar blüht der Klatsch. Niemand kann so recht verstehen, dass eine feine Dame wie sie sich ausgerechnet diesen eher grob gestrickten, dazu kleingewachsenen und wesentlich älteren Mann mit schillernder Vergangenheit erwählt hat. Aber sie merken rasch, dass sie voll zu ihm steht, sich nicht irritieren lässt – und akzeptieren beide schließlich auch als Paar. „Trotz der Gegensätze schien die Ehe Consten glücklich zu sein“, konstatierte der Arzt Günther Huwer Jahrzehnte später noch in seinen Lebenserinnerungen. Doch nahm er wohl zu Recht an, dass „der kleine, gedrungene, weißhaarige Mann mit 509
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
dem roten Whiskygesicht“, der „so wunderbar lügen“ konnte und die Tage mit seinen Mongolenponys auf dem Glacis verbrachte, „von dem kleinen 1018 Gehalt seiner ruhigen und gründlich gebildeten Frau“ lebte. Die in Peking lebenden Deutschen verhelfen ihnen gelegentlich sogar selbst zu kleineren Einkünften, indem sie Vortragsabende über chinesische Kunst oder mongolischen Lamaismus organisieren. Sie schicken ihre Kinder zu den Constens zum Nachhilfe-Unterricht in Deutsch oder Englisch, und natürlich auch weiter zum Reiten. Die von Etzel Consten angebotenen Reitausflüge erhalten jetzt eine besondere Note. Er verfasst kleine Vorträge zu Geschichte und Kultur des jeweiligen Ausflugsziels, fertigt maßstabsgerechte farbige Kartenskizzen zu den geplanten Routen an. Teilweise haben diese Kartenzeichnungen von Constens Hand, zu denen auch historische 1019 Karten, z.B. über die Hunnenzüge in Zentralasien um 100 v. Chr. und die Handelsstraßen zwischen China und Afghanistan im ersten nachchrist1020 lichen Jahrhundert gehören, sogar die Zeiten überdauert. Für kurze Zeit hat er sogar eine bezahlte Stelle an einer neu gegründeten landwirtschaftlichen Hochschule. Er unterrichtet dort Deutsch und nutzt dies, in Erinnerung an sein Studienjahr in der Kolonialschule Witzenhausen, für praktische Unterweisungen zum Anbau von Feldfrüchten. Doch leider muss die Hochschule, nachdem der Dekan mit der Kasse durchge1021 gangen ist, wieder schließen. Sie wiederum begleitet gelegentlich ausländische Sammler zu den Pekinger Kunsthändlern, berät sie über die Qualität der Objekte und ihren Preis. Sie versteht sich, zur Freude eines in Peking lebenden deutschen Kunsthändlers, auf die japanische Technik der Restaurierung antiken Porzellans und trägt so mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten zum gemeinsamen Einkommen bei. Erst Jahre später sollten noch Lehraufträge hinzukommen und sich die prekäre Finanzlage der Constens insgesamt bessern. Das Paar lebt anfangs also von der Hand in den Mund. Beide sind jedoch erfüllt von ihren jeweiligen Aufgaben und den gemeinsamen Interessen. Man kann das Glück nennen – trotz der einen oder anderen Meinungsverschiedenheit, seiner Unfähigkeit im Umgang mit Geld und seiner Neigung zu Eifersucht, die ihr vor allem in den ersten Ehejahren zu schaffen 1022 macht, wie auch anderer Malheurs, die man durchaus, wie Eleanor von Erdberg es in ihren Erinnerungen getan hat, Abenteuer nennen darf. So 510
3. Eleanor und Etzel – ein ungleiches Paar wagt die Ehe
platzt im eiskalten Pekinger Winter eines der langen Ofenrohre, die sich unter der Decke und entlang der Wand des Schlafraums hinziehen, den Eleanor mit japanischen Tatami und Futon ausgelegt hat. Ein Porträt Čingis Chaans aus Etzels Mongolei-Sammlung wird dabei zerstört. Im Frühjahr erwischt es ein Wasserrohr im Bad, und kurz vor Einsetzen der Regenzeit fällt plötzlich der Putz von der Wohnzimmerdecke; es stellt sich heraus, dass der freistehende Holzpfosten, der den Querbalken des schweren chinesischen Hausdaches stützt, unter der Last nachgab und ein Teil des Daches einstürzen ließ. Zwar kommt niemand zu Schaden, doch ist das Zimmer vorerst nicht bewohnbar, das Dach muss neu gerichtet werden. Das alles dauert, im Haus steht derweil das Regenwasser. Doch erfahren sie von dem Hauseigentümer interessante Details über die Geschichte des Anwesens. Es hat an dieser Stelle tatsächlich einmal ein buddhistisches Kloster gegeben. Ein Kaiser im 18. Jahrhundert hatte es den Jesuiten überlassen, denen Peking ja auch das benachbarte Observatorium und eben die Kunst des Kanonengießens verdankte. Später wurde das Kloster aufgelassen, das Areal erwarb ein chinesischer Methodist, der alle buddhistischen Spuren beseitigte und den noch stehenden Tempel samt Nebengebäuden zum Wohnen 1023 vermietete. Eleanor begreift nun, weshalb die Miete so niedrig ist: Kein Chinese würde auf ein Grundstück ziehen, auf dem ein Tempel gestanden hat, um sich nicht dem Zorn der vertriebenen Geister auszusetzen. Damit waren natürlich nicht die friedliebenden Buddhas und Bodhisattvas gemeint, die hier einst den Altar zierten, sondern die rachsüchtigen chinesischen Hausgeister, die sich durch die Umbauten und Renovierungen aufgescheucht fühlten und nach gängiger Überzeugung ihrerseits zu stören anfingen. So unterbleibt, nachdem der Schutt weggeräumt und die Ordnung einigermaßen wiederhergerichtet ist, die weitere Renovierung des Wohnzimmers. Der Fuchsgeist als ärgster Störenfried erhält ein Häuschen auf dem reparierten Dachfirst, der Hausfrieden ist fürs Erste wiederherge1024 stellt.
4. Chinesischer Bürgerkrieg und japanische Bedrohung Der Frieden draußen allerdings wird immer brüchiger. Längst haben japanische Truppen die Provinz Jehol erobert und Marschall Zhang Xueliang ins Exil getrieben. Chiang Kaisheks Kräfte sind noch immer im Süden im 511
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
Kampf gegen die kommunistischen Truppen gebunden. Als die Japaner in der Nacht zum 7. Juli 1937 einen Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke, einem der häufig von den Constens angesteuerten Ausflugsziele südwestlich Pekings provozieren, ist dies der Auftakt für den offenen Krieg. Consten schreibt dennoch nur wenige Tage später an Grete Jacobi-Müller, er fühle sich in Peking einigermaßen sicher. Seit einigen Tagen ist es hier etwas unruhig. Die Japaner haben bei Lukuschao, 30 Kilometer von Peking an der Marco-Polo-Brücke wieder einmal Krakehl mit der ihr [sic] so verhassten 29. chines. Division provoziert, indem sie einfach die Chinesen beschuldigten auf ihre manövrierenden Truppen geschossen zu haben. Aber dazu sind die Chinesen trotz ihres Hasses zu klug. Die Japaner aber unterstrichen ihre Beschuldigung mit Geschützfeuer. Bei dem Gefecht kamen etwa 250 chines. Soldaten um. Japaner sollen weit über 100 gefallen sein. Aber das erfährt man nie genau. Einstweilen sind die Stadttore Pekings geschlossen. Niemand kann heraus und herein. Es ist gut, dass wir in der Regenzeit sind, so kann ich sowieso nicht ausserhalb der Stadttore reiten. Denn das flache Land ist bei einem Ausläufer des Taifun, der mit reichen Regenmengen vom Gelben Meer kommt, in seinen tiefen 2-3 Meter ausgefahrenen Hohlwegen unpassierbar. Die politische Lage hat sich hier draussen verdammt zugespitzt. Wenn die Sowjets nicht gerade zur unrechten Zeit mit ihrem grossen Reinemachen [d.h. den stalinistischen Säuberungen; D.G.] angefangen hätten, dann wäre hier draussen der Krakehl schon längst im 1025 Gange.
Doch erweist sich die Ruhe als trügerisch. Kurz darauf marschieren die Japaner in Peking ein, übernehmen die Kontrolle über die Stadt, wenn auch zum Schein unter einer nordchinesischen Marionettenregierung. Consten hält Grete über die Lage auf dem laufenden. Er sei in seinem Haus geblieben, als beim Einmarsch der Japaner alle in das – durch eine Mauer geschützte – Gesandtschaftsviertel geflüchtet seien, schreibt er ihr unter dem 4. September 1937. In solchen Zeiten ist es schon besser, in seinem Hause zu sein als alles im Stich zu lassen u. dann, wenn die angebliche Gefahr vorüber ist, das Haus bestohlen 1026 – wenn nicht geplündert – vorzufinden.
512
4. Chinesischer Bürgerkrieg und japanische Bedrohung
Alles gehe inzwischen wieder seinen gewohnten Gang. Nur könne man außerhalb der Stadttore kaum noch reiten, da versprengte chinesische Soldaten sich zu Banden zusammengeschlossen hätten. Dass Krieg herrsche mache sich vor allem an den drastisch gestiegenen Kohlepreisen bemerkbar. So könnte der Winter ungemütlich werden. Einstweilen seien die Japaner jedenfalls „für uns ein guter Schutz gegen den Bolschewismus, der jetzt 1027 schon ein Drittel Asiens in den Klauen hat“. In seinem nächsten Brief an Grete wenige Wochen später geht Consten etwas ausführlicher auf die Kämpfe um Peking ein. Als Gründe für seine Gelassenheit inmitten einer aufgescheuchten Bevölkerung nennt er seine Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg. Bombenabwürfe und das Rattern von Maschinengewehren seien nichts Neues für ihn gewesen, so Consten. Trotz der Gerüchte über bevorstehende schwere Kämpfe im Stadtgebiet sei er bei seiner Auffassung geblieben, dass ihre Heftigkeit wohl nicht annähernd an die im Mittelabschnitt der Westfront und auf Gallipoli heranreichen werde. Unangenehm war nur, wenn die schweren japanischen Bomber in 50-100 Meter Höhe über Pao Tschang Ta Miao wegbrausten, dann hatte ich immer das Gefühl, dass der Herr Flieger aus Versehen u. Ungeschicklichkeit eines seiner Eier zu früh abwerfen könnte. Es ist eben schlimm, wenn statt der Henne so ein zentnerschweres Ei an zu gackern fängt. – Von den Japanern hatten wir überhaupt nichts zu fürchten! Es hätte bei der aufgeputschten Stimmung der Bevölkerung u. der geschlagenen chines. Soldaten allerdings sehr leicht zu einem Fremdenpogrom kommen können. Deshalb blieben bei mir die Tore geschlossen, dann zog ich die Hakenkreuzfahne hoch, machte mich fertig zur Verteidigung und wartete der Dinge, die da kommen sollten. Aber sie kamen 1028 nicht! – und im übrigen bin ich dergleichen gewohnt.
Dass auch die Familienangehörigen des Kochs, des Hausboys und des Pferdeknechts unter der Hakenkreuzflagge zeitweise Schutz vor der Brutalität der japanischen Besatzer fanden, erwähnte Eleanor von Erdberg in ihren 1029 Erinnerungen an die gemeinsamen Jahre mit Consten in Peking. Von da an gehörte das Ehepaar Consten sozusagen zum chinesischen Familienverband ihres Boys, was ihm vor allem in den vierziger Jahren, als sich die allgemeine Lage erneut verschlechterte, sehr zustatten kam. Denn der Famili513
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
enclan ihres Hausdieners besaß Bauernhöfe im Pekinger Umland und konnte in Notzeiten für frisches Gemüse, Fleisch, Milch und Eier sorgen. Auch im fernen Europa nehmen die Spannungen zu. Hermann Consten ist dies natürlich nicht entgangen. Schon in seinem Sommerbrief an Grete hatte er die Lage dort, vor allem die britische Haltung gegenüber HitlerDeutschland, mit der aufgeheizten Atmosphäre im Juni/Juli 1914 verglichen. Er rechnet für beide Kontinente mit Krieg und meint, in einem sol1030 chen Fall sei man in Peking immer noch am sichersten. Diese Einschätzung hat auch mit der scheinbar paradoxen Tatsache zu tun, dass Hitlers Interesse an einem engeren Zusammengehen mit China angesichts des siegreichen Vormarschs der Japaner zunehmend nachlässt. Entgegen dem Rat der mittlerweile in Nanking tätigen Diplomaten, dem sich sogar Hitlers einstiger Kampfgefährte Kriebel, seit 1934 als Generalkonsul in Shanghai 1031 tätig, anschloss, vor allem aber auch gegen die Handelsinteressen der deutschen China-Kaufleute, betreibt Außenminister von Ribbentrop gezielt 1032 die Annäherung des Dritten Reichs an Japan. Consten hält seinerseits die pro-japanische Politik Hitlers und Ribbentrops für richtig. Der Kriegssturm ist über uns weggebraust und tobt sich im Süden aus. Der Kampf um Shanghai macht den Japanern stark zu schaffen. Aber ich glaube, wenn ihre Truppen, vom Norden kommend den Gelben Fluss erreicht haben, bleiben sie dort stehen. Dann wird der Kampf um Shanghai nach u. nach abflauen. Denn dieser Kampf wird nur deshalb geführt, um Tschiang Kaischek daran zu hindern seine Elite-Truppen nach Norden zu werfen. In der Zwischenzeit aber wird die Freundschaft China–Sowjets immer inniger und wir steigen bei den sehr realistisch denkenden Japanern immer mehr im Wert. Hier wird behauptet, dass sie im letzten Monat für 40 Millionen Yen bei uns Kriegsmaterial bestellt haben. Wenn sie doch nur in Devisen berappen würden! Ich glaube, dann würde Schacht sich schmunzelnd die Hände reiben. 1033 Nein, ich denke nicht daran, Peking zu verlassen!
Consten bleibt also in Peking, trotz der geradezu mittelalterlichen Verhältnisse seiner Umgebung, die er Grete anschaulich schildert. Romantik pur ist dies gerade nicht, und wohl auch deshalb setzt er auf die Japaner. Ihnen traut er nämlich zu, an den vorsintflutlichen und unhygienischen Zuständen des einstigen Nabels im Reich der Mitte etwas zu ändern. Mit seiner 514
4. Chinesischer Bürgerkrieg und japanische Bedrohung
Wertschätzung für die Japaner wächst zugleich seine Verachtung für die Chinesen. Nachttöpfe werden hier für gewöhnlich auf die Strassen – jetzt zwar nur in den Nebenstrassen – ausgegossen. Dort sieht man auch recht oft die ganze minderjährige Familie reihenweise in hockender Stellung nebeneinander sitzen. Es fehlt nur noch, dass sie, wenn sie aufstehen, gackern. Bei Regenwetter gleichen die Hutungs – so heissen die Nebenstrassen – kleinen Bächen. Der Lao chien yü Platz ist dann das Sammelbecken u. tagelang steht dort das Wasser Fuss hoch. Durch die Hutungs ist nur mit Rikscha's durchzukommen. Die Kulis stampfen dann durch den duftenden Dreck bis weit über die Knöchel. Es interessiert mich nun wie wir aus dem ausklingenden Mittelalter herauskommen. Ich glaube nicht, dass die Chinesen, so wie es die Japaner gemacht haben – mit einem Satz aus dem feudalen Mittelalter der Condottiere in die Moderni1034 tät hineinspringen können u. wollen.
Dass sich die eigenen Wohnverhältnisse noch in den 30er Jahren nachhaltig gebessert haben müssen, weil ein Wohnungswechsel stattfand, schilderte Eleanor von Erdberg in ihrem Erinnerungsbuch. Vor allem gab es mehr Platz für die Pferde und die Dienerschaft, ein sonniges und geräumiges Wohnzimmer und ein kleines Arbeitszimmer für den Hausherrn, schattige, akazienbestandene Höfe. Das neue Anwesen in der Chiang Tsa Hutong Nr. 15 lag in der Pekinger Oststadt, etwas näher am Gesandtschaftsviertel. Damit war es leichter geworden, abends Gäste zu haben. Und Hermann Consten zeigte sich von einer neuen Seite. Wenn wir eine Gesellschaft gaben, die unseren Räumen entsprechend klein sein musste, kochte Etzel. Da er sich ungewöhnliche Rezepte ausdachte, konnten wir bestehen auch ohne ein ganzes französisches Menü zu bieten wie die Köche der Botschaften. Unser Geschirr war schönste ja1035 panische Keramik, das hatte auch niemand anders.
Durch die gesellschaftlichen Kontakte wurden immer wieder auch fremde Besucher an die Constens weitergereicht, so 1938 eine niederländische Malerin und Weltreisende, Lily Eversdijk-Smulders, die durch ihre orientalischen Porträtstudien seinerzeit in Asien recht bekannt war. Dank Consten gelang es ihr, den Abt des Lamatempels porträtieren zu dürfen. Allerdings 515
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
musste er bei den Sitzungen mit anwesend sein, da es einem hohen Lama nach den buddhistischen Mönchsregeln untersagt war, sich allein mit einer Frau in einem Raum aufzuhalten. In Peking hatte Eversdijk-Smulders zwei Ausstellungen mit ihren schönen Kohle- und Pastellzeichnungen, auf denen der jeweilige Typus der Porträtierten stärker zum Ausdruck kam als 1036 ihre Individualität. Als Dank für seine Vermittlung porträtierte die Künstlerin auch Hermann Consten auf dessen eigenen Wunsch als sechzigjährigen, weißgelockten Mann, mit seinen kräftigen dunklen Augenbrauen und einem leicht melancholischen, etwas müden, fast schon altersmilden 1037 Blick, doch im schlichten weißen Hemd mit offenem Schillerkragen. Der Kontrast zu dem etwa 15 Jahre früher entstandenen repräsentativen Fürstenporträt von Heinz Munz, das Consten im vollen Ornat und von allen weltlichen und geistlichen Attributen eines hohen mongolischen Würdenträgers umgeben zeigt, könnte größer nicht sein. Dass eine späte Porträtzeichnung von Consten überhaupt existierte, kam 2005 durch einen Zufall ans Licht. Eine Dame aus Hilversum, die im Internet auf die soeben in Köln zu Ende gegangene Ausstellung mit den historischen Fotografien Constens aus der Mongolei aufmerksam geworden 1038 war, meldete sich bei der Verfasserin. Als Vorsitzende einer kurz zuvor gegründeten Stichting Lily war sie gerade dabei, den Nachlass der Künstlerin für eine Biografie durchzusehen und war dabei auf ein Foto des Consten-Porträts gestoßen. Auf dessen Rückseite hatte die Künstlerin notiert: „order portret pastel Dr. Hermann Consten (German) the famous Mongolia-explorer, made in Peking“. Die Dame schickte mir einen Abzug des Fo1039 tos und erkundigte sich, ob das Original etwa noch irgendwo existiere. Leider erbrachte eine entsprechende Umfrage unter den Erben des Consten-Nachlasses kein Ergebnis. Ab Mitte der 30er Jahre kamen hin und wieder mongolische Lamas zu Besuch bei Hermann Consten, nicht immer zur Freude Eleanors. Einige von ihnen kannte Consten noch aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. So war 1935 Gelen Lama Žamsran bei ihm aufgetaucht. Consten hatte ihn 1908 als Begleiter des XIII. Dalai Lama und Agvan Doržievs kennengelernt. In den 1040 20er Jahren war der Gelen im Auftrag seines Klosters „im Niemandsland“ mit Žal Lama, dem „Roten Lama“ zusammengetroffen. Und in den 30ern war er zumeist unterwegs, „im Niemandsland auf Lamawander516
4. Chinesischer Bürgerkrieg und japanische Bedrohung
schaft“, wie Consten mit Bleistift auf der Rückseite eines Fotos seines Gastes, das sich im Nachlass fand, etwas kryptisch vermerkt hatte. Andere Besucher kamen auf Empfehlung des Abtes des Pekinger Lamatempels mit irgendwelchen Anliegen, manchmal wohl auch politischer Natur. Man unterhielt sich auf Mongolisch, tauschte kleine Geschenke aus, begutachtete Constens Neuerwerbungen auf seinen Streifzügen über Pekings CurioMärkte, darunter ein etwa 300 Jahre altes Kanjur, Kultgeräte und einige Landkarten der Weidegebiete aus dem 1041 frühen 20. Jahrhundert. Unter den Gästen war auch ein auf Eleanor etwas Abb. 31: Geistlicher Besuch aus dem unheimlich wirkender Lama „Niemandsland“ Zentralasiens in Peking. der Rotmützen-Sekte, der für Roter Lama mit einer Schädelschale aus Constens Kollektion, um 1938 Consten aber offenbar besonders interessant war. Von diesem Lama, dessen Namen Consten leider nicht verriet, fand sich im Nachlass ein Foto, wie er im vollen Ornat, mit buddhistischem Rosenkranz um den Hals und einer alten Schädelschale (Gabala, mong. gaval) aus Constens Mongolei-Sammlung in der Hand, im Garten des Consten-Anwesens sitzt. Und schließlich gab es auch mit Diluv Chutagt, der 1931 ins Exil gegangen war und seither in Peking lebte, vermutlich um die Jahreswende 1938/39 ein Wiedersehen. Für meine Frau ist das immer so ein kleines Fest, wenn irgendein schmutziger Khubilgan (Wiedergeborener; H.C.) bei mir auftaucht. So erschien vor einigen 517
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
Wochen mein alter Freund Delobin-gegen bei mir!! Die Freude war gross! Delobin-gegen versucht mit Hilfe der Japaner die Mongolen in der Khalchai zu 1042 befreien – spielt also eine ähnliche Rolle wie 1911.
Das Wiedersehen muss etwa um die Zeit stattgefunden haben, als Diluv Chutagt auf Einladung der japanischen Besatzungsbehörde eine Reise nach Japan unternommen hatte. Man hatte ihm dort, wie Owen Lattimore in der Einleitung zu seiner Veröffentlichung der Memoiren des lamaistischen Würdenträgers schrieb, viele Tempel gezeigt und ihn mit großer Ehrerbietung behandelt. Doch habe er – und dies widerspricht diametral der Einschätzung Constens – „vermieden, irgendeine Verabredung zu treffen oder Ernennung zu akzeptieren, die ihn als Agenten der japanischen Politik aus1043 weisen würden.“ Nach seiner Rückkehr nach Peking, so Lattimore weiter, habe sich Diluv Chutagt nach Shanghai abgesetzt, sei von dort mit dem Schiff nach Hongkong und weiter mit dem Flugzeug nach Chungking gereist. Chiang Kaishek, inzwischen von Nanking vor den japanischen Truppen dorthin ausgewichen, habe ihm eine Position im Büro für Mongolische 1044 und Tibetische Angelegenheiten verschafft. So ist durchaus denkbar, dass dieses Wiedersehen Constens mit Diluv Chutagt eigentlich dessen Abschiedsbesuch war, da er Peking kurz darauf verließ und sich dem Einflussbereich der Japaner ebenso diskret entzog wie er sich 1931, nach dem Schauprozess in Ulaanbaatar, der Kontrolle der mongolischen Geheimpolizei entzogen hatte. Constens Fehleinschätzung der Haltung Diluv Chutagts gegenüber den Japanern korrespondiert auffallend mit seiner persönlichen Sympathie für das japanische Vorgehen in China. Angesichts einer besorgniserregenden Kohle- und Lebensmittelknappheit im Frühwinter 1938 und exorbitanter Preise, für die er hauptsächlich die Chinesen verantwortlich macht, schildert er Grete in seinem Weihnachtsbrief die Veränderungen, die sich in Peking unter der japanischen Besatzung vollzogen haben. Wir erleben hier in dieser Richtung ganz ähnliche Sachen wie seiner Zeit in Deutschland nach dem Krieg. Die Japaner tun alles mögliche, der neuen Regierung zu helfen, haben aber selber allerlei Sorgen, den im Süden wütenden Krieg zu einem glücklichen Ende zu führen. Man kann es den Japanern nicht verdenken, dass sie die für ihre Schiffe notwendigen Kohlen – und auch die 518
4. Chinesischer Bürgerkrieg und japanische Bedrohung
für ihre Rüstungsindustrie – nicht mehr den Engländern oder Amerikanern verkaufen wollen, wenn sie sie unter ihrem eigenen Regime aus China exportieren können. Und so geht es mit vielem. Wir haben zur Zeit hier in Peking etwa 37.000 Japaner, meistens Beamte u. Kaufleute. Aber diese 37.000 Japaner haben der orientalischen Weltstadt Peking schon ein westlich europäisch beeinflusstes japanisches Gesicht gegeben. Die Japaner bauen u. bauen u. bauen! D.h. sie kleben die Häuser nicht aus alten gestohlenen gebrochenen Ziegeln u. Dreck zusammen, sondern sie benutzen gesunde Ziegeln [sic], Kalk u. Beton. Überall wo Japaner in chines. Wohnungen einziehen, richten sie ihre Wohnungen japanisch ein. Die Nachfrage nach aus Stroh geflochtenen „Tatami“ (jap. dicke elastische Fußbodenmatten; H.C.) war so gross, dass ich kaum Stroh für meine Pferde kaufen konnte und dann waren die Preise danach! – Haben die Japaner ein Haus bezogen, so brechen sie sofort Fenstern [sic] in die Strassenwand durch u. lassen ihre Strassentore u. Türen weit offen stehen. Das gibt dem Strassenbild für uns alten [sic] Chinesen ein ganz anderes Aussehen, da die Chinesen sich ängstlich vor der Aussenwelt abschliessen u. böse Blick u. Geister durch eine hinter der Haustür erbaute Geistermauer beim Öffnen der 1045 Haustüre fernhalten.
Consten schließt mit den Worten: „Dir, deinen Kindern u. Deinem Mann wünsche ich ein recht frohes Weihnachtsfest u. ein frohes glückliches Neujahr in dem neuen Gross Deutschland.“ Der Anschluss Österreichs im März und die Annexion des Sudetenlands im Spätherbst 1938, die zeigten, wie auch in Europa die Kriegsgefahr systematisch geschürt wurde, hatte in Hermann Consten alte Kampfinstinkte geweckt. Er hatte Adolf Hitlers Vorgehen begrüßt. Dagegen sah er im Münchner Abkommen vom September nur eine Hinhaltetaktik der Briten und Amerikaner, um weiter aufrüsten und Hitler entgegentreten zu können. In diesem Sinne schrieb er Anfang November an Grete: Dass wir hier draussen vor dem „schwarzen Mittwoch“, am schwarzen Mittwoch selber u. nachher um die Radios herumsaßen u. gespannt auf die nächsten Nachrichten lauschten, die uns Krieg oder einen schwerbewaffneten Frieden bringen sollten, kannst Du Dir denken. Die Sowjets funkten mit ihren Störungsversuchen aber dazwischen, sodass wir von der entscheidenden Führerrede nur Bruchstücke verstehen konnten, wogegen der engl. Sender – der übri519
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
gens sehr gemässigt war (man kannte die Engländer kaum wieder) klar u. deutlich zu uns sprach. Als die Sache mir zu brenzlich wurde, entschloss ich, koste es was es wolle, nach Deutschland mich durchzuschlagen und mich wieder zur Verfügung zu stellen. […] Bis dann neulich sich einstweilen alles in Europa in Wohlgefallen auflöste. Trotzdem bin ich nicht ruhig. Mir gefallen Bemerkungen der Engländer u. Amerikaner, die unnachgiebiger Weise gemacht werden, ganz u. gar nicht. Unser Vaterland wird in drei Jahren einer gewaltig gerüsteten Welt gegenüber stehen. Hoffentlich meistert dann der Führer die Situation ebenso glänzend wie in Godesberg u. München. – Ich glaube aber, u. das rechne ich mir zur Ehre an, ich bin der einzige gewesen, der den Versuch machen wollte, von hier aus im Fall eines Krieges nach Deutschland 1046 zurückzukehren, resp. durchzuschlüpfen.
Leicht sei ihm der Entschluss, zu den Fahnen zu eilen, nicht gefallen, so Consten weiter, denn – „und jetzt bin ich zu einem Thema gekommen, das ich lange schon einmal mit Dir besprechen wollte“ – er hätte seine Frau in 1047 unsicheren Verhältnissen zurücklassen müssen. Erst jetzt, im November 1938, geht Hermann Consten näher darauf ein, dass er bereits seit über zwei Jahren verheiratet ist. Zwar betont er, ihr seinerzeit eine Mitteilung geschickt und nie einen Glückwunsch von ihr erhalten zu haben. Doch hat er zwei Jahre lang mit ihr laufend korrespondiert, ohne seine Frau auch nur einmal erwähnt zu haben. Damit ist für ihn das offensichtlich unangenehme Thema auch schon wieder erledigt. Möglicherweise lag das Verdienst dafür, dass ihm dies gegenüber der lieben langjährigen Freundin in Thüringen endlich gelang, bei Eleanor. Den nachfolgenden Briefen merkt man nicht nur Constens Erleichterung an, eine schwierige psychologische Hürde genommen zu haben, sondern auch, wie sehr seine Frau Wert darauf legt, an dieser Freundschaft teilzuhaben, Grüße auszurichten und selbst ihre Dankbarkeit für so viel Hilfe zu bezeugen. Liebe gute Grete! Ich habe Deine drei letzten Briefe erhalten. Meine Frau und ich haben uns beide sehr darüber gefreut. Meine Frau dankt Dir von Herzen für alle Sorge, die Du Dir stets für mich gemacht hast und schickt Dir einliegend ihr Bild. […] Über Eure Weihnachtsbastelei haben wir uns sehr gefreut, meine Frau streicht nämlich auch gerne alles mögliche an. Wenn wir auch für niemanden Puppen520
4. Chinesischer Bürgerkrieg und japanische Bedrohung
stuben oder Bahnhofshallen zu basteln oder zu streichen haben, so müssen zum Anstreichen wenigstens die Türen herhalten. Auch das ewige Frieren hast Du mit meiner Frau gemeinsam und ich hoffe, dass der Pelz, den wir schick1048 ten, Dich vor der zweiten Kältewelle bewahrte.
Auch in diesem Brief ist Consten allerdings recht schnell wieder bei dem, was ihn eigentlich bewegt: die politischen Ereignisse in Deutschland, die er nur aus der Ferne mitverfolgen kann. Und er macht keinen Hehl daraus, auf wessen Seite er steht. Im übrigen sind wir hier über das was sich in Deutschland tut, durch Freund u. Feind genau im Bilde. Des Führers Reden hören wir mit Begeisterung im Radio, wenn auch Wladiwostok u. die Chinesen in Chungking recht unangenehme Störungsversuche machen. Das sind Vorübungen für den kommenden Propaganda-Äther-Krieg. Die Russen geben sich die größte Mühe. Sie senden Deutsch! Dem Sprecher resp. der Sprecherin merkt man ihre jüdische Abstammung wirklich nicht an. Aber der Blödsinn, den sie über Nazism, HitlerDeutschland u.s.w. verzapfen ist so ekelhaft, dass man schleunigst eine andere Wellenlänge aufsucht. […] Gerade heute Nachmittag hörte ich bei einer Bekannten, als wir vom Reiten kamen, die Wiener-Berliner Morgensendung, darunter „Lieder von der Landstrasse“. Dann gab’s eine engl. Sendung, eine sogenannte „nachdenkliche englische Sendung“ für die stupiden Engländer mit anschließender Brahms-Musik. Trotz all dieser von uns ernst gemeinten Versuche der Aufklärung glaubt jeder Engländer, besonders durch das letzte Auftreten u. systematische – jüdische Politik Roosevelt’s, dass Hitler nur auf den Augenblick wartet wo er Frankreich zum Frühstück, England zu Mittag u. die übrigen anrüchigen Demokratien zum Abendbrod [sic] verschlingen kann. Je dümmer die Propaganda u. je niederträchtiger die Hetzreden, desto eher 1049 werden sie geglaubt.
Als am 1. September 1939 deutsche Truppen in Polen einmarschieren und damit den Zweiten Weltkrieg auslösen, will sich Eleanor Consten, nach einem Erholungsurlaub bei Freunden in Japan, gerade in Kobe auf das Schiff zurück nach China begeben. Doch es geht kein Schiff mehr. Unter vielen deutschen Passagieren, die am Abend vor der geplanten Abreise ratlos im deutschen Konsulat der westjapanischen Hafenstadt versammelt sind, entdeckt sie den Pfarrer der evangelischen Gemeinde Pekings und ermuntert 521
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
ihn, mit ihr per Bahn über Korea und die Mandschurei nach China zurückzukehren. Es wird eine abenteuerliche Reise, die viele Tage dauert, wobei sie in ständiger Sorge ist, ihr Etzel könnte tatsächlich auf seine alten Tage 1050 noch in den Krieg gezogen sein. Doch er ist zur Stelle, und ihr gemeinsames Leben in Peking geht vorerst so weiter wie bisher.
5. Lehrtätigkeit und Arbeit an der „Encyclopedia Mongolica“ Ende 1936 war Eleanor von Erdbergs Bonner Dissertation unter dem Titel „Chinese Influence on European Garden Structures“ und mit ihrem neuen Doppelnamen, von Erdberg-Consten, in Harvard erschienen. Doch waren ihrer weiteren Tätigkeit als Kunstwissenschaftlerin in Peking anfangs gewisse Grenzen gesetzt. Sie war froh, dass sie Lehraufträge für englische Literatur und Geschichte der Weltliteratur an mehreren Pekinger Hochschulen, darunter der von Amerikanern betriebenen Yenching-Universität, wahrnehmen oder gelegentlich Vorträge zu ihrem Fachgebiet halten und Privatschüler unterrichten konnte. Mehr durch einen Zufall erhielt sie schließlich einen kleinen Forschungsauftrag der von Steyler Missionaren 1051 betriebenen katholischen Furen-Universität, über dessen Ergebnis sie in dem renommierten Jahrbuch ihres Sinologischen Instituts, Monumenta Se1052 rica, einen Aufsatz veröffentlichen konnte. 1946 bot man ihr sogar eine Stelle als Associate Professor an, die sie bis zu ihrer Ausreise aus China wahrnehmen sollte. Hermann Consten, der Anfang der 30er Jahre mehrere Artikel für Gottlob Mayer verfasst hatte, darunter eine 1932 veröffentlichte Reportage über 1053 die Ming-Gräber, hatte ebenfalls 1937 sein in Japan angefangenes Romanmanuskript fertiggestellt. Er schickte Mayer ein maschinenschriftliches Exemplar des neuen Werks nach Stuttgart, mit der Bitte, es bei einem Verlag unterzubringen. Doch mit weiteren Veröffentlichungen in Deutschland war es tatsächlich nicht einfach. Mayer hatte seine Stelle in Stuttgart verloren und war weggezogen. Es brauchte etliche Monate, die Verbindung neu zu knüpfen. Der Verlag Strecker und Schröder, bei dem in den zwanziger Jahren „Der rote Lama“ und die Afrika-Erzählungen erschienen waren, zeigte sich weder an der Veröffentlichung des neuen Romans noch an einer Neuauflage der zuvor erschienenen Bücher ernstlich interessiert. Vor allem stand wohl „Bibi Faida“, die halb autobiographische Geschichte eines 522
5. Lehrtätigkeit und Arbeit an der „Encyclopedia Mongolica“
deutsch-afrikanischen Liebesverhältnisses von ungeschminkter Erotik, quer zur Rassenpolitik des Dritten Reiches. Mit Constens Person oder einem angeblichen Publikationsverbot schienen die Vorbehalte des Verlags wohl weniger zu tun zu haben, eher mit den neuen Gesetzen über die Reinhaltung der germanischen Rasse. Immerhin hatten sich noch einige Honorare aus dem Verkauf der alten Auflagen angesammelt, die Consten endlich über1054 wiesen wurden. Nun wollte sich Grete bemühen, einen anderen Verlag für ihn zu finden, doch sie blieb ebenfalls ohne Erfolg. Schließlich gab Consten die Schriftstellerei ganz auf, um sich wieder verstärkt einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Mongolei zuzuwenden. An der Arbeitsweise seiner Frau konnte er beobachten, wie wichtig dafür ein vertieftes Quellenstudium war. Ihm fehlte natürlich seine Blankenburger Bibliothek, und Grete Jacobi-Müller musste im Laufe der Jahre immer mal wieder dicke Bücherpakete nach China schicken. Schon 1936 hatte er aus Kyoto an sie geschrieben, um seine Mongolei-Manuskripte und eine im Zusammenhang mit seinen damaligen Veröffentlichungen angelegte Kartei gebeten. Auch um sein Bibliotheksverzeichnis bat er. Er wollte sich eine Kopie davon machen, damit er bestimmte Titel gezielt bei ihr bestellen konnte. In Peking erwies sich derweil der Kontakt zur Furen-Universität für beide Constens als fruchtbar. Denn nicht nur Eleanor, sondern auch Hermann Consten erhielt die Chance, in einer der Universitätszeitschriften zu publizieren. Zwischen 1939 und 1941 erschienen in der Zeitschrift Collectanea Commissionis Synodalis in Sinis insgesamt vier Aufsätze Constens in englischer Sprache über mongolische Klöster, ihre Hierarchien und das religiöse Leben der Lamas. Dabei ist anzunehmen, dass Eleanor ihm nicht nur tätige Hilfestellung geleistet, sondern auch die englische Übersetzung der Texte vorgenommen hat. Eine weitere Publikationsmöglichkeit für das Ehepaar Consten tat sich durch die Bekanntschaft mit dem Journalisten Klaus Mehnert auf, der während der 40er Jahre in Shanghai die vom deutschen Auswärtigen Amt finanzierte englischsprachige Zeitschrift XX. Century herausgab. Er veröffentlichte dort einen Aufsatz Hermann Constens mit dem Titel „Lamaism in Mongolia“ und – teilweise unter dem Pseudonym Beata von Erdberg – mehrere Artikel Eleanors über chinesische 1055 Kunst und Architektur. Alle diese Artikel gaben Hermann Consten die 523
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
Möglichkeit, einige seiner in der Mongolei und China gemachten Fotos zu veröffentlichen und dafür entsprechend gut honoriert zu werden. Trotz Hitlers Überfall auf Polen im September 1939 und der verstärkten nationalsozialistischen Propaganda unter den Auslandsdeutschen blieben die internationalen freundschaftlichen Kontakte der Constens auch während der Kriegsjahre weitgehend ungetrübt lebendig. Die in Peking lebenden Deutschen, gleich ob Reichsdeutsche oder Emigranten, rückten eben1056 falls enger zusammen. Eleanors Deutschkurse wurden nun als „kulturell wichtig“ noch zusätzlich vergütet. Außerdem bot sie Japanischkurse für Deutsche an, um ihnen den sprachlichen Umgang mit der Besatzungsmacht zu erleichtern. Hermann Consten wurde zum Bibliothekar des Deutschen Clubs ernannt, der nach dem „Anschluss“ Österreichs in die ehemalige österreichische Gesandtschaft umgezogen war, und verbrachte dort täglich mehrere Stunden. Er wurde dort so etwas wie eine Institution, denn viele Bibliotheksbenutzer, vor allem die Jugend, fühlten sich bei ihrer Lektüreauswahl durch ihn gut beraten. Wenn nicht gerade jemand Bücher ausleihen wollte oder andere Bibliotheksaufgaben zu erledigen waren, nutzte Consten die Zeit für ein Projekt, von dem er schon seit längerem träumte: nämlich die bereits vor dem Ersten Weltkrieg für seine Arbeit an den „Weideplätzen“ angelegte mongolische Kartei auszubauen zu einer Enyclopedia Mongolica. In ihr sollten alle Aspekte nomadischen Lebens in Zentralasien, Geschichte und Ethnographie, Literaturen und Religionen der mongolischen Völker, samt den über sie verfassten wissenschaftlichen Werken, erfasst werden. „Es war ihm nur ein Bruchteil der dazu nötigen Literatur zugänglich, aber schon sein eigenes Wissen füllte hunderte von Zetteln“, merkte Eleanor von Erdberg in ihren Erinnerungen dazu an. „Allein das auszuwerten, was in seinem Kopf gespeichert war und was in den Büchern stand, die er 1057 besaß, ergab tausende von Stichworten.“ Gelegentlich half ihm ein russischer Emigrant. Er war ein ehemaliger Diplomat, den Consten offenbar noch von seinen frühen Mongoleireisen aus dem damaligen Urga kann1058 te. Auch ließ sich feststellen, dass der Kunsthistoriker und Sinologe Max 1059 Loehr zwei Einträge zum Stichwort „Historische Personen“ beisteuer1060 te. Am Ende sollte Hermann Consten über 30 Zettelkästen mit insgesamt mehr als 55.000 Einträgen gefüllt haben, die er, als das Ehepaar Cons524
5. Lehrtätigkeit und Arbeit an der „Encyclopedia Mongolica“
ten mit den letzten noch verbliebenen Deutschen Peking im Jahr 1950 verlassen musste, mit in seine zerstörte Heimat brachte. „Frau Dr. Consten hat ihrem Mann beigebracht, wie man wissenschaftlich arbeitet“, so erinnerte sich noch Jahrzehnte später der hochbetagte Paul Wilm, der zwischen 1924 und 1949 für verschiedene deutsche Firmen sowohl in China wie auch in 1061 der Mongolei tätig gewesen war. An vielen Zetteln kann man noch erkennen, dass sie ursprünglich Leihzettel der Bücherei des Deutschen Clubs in Peking gewesen waren; Consten hatte sie sich auf Karteiformat zurechtgeschnitten. Angesichts der Teuerung und Papierknappheit jener Jahre war es verständlich, dass kein Fetzchen unbeschriebenen und unbedruckten Papiers, seien es an die Constens adressierte Briefe und Briefumschläge, Einladungs- und Speisekarten, Verlobungsanzeigen, später auch Verlautbarungen des Ortsgruppenleiters oder Blockwarts der Pekinger NS-Ortsgruppe, Bulletins des Deutschen 1062 Nachrichtenbüros Peking etc., vor Constens Schere sicher waren. So erweist sich der Inhalt der insgesamt 32 Karteikästen, die nach Constens Tod an die Berliner Staatsbibliothek gelangten, in doppelter Hinsicht als aufschlussreich. Auf den Vorderseiten spiegeln die nach Sachgebieten und Stichworten – teilweise allerdings auf der Basis eines von Consten selbst 1063 entwickelten, höchst komplizierten Systems – geordneten Informationen sein phänomenales Gedächtnis wie auch die penible Lektüre und „Verzettelung“ der seinerzeit wichtigsten Werke, also den Stand der mongolistischen Forschung bis etwa in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die Rückseiten dieser einzeln zugeschnittenen Zettel jedoch – einige lassen sich noch wie ein Puzzle wieder zusammensetzen – geben Aufschluss über die sozialen Kontakte Eleanors und Etzel Constens in ihren gemeinsamen Pekinger Jahren. Etwa 30 Namen ließen sich verifizieren, darunter die Diplomaten Wilhelm Haas, Felix Altenburg, Hans Spengler und Eugen Ott mit ihren Frauen, die Sinologen Ilse Martin-Fang, Alfred Hoffmann, Max Loehr, Wolfgang Franke und Helmut Wilhelm, die Literaten Alfred Koehn und Alfred Lückenhaus, Geschäftsleute und Ärzte – un1064 ter ihnen viele Kunstsammler – aus Peking, Tientsin und Shanghai, kurz: die gesellschaftliche, kulturelle und intellektuelle Crème der seinerzeit in China lebenden Deutschen. Vor allem aber war Eleanor Consten wohl sehr froh, dass ihr Mann – nachdem er die Schriftstellerei wegen der 525
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
Schwierigkeit, einen deutschen Verlag zu finden, an den Nagel gehängt hatte –, eine ihn voll ausfüllende Beschäftigung für sich gefunden hatte. Denn: Sie hielt seine Erinnerungen und seine Sprachkenntnisse wach. Dass sie nie ein Ende finden würde, war eher ein Vorteil; sein Geist blieb jung, 1065 weil die Aufgabe sich vor ihm in eine grenzenlose Zukunft erstreckte.
Und schließlich sollte nicht unerwähnt bleiben, dass auch die in Berlin aufbewahrten Karteikästen eingefaltete Zeitungsausschnitte enthalten, in diesem Fall mit Hintergrundberichten zu den damals aktuellen Entwicklungen der Mongolei-Frage aus chinesischer Sicht. In manchen Fällen ergab sich dabei eine denkwürdige Koinzidenz der Ereignisse. So nahm Consten am 1. September 1939, dem Tag des deutschen Überfalls auf Polen, einen Artikel der Zeitung The Peking Chronicle über die mongolische Grenze in seine Kartei auf, der sich mit den Ursachen und Folgen der mongolisch-japanischen Kämpfe bei Nomonhan befasste. Consten hatte den Artikel auf die blanke Rückseite eines deutschen Nachrichtenbulletins geklebt, das Meldungen über Truppenmobilisierungen in Polen enthielt. Eine Kurzmeldung desselben Blattes vom August 1946 über die geplante staatliche Anerkennung der Mongolischen Volksrepublik durch die USA hatte er auf die Rückseite eines auf Karteiformat zugeschnittenen Umschlags geklebt, auf dessen Vorderseite noch der Poststempel Peiping 24.12.34 sowie ein weiterer Stempel „Oberkommando der Wehrmacht“ und der Vermerk „Geöffnet“ zu sehen sind.
6. Mao erobert Peking – Ausweisung und Heimkehr Nach Japans Überfall auf Pearl Harbor 1941 und der Ausweitung des Krieges auf Südostasien verschwinden die meisten der in Peking lebenden Europäer und US-Amerikaner im Internierungslager von Weixian auf der Halbinsel Shandong. Praktisch können nur die etwa 480 Deutschen als Angehörige der mit Japan verbündeten Achsenmacht in Peking wohnen blei1066 ben. So wird es um das Ehepaar Consten einsamer. Die Yenching-Universität muss ihre Vorlesungen einstellen, die Häuser ihrer amerikanischen Freunde werden beschlagnahmt, diese selbst zunächst in der Stadt interniert und dann weggebracht. Immerhin haben einige von ihnen noch wich526
6. Mao erobert Peking – Ausweisung und Heimkehr
tige Dinge bei den Constens unterstellen können, vor allem Bücher, Sammlerstücke – und ihre Pferde. Mit den amerikanischen Freunden, von denen sie viele nie wiedersehen sollen, verlieren Eleanor und Etzel aber einen Teil 1067 ihrer Einkünfte. So schließen sie sich wieder enger an die deutsche Gemeinde an, die durch eine Gruppe von Flüchtlingsfrauen mit ihren Kindern aus den von den japanischen Eroberern aufgelösten holländischen Internie1068 rungslagern in Indonesien verstärkt worden ist. Gemeinsam mit ihren Landsleuten verfolgen sie in wachsender Besorgnis, wie das Kriegsgeschehen in Europa, die Luftangriffe auf deutsche Städte die Zivilbevölkerung immer stärker in Mitleidenschaft zieht. Eleanor Consten sieht wohl spätestens nach dem Eintritt der USA in den Krieg die deutsche Niederlage kommen, doch traut sie sich nicht, mit ihrem Mann darüber zu sprechen und dessen Siegeszuversicht in Frage zu 1069 stellen. Spätestens mit dem Fall Stalingrads und der Landung der Amerikaner in der Normandie, über die der Leiter des Deutschen Nachrichtenbüros (DNB) Peking, Herbert Müller, im Deutschen Club ausführlich berich1070 tet, muss jedoch auch Hermann Consten gedämmert haben, dass die Berichte der feindlichen Auslandssender wohl zutreffender waren als es die NS-Propaganda glauben machte und dass der Krieg für Hitler nicht mehr zu gewinnen ist. Auffallend ist, dass gerade für diese Jahre seine Briefe an die Freunde in Deutschland nicht mehr vorhanden sind. Mit der deutschen Kriegsniederlage im Mai 1945 und dem Zusammenbruch der japanischen China-Front ändert sich die Situation. Der Zusammenhalt der Deutschen in Peking zerfällt. Während die einen das Ende des Krieges in Europa und den Tod Hitlers begrüßen und Pläne für eine Heimkehr schmieden, fragen sich die anderen besorgt, was nun mit ihnen geschehen wird. US-Marines, die, aus Okinawa kommend, an Chinas Küsten gelandet sind und nun, nach der Entwaffnung der japanischen Truppen und der Freilassung der Internierten, singend und Fahnen schwenkend durch Pekings Hauptstraßen fahren, lösen gemischte Gefühle aus. Kurz nachdem die Japaner aus der Stadt verschwunden sind, marschieren Guomindang-Truppen ein. Die neue Administration beschlagnahmt deutschen 1071 Besitz, darunter das Hospital und einige Botschaftsgebäude. Die Central Intelligence Group (CIG), Vorläuferin des CIA, lässt etliche China-Deutsche verhaften, denen enge Beziehungen zum NS-Regime zur 527
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
Last gelegt werden. 1946 setzen erste Zwangsrepatriierungen von NSDAPMitgliedern und ihren Angehörigen ein. Die meisten werden mit einem USSchiff nach Europa zurückgeschickt. Nach der Ankunft in Bremerhaven sollten sie per Bahn quer durch das kriegszerstörte Westdeutschland Richtung Süden gebracht und auf der Festung Hohenasperg monatelang festge1072 halten werden, bis ihr jeweiliger Fall geklärt war. Der sogenannten „Gruppe Ehrhardt“, benannt nach dem Leiter der militärischen Abwehr in China, machen die Amerikaner 1946 vor dem Kriegsverbrechertribunal in Shanghai den Prozess. Unter den Angeklagten befindet sich auch der Mongolist Walther Heissig, mit dem das Ehepaar Consten ebenfalls freund1073 schaftlichen Kontakt pflegte. Heissig, ein gebürtiger Österreicher, wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt und anschließend mit anderen Verurteilten in die amerikanische Zone des besetzten Deutschland verbracht. Er verbüßte dort jedoch nur zwei Jahre seiner Strafe auf der Festung Landsberg – ein Indiz dafür, dass zumindest Teile der Anklage absurd waren und das Urteil 1074 nachträglich revidiert worden ist. Hermann Consten mag es angesichts der Verhaftungen und Zwangsrepatriierungen im nachhinein als einen Vorteil angesehen haben, der Partei nicht mehr anzugehören, denn so konnten er und seine Frau eine Freistellung erwirken und vorerst unbehelligt weiter in China bleiben. Zwar verlor Eleanor Consten eine ihrer Lektorenstellen, dafür gab es aber neue Aufgaben für sie an der Furen-Universität sowie als Kunstberaterin und Führerin für amerikanische Touristen. Auch fuhr sie nun regelmäßig zu Kursen und Vorträgen über Chinas Kultur und Kunst ins 120 Kilometer entfernte 1075 Tientsin. Hermann Consten übernahm derweil Führungen im Lamatempel. Und auch die Ausflüge zur Großen Mauer konnten nach einiger Zeit wieder aufgenommen werden. In der Rückschau bezeichnete Eleanor Consten die Jahre 1946–1948 als 1076 „lange, glückliche Jahre“, als die besten in ihrer Pekinger Zeit. Keiner der beiden dachte je daran, Peking eines Tages wieder zu verlassen. Doch mehren sich ab 1947 Anzeichen einer neuen Gefahr. Denn der Bürgerkrieg in China ist mit Japans Niederlage keineswegs beendet. Im Gegenteil. Chiang Kaishek sieht sich durch den Vormarsch der kommunistischen 1077 Truppen Mao Zedongs, diesmal von Norden her, zunehmend bedrängt. Als Eleanor Consten Ende 1947 die Stelle einer Kuratorin für ostasiatische 528
6. Mao erobert Peking – Ausweisung und Heimkehr
Kunst am Museum in Honolulu angeboten wird, sagt sie zu und beantragt für sich und ihren Mann ein US-Einwanderungsvisum, doch klappt es nicht. Auch eine geplante Versetzung zur Katholischen Universität in Nagoya scheitert an administrativen Hindernissen der amerikanischen Besatzungsbehörden in Japan. Während sich der Ring der Achten Rotchinesischen Armee um Peking langsam schließt, verlassen immer mehr Ausländer über eine noch offene Bahnlinie nach Süden oder eine Luftbrücke der 1078 protestantischen Mission die Stadt. Gegen Jahresende 1948 schreibt Hermann Consten an Klaus Strölin über die Ungewissheit der Lage: […] Die Rote Armee ist im Anmarsch. Bisher weiß niemand, ob Fu Tso Yi, der Kuomintang-Kommandant des Nordens, mit seinen gut disziplinierten Truppen Peking und Tientsin wird halten können. Kommen die Roten nach Peking, und das geschieht sicher vor oder kurz nach chines. Neujahr, also im Februar 1949, dann wissen wir nicht, was werden soll. Wir als Deutsche können nirgendwo hin. Gerüchteweise verlautet es, dass die roten Truppen gute Disziplin hätten und ihre Führer den Deutschen gegenüber nicht feindlich eingestellt sind. Wir werden das ja, sobald sie kommen, am eigenen Leibe spüren. Vielleicht ist dieser Weihnachtsbrief für längere Zeit die letzte Nachricht, die Du und Deine Mutter erhalten. Meistens kommt es aber in China anders als man 1079 denkt.
Consten ermuntert den jungen Mann, der kurz vor seinem Abitur steht, die Hürde zu nehmen. Seine Generation möge die Hoffnung auf einen Wiederaufbau des zerstörten und besetzten Deutschlands an die eigenen Kinder weitergeben. Er selbst als mittlerweile 70-Jähriger werde dies wohl nicht mehr erleben. Immerhin sei die Kriegsgefahr in Europa vorerst gebannt. Dafür sehe es in Asien brenzlig aus. Die Kolonialzeit des weißen Mannes ist endgültig dahin. England und Frankreich werden ihren asiatischen Besitz nicht halten können. Frankreichs Truppen in Süd-China sind zwangsweise rekrutierte Mannschaften des AfrikaCorps Rommel, die in frz. Gefangenschaft gerieten. Die Amerikaner stopfen 1080 z.Z. unser altes deutsches Tsingtao mit Truppen in Schiffen voll.
Am 31. Januar 1949 fällt Peking in die Hand der Kommunisten. Die Guomindang-Armee hatte sich schon im Laufe des Dezember aus der Umge529
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
bung der Stadt zurückgezogen, so vollzieht sich der Wechsel auffallend friedlich. Die Bevölkerung ist erleichtert, denn Chiang Kaisheks Truppen und die zutiefst korrupte Beamtenschaft waren verhasst. Doch notierte Eleanor von Erdberg später in ihren Memoiren, die neuen Herren seien kei1081 neswegs jubelnd empfangen worden. Vielmehr hätten sich die Menschen in ihre Häuser zurückgezogen und die weitere Entwicklung abgewartet. Dass ein anderer Wind weht, macht sich erst langsam bemerkbar; es gibt neue Vorschriften im Unterrichtswesen; man sieht russische Berater mit ihren Frauen und Kindern auf der Straße. Der Boy, dessen zahlreiche Familie in der Zeit der Ungewissheit zu den Constens gezogen war, erzählt von Enteignungen auf dem Lande, von der Umverteilung von Grund und Boden und hohen Ernteabgaben. Den Befehl, alle Waffen abzuliefern, ignoriert Hermann Consten. Nur eine seiner Pistolen übergibt er gegen Quittung der roten Militärbehörde. Ein US-Konsul bringt Constens kostbare 1082 Gewehre in seinem Diplomatengepäck außer Landes. Nach der endgültigen Vertreibung Chiang Kaisheks und seiner Guomindang vom chinesischen Festland und deren Flucht auf die Insel Taiwan ruft Mao Zedong am 1. Oktober 1949 von einer großen Tribüne am Platz des Himmlischen Friedens die Volksrepublik China aus. Peking wird wieder Hauptstadt des Reichs der Mitte. Erst mit dem Ausbruch des Korea-Kriegs im Juni 1950 wird die Lage der wenigen noch verbliebenen westlichen Ausländer in Peking wirklich prekär. Es kommt zu Beschlagnahmungen und Verhaftungen; Familienangehörige werden unter Hausarrest gestellt. Einige Personen, darunter ein deutscher Kaufmann, verschwinden, ohne dass man je wieder etwas über sie erfährt. Andere, unter ihnen ein italienischer Diplomat, Vater eines von Eleanors Schülern, wird wegen eines angeblichen Mordkomplotts gegen Mao Zedong angeklagt. Monate später wird er in einem offenen Karren 1083 zum Hinrichtungsplatz gebracht und erschossen. Auch ein Pater der Furen-Universität verschwindet; er soll erst nach Jahren aus dem Gefängnis wieder freikommen und ausgewiesen werden. Noch sind die Constens in ihrer Bewegungsfreiheit nicht sonderlich eingeschränkt. Doch sind ihre Tage in Peking gezählt, als die Regierung im Oktober 1950 die Gleichschaltung aller Hochschulen bekanntgibt und die ausländischen Lehrer der Furen-Universität daraufhin aus Protest ihre Kündigung einreichen. Damit 530
6. Mao erobert Peking – Ausweisung und Heimkehr
entfällt die Existenzgrundlage der Constens, Eleanors Einnahmen aus ihrer Lehrtätigkeit. Der Zufall will es, dass die Bonner Regierung nach einjährigem Bemühen endlich ein Schiff chartern konnte, mit dem die letzten noch in China verbliebenen Deutschen zurückgeholt werden sollen. Als Eleanor davon erfährt, meldet sie sofort die Passage für zwei Personen an. Doch Hermann Consten möchte lieber in Peking sterben als auf seine alten Tage in eine Heimat zurückkehren, die er über 20 Jahre nicht gesehen hat, die unter den alliierten Siegermächten aufgeteilt wurde und die, wie er weiß, von den Kriegszerstörungen gezeichnet ist. Am Ende lässt er sich aber überzeugen, dass es für sie beide das Beste ist, China mit der wohl letzten sich noch bie1084 tenden Möglichkeit zu verlassen. Zwei ihnen noch verbliebene Pferde übernimmt ein britischer Diplomat, einige Damen der Botschaft nehmen sich der Hunde an, den größten Teil ihrer Möbel vermachen sie ihrem Hausboy. Alles andere packen sie in Kisten, einige Studenten helfen bei der Anfertigung der Transportlisten in chinesischer und englischer Sprache. Vor allem müssen sie unverdächtige Bezeichnungen für die chinesischen Kunstobjekte finden. Denn inzwischen gilt ein striktes Ausfuhrverbot für Antiquitäten, die älter als 50 Jahre sind. Hermann Constens mongolische Kartensammlung bereitet ebenfalls Kopfschmerzen, denn die Mitnahme von Karten ist verboten. Doch findet sich eine Lösung. Der englische Militärattaché wusste Rat: Er würde sie im Kuriergepäck nach London schicken, wenn Etzel erlaubte, dass sie dort im Kriegsministerium ausgewertet würden. Nach einem Jahr kam dieser seltene 1085 Schatz wohlbehalten aus London zu uns nach Aachen.
Insgesamt 24 Kisten mit Büchern, Kunst, Kleidung, Teppichen, Geschirr und einigem Hausrat sind gepackt und bereits auf dem Weg nach Tientsin, als die Constens kurz vor Abfahrt ihres Zuges eine Vorladung auf das Ausländeramt erhalten, wo man ihnen und einigen anderen dort versammelten Deutschen das bereits erteilte Ausreisevisum wieder abnimmt. So müssen sie unverrichteter Dinge in ihre Wohnung zurück, wo immerhin noch die Möbel stehen. Da sich ihr Missgeschick rasch herumspricht, helfen Freunde und der Hausboy mit dem Nötigsten. Doch leben sie in ständiger Sorge, die Polizei könnte nachts ans Tor klopfen und sie verhaften. Schließlich sind 531
VI. Die chinesischen Jahre 1929–1950
ihre engen Kontakte zu den Amerikanern bekannt. Ein Spionagevorwurf wäre leicht zu konstruieren. Doch wendet sich ihr Glück ein weiteres Mal und sie erhalten nach einer knappen Woche schließlich doch noch die Ausreisegenehmigung. Auch der umgebaute irische Frachter, die Dundalk Bay, einstmals als Nürnberg unter deutscher Flagge fahrend, liegt noch vor der Reede von Tientsin. Die Aufregungen und Kontrollen, die Angst vor allem, bis sie tatsächlich nach vielen Verzögerungen an Bord des Schiffes gelangen, das sie nach Jahrzehnten in China in das geteilte Deutschland zurückbringen soll, schil1086 dert Eleanor von Erdberg höchst lebendig in ihren Erinnerungen. Was sie in der Heimat erwartet, wo sie leben werden, wissen sie noch nicht. Hermann Consten hat an seine vertraute Cousine Mie geschrieben und sie über die bevorstehende Rückkehr informiert. Vielleicht kann man zunächst bei den Dahmes wohnen und dann weitersehen. Nach dem Einlaufen des Schiffes in den Hamburger Hafen kommen sie erst einmal bei entfernten Verwandten Eleanors in der Hansestadt unter. „Wir wurden erwartet! Was das bedeutete, kann nur der ermessen, der sich mit dem Schicksal der Obdachlosigkeit bereits abgefunden und nur noch auf einen Platz im Lager gehofft hat“, schreibt Eleanor von Erdberg in ihren Erinnerungen. „Etzel war 25 Jahre nicht in Deutschland gewesen, ich 18. Alle Bande mussten neu ge1087 knüpft werden. Hier war ein wunderbarer Anfang.“ Es ist der Silvesterabend des Jahres 1950.
532
VII. Summe des Lebens 1951–1957 1. Wieder in Aachen: Der Kreis schließt sich Das neue Jahr beginnt mit der Bahnfahrt von Hamburg nach Aachen, wo Cousine Mie dem aus China zurückgekehrten Paar fürs Erste ein Zimmer freigemacht hat. Beide sind über das Ausmaß der Zerstörungen, das sie, fünf Jahre nach Kriegsende, vom Zug aus immer noch sehen können, tief erschüttert. Längst sind nicht alle Trümmer weggeräumt, manche Bahnhöfe sind nur provisorisch repariert. Die Städte, vor allem im Ruhrgebiet, machen einen grauen, trostlosen Eindruck. Von Wiederaufbau kann noch nicht die Rede sein. Besonders schmerzlich trifft Hermann Consten die Heimkehr in seine Geburtsstadt Aachen. Etzel kam nach Hause, aber er kannte seine Vaterstadt nicht mehr wieder. Ganze Straßenzüge waren ausgelöscht; er fand sich nicht zurecht, weil er Häuser suchte und nur Trümmergelände fand. Von seinem großen Elternhaus standen nur noch einige Stücke der Erdgeschossmauer. Auch ihre neugotischen Bögen mit der sorgfältigen Steinmetzarbeit des vorigen Jahrhunderts wurden bald abgerissen, um einem nüchternen 1088 Neubau Platz zu machen.
Die Aachener Verwandten sind zusammengerückt, Cousine Mie überlässt Eleanor und Etzel das Schlafzimmer, das sich allerdings nicht heizen lässt. So findet sich die Hausgemeinschaft meist in der Küche um den Herd versammelt. Von China hat ein jeder nur 80 US-Dollar mitnehmen dürfen; sie sind schnell verbraucht. Eleanors Mutter schickt gelegentlich Geld aus den USA. Hauptsorge ist also, sich eine neue Existenz zu schaffen, bezahlte Arbeit zu finden. Nach den Jahren der Hitler-Diktatur und des Krieges ist unter den Menschen nicht nur der Hunger nach Brot groß, sondern auch der Hunger nach neuer geistiger Nahrung, nach lebendiger Kultur und nach vertiefter Kenntnis fremder Kulturen. Wir kamen mitten hinein in den neuen Aufbruch geistigen Lebens nach der langen Erstarrung. Wir hörten mindestens einen Vortrag in der Woche, im Außeninstitut der Technischen Hochschule, im Englischen Zentrum „Die Brücke“, im Kunstmuseum. Oft saßen wir nachher mit den Vortragenden zusammen in lebhaftem Meinungsaustausch. Die Deut533
VII. Summe des Lebens 1951–1957
Abb. 32: Die Trümmer und Ruine der Adler Brenn- und Brauerei Consten in Aachen, um 1959
schen waren geistig hungrig; sogar wir konnten manchmal ein Krümchen Nahrung beisteuern. Etzel sagte oft: „Der Kreis schließt sich.“ Auch im letzten Hafen seines Lebens konnte er teilhaben am geschäftigen Trei1089 ben.
Tatsächlich gibt es in Aachen Menschen, die sich noch an Hermann Consten erinnern und den mittlerweile 73-Jährigen auffordern, so wie früher Vorträge über die Mongolei zu halten. Im März 1952 spricht er im Physikalischen Institut der TH zum Thema „Der Lamaismus und die Klöster“. Im Jahr darauf berichten Aachens Zeitungen von einem Vortrag Constens in der „Brücke“ über seine bald schon 50 Jahre zurückliegenden frühen Mongoleireisen. Die Aachener Volkszeitung, die Consten kurzerhand auch noch zum Professor beförderte, berichtete anschließend beeindruckt: Abenteuerlich und schicksalhaft schon war es, wie Consten nach Moskau kam und man ihm dort den Auftrag erteilte, in der Mongolei „Köpfe zu sammeln“. Das warf ihn mitten in die brodelnden Ereignisse, wobei der bescheidene Redner nur am Rande wissen ließ, welche bedeutende Rolle er dabei selbst gespielt und welche wertvollen Informationen er neben der 534
1. Wieder in Aachen: Der Kreis schließt sich
Durchführung seiner wissenschaftlichen Aufgabe für seine deutsche Hei1090 mat sammelte.
Gegen Jahresende 1954 schildert Consten mit dem ihm eigenen Erzähltalent gegenüber der Aachener Volkszeitung seine Begegnungen mit Aachener Auswanderern in Sibirien. Das war noch vor dem Ersten Weltkrieg gewesen, doch stellt er seine Erlebnisse so lebendig dar, als hätten sie sich erst vor wenigen Wochen ereignet. Das Blatt macht einen Dreispalter dar1091 aus. Auch aus anderen Städten kommen Anfragen zu Vorträgen. Doch sind die Honorare überall bescheiden. Bald findet sich aber für Eleanor eine Stelle an der 1946 wiedereröffneten Technischen Hochschule, im Kunsthistorischen Institut ihrer Architektur-Fakultät. Mit einem Lehrauftrag und einer Anstellung in der Bibliothek ist der Lebensunterhalt des Paares erst einmal soweit gesichert, dass es in Alsdorf bei Aachen eine Zweizimmerwohnung mit Küche in einem Neubau beziehen und endlich auch die 24 Kisten mit ihrem Umzugsgut aus China kommen lassen kann, die lange bei einem Hamburger Spediteur eingelagert waren. Allmählich bildet sich auch wieder ein neuer Freundeskreis; er ist Hilfe und Anregung zugleich, dauerhaft Fuß zu fassen in der alten, entfremdeten Heimat. Mit der Erleichterung, dass alles sich glücklich fügt, macht sich zugleich auch tiefe Erschöpfung bemerkbar. Nach den inneren Anspannungen der letzten China-Jahre, dem Abschied von Peking und der Heimkehr ins Ungewisse, in ein Land, das selbst erst wieder zu neuer Orientierung finden muss, braucht dies alles Zeit. „Wir mussten nun in Deutschland eine Lehre besonderer Art durchmachen“, vermerkte Eleanor von Erdberg später in ihren Erinnerungen und fuhr fort: In unserem Leben fehlten zwei bedeutende Abschnitte, durch die unsere Verwandten und Freunde hatten hindurchgehen müssen, die Nazi-Zeit und der Krieg. Mit keinem konnten wir das Verhältnis da wieder aufnehmen, wo es abgebrochen war. Keiner, sei er nun für oder gegen Hitler gewesen, war unter seiner Herrschaft und im Kriege unverändert geblieben; jeder trug schwer an den Folgen und Erinnerungen an diese schrecklichen Zeiten. Uns fehlte diese Vergangenheit; was wir gehört hat1092 ten, war fast alles Lüge gewesen.
Doch ist Eleanor schon ein wenig verwundert darüber, wie stark die re535
VII. Summe des Lebens 1951–1957
staurativen Tendenzen in der Bundesrepublik der fünfziger Jahre sind. Während sie registriert, wie die junge Generation das Verschwinden der alten Zwänge und Vorurteile für sich zu nutzen versteht, sieht sie die Älteren „ängstlich zurückkriechen in die alten leeren Formen, anstatt die Freiheit 1093 eines neuen Anfangs zu begreifen“. Auch zwischen ihr und ihrem Mann macht sich in dieser Frage der Generationsunterschied sicher bemerkbar, wenn auch abgemildert durch Hermann Constens lange Auslandserfahrung. Von ihm selbst, der in der Kaiserzeit und während der Weimarer Republik auf Seiten der deutschnationalen Kräfte politisch aktiv gewesen war, der Hitlers Aufstieg und seine Kriegspolitik sogar noch von Peking aus begrüßt hatte, sind nach der Heimkehr keine Reflexionen über die verheerenden Folgen dieser Politik mehr überliefert. Was nicht heißt, dass er nicht auch nachdenklich geworden war. Denn auch er hat nun an den Folgen mitzutragen. Die Teilung des Landes in zwei einander feindlich gegenüberstehende Staatsgebilde macht ihm einen Besuch in Thüringen, das nun in der DDR liegt, unmöglich. Die Kontaktaufnahme zu den treuen Freunden dort ist erschwert. Doch lebt Gretes Sohn, Klaus Strölin, im Westen, in Esslingen, wo er die Apotheke seines Vaters übernommen hat. Über ihn erfährt Hermann Consten Näheres vom Schicksal der weiter unter einer – diesmal roten – Diktatur lebenden Freundin. Es muss ihn tief berührt haben, zu erfahren, wie sie über all die Jahre, teilweise unter schwierigsten Bedingungen, seinen 1927 in Bad Blankenburg zurückgelassenen Besitz stets mit sich geführt und gegen fremden Zugriff verteidigt hat. Seit Jahren bereits wohnte Margarete Jacobi-Müller mit ihrem zweiten Mann in Eisenach. Sie erlebte dort das Kriegsende in dem zunächst amerikanisch, dann sowjetisch besetzten Thüringen. Und wie Klaus Strölin zu berichten weiß, klingelten schon kurz nach der Einnahme Eisenachs durch die Russen im September 1945 sowjetische Geheimdienstoffiziere an ihrer Tür. Sie fragten nach Hermann Constens Tagebüchern und geheimen Aufzeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg 1094 und drohten mit der Beschlagnahme seiner Bibliothek. Welche Geistesgegenwart muss dazu gehört haben, den Besitz zu leugnen und noch in der Nacht Constens Aufzeichnungen lieber zu verbrennen als sie in die Hände der Russen fallen zu lassen! Er selbst hat dies, als er nach seiner Rückkehr 536
1. Wieder in Aachen: Der Kreis schließt sich
davon erfuhr, gutgeheißen. Auch dass sie den größten Teil seiner Bibliothek nach und nach verkaufen musste, um selbst über die Runden zu kommen, kann er nachvollziehen, selbst wenn es ihn wohl sehr geschmerzt haben dürfte. Bleiben die Gebiete jenseits des Eisernen Vorhangs nun auf unbestimmte Zeit versperrt, so öffnen, eines nach dem anderen, wenigstens wieder die übrigen Nachbarländer ihre Grenzen. 1954 reist Eleanor Consten mit ihrem Mann per Bahn zu einem Sinologenkongress nach Rom. Und die Steyler Missionare, von denen einige ihrer alten Bekannten aus Peking ebenfalls heil zurück sind, schenken dem Paar noch eine Woche dazu. Die beiden durchstreifen die Ewige Stadt, besuchen anschließend eine Cousine Eleanors in Florenz, wo sie von der „subtilen Mischung der Grautöne“ des Baptisteriums besonders angetan ist. Die Krönung der Italien-Reise aber ist der Besuch Venedigs, wo zum 700. Geburtstag Marco Polos im Dogenpalast eine große Ausstellung mit chinesischer Kunst eröffnet werden soll, die Kunsthistoriker, Künstler und Sammler aus aller Welt anzieht. Allein erlebt sie einen beglückenden Konzertabend im nächtlich goldschimmernden Marcus-Dom. Gemeinsam wandern sie „über Gassen, schmale Stege am Wasser, Brücken, Plätze“ – nur die schwankenden Gondeln und Vaporetti meiden sie. Nach ihrer Meinung ist die Stadt nicht so sehr für junge Liebende gemacht – „nein, es ist eine Stadt für Alternde“, also eine Stadt nach 1095 ihrem Herzen. Andere, kürzere Reisen schließen sich an: Maria Laach, Paris, Amsterdam, Colmar, Ronchamps. Ich war ein recht guter Reisemarschall geworden; Etzel verließ sich ganz auf mich; er hatte in Asien verlernt, in zivilisierten Gegenden und Trans1096 portmitteln zu reisen.
Ein Ausstellungsprojekt im Stuttgarter Lindenmuseum bietet Gelegenheit, im benachbarten Esslingen Klaus Strölin und dessen Frau Ingeborg zu besuchen und alte Freundschaftskontakte neu zu knüpfen. Und schließlich fahren die beiden Constens noch zum 80. Stiftungsfest der Arminia nach Karlsruhe, wo Hermann Consten, der weitgereiste Bundesbruder, der geheimnisvolle Agent und Abenteurer, im Mittelpunkt des Interesses steht. Im Kreis der studentischen Jugend und der „alten Herren“ fühlt er sich 1097 noch einmal jung, tanzt Walzer mit seiner Frau bis tief in die Nacht. 537
VII. Summe des Lebens 1951–1957
1955 habilitiert sich Eleanor Consten und erhält an der TH Aachen eine Professur. Ihre Vorlesungen über das japanische Haus und amerikanischen Wohnbau sind eine große Attraktion für angehende Architekten und Bauingenieure in einem Land, wo sich ein modernes Wiederaufbauprogramm für die zerstörten Städte weitgehend durchzusetzen beginnt. Im selben Jahr ziehen die Constens noch einmal um in eine größere Wohnung, an die Ludwigsallee 73 in Aachen. Sie leben dort inmitten ihrer zentral- und ostasiatischen Schätze, von denen sie zum Glück nur einen geringen Teil verkaufen mussten, um ihr Budget ein wenig aufzubessern. Bevor Eleanor zu einer ersten längeren Abb. 33: Hermann Consten auf dem 80. Stiftungsfest der Arminen in Vortragsreise in die USA aufbricht und Karlsruhe, 1956 Etzel sich in Aachen wieder der Arbeit an der Encyclopedia Mongolica zuwendet, zeigt das Ehepaar Consten im Suermondt-Museum einen Teil seiner chinesischen und mongolischen Sammlungen in einer viel beachteten Ausstellung. Auch im Museum für Ostasiatische Kunst in Köln, damals noch in seinem provisorischen Domizil am Hahnentor, stammte ein Teil der Leihgaben in einer von seinem damaligen Direktor Werner Speiser kuratierten Ausstellung ostasiatischer Werke von den beiden Constens. Er der Kenner, zog keine Grenzen; außer unseren besseren Stücken borgte er auch unser japanisches Geschirr aus den dreißiger Jahren. Wir mussten uns derweil zu Hause mit wenigen Tellern behelfen. Die „Cons1098 ten’sche Küche“ war Speiser eine große Vitrine wert.
Im Frühjahr 1957 meldet sich die Kulturredaktion des Westdeutschen Rundfunks bei Hermann Consten und erbittet einen Beitrag über seine 1099 Mongolei-Erfahrungen für ihre Sendereihe „Der Lebensabend“. Auch 538
1. Wieder in Aachen: Der Kreis schließt sich
diesmal sind es ausschließlich die Reisen und Erlebnisse vor dem Ersten Weltkrieg, von denen er berichtet. Für den beinahe Achtzigjährigen haben sich die weiter zurückliegenden Erinnerungen eindeutig in den Vordergrund geschoben, sind wieder lebendig und plastisch präsent, wie dies bei alten Menschen eben häufig geschieht. Nur wenige Monate später, in den Sommerferien 1957, beteiligt sich Eleanor an einer städtebaulichen Exkursion nach Berlin. Als sie zurückkehrt, ist Hermann Consten tot. Schlaganfall. Er starb mitten in der Unterhaltung mit Freunden; er kann sich des Schlags nicht bewusst gewesen sein, so wenige Sekunden lagen zwischen 1100 Leben und Tod. Für ihn, den fast Achtzigjährigen, war es eine Gnade.
So endete, eher unspektakulär, ein wildbewegtes Leben, das vom Leben selbst und nicht von Karl May geschrieben worden war. Die Todesanzeige in der Aachener Presse ist schlicht. Neben Eleanor Consten nennt sie fünf der noch lebenden Geschwister und Halbgeschwister als Hinterbliebene, darunter auch Bruder Franz, zu dem das Verhältnis bis zum Schluss gespannt blieb. In der Pfarrkirche Heilig Kreuz findet am 9. August ein katholischer Trauergottesdienst statt; anschließend wird Hermann Consten auf dem Aachener Ostfriedhof am Adalbertsteinweg beigesetzt. In Aachen, wo sein Leben begonnen hatte, endete es auch. Hatte er dort den „Tempel des Lebens“ endlich erreicht, nach dem er immer gesucht hatte? Er wird es uns nicht mehr sagen können. Auch so manches andere Geheimnis hat er mit ins Grab genommen, das selbst durch die Recherchen zu diesem Buch nicht hatte gelüftet werden können.
2. Unvollendet im Nachlass: „Encyclopedia Mongolica“ Hermann Consten geriet in Vergessenheit. Eleanor von Erdberg, mittlerweile in zweiter Ehe mit ihrem amerikanischen Vetter Robert von Erdberg verheiratet, bemühte sich vergeblich, Constens Roman „Der rote Lama“ neu herauszubringen. Ein junger türkischer Künstler trug sich in den achtziger Jahren mit Plänen, ein Buch mit Constens Türkei-Fotos und einigen 1101 seiner türkischen Anekdoten herauszubringen. Man hat nie wieder davon gehört. Und sie selbst konnte sich, bald 30 Jahre nach Constens Tod, auch nicht mehr dazu aufraffen, seine Lebensgeschichte oder besser: Geschichten aus seinem Leben aufzuzeichnen – Geschichten, die ihr von ihm 539
VII. Summe des Lebens 1951–1957
persönlich oder von anderen erzählt worden waren. Nur Constens FrauenGeschichten, von denen ihr im Laufe der Jahre nach seinem Tod das eine oder andere zu Ohren kam, wollte sie ausgeklammert wissen. „Ich habe nie nach den Frauen in seinem Leben gefragt. Er hat auch nie eine erwähnt – 1102 außer Ihrer Mutter“, schrieb sie 1986 an Klaus Strölin. Sie kam nicht einmal dazu, Constens Tagebücher zu lesen. Vielleicht scheute sie auch den Blick auf die Nachtseite eines Menschen, der ihr so nahegestanden hatte und den sie nur so, wie sie ihn selbst erlebt hatte, im Gedächtnis behalten wollte. Viele Dinge aus Constens Nachlass hatte Eleanor von Erdberg bereits weggegeben, an Menschen oder Institutionen, von denen sie annahm, es könnte sie interessieren. Mitte der neunziger Jahre begann sie das zu sichten, was noch bei ihr vorhanden war und zerriss – leider – „alles das, was 1103 von Etzel an Manuskripten aufbewahrt war, aber gedruckt vorlag“. Das Manuskript seines nie veröffentlichten Japan-Romans schickte sie zur Entscheidung, was damit geschehen solle, nach Esslingen. Ihr eigenes Urteil hatte sie aber schon gefällt. Er ist in einem Stil geschrieben, den heute niemand mehr liest, nicht 1104 spannend und zu kurz für ein Buch.
Auch Hermann Constens wissenschaftliche Beschäftigung mit der Mongolei beurteilte Eleanor von Erdberg, wohl wissend, dass er vor den Augen der Fachwelt nicht bestanden hatte, in aller Nüchternheit der Wissenschaftlerin, die sie selbst nun einmal war. Realistisch gesehen sollte man alles vernichten. Die Mongolistik ist über diese Aufzeichnungen hinweggegangen. Und die „Weideplätze“ gibt es 1105 noch – die sind unvergänglich.
Immerhin, mehr als 50 Jahre nach Constens Tod wurde – angestoßen durch die neugierige Journalistin, die ein Buch über Hermann Consten zu schreiben und seine Fotos in einer Ausstellung zu zeigen gedachte – von der einen oder anderen Mappe, dem einen oder anderen Kasten doch noch der Staub eines halben Jahrhunderts abgewischt, wurden zerbröselte Gummibänder und verrostete Büroklammern entfernt und der Inhalt einmal näher in Augenschein genommen. Dies betraf zum einen die im Seminar für Kul540
2. Unvollendet im Nachlass: „Encyclopedia Mongolica“
tur und Sprachen Zentralasiens vorhandene Sammlung, sowie dort ebenfalls aufbewahrte kunsthistorische und andere Fotografien, zum Teil von 1106 Consten selbst aufgenommen, zum Teil auch von ihm erworben. Zum anderen betraf es Constens Hinterlassenschaften in der Berliner Staatsbibliothek: seine mongolische Landkartensammlung und die 32 Zettelkästen mit den Materialien für die nie abgeschlossene Encyclopedia Mongolica samt Glossar. Die einzigartige Landkartensammlung zählt heute zu den besonderen Schätzen der Berliner Staatsbibliothek. Und im Juli 2010 stellte der Leiter des Referats Zentralasien, Dr. Michael Balk, Constens Zettelkästen auf der 53. PIAC (Permanent International Altaistic Conference) in St. Petersburg, auf der es um das Thema „Unknown Treasures of the Altaic World in Libraries, Archives and Museums“ ging, einem größeren Kreis von Spezialisten vor. When I first saw Consten's encyclopaedia, I was impressed and thought that it could be a good idea to have it edited and published. Consten knew Mongolia pretty well and he saw it at a time in history which is irretrievably gone. So, one can expect to find one or the other useful information. On the other hand, it must be said that most of the information Consten collected are notes he took from books he read later, extracting Schmidt, Waddell, Kowalewski, Mostaert, Grousset, Haenisch, Heissig, himself, and a number of others. More often than not he offers only reproductions of information already published. After going through it in a cursory manner I must confess that I finally found Consten's encyclopaedia confusingly arranged rather than useful and I grew substantially doubtful if it is worth being edited and published, but I do not want to anticipate any 1107 such decision if it was to be made.
Ähnlich vorsichtig hatte ich selbst in meiner ersten Beschreibung des Inhalts der 32 Karteikästen geurteilt: Nach meinem Eindruck stellt er eine Fundgrube für Diplom- oder Doktorarbeiten aus den Bereichen Mongolistik, Religionswissenschaft, Buddhismusforschung, Kunstgeschichte, Geographie und Sozialgeschichte dar. Ob sich nach mehr als einem halben Jahrhundert eine Publikation sowohl der Enzyklopädie wie auch des Wörterbuchs empfehlen würde,
541
VII. Summe des Lebens 1951–1957
vermag ich nicht zu beurteilen. Das ist eine Frage für die Fachwissen1108 schaft.
Es sieht eher nicht danach aus, dass Hermann Constens immense, von den Entwicklungen und wissenschaftlichen Ansprüchen der modernen mongolistischen Forschung längst überholte Fleißarbeit doch noch zu späten Ehren käme, aber dennoch könnten die 32 Karteikästen, inzwischen ergänzt durch einige weitere nach Berlin gelangte Kästen aus dem Zentralasienseminar der Universität Bonn, durchaus eine brauchbare Quelle für das eine oder andere Forschungsprojekt sein. Für einige wenige der Kästen – allem Anschein nach handelt es sich um den alten Kern seiner bereits in den zwanziger Jahren begonnenen „Kartei über die Mongolei“ – müsste allerdings erst ein Suchsystem entwickelt werden, denn Constens Klassifizierung ist in der Tat eigenwillig, manchmal kryptisch und auch von ihm selbst nicht immer konsequent durchgehalten. Der Eindruck ist nicht von der Hand zu weisen, dass der mit Verschlüsselungscodes vertraute Geheimagent von einst unbefugte Benutzer ganz bewusst ein wenig in die Irre führen wollte. Ein wichtiger Schlüssel in Constens alphabetischer Ordnung ist zum Beispiel die Verschlagwortung von Z nach A statt umgekehrt. Auch ein zweiter Schlüssel war relativ leicht zu knacken. Die Einordnung der Stichworte erfolgte nicht nach dem Anfangsbuchstaben des jeweiligen Begriffs, sondern nach dem zweiten Buchstaben, wobei St und Sch jeweils als ein Laut behandelt wurden. Ein paar Beispiele: Y – Nyimpa rote Sekte der Lama, siehe Bon. Buddhistische Glaubenslehre. Ihr Einführer in Tibet: Padma-sambhava. Brandt [unles.] d. lebende Buddhas p. 93 W – Schweden O – Mongolei [Der Kasten enthält unter O einen Zeitungsausschnitt aus der Deutschen Tageszeitung vom 3.8.1922 mit dem Titel „Der russische Staatenbund“, in dem es heißt, die UdSSR weise 27 autonome Einzelstaaten auf, darunter irrtümlicherweise, Nr. 25: die Mongolische Republik (Hauptstadt Urga). Dazu handschriftlich mit Tinte eine separate Karteikarte:] Mongolei, wurde bis zum Ausbruch der mongolischen Revolution vor der 542
2. Unvollendet im Nachlass: „Encyclopedia Mongolica“
Unabhängigkeitserklärung des Chutuchtu von Urga 1912/13 angeblich, weil in China die Republik erklärt worden war und die Chalchafürsten unter Druck oder auf Betreiben Russlands in folgende Aimaks und Fürstentümer eingeteilt. Im Norden: Chalcha, im Süden: Bargu Burät, Aro-Chortschin, Chlors Durbot, Dshulit, Baring, Dsharot, Oniut, Naiman, Archan. In den mittleren Steppen: […] Näher a. China: Tumet (i.d. südl. Ecke) Charatschin, Lachar, Mo-mingan, Orat (die Hälfte des Landes waren Weideplätze des Bogd Khan), Kukin-choto […], Orton (nördl. Krümmung d. Gelben Flusses), Kuku-nor (chines. Lincha, „das blaue Meer“. TB III, 219, siehe Chalcha! Zwei Wege führen in die Mongolei, der eine über Naikou und Kalgan, der 1109 zweite über Ku-peh-k’ou und Jehol. (Erkes, China p. 13), von T’ai-yuanfu über Tai-teh-chou und Ta-b’ung-fu ebenfalls ein Weg in die Mongolei. Kosch-Agatsch [Die Karteikarte enthält Daten und persönliche Eindrücke der Umgebung der Stadt und des Klimas.] Kor-Ketschun [Daten und persönl. Eindrücke; Consten vergleicht eigene Beobachtungen mit dem, was er bei Radloff gelesen hat.] Goldgewinnung [Zeitungsausschnitt Börsenzeitung, Ende August 1923 über Goldgewinnung in der Mongolei, mit Statistik betr. Umfangs der Goldförderung zwischen 1902 und 1920.] E – Nephrit Kasch. Pers. Hasi, chines. Yük. Wird durch chinesischen Einfluss (meistens auch chines. Arbeit) als und für ganz besonders kostbare Schmuckgegenstände verarbeitet. So z. B. zu Armbändern, Schnupftabakdosen, Pfeifenspitzen, Ohrgehänge usw. Diese Ware kommt fertig aus China. Nephritstücke sind in der Mongolei unbekannt. Die Lager in China sind erschöpft, obwohl in der neolithischen Periode in China der Yük (Nephrit) das gewöhnliche Material für Wertzeug war. Die noch heute bekannten Fundstellen waren im Altertum schon erschöpft. Kommt der Stein heute fast nur aus Khotan u. Turkestan. Hier besitzt die Nephritindustrie noch heute ihr einziges Zentrum auf der Erde (Erkes, China p. 16) Großes Lager auch im Kunlun-Gebirge, werden in Khotan verarbeitet. (Schlagintweit, Indien u. Hochasien p. 161-183) B – Obo
Steinaltar des Schamanismus (auch Grenzstein). Literatur: Wei-
543
VII. Summe des Lebens 1951–1957
deplätze v. Consten p., 54, 65, 66, 80, 82, 149.
1110
Delitsch: Die grosse Täuschung p. 18, 28, 29, 53,
A – Maimaitschen chines. Handelsplatz, Marktort. Erste chines. Stadt hinter Kiachta (deren Schwesterstadt, von hier 360 Werst n. Urga. Obutschew, China Bd. I, p. 19) und Maimatschin bei Urga, 7 Werst v. Urga, also 4 W. v. russ. Generalkonsulat am Tola gelegen, gerade Straßen, gut gebaute Handelshöfe, schöne Fanse [Wohnhäuser mit Innenhöfen; D.G.], mächtige Lagerschuppen, prächtiger Tempelgrund, Verwaltungshaus irgend eine Art Börse, Handelsbank, Telegraf; Verwaltung durch gewählte Ältesten. Früher, vor dem Bau der großen sibirischen Bahn Hauptstapelplatz für [unles.] und Hauptzentrum des Handels m. d. Äußeren Mongolei. Von hier wurde der chinesische Handel bis in die entferntesten Winkel der Steppe vorgetrieben. Umsätze einzelner Firmen bei 2 Millionen Rubel jährlich (Moskauer Handelsexpress p.41-42). Lt. Iwan Mong p. 21 ist Maimatschin bei Urga von Chinesen und Mongolen bevölkert. Die ersteren wohnen in Fansen, die Mongolen in den äußeren Teilen Maimatschins in Jurten. In Maimatschin gibt es vier Tempel (drei chines., ein mong.) und ein chines. Theater und Hotels, die Fremde beherbergen. Die Bevölkerung zählt 8.000 Köpfe. Weitere Karte: Maimaitschen bei Kiachta Hauptstraße Es gibt in der Mongolei zwei Hauptstraßen: 1) Kobdo über Uliasutai und Buir-usu nach Kalgan (2.130 km); 2) Kiachta–Urga–Kalgan (1.320 km); vier Nebenstraßen: 1) Urga–Uliasutai (400 km); 2) Kobdo zur russischen Grenze Pass-chak Urton, russischerseits Tarschanti (330 km); 3) Kobdo nach Tschugu-tschak (750 km); 4) Uliasutai nach Barkul (600 km). Alle übrigen Straßen und Karawanenwege, welche die Mongolei in alle Richtungen durchziehen, so die geheime Kaufmannstraße (Weidepl.). Der Unterschied zwischen Haupt- und Nebenstraße mit Poststationen ist der, dass an den Hauptstraßen 12 Jurten stehen, auf den Nebenstraßen nur 10. Handel „Handel in der Mongolei“ [Ostasiatischer Lloyd, Shanghai, No. 46 vom 18. Nov. 1910. Abschrift Consten auf 3 Karteikarten, doppelseitig, Tinte:] Vizepräsident Petrow von der Kaiserlich Russischen Orientgesellschaft gibt folgenden Bericht über den Handel in der Äußeren Mongolei: Meine Reise dauerte im ganzen zehn Wochen. Ihr Hauptziel war, die wirtschaftliche Lage in der Mongolei zu studieren. [Die Russen hatten Proble544
2. Unvollendet im Nachlass: „Encyclopedia Mongolica“
me wegen der internationalen Konkurrenz, Amerikaner, Deutsche etc. Petrow plädiert in seinem Bericht für den Eisenbahnbau zur Intensivierung des politischen und wirtschaftlichen Einflusses. Consten macht einen Querverweis auf das Stichwort Kiachta, abgelegt unter dem Buchstaben I.] Im von Consten gewählten Ordnungssystem lässt sich ferner eine vertiefte Verschlüsselung nachweisen. Gibt es unter einem Registerbuchstaben mehrere Stichworte, z.B. Han-, Ham-, Hal- etc., dann richtet sich ihre Einordnung hinter der Registerkarte A nach dem dritten Buchstaben, und zwar wiederum in der Reihenfolge Z bis A, und so weiter und so fort für die nachfolgenden Buchstaben. Auch die Zwischenregister hat Consten alphabetisch von hinten nach vorn angelegt. Beispiele: S–
-su -so -sa
R–
-ru -ro -rh
P–
-pu -po-l -po-d -pi
I–
Kiakhta Kiachta
H–
Khobdo Khalha
G-
Goldgewinn Goldari Goktur
Dies sollte genügen, um eine Vorstellung davon zu geben, was einen erwartet, wenn man sich auf Constens Arbeitsmethodik einlässt. Auf dieser Ebene begegnete der Gelehrte Hermann Consten zweifellos dem Geheimagenten Hermann Consten. Im Gros der in den dreißiger und vierziger Jahren in Peking angelegten Karteien hat Hermann Consten dieses komplexe System nicht weiter verwendet, sondern ist, zumindest für die Stichworte, zu einem normalen ABC-Register übergegangen. Was die Arbeit mit der Zettelsammlung darüber hinaus schwierig macht, ist das, was Dr. Balk in seinem Petersburger Referat als „confusingly arranged“ bezeichnet hat. Die Aufteilung der einzelnen Sachgebiete lässt keine innere Logik erkennen. Warum zum Beispiel nach drei Kästen mit Einträgen zum Buddhismus der vierte Völker und Stämme, Clane und Dynastien enthält, die Kästen 5 bis 12 wiederum der Religion – dem Lamaismus, Klöstern und Tempeln, Kulten und Lehrschriften, Ikonographie und schließlich der Verbindung zum Schamanismus gewidmet sind und schließlich die Kästen 24 und 25 noch 545
VII. Summe des Lebens 1951–1957
einmal zahlreiche Einträge zu buddhistischen Gottheiten enthalten, erscheint nicht nachvollziehbar. Der Sachverhalt lässt sich wahrscheinlich nur so erklären, dass Consten erst im Laufe seiner langjährigen Arbeit feststellte, wie viele Aspekte gerade für den schon damals recht gut erforschten Bereich des tibetischen Buddhismus und seiner mongolischen Erscheinungsformen bei der Verzettelung zu berücksichtigen waren. Man kann also davon ausgehen, dass die Reihenfolge und Anordnung der Kästen nicht die endgültige gewesen ist.
546
Epilog Statt eines Nachworts eine Schriftanalyse Unter den vielen Erinnerungen von Privatpersonen an Hermann Consten, die ich im Laufe der Jahre, nicht zuletzt dank der Mithilfe des Studienwerks Deutsches Leben in Ostasien e.V., sammeln konnte, gehörte auch jene von Frau Marianne Jährling, die während des Krieges mit ihrer Mutter und ihrem Bruder als Flüchtling aus Batavia, dem heutigen Jakarta nach Peking kam. Da sie in Batavia eine holländische Schule besucht und 1940/41 im Internierungslager ein Jahr lang überhaupt keinen Schulunterricht gehabt hatte, erhielt sie von Dr. Eleanor Consten Nachhilfeunterricht in deutscher Rechtschreibung. Außerdem war sie eine eifrige Benutzerin der deutschen Gemeindebibliothek, wo sie bei Hermann Consten bevorzugt Karl-May-Bücher auslieh und ihm gelegentlich auch das eine oder andere beschädigte Buch reparierte. Der Bibliothekar selbst erschien ihr „wie eine Figur von Karl May“ und erinnerte sie schon damals „an manche schräge Type“ in dessen Romanen. Aber ihr war bereits als Kind noch etwas anderes an Hermann Consten aufgefallen: Er trug am Zeigefinger einen großen länglichen Ring, der das ganze Grundglied des Fingers bedeckte. Heute noch sieht sie seinen hochgestellten Zeigefinger mit dem großen Ring beim Schreiben vor 1 sich. „Er schrieb mit einer Feder und hatte eine schöne, saubere Schrift.“ Constens Handschrift war in der Tat bemerkenswert. Sie verriet, abgesehen von Schönheit und Sauberkeit, vor allem seine eigenwillige, schwer durchschaubare Persönlichkeit, über die ich mir bereits anhand der vorliegenden Dokumente und Bilder eine Meinung gebildet hatte. Da ich selbst in graphologischen Dingen ein absoluter Laie bin, ich aber während meiner Beschäftigung mit Constens Charakter gerne wissen wollte, was man darüber in seiner Handschrift erkennen konnte, habe ich mich an eine mir bekannte Münchner Graphologin gewandt. Ich legte ihr Schriftproben aus den Jahren 1901, 1913, 1925, 1929 und 1937 vor; dazu gab ich die Auskunft, es handle sich um eine männliche Person, inzwischen verstorben. Das Ergebnis der Schriftanalyse bestätigte nicht nur in verblüffender Weise manches, das ich inzwischen über Hermann Consten wusste. Es nannte darüber 1
Renate Jährling (StuDeO e.V.) an Götting über die Auskunft ihrer Cousine zu Consten, 12.4.2008
547
Epilog
hinaus auch die möglichen Ursachen und Bedingungen, unter denen seine Anlagen und Begabungen zur Ausbildung dieser auffallenden Persönlichkeitsstruktur geführt hatten. So hieß es dort u.a.: Ein Mensch, dessen Lebensqualität, Eigenart und ungewöhnliche Persönlichkeit aus einer immensen Triebkraft und Stärke gespeist wurde. Seine Leistungs- und Wirkungsfähigkeit fußte auf diesem überdurchschnittlichen Potential des Antriebs wie auch auf einer kompensierten hohen Eitelkeit, einer Geltungssucht! Letztere vermutlich basierend auf einem aus früher Kindheit empfundenen Minderwertigkeitsgefühl, väterlicher Ab1 lehnung oder besonderer Härte ihm gegenüber.
Die Graphologin verwies im anschließenden mündlichen Gespräch vor allem bei den Briefen des 22- bis 35-jährigen Consten auf seine überbetonten Unterlängen (Trieb), eine schwach ausgebildete Mittelzone (Erdung) sowie eine kaum vorhandene Oberzone (Geist, Intellekt) und fuhr in der Analyse fort: Mit einer raffinierten, schlauen Intelligenz, die Gemütsanteile oder Gefühle zurückdrängte, vermochte er ein breites Register verwirrender Wesenszüge zu ziehen! Neugieriges Weltinteresse, ausgeprägte Lebensneugier mit Abenteurergeist gepaart, rücksichtslose Eigensucht mit zäher Durchsetzungsfähigkeit persönlicher Wünsche – immer auf private Anerkennung und Gewinn bedacht – hingebende Offenheit, misstrauisch brüske Zurücknahme. [Er war] keiner, der sich einer höheren Idee einoder unterordnete, einem Ideal etwa; sondern alles, was er sich aneignete oder unternahm, tat er mit persönlich gefärbten Kalkül. Für seine Mitmenschen wird er nicht einschätzbar gewesen sein, denn er spielte nie 2 mit offenen Karten, blieb in vielerlei Spielarten verdeckt.
Es handelte sich bei Hermann Consten also um einen von starken Gegensätzlichkeiten geprägten Charakter, auffallenderweise jedoch, wie es in der Analyse weiter hieß, „ohne Gespaltensein“. Wir haben es vielmehr mit einer von innen getriebenen, dubiosen, ja schillernden Gesamtpersönlichkeit zu tun, mit bunter Lebensvielfalt sei1 2
Olympia Rothe: Graphologisches Gutachten Hermann Consten. Privatmanuskript. Ebd.
548
Statt eines Nachworts eine Schriftanalyse
ner Interessen wohl, dazu bienenfleißig sich vielerlei aneignend, ja mit Fleiß auch nachjagend (mehr Fleiß als Intellekt!) – niemals sesshaft oder 1 zufrieden mit gewonnenen Erkenntnissen in breitgefächerten Gebieten.
Vielleicht liegt hier auch der Grund, weshalb Hermann Consten vieles, was er begann, letztlich nicht zu einem erfolgreichen Ende brachte. Und noch etwas verriet seine Schrift: Da nicht im Eigenwert verankert, war vermutlich seine Achillesferse, dass er – leicht gekränkt und verletzbar – unversöhnlich reagierte. Zäh bis zum Äußersten gab er sicher nie etwas Anvisiertes auf. Alles in allem eine höchst reizvolle, ungewöhnlich chamäleonartige Persönlichkeit. Eine 2 singuläre Zeiterscheinung.
In der Spätschrift sieht die graphologische Analyse dieselben Wesenszüge, aber „milder, weicher, versöhnlicher geworden“. Sie konstatiert „eine innere Wandlung von Abstand und Beschaulichkeit“, das Hervortreten des in früherer Lebenszeit verdrängten Gefühlslebens, ja gelegentlich zeigen sich sogar „zarte transzendente Strebungen“. Die Gutachterin fasste ihren Eindruck abschließend in dem Begriff „vielverschlungene Wege“ (Hermann Pongs) zusammen. Ähnlich dem Netz der Wegespuren in der mongolischen Steppe, wirkten Hermann Constens Anlagen und Strebungen an einem „vielverschlungenen“ Lebensmuster, das mit dem der meisten seiner Zeitgenossen nicht vergleichbar war. 1 2
Ebd. Ebd.
549
Anhang Danksagung Am Zustandekommen dieser ersten Biografie über den Forschungsreisenden und Geheimagenten Hermann Consten war ich nicht allein beteiligt. Viele Menschen im In- und Ausland haben mich mit Anregungen, Vorschlägen, Korrekturen, Hilfe bei der Quellensuche oder mit Übersetzungen russischer, türkischer, chinesischer und mongolischer Dokumente tatkräftig unterstützt. Die Anteil nehmende Neugierde von Verwandten, Freunden und Bekannten an den Recherchen, am Schreibprozess, gelegentlich sogar als erste kritische Leser bereits fertiger Kapitel, war stete Ermunterung und Ermutigung, das einmal Begonnene auch zu Ende zu führen. Ganz besonders Dank sagen möchte ich Anne und Rainer Hesse (Amsterdam), denen ich, neben meinen Freunden in der Mongolei, dieses Buch gewidmet habe. Denn sie haben mich auf Hermann Consten aufmerksam gemacht, als sie vor vielen Jahren einmal bei mir in Köln übernachteten und mir als Gastgeschenk die antiquarische Ausgabe der „Weideplätze der Mongolen“ überreichten. Keiner von uns ahnte damals, welchen Stein sie damit ins Rollen brachten. Tief verbunden fühle ich mich den Verwandten Hermann Constens und Eleanor von Erdbergs, den Familien Corts, Smith und Scheluchin, ganz besonders aber Klaus und Ingeborg Strölin. Sie alle nahmen sich Zeit für lange, manchmal bis in die Nacht dauernde Gespräche; sie ließen mich Einblick nehmen in Korrespondenzen und Tagebuchaufzeichnungen; sie stellten Bildmaterial zur Verfügung, teilten ihre persönlichen Erinnerungen an „Onkel Consten“ mit mir. Außerdem waren sie wunderbare Gastgeber, wann immer ich bei ihnen auftauchte. Private Erinnerungen steuerten ferner ehemalige Freunde und Bekannte von „Etzel und Eleanor“ aus Aachen, Köln, Marburg, Pavia und Peking bei. Durch freundliche Vermittlung und eine Umfrage des StuDeO-Archivs unter ehemaligen China-Deutschen kamen etliche weitere Erinnerungsschnipsel hinzu. Die Burschenschaft Arminia in Karlsruhe und Dr. Cai Witt vom Verband Schlaraffia halfen mit Auskünften. Sie alle trugen dazu bei, im Laufe der Arbeit an der ConstenBiografie das facettenreiche Bild dieser ungewöhnlichen Persönlichkeit zu vervollständigen. Dazu durften eine Handschriftenanalyse und die Deu550
Danksagung
tung von Constens chinesischem Namenssiegel nicht fehlen. Für erstere danke ich meiner Kindheitsfreundin, der Graphologin Olympia Rothe (München), für letztere meinen Londoner Freunden Prof. Dr. Roderick Whitfield und seiner Frau, Prof. Dr. Young-sook Pak, ganz herzlich. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes (Berlin) bin ich ebenso zu Dank verpflichtet wie dem Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde, dem Bundesarchiv/Militärarchiv in Freiburg, dem Archiv des Deutschen Museums in München, Frau Blaue von der Bibliothek des Deutschen Instituts für Tropische und Subtropische Landwirtschaft (DITSL) in Witzenhausen, Renate Jährling und Anita Günther vom Studienwerk Deutsches Leben in Ostasien e.V. (StuDeO), Thorsten Mäntel vom Archiv der Hausbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. in Köln, Dr. Michael Balk von der Ostasienabteilung der Berliner Staatsbibliothek. Ich danke ferner den Universitätsarchiven in Aachen und Karlsruhe, dem Bildarchiv der Deutschen Kolonialgesellschaft an der Universitätsbibliothek Frankfurt/M., dem Historischen Archiv des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, ebenfalls in Frankfurt, den Stadtarchiven in Aachen, Friedrichsdorf, Bad Blankenburg, Saalfeld und Rudolstadt, dem Deutschen Adelsarchiv (Marburg), dem Landesarchiv NRW in Düsseldorf. Im Ausland waren es das Österreichische Haus- Hof- und Staatsarchiv/Kriegsarchiv in Wien, die National Archives in Kew bei London, die Hoover Institution Archives der Stanford University in Palo Alto (Kalifornien) sowie das Mongolische Staatsarchiv und das Archiv des Außenministeriums der Mongolei in Ulaanbaatar, die mir freundlich Akteneinsicht gewährten. Angesichts der Weltläufigkeit Hermann Constens, seiner weiten Reisen in mehreren Kontinenten, seines langjährigen Aufenthalts in China, nicht zuletzt aber angesichts seiner persönlichen Verwicklung in die politischen und militärischen Konflikte zu Beginn des 20. Jahrhunderts, kamen mir nützliche Hinweise von Fachwissenschaftlern auf verschiedenen Gebieten bei der Recherche wie auch beim methodischen Umgang mit fremdsprachigen Quellen und Hilfestellung bei ihrer Auswertung sehr zustatten. Danken möchte ich dafür dem Direktor des Zentrums für Deutschland-Forschung an der Mongolischen Akademie der Wissenschaften in Ulaanbaatar, Prof. Dr. Udo B. Barkmann, und seinem Assistenten R. Tördalaj M.A., ferner Dr. T. Galbaatar, Prof. Dr. E. O. Batsaikhan, Dr. Baabar und nicht zu551
Anhang
letzt Dr. A. Saruul, deren Großvater Erdene Batchaan mit Consten Kontakt hatte. Dank der freundlichen Fürsprache von Prof. Dr. Klaus Kreiser (Berlin) gelangte ich über Dr. Mustafa Aksakal (Washington) und Prof. Dr. Sinan Kuneralp (Istanbul) an türkische Dokumente über Hermann Consten. Dr. István Fazekas von der Ungarischen Archiv-Kommission in Wien bemühte sich, mir Zugang zu ungarischen Archiven zu verschaffen. Prof. Dr. Dmitri A. Funk vom Ethnologischen Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau recherchierte für mich in den Matrikelunterlagen des einstigen Lazarev-Instituts. Dr. Joachim O. Habeck vom MaxPlanck-Institut für ethnologische Forschung in Halle/S. gab entscheidende Hinweise zu Ethel John Lindgren. Last but not least danke ich Dr. Jürgen W. Schmidt (Oranienburg) und Dr. Tilman Lüdke (Freiburg) für Recherchehilfe und eingehende Beantwortung meiner Anfragen zu der mir fremden Welt der Geheimdienste und des Militärs. Und schließlich möchte ich es nicht versäumen, den Verleger Gerd Winkelhane, den Lektor cum Layouter Henrik Jeep und die Mitarbeiter des Klaus Schwarz Verlags meines ganz besonderen Dankes zu versichern. Denn ohne ihre Begeisterung für mein Projekt, ohne ihre Entschlossenheit, es umzusetzen, hätte das Manuskript über Hermann Constens wildbewegtes Forscher- und Agentenleben wohl noch einige Zeit in meiner Schublade geschlummert. Doris Götting
552
Literatur und Bildnachweis
Hermann Constens Werke BÜCHER Weideplätze der Mongolen. Im Reiche der Chalcha. 2 Bände mit zahlreichen Abbildungen und zwei Landkarten, Berlin 1919/1920. Der Kampf um Buddhas Thron. Berlin 1925 Mysterien. Im Lande der Götter und lebenden Buddhas. Berlin 1925 …. und ich weine um dich, Deutsch-Afrika. Stuttgart 1926. Der rote Lama. Ein Erlebnis aus dem innersten Asien. Stuttgart 1928 ZEITSCHRIFTENAUFSÄTZE Die Lage in der Mongolei. In ASIEN – Organ der Deutsch-Asiatischen Gesellschaft. Nr. 2, Nov. 1913, S. 1 ff. Briefe alter Kameraden: Hermann Consten. In: Der deutsche Kulturpionier – Mitteilungen der Deutschen Kolonialschule Witzenhausen, Jg. 1924/25, Nr. 1, S. 36 ff. (Bericht über die politischen Ereignisse in der Mongolei nach 1911) Durch Asiens Wälder und Wüsten. In: Die Gartenlaube. Jg. 1924, Nr. 41, S. 707-710 (Teil I); Nr. 42, S. 724-728 (Teil II) Mongolische Probleme. In: Deutsche Akademische Rundschau, 6. Jg., Nr. 4, S. 15-17 (1925) Die Geisterstraße. Ein Ritt zur Totenstadt der Ming-Dynastie. In: Bibliothek des Wissens und der Unterhaltung, VI. Band, S. 148-165. Stuttgart 1932 Denominations of Monasteries in Outer and Inner Mongolia. In: Collectanea Commissionis Synodalis in Sinis Nr. 12 (1939) S. 11-19 The Secular Administration of Mongolian Monasteries and their Shabinars. In: Collectanea Commissionis Synodalis in Sinis Nr. 13 (1940), S. 396-406 The Religious Life in Mongolian Monasteries – Root and Growth. In: Collectanea Commissionis Synodalis in Sinis Part I: Nr. 14 (1941), S. 831-838; Part II: Nr. 15 (1941), S. 1004-1010 Lamaism in Mongolia. In: XXth Century (hg. von Klaus Mehnert), Band 5, Nov. 1943, S. 308-325
553
Anhang
Sekundärliteratur Aksakal, Mustafa: The Ottoman Road to War. The Ottoman Empire and the First World War. Cambridge 2008 Baabar: From World Power to Soviet Satellite. History of Mongolia. Hrsg. v. Christopher Kaplonski. Cambridge 1999 Baer, Martin und Schröter, Olaf: Eine Kopfjagd. Deutsche in Ostafrika. Spuren kolonialer Herrschaft. Berlin 2001 Barkmann, Udo B.: Geschichte der Mongolei oder Die „Mongolische Frage“. Die Mongolen auf ihrem Weg zum eigenen Nationalstaat. Bonn 1999. Batsaikhan, E.O.: Bogdo Jebtsundamba Khutukhtu. The last King of Mongolia. Ulaanbaatar 2009. Becher, Jürgen: Daressalaam, Tanga, Tabora. Stadtentwicklung in Tansania unter der deutschen Kolonialherrschaft 1885-1914. Missionsgeschichtliches Archiv, Band 3, Stuttgart 1997. Bell, Charles: Der große Dreizehnte. Das unbekannte Leben des XIII. Dalai Lama von Tibet. Bergisch Gladbach 2005. Berghahn, Volker R.: Der Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten 1918-1935. Düsseldorf 1966 Brandt-Mannesmann, Ruthild: Max Mannesmann, Reinhard Mannesmann – Dokumente aus dem Leben der Erfinder. Remscheid 1964. Budbayar, Ishgen: Die mongolisch-deutschen Beziehungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Berlin 2009 Ce Shaozhen: Flaneur im alten Peking. Ein Leben zwischen Kaiserreich und Revolution. München 1990 Dönninghaus, Victor: Die Deutschen in der Moskauer Gesellschaft, Symbiose und Konflikte 1494-1941. Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Band 18, Göttingen 2002 Eichner, Karsten: Briten, Franzosen und Italiener in Oberschlesien, 1920-1922. Die Interalliierte Regierungs- und Plebiszitkommission im Spiegel der britischen Akten. Beihefte zum Jahrbuch der Schlesischen FriedrichWilhelms-Universität, Bd. XIII, St. Katharinen 2002 Erdberg, Eleanor v.: Der strapazierte Schutzengel. Erinnerungen aus drei Welten. Waldeck 1994. Filchner, Wilhelm: Wetterleuchten im Osten. Erlebnisse eines diplomatischen Geheimagenten. Berlin 1928
554
Literatur und Bildnachweis
Fischer, Fritz: Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18, Düsseldorf 1977 Frédéric, Louis: Les Dieux du Bouddhisme – Guide iconographique. Paris 1992 Freyeisen, Astrid: Shanghai und die Politik des Dritten Reiches. (Diss.) Würzburg 2000 Gall, Lothar: Aufstieg und Niedergang großer Reiche. Russland und Deutschland in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Vortrag im Deutschen Historischen Institut Moskau (18.10.2006) Druckfassung als pdf-Version. Götting, Doris (Hrsg.): Bilder aus der Ferne. Historische Fotografien des Mongoleiforschers Hermann Consten. Ausstellungskatalog, Bönen 2005 Guo, Hengyu (Hrsg.): Von der Kolonialpolitik zur Kooperation: Studien zur Geschichte der deutsch-chinesischen Beziehungen. München 1986 Hacısalihoğlu, Mehmet: Die Jungtürken und die mazedonische Frage 18901918. Südosteuropäische Arbeiten, Band 116, München 2003 Häupel, Beate: Die Gründung des Landes Thüringen. Staatsbildung und Reformpolitik 1918-1923. In: Demokratische Bewegungen in Mitteldeutschland Bd. 2, Weimar, Köln, Wien 1995 Hedin, Sven: Zu Land nach Indien durch Persien, Seistan und Belutschistan. Zwei Bände, Leipzig 1910 ― ders.: Von Peking nach Moskau. Leipzig 1924 ― ders.: Jehol, die Kaiserstadt. Leipzig 1932 Heissig, Walther: Die Mongolen. Ein Volk sucht seine Geschichte. Düsseldorf/Wien 1979 Hoegner, Wilhelm: Die verratene Republik. Geschichte der deutschen Gegenrevolution. München 1958 Jäschke, Gotthard: Der Turanismus der Jungtürken. Zur osmanischen Außenpolitik im Weltkriege. Leipzig 1941 John, Jürgen: Das Land Thüringen in der Weimarer Republik. Thüringische Blätter zur Landeskunde, herausgegeben von der Landeszentrale für Politische Bildung, Erfurt 2004 Károlyi, Michael Graf: Gegen eine ganze Welt. Mein Kampf um den Frieden. München 1924 ― ders.: Faith without Illusion, Memoirs of Michael Karolyi. Translated from Hungarian by Catherine Karolyi. London o. J. (1956) Koch, Hansjoachim W.: Der deutsche Bürgerkrieg. Eine Geschichte der deutschen und österreichischen Freikorps 1918-1923. Berlin 1978. Korostovec, Ivan J.: Devjat’ mesatsev v Mongolii. Dnevnik Russkogo upolnomočennogo v Mongolii, Avgust 1912 – Maj 1913 g. (Neun Monate in der 555
Anhang
Mongolei. Tagebuch des russischen Bevollmächtigten in der Mongolei August 1912 bis Mai 1913). Herausgegeben von E. Ookhnoi Batsaikhan. Ulaanbaatar 2009. ― ders.: Von Cinggis Khan zur Sowjetrepublik. Berlin/Leipzig 1926. Korzetz, Ingo: Die Freikorps in der Weimarer Republik: Freiheitskämpfer oder Landsknechtshaufen? Aufstellung, Einsatz und Wesen bayerischer Freikorps 1918-1920. Marburg 2009. Kotkin, Stephen und Elleman, Bruce A.: Mongolia in the 20th Century. Landlocked Cosmopolitician. New York/London 1999. Kreiser, Klaus: Istanbul. Ein historischer Stadtführer. München 2009 Lattimore, Owen und Isono, F. (Hrsg.): The Diluv Khutagt. Memoirs and Autobiography of a Mongol Buddhist Reincarnation in Religion and Revolution. Asiatische Forschungen Band 74, Wiesbaden 1982 Lendvai, Paul: Die Ungarn. Eine tausendjährige Geschichte. München 2001 Leutner, Mechtild (Hrsg.): Deutschland und China 1937-1949. Politik – Militär – Wirtschaft – Kultur. Eine Quellensammlung. Bearbeitet von Wolfram Adolphi und Peter Merker. Berlin 1998 Lüdke, Tilman: Jihad made in Germany. Ottoman and German Propaganda and Intelligence Operations in the First World War (Diss. Oxford University 2001), in: C. Dawletschin-Linder et al. (Hrsg.), Studien zur Zeitgeschichte des Nahen Ostens und Nordafrikas, Band 12, Münster, Hamburg, Berlin, Wien, London 2005 Lukacs, John: Budapest 1900. A Historical Portrait of a City and its Culture. New York 1988. Majer, Zsusa, Teleki, Krisztina: Monasteries and Temples of Bogdiin Khüree. Ikh Khüree or Urga, the Old Capital City of Mongolia in the First Part of the Twentieth Century. A Survey. Ulaanbaatar 2006 Marshall, Alex: The Russian General Staff and Asia. London 2006 Matthiesen, Helge: Bürgerstolz und Nationalsozialismus in Thüringen. Das bürgerliche Gotha von 1918 bis 1930. Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen, Kleine Reihe Bd. 2, Jena, Stuttgart 1994 McMeekin, Sean: The Berlin-Baghdad Express. The Ottoman Empire and Germany’s Bid for World Power. Cambridge (Mass.) 2010. Mehnert, Klaus: Ein Deutscher in der Welt. Stuttgart 1981. Mühlmann, Carl: Das deutsch-türkische Waffenbündnis im Weltkriege. Leipzig 1940 Nadolny, Rudolf: Mein Beitrag. Wiesbaden 1955 Norbu, Thubten J., Martin, Dan (Hrsg): Dorjiev: Memoirs of a Tibetan Diplo556
Literatur und Bildnachweis
mat. Hokke-Bunka Kenkyū, Journal of the Comprehensive Study of Lotus Sutra, No. 17, March 1991 (Tokyo) Pakenham, Th.: The Boer War. London 1979 Paquet, Alfons: Gesammelte Werke. Stuttgart 1970 Pomiankowski, Joseph: Der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches. Erinnerungen an die Türkei aus der Zeit des Weltkrieges. Zürich, Leipzig, Wien 1928 Pozdneev, Aleksej M.: Skizzen aus dem Klosterleben in der Mongolei, St. Petersburg 1887 Prževalski, Nikolaj: Auf Schleichwegen nach Tibet. Lenningen 2004 Reventlov, Ernst Graf zu: Deutschlands auswärtige Politik 1888-1914. 2 Bände, Berlin 1916 Ratenhof, Udo: Wirtschaft, Rüstung und Militär in der Chinapolitik des Deutschen Reiches von 1871 bis 1945. (Diss.) Wehrwissenschaftliche Forschungen Band 34, Freiburg 1985 Rathmann, Lothar: Stossrichtung Nahost 1914-1918. Zur Expansionspolitik des deutschen Imperialismus im ersten Weltkrieg. Berlin 1963 Rosenbach, Harald: Das Deutsche Reich, Großbritannien und der Transvaal (1896-1902). Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 52, Göttingen 1993 Schlögel, Karl: Im Raume lesen wir die Zeit. München 2003 Schmidt, Jürgen W.: Gegen Russland und Frankreich. Der deutsche militärische Geheimdienst 1890-1914. Ludwigsfelde 2006 ― ders.: Geheimdienste, Militär und Politik in Deutschland. Ludwigsfelde 2008 Schulze, Hagen: Weimar. Deutschland 1917-1933. Berlin 1982 Schumann, Hans Wolfgang: Buddhistische Bilderwelt. Ein ikonographisches Handbuch des Mahayana- und Tantrayana-Buddhismus. Köln 1986 Silberstein, Gerard E.: The Troubled Alliance. German Austrian relations 1914 to 1917. The University Press of Kentucky, Lexington 1970 Snelling, John: Buddhism in Russia. The Story of Agvan Dorzhiev, Lhasa’s Emissary to the Tsar. Shaftesbury, Rockport, Brisbane 1991 Speake, Jennifer (Hrsg.): Literature of Travel and Exploration, an Encyclopedia. Vol. 1 (2003) Sprenger, Matthias: Landsknechte auf dem Weg ins Dritte Reich? Zu Genese und Wandel des Freikorpsmythos. Paderborn 2008 Springweiler, Max: Flugpionier in China. Hamburg 1996
557
Anhang
Sprotte, M. H. et al. (Hrsg.): Der Russisch-Japanische Krieg 1904/05. Anbruch einer neuen Zeit? Wiesbaden 2007 Stübner, Joachim et al. (Hrsg.): Auf Goldsuche in der Mongolei. Chronik der Geologenexpedition der DDR in der MVR. Dresden 2005 Tafel, Albert: Meine Tibetreise. 2. Aufl. Stuttgart 1923 Tessin, Georg: Deutsche Verbände und Truppen 1918-1939. Osnabrück 1974 Trümpler, Charlotte: Das Große Spiel. Archäologie und Politik. Köln 2008 Trumpener, Ulrich: Germany and the Ottoman Empire 1914-1918. Princeton 1968 Tuchman, Barbara W.: August 1914, London 1962, dtsch. Frankfurt/M. 1999 Underdown, Michael: Aspects of Mongolian History 1901-1915. In: Zentralasiatische Studien des Seminars für Sprach- und Kulturwissenschaft der Universität Bonn, Nr. 15 (1981) Vogel, Renate: Die Persien- und Afghanistan-Expedition Oskar Ritter von Niedermayers 1915/26 (Diss. WWU Münster 1973). Studien zur Militärgeschichte, Militärwissenschaft und Konfliktforschung Band 8, Osnabrück 1976 Wawrick, Peter (Hrsg.): The South-African War. The Anglo-Boer War 18991902. London 1980 Weiers, Michael: Geschichte der Mongolen. Stuttgart 2004 Westphalen, Gerlinde Gräfin v.: Anna Luise von Schwarzburg. Die letzte Fürstin. Jena 2005 Wieland, Lothar: Belgien 1914. Die Frage des belgischen „Franktireur-Krieges“ und die deutsche öffentliche Meinung von 1914 bis 1936. Studien zum Kontinuitätsproblem der deutschen Geschichte. Band 2, Frankfurt, Bern, New York 1984 Windischgraetz, Prinz Ludwig: Vom Roten zum Schwarzen Prinzen. Mein Kampf gegen das k.u.k. System. Berlin/Wien 1920 Wolff, David, The Russo-Japanese War in Global Perspective. In: Kowner, R.: Rethinking the Russo-Japanese War. Centennial Perspectives. London 2006
558
Literatur und Bildnachweis
Bildnachweis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Postkarte um 1880. Nachlass Consten, Sgl. Corts. Privatfoto 1905. Nachlass Consten, Sgl. Corts. Privatfoto um 1898. Nachlass Consten, Sgl. Corts Universitätsbibliothek Frankfurt/Main, Bildsammlung der Deutschen Kolonialgesellschaft Nr. 011-1204-07 wie 4, Nr. 0011-1204-11 Unbekannter Fotograf um 1905. Nachlass Consten, Sgl. Strölin. Abgebildet in WP 2, Tafel 61 Unbekannter Fotograf um 1906. Abgebildet in Hermann Consten „Mysterien“, Berlin 1925 (Frontispiz) Unbekannter Fotograf um 1907. Nachlass Consten, Sgl. Strölin Unbekannter Fotograf 1912. Nachlass Consten, Sgl. Strölin Unbekannter Fotograf 1912. Abgebildet in WP 1, Tafel 25 Foto: Hermann Consten 1912. Abgebildet in WP 1, Tafel 20 Foto: Hermann Consten 1912. Abgebildet in WP 1, Tafel 46 Foto: Hermann Consten 1912. Abgebildet in WP 2, Tafel 1 Nach einer Fotografie (1915) gemalt von Heinz Munz um 1922. Nachlass Consten, Sgl. Strölin Studioaufnahme, Konstantinopel 1915. Nachlass Consten, Sgl. Strölin Foto: Hermann Consten. Abgebildet in WP 2, Tafel 49 Unbekannter Fotograf um 1923. Repro: D. Klotz. Mit frdl. Genehmigung der Greifenstein-Freunde e.V., Bad Blankenburg Berliner Pressedienst 1925. Original-Abzug im Nachlass Consten, Sgl. Strölin Privatfoto 1926. Nachlass Consten, Sgl. Strölin Privatfoto. Mit frdl. Genehmigung von Klaus Strölin Foto: Hermann Consten, Tientsin 1928. Mit frdl. Genehmigung v. Frau Kemper-Didaskalu Foto: Hermann Consten, 1928. Nachlass Consten, Sgl. Strölin Foto: Hermann Consten 1928. Fotothek des Zentralasienseminars der Universität Bonn B 939/Ge 08 Foto: Hermann Consten 1929. Nachlass Consten, Sgl. Strölin Foto: Hermann Consten 1929. Nachlass Consten, Sgl. Strölin Foto: Hermann Consten 1929. Fotothek des Zentralasienseminars der Universität Bonn B 936/Ge 08 559
Anhang
27 28 29 30 31 32 33
Unbekannter Fotograf 1931. Nachlass Consten, Sgl. Strölin Unbekannter Fotograf um 1933. Nachlass Consten, Sgl. Strölin Privatfoto um 1934. Nachlass Consten, Sgl. Strölin Foto: Hermann Consten, Kamakura (Japan) 1936. Nachlass Consten, Sgl. Strölin Foto: Hermann Consten um 1938. Nachlass Consten, Sgl. Strölin Privatfoto um 1959. Nachlass Consten, Sgl. Corts Privatfoto 1956. Nachlass Consten, Sgl. Corts
560
Über die Autorin Doris Götting, M.A. (*1940) entstammt einer Münsteraner Künstlerfamilie. Neben dem Studium der Germanistik, Slawistik, Kunstgeschichte und Publizistik an den Universitäten Münster und München, das sie 1966 mit dem Magister abschloss, absolvierte sie Berufspraktika bei der Süddeutschen Zeitung und der Pressestelle des Goethe-Instituts. Anschließend arbeitete sie als politische Redakteurin bei der Deutschen Welle in Köln. Ab 1970 unternahm sie zahlreiche Reportage-Reisen in asiatische Länder, u.a. nach Indien, Bangladesh, Vietnam, Kambodscha, VR China, Japan, Südkorea, Taiwan, Bhutan, Burma und berichtete über die dortigen Entwicklungen für die ARD und Printmedien. In den 1980er Jahren war sie Redaktionsmitglied des Deutschen Programms von Radio Japan in Tokyo. 1990/91 gehörte sie zu den ersten westlichen Reportern, die aus Ulaanbaatar über den Zusammenbruch des Sozialismus und die demokratische Neuordnung in der Mongolei berichteten. Sie realisierte gemeinsame Hörfunkproduktionen mit den Rundfunkanstalten der Mongolei und Bhutans. Von 1994 bis 2003 war sie Präsidentin der Deutsch-Mongolischen Gesellschaft e.V. (Bonn) und verantwortliche Redakteurin der Jahresschrift „Mongolische Notizen“ (Mitteilungen der Deutsch-Mongolischen Gesellschaft e.V.). Im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung führte sie 1997 in Ulaanbaatar ein Medienseminar für Parlamentarier und Medienschaffende zu den Themen Presserecht, Freiheit und Verantwortung von Journalisten durch. Im Zusammenhang mit ihren Recherchen über Hermann Consten ernannte sie das Deutschland-Forschungszentrum beim Institut für Internationale Studien der Akademie der Wissenschaften der Mongolei im Jahr 2010 zu seinem Ehrenmitglied. Inzwischen lebt Doris Götting als freie Autorin in Münster und wirkt dort u.a. auch als Sprecherin an speziellen Hörbuchproduktionen für Blinde und Sehbehinderte mit.
561
Namensregister Abshagen, Karl Heinz ..............................485 Agvan Doržiev ..............13, 121, 140, 143ff., 149f., 201, 381, 458, 516 Akkersdijk, Joris ........54ff., 62, 71ff., 81, 84, 86ff., 96, 98 Al-Arabi, Mohammed ..............................264 Alinge, Curt ..........352, 357, 404f., 454, 465, 469, 472ff., 482f., 492 Altenburg, Felix ........................................525 Amursana ..........................................204, 363 Andrássy, Gyula Graf ..............................326 Andrews, R. Ch. ........................................384 Anučin, Dmitri N. (Anutschin) ..119, 122f., 125, 134, 139, 150f. Arning, Wilhelm ...............41f., 486ff., 495ff. Asmis, Rudolf ........................385ff., 391, 489 Attila (Etzel) ........................12, 239, 312, 315 Baldanov ........................................455, 458ff. Balk, Michael .............................541, 545, 551 Bälz-Wermbter, H. ...................................496 Basel, Friedrich W. ...................................497 Basel, Hertha .............................................496 Bassermann, Ernst ....................................212 Batchaan (Batukhan), Erdene ...346, 388ff., 402, 412, 456, 464, 469ff. Bell, Charles ..............................140, 142, 149 Berghausen, Georg ...................................276 Bertram, Rudolf ........................414, 419, 481 Bethmann Hollweg, Theobald v. .......159f., 172ff., 206, 209, 211, 217, 235f., 245, 259, 283, 289, 304, 306 Betz (Generalkonsul Tientsin) ............481ff. Bindel, Theodor ....370, 372, 374, 380, 382f., 388f., 392, 406 Bint Van Gončigsüren (Bintu-Wan) ......199 Bodoo, D. ...................................................385 Bogd Chan, s. auch Jebtsundampa Chutagt .............163ff., 168f., 176f., 180f., 185, 198ff., 382, 471 Borch, Herbert v. ..............................481, 483 Bouldewyn, P. ...................................424, 426 Boyé, Adolf ................................................411 Bronsart v. Schellendorf, Fritz ....52, 54, 295 Brüder Mannesmann ...........173ff., 200, 209, 227f., 257, 350 Büro Mannesmann-Roselius .........238, 246, 266, 310, 313
Bussche, von dem .............................248, 265 Caprivi, Leo v. .............................................70 Castiglione .................................................167 Ce Shaozhen (Cedendorž), s. auch Palta, Georgi....................................................499 Cerenpil ......................................................202 Chiang Kaishek ....408, 426, 483, 487f., 491, 511, 518, 528, 530 Chubilaj Chaan .................................152, 507 Čin Van Chanddorž (Chandu Wan) ....162, 208 Čingis Chaan .............................164, 402, 511 Consten-Claudy ................................348, 368 Consten, Anna Maria ...............................19 Consten, Eleanor s. auch: Erdberg, Eleanor v. .........521, 525, 527f., 537, 539, 547 Consten, Franz ....................................50, 397 Consten, Hermann Jos. Sebastian ....19, 25, 27, 50 Consten, Johann Mathias ..........................19 Consten, Maria Charlotte ..........................18 Costinescu ..................................................265 d’Hondt, P. .................................................433 Da Lama Cerenčimed ...............................162 Daelman, P. ...............................446, 448, 450 Dahme, Maria (Mie) ..............236, 290f., 532 Dahme, Theodor .....236, 290f., 309, 397, 532 Dalai Lama (XIII.) ......12, 121, 140ff., 149f., 153, 201, 386, 465, 516 Dalai Lama (XIV.) ..........................141f., 144 Dambijžancan, s. auch Žal Lama ...204, 363 Daozong .....................................................439 David-Néel, Alexandra ............................147 Dillon, Emil J. ............................................217 Diluv Chutagt Žamsranžav .........184f., 188, 391, 453, 467, 517f. Dirksen, Herbert v. ...................................411 Dittenhofer, Xaver .................176f., 195, 202 Dupont, P. Louis ...........438ff., 442f., 446ff., 451, 458, 481, 483, 485, 488 Ehrhardt, Hermann ..........................371, 374 Ehrhardt, Ludwig .....................................528 Eichheim, Henry .......................................404 Eichheim, Mrs. (Mutter v. Lindgren) ....399 Eisner, Kurt ................................................371 Emin Pascha ..............................................108
562
Namensregister
Emir v. Afghanistan .......229, 231, 233, 243, 245, 251, 277 Enver Pascha ........226, 228ff., 242ff., 246ff., 252, 254f., 259ff., 266, 270, 283f., 288, 290, 292, 294, 296f., 299, 301, 303, 310, 313f., 339, 484 Erdberg, Eleanor v., s. auch Consten, Eleanor .........401f., 500, 502ff., 509, 511, 513, 515, 522ff., 530, 532, 535, 539f. Erdberg, Robert v. .....................................539 Erzberger, Matthias ..................................371 Escherich, Georg ....................370f., 374, 491 Eversdijk-Smulders, Lily .......................515f. Fabarius, Ernst ....18, 23, 27, 40ff., 64, 74ff., 78, 80ff., 84, 89, 104, 370, 392, 486 ffrench of Monivea, Catherine .............414f. Filchner, Wilhelm .............................202, 349 Fleck (Major) .............................................333 Franke, Wolfgang .....................................525 Fredrich, Franz ..................................271, 274 Frey-Näf, Barbara .....................................402 Fröhlich, August .......................................373 Fuchs, Walter ............................................352 Fürstenberg-Stammheim, v. 298, 302, 304, 330, 376 Galdan ..............................354ff., 359f., 361ff. Garnier, Louis-Frédéric ....................25ff., 29 Gelen Lama Žamsran ...............................516 Geleta, Joseph ....................................472, 478 Gempp, Friedrich ....................................308f. Gerlich ......54ff., 66f., 72f., 85ff., 90ff., 94, 96 Gipperich, Hermann .....385ff., 391, 404, 489 Gobsch, Hanns ..........................................308 Goltz Pascha, Colmar v. d. ......................291 Gončig, Dr. ........................................458, 462 Gonda, Heinrich ........................................329 Gorodeckij, Salomon ................................455 Grey, Edward ............................................274 Griesinger, Walter ..................................276f. Grimm, Wilhelm .......................................315 Groth, Victor v. .................169, 173, 191, 207 Grünwedel, Albert .......349f., 356, 363, 366, 407, 423, 425, 453 Gung Chajsan s. Chajsan Gung ........152f., 162, 178, 180ff., 184, 204 Haas, Wilhelm ...........................................525 Habeck, J.O. ...............................................405
Haenisch, Erich ............390, 403, 469f., 478, 491, 541 Hagenbeck, Carl .......................105, 107, 111 Halil Pascha (Bey) ..................255, 284, 287f. Hammer-Purgstall, Joseph v. ..................315 Hauer, Erich ..............................................356 Hauschild (Vizekonsul).........160, 172ff., 225 Hedin, Sven .............231f., 349, 403, 473, 490 Heinrich, Bruno ......................176f., 195, 202 Heissig, Walther ...............................528, 541 Hentig, Werner Otto v. ............225, 287, 355 Herrmann, Rudolf .....................435, 462, 484 Hertling, Georg v. (Reichskanzler) ........330 Hesse (Konsul Bagdad) ........................278ff. Hétenyi, Imre ............................................320 Heyns, P. ............................................433, 438 Hikmet Bey ................................................339 Hindenburg, Paul v. .................................498 Hindorf, Richard .....................42, 55f., 71, 87 Hitler, Adolf ............371, 374, 486, 498, 501, 514, 519, 521, 524, 527, 535f. Hoffmann, Alfred .....................................525 Hohenlohe, Fürst ......................................302 Holtzendorff, v. .................................233, 251 Horthy, Miklós ..........................................375 Humann, Hans ..........230, 248, 255, 261, 263 Huwer, Günther ........................................509 Ignatiev ......................................................305 Ismail Hakki Pascha .........................255, 261 Isome ...........................................................188 Jäckh, Ernst .............224, 227, 244, 248, 252f. Jacobi-Müller, Margarete, s. auch Strölin Margarete .............395, 401, 501, 512, 536 Jagow, Gottlieb v. .............................235, 238 Jährling, Marianne ...................................547 Jebtsundampa Chutagt (I.) s. auch Zanabazar ....................138, 355, 360, 449 Jebtsundampa Chutagt (VIII.), s. auch Bogd Chan 142, 145, 152, 161f., 165, 177, 200, 382, 391, 449 Juhácz-Nagy ..............................................332 Junkel, Lotte s. auch Taitai ...................416f. Junkel, Otto .............................409, 416f., 474 Kadri Bey .................................................298f. Kangxi ................................................356, 449 Karl I. v. Ungarn .......................332, 343, 375 Károlyi, Imre ...................314, 325, 328f., 336
563
Anhang
Károlyi, Mihály .........13, 314, 320ff., 325ff., 331f., 335f., 338ff., 343, 375ff., 395 Katsura .......................................................188 Kazakov, G. A. ..........................................199 Kellen, Tony ..............................................357 Kéri, Paul .........................................324f., 340 Kerwyn, P. Louis ............................438f., 451 Klein (Oberst) .........269, 277f., 281, 284, 286 Kočetov, Konstantin .................................455 Koehn, Alfred ...........................................525 Kohlhaas (Konsul) ...............118, 123f., 152, 170ff., 206ff., 214, 224f. Kölber, Otto ...............................................494 Korostovec, I. J. ...162, 186, 194ff., 206, 209, 300 Kossuth, Lájos ...........................................312 Kozlov, Petr. K. .........................................120 Kress v. Kressenstein, Friedrich .............271 Kriebel, Hermann ............371ff., 487ff., 491, 493, 514 Krüger, „Ohm“.....................................93f., 96 Kühlmann, Richard v. ..............................335 Kun, Béla ..................................................375 Kuropatkin, A. N.......................................306 Kuzminski .................................................195 Laffert, Karl v. .......................246, 248, 250ff. Lambrecht, Nanny..................219, 221f., 361 Lattimore, Owen ...............................352, 518 LeCoq, Albert v. ................................349, 407 Lenin, V. I. ..............................113, 392, 460ff. Lessing, Ferdinand ...........................349, 491 Li Ninfa ....................163, 179, 186f., 194, 202 Liman v. Sanders, Otto ............229, 257, 295 Lindgren, Ethel J. ........369, 391, 399, 402ff., 411ff., 440, 465, 468f., 472ff., 477ff., 482, 484, 486, 492, 503 Lindgren, John R. ......................................404 Linzen, Heinrich .......................................355 Liu Suifeng .................................................432 Ljuba, V.F. ..................................144, 177, 195 Loehr, Max .............................................524f. Lossow, Otto v. .................................372, 374 Lucius, Hellmuth v. ..........................169, 208 Lückenhaus, Alfred ..................................525 Ludendorff, Erich v. .........341, 371, 374, 486 Luther, Hans ......................411, 420, 450, 477 Luvsan Navaan .................455, 458, 460, 464
Maercker, Georg L. R. (General) ............347 Majski, I.M. .............................................386f. Maltzahn, Ago v. ..............................169, 393 Mamen, Oscar M. .....................................404 Manlaj Baatar Damdinsüren . .181, 184, 187 Mannesmann, Alfred ...............................310 Mannesmann, Carl ...................................222 Mannesmann, Max ........171, 222, 225, 310f. Mannesmann, Otto ...................................311 Mannesmann, Reinhard, s. auch Brüder Mannesmann und Büro MannesmannRoselius ..........171, 222f., 225, 227f., 231, 236, 241ff., 248, 251f., 273, 293, 310f. Mao Zedong ......................................528, 530 Marco Polo .................................................537 Marquardt, Joseph ....................315, 354, 423 Martin-Fang, Ilse ......................................525 Matuschka, Manfred v. ..............................71 May, Karl ...........24, 258, 357f., 500, 539, 547 Mayer, Gottlob ..........488ff., 492ff., 501, 522 Mecklenburg, Adolf Friedrich zu ...........392 Mecklenburg, Joh. Albrecht zu .................42 Mehnert, Klaus ..........................................525 Mielke, Rita .............................................401f. Miller, V. F. ......................................118f., 300 Ming Bao, s. auch Chajsan Gung .......153, 178, 182 Montgelas, Max v. ....................................210 Morgenthau, Henry ...............................249f. Mühlenweg, Fritz .....................................349 Müllejans, Arthur .............................379, 448 Müller, Friedrich Karl ......................349, 407 Müller, Herbert .........................................527 Müller, Mathaeus .......................................26 Mullie, Joseph .................423f., 426, 433, 438 Munz, Heinz ......................104, 167, 288, 516 Nadolny, Rudolf ........................................291 Naumann, Friedrich .................................227 Neratov, A. A. ...........................................162 Ngombe ....................77, 85f., 101ff., 108, 122 Nicolai, Walter ..................................308, 338 Niederlande, Heinr. der ...........................393 Niedermayer, Fritz ....................................276 Niedermayer, Oskar ...234, 238, 252, 255ff., 260, 265, 268f., 272f., 275, 277ff., 294 Nikolaus II. ........113, 115, 121, 140, 143, 161 O’Connor, W.F.T. .....................................144
564
Namensregister
Oppenheim, Max v. ............68ff., 223f., 230, 233f., 237, 246, 253, 255, 293, 313 Orlov, P. .........................................191ff., 202 Ossendowski, Ferdinand .................349, 356 Ott, Eugen ..................................................525 Palta Van (Polta Wan) .............................185 Palta, Georgi, s. auch Ce Shaozhen .......499 Panchen Lama (IX.) ...............142, 449f., 453 Pannwitz, v. ...............................................302 Paquet, Alfons ...........................................130 Paschen, Peter ...........................233, 271, 276 Paschen, Wilhelm ...................271, 273, 276f. Petöfi, Sándor ............................................312 Polónyi, Desider ................................325, 327 Pongs, Hermann .......................................549 Pourtalès, Friedrich v. ..............................211 Power, Eileen ............................................399 Pozdneev, A. M. ........................................127 Prittwitz, v. ................................................233 Prževalski, N. M.......................................119f. Rabe v. Pappenheim, Werner................291f. Rabinovič, Abraham .................................455 Radoslavov ................................................297 Rákosi, Jenö .......................................312, 314 Rasdolski (russ. Konsul) ..........................204 Rathenau, Walter ......................................371 Rathje, Hannes ..........................................494 Rausch, Ottomar ...............................118, 234 Reichenau, Franz v. (Botschafter)...........232 Reis, Philipp ...........................................26, 28 Reuf Bey .................271, 275, 277ff., 285, 295 Reuß, Heinrich Fürst ..........................70, 294 Ribbentrop, Joachim v. .............................514 Richthofen, Hartmut v. ............................355 Rjabušinski, Stepan ........................114f., 213 Rockhill, W. W. .........................................144 Roeder, Dietrich v. .................319, 333, 376f. Rohrbach, Paul ..........................................227 Ronge, Max ................................218, 336, 338 Roosevelt, Franklin Delano .....................521 Roosevelt, Theodore .................................144 Roselius, Ludwig ..............227f., 231, 241ff., 247ff., 255, 259ff., 263f., 266, 269, 271ff., 279ff., 283, 293f., 298 Roth, Andor ........465f., 468, 472f., 476, 478f. Rothe, Olympia .........................................551 Said Halim Pascha ............................230, 249
Sajn Noyon Chan (Sain-Noin-Chan) . .186, 192ff., 198f., 211 Sandō (Amban) .......................152, 162, 165f. Sartuul Cecen Van s. auch Cecen Bejs ...... 163, 180, 182 Saruul, A. ...........................................391, 470 Schabinger v. Schowingen, K. E. ...........264 Scharffenberg, Paul ..............474, 481, 496ff. Scharffenberg, Renate ..............................496 Scheich-ul-Islam................................267, 293 Schele, Friedrich v. ...................................68f. Scheluchin, Michael ................................417 Schlögel, Karl ............................................351 Schmelzer, Dr. ...................................379, 457 Schmidt, Wilhelm .............419, 481, 494, 496 Schonauer ..................................................486 Schünemann ..............................267, 272, 275 Schwarzburg-Rudolstadt, Günther v. 392f. Seeckt, Hans v. ..........................................372 Simonyi ...................................................323ff. Souchon, Wilhelm A. (Admiral)......230, 266 Speiser, Werner .........................................538 Spengler, Hans ..........................................525 St. Paul-Illaire, Walther v. ......59, 70f., 87f., 90, 92f. Stalin, I. V. .................................................392 Steinwachs, Rudolf .........................246f., 290 Sterz, Rudolf .............................................481 Stolypin, Pëtr. A. .......................................162 Strauss .....................................................155ff. Stresemann, Gustav .................................373 Strölin, Klaus ........166, 345f., 369, 398, 529, 536f., 540 Strölin, Margarete (Grete) .....398, 400, 460, 469, 484f., 487ff., 491, 507, 509 Suhrkamp, Peter ........................................390 Suleiman Askeri Bey .......274, 277ff., 283f., 286, 294f. Szász, Karl v. .....................................320, 332 Szérenyi ......................................................335 Szittya, Emil ..............................................319 Szurmay, Sándor ............................335, 337f. Tafel, Albert ......................................145, 149 Taitai .....................415ff., 420, 423, 427, 429, 435ff., 440, 443, 447f., 450, 453f., 460, 469, 474f. Teleki de Szék, Pál ....................................314
565
Anhang
Tisza, István ............................320f., 338, 343 Togtoch Gun ..............................................203 Tolstoj, Lev N. .............................82, 110, 113 Tomaševski ...............................................195 Tördalaj, R. ................................................168 Tornau, Traugott ....................331, 333, 377f. Totchkoff ....................................................298 Trebitsch-Lincoln, Ignaz ..........................404 Uchtomski, E.E. .........................................121 Udai Wan (Udaj Van) ..............................213 Ungern-Sternberg, Roman v. ..........386, 391 Urmánczy, Ferdinand .............321ff., 326ff., 330, 337 Utsi, Mikel .................................................405 Vásárhelyi, Franz ....................................323f. Vasiljev, A.N. ............................................382 Versen, v. ...................................................272 Voigt, Günther ..........................................271 Waldburg, Graf v. .....................................241 Walter, A. A. ...........154f., 158, 160ff., 177f., 180f., 188f., 195, 204 Wangenheim, Hans v. (Botschafter). .232f., 237f., 245ff., 258ff., 269, 275, 279f., 282f., 289f., 292f., 296f., 302 Wassmuss, Wilhelm ..........233f., 238, 245f., 248, 250ff., 258, 267f., 270ff., 274f., 278, 286f., 294 Waurick, Bernhard ......................388f., 406f. Weber, Erich (General) ............................250 Weise, Paul ........................................78ff., 89 Weiske, Fritz ......................................352, 388 Wekerle, Sándor ......320f., 326ff., 331ff., 343
Wesendonck, Otto Günther v. ...234, 240f., 251, 257, 280f., 290 Wetzell, Georg ..................................488, 493 Weule, Karl ................................................403 Wied, Fürst Wilhelm zu..............................42 Wilhelm II. .....28, 94, 126, 144, 223, 230, 248 Wilhelm, Helmut ......................................525 Wilm, Paul .................................................525 Windischgraetz, Ludwig ...............375f., 379 Wodianer, v. ..............................................330 Wohltmann, Ferdinand .......................42, 83 Wolff, v. ...........................................499f., 502 Wolman, Karl Heinrich ...........................484 Wyneken, Gustav .....................................390 Xionin ......................................163, 180f., 414 Younghusband ..................................121, 145 Yuan Shikai ........................................189, 421 Zanabazar ..................................................449 Zanthier, v. ......................................488f., 491 Zhang Xueliang ........................483, 493, 511 Zhang Zuolin ............................................426 Zimmermann, Arthur ....223, 228, 232, 253, 259, 280 Zintgraff, Alfred .....................................228f. Zugmayer, Erich .......................234, 276, 278 Žal Lama, s. auch Dambižancan ..........185, 204ff., 363ff., 367, 516 Žalchanc Chutagt Damdinbazar.....163 f., 182 ff., 190, 193 f., 204, 295, 384, 391, 453, 467 Žamsrano Ceveen, s. auch Žamsran ...385, 412, 469
566
ANMERKUNGEN 1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
DITSL, Archiv der DKS; Schülerakte Consten, Schreiben Fabarius an Frau Hermann Consten vom 14.5.1900. Todesanzeige im Stadtarchiv Aachen Aachener Adressbuch 1868; unter: http://freepages.genealogy.rootsweb.com Stadtarchiv Aachen; Gewerbe- und Handelssachen Stadt Aachen, Acta 1,4/443 (1878), Acta 4/143 (1895 und 1899/1900) Bürgermeisterei Aachen, Geburtsurkunde Nr. 562 für Hermann Joseph Sebastian Contzen, ausgestellt 7.4.1852, mit dem amtlichen Namensänderungsvermerk auf der Rückseite vom 5.3.1877; beglaubigte Abschrift der Urkunde vom 24.11.1920 aus dem Nachlass Hermann Constens. Für die Überlassung einer Kopie danke ich Hans Corts; D.G. Beglaubigte Abschrift des Abgangszeugnisses der Realschule Aachen im Stadtarchiv Friedrichsdorf/Taunus; Schulakten des Institut Garnier. Zur Geschichte des Institut Garnier vgl. den Aufsatz von Herbert Zimmermann in: Suleburc Chronik, Geschichtsblätter des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Seulberg e.V. 12. Jg. 1981, S.53-59 und Silke Lorch-Göllner: Vom „Maison d'Education“ zur „Garnier'schen Lehr- und Erziehungsanstalt“. Erziehung und Bildung angehender junger Kaufleute in Friedrichsdorf in den Jahren 1836 bis 1860. In: SuleburcChronik, Jg. 27, S. 24-43 Stadtarchiv Friedrichsdorf/Ts., Schulakten Institut Garnier, Matrikelbuch 1890–1903, Sommersemester 1892. Zit. nach Zimmermann a.a.O. S.55 Sonnez, II., 1897 Stadtarchiv Friedrichsdorf, Schulakten des Institut Garnier, Abschlussprüfungen Herbst 1895, Schriftliche Deutschprüfung, Aufsatz. Ebd. Original im Stadtarchiv Friedrichsdorf, Schulakten Institut Garnier. Vgl. Max Eckert, Der Aachener Student (1920), Internetrecherche unter www.aachen.lu/index.php/avlhistory/quellen/der_aachener_student/ Hochschularchiv der RWTH Aachen, Matrikelbuch Wintersemester 1895/96 Hochschularchiv der RWTH Aachen, Matrikelbuch Sommersemester 1896 Vgl. Max Eckert a.a.O. Freiherr Gisbert von Romberg, genannt der „Tolle Bomberg“ (1839–1897), Münstersches Original aus dem westfälischen Landadel Auskunft über diese Episode verdanke ich Michael Scheluchin und Klaus Strölin; D.G. Vgl. Klaus Peter Hoepke, Geschichte der Fridericiana. Stationen in der Geschichte der Universität Karlsruhe (TH) von der Gründung 1825 bis zum Jahr 2000. Universitätsverlag Karlsruhe 2007 Universitätsarchiv Karlsruhe, Matrikelbücher, Bestandsnr. 21003, Sign. 11 Universitätsarchiv Karlsruhe, Studienverzeichnisse der Abteilung Architektur, Bestandsnr. 10001, Sign. 1524-1527 Archiv der Burschenschaft Arminia Karlsruhe, Eintragung zu Consten im Semesterbericht WS 1897/98; lt. Auskunft Werner Bonfert, Weinheim. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PAdAA), Akten zur deutsch-türkischen Afghanistan-Expedition 1914/15, Blatt 52 (Personalbogen der Expeditionsteilnehmer, zu denen auch Hermann Consten gehörte.) Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg (BA/MA), RW 5/v. 7, Band 7, Blatt 35 Vgl. Reichsmilitärgesetz von 1874, „Bestimmungen über den einjährig-freiwilligen Dienst im Heer und in der Marine“ (Berlin 1880) „Mein kleiner Held“ – diese liebevoll ironische Bezeichnung hat mich im Laufe meiner Beschäftigung mit Hermann Consten beim Forschen und Schreiben beflügelt, wenn er sich mal wieder in ein wildes Abenteuer gestürzt hatte. Graf Ernst zu Reventlow, Deutschlands auswärtige Politik 1888–1914, Berlin 1916, S. 120 Vgl. Harald Rosenbach, Das Deutsche Reich, Großbritannien und der Transvaal (1896–
567
ANHANG 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
1902). Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 52, Göttingen 1993, S. 275 ff. DITSL Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Dok. Nr. 2256 Die Angaben zur Geschichte der Deutschen Kolonialschule entstammen überwiegend der Arbeit von Eckhard Baum: Daheim und überm Meer. Von der Deutschen Kolonialschule zum Deutschen Institut für Tropische und Subtropische Landwirtschaft in Witzenhausen. Beiheft 57 als Sonderausgabe z. Schriftenreihe „Der Tropenlandwirt“. Witzenhausen 1997 Zit. nach Baum, S. 42 Zit. nach Baum, S. 54 Vgl. Baum, S. 65 Dazu ausführlich, S. 41ff. Zitiert nach Baum, S. 61 Baum, S. 49 Vgl. Ernst Fabarius, Völkerkunde und die Kolonialwirtschaft. In: Der Deutsche Kulturpionier, Jg. 1900, Nr. 3 (Winterausgabe), S. 45 ff. Vgl. Baum, S.54 f. DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Dok, Nr. 4303 DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, amtliche Beglaubigung der belegten Fächer vom 28.10.1926. DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Dok. Nr. 76 vom 4.1.1900 DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Dok. Nr. 1011 vom 7.1.1900 DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Dok. Nr. 104, unvollständige Kopie des Schreibens, ohne Datum. Fritz Bronsart von Schellendorf (1868–1950). Besitzer einer Zebra-Zucht am Fuß des Kilimandscharo in West-Usambara, Verfasser von Novellen aus der ostafrikanischen Tierwelt. Während des Ersten Weltkriegs Oberkommandierender der Landstreitkräfte der Osmanischen Armee. Er gilt als mitverantwortlich für die Massendeportationen von Armeniern in der Osttürkei und ihre Todesmärsche in die syrische Wüste. DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Dok. Nr. 2156 vom 8.5.1900 DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Schreiben Fabarius vom 14.5.1900 DITSL, Archiv der DKS, Haus- und Dienstbuch der Deutschen Kolonialschule ab Juli 1899, Tageseintragungen vom 12. und 19. Mai 1900. Vgl. Baum, S. 51 Der Deutsche Kulturpionier 1900, Nr. 3 (Winterausgabe), S. 4 f. DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Kopie der beglaubigten Zeugnisabschrift vom 28.10.1926. Hausarchiv des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Abkürzung: HBO), Akten der Rheinischen Handëi Plantagen-Gesellschaft (RHPG), Korrespondenzakte Nr. 74, Schreiben Hindorf vom 27.8.1900. Ebd., Schreiben Hindorf vom 9.9.1900 Ebd., Schreiben Akkersdijk vom 10.8.1900 Vgl. Geschäftsbericht der RHPG. In: Der Tropenpflanzer, Jg. 3, Nr. 8, August 1900, S. 410 Die Bezeichnung fand sich bei Prosper Müllenhoff, Ostafrika im Aufstieg. Essen 1910, S. 118. Bei der Schilderung des Aussehens der Stadt Tanga zu Beginn des 20. Jahrhunderts stütze ich mich außerdem teilweise auf Müllenhoffs Bericht. Ausführliche Darstellung in: Jürgen Becher, Daressalaam, Tanga, Tabora. Stadtentwicklung in Tansania unter der deutschen Kolonialherrschaft 1885–1914. Missionsgeschichtliches Archiv Band 3, Stuttgart 1997. Constens erster Bericht aus Kwamkuju an Dr. Fabarius vom 2.12.1900; DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten. Ebd.
568
ANMERKUNGEN 60 61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
HBO, Nachlass Max v. Oppenheim (NL MvO), 1 / 4 HBO, NL MvO, 1 / 4, S. 79 Leo von Caprivi (1831–1899), seit März 1890 als Nachfolger Otto von Bismarcks Kanzler des Deutschen Reiches. Caprivi trat übrigens wenige Tage nach der endgültigen Genehmigung des Oppenheim’schen Kaufvertrags, am 28.10.1894, von seinem Amt zurück. HBO, NL MvO, 1 / 4, S. 80 Vgl. Gabriele Teichmann, Max Freiherr von Oppenheim – Archäologe, Diplomat, Freund des Orients. In: Charlotte Trümpler (Hg.), Das Große Spiel – Archäologie und Politik. Köln 2008, S. 238 ff. Gartenmeister an der Kolonialschule in Witzenhausen; D.G. Schwarzwasserfieber. Eine gefährliche Form der Malaria Tropica. Auslöser: Chinin oder andere Malariamittel, Stress und Alkoholismus. Symptome: Schüttelfrost, hohes Fieber, heftiges Erbrechen, blutiger bis schwarzroter Urin, Milz- und Leberschwellung mit Gelbfärbung der Haut, in schweren Fällen Urinverhalten und Nierenversagen mit meist tödlichem Verlauf. Vgl. Deutsches Kolonial-Lexikon (hrsg. H. Schnee, 1920), Bd. III, S. 325. Gemeint ist die Kaffeeaufbereitungsanlage, die in den Geschäftsberichten der RHPG erwähnt wird. Fabarius plante die Einrichtung einer völkerkundlichen Sammlung in Witzenhausen, die von den ausgereisten ehemaligen Kolonialschülern in ihren jeweiligen Ländern zusammengetragen und der Kolonialschule gestiftet werden sollte. DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten (Originalbrief); leicht gekürzt abgedruckt in: Der Deutsche Kulturpionier Nr. 4, 1901, Frühjahrsausgabe. Bestätigung dieser und der folgenden Angaben in den Akten der RHPG im Hausarchiv des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie. Wie ernst man die Pestgefahr damals nahm, geht aus den Mitteilungen des Kaiserlichen Bezirksamts in Tanga hervor. Noch im Dezember 1901 erschienen in den Anzeigen für Tanga Aufforderungen, Hofräume und die Umgebung von Wohngebäuden stets rein zu halten. Für die Ablieferung getöteter Ratten wurden Prämien gezahlt (vgl. Anzeigen für Tanga vom 21.12.1901). DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Consten an Fabarius 26.3.1901. Schreiben Paul Weise an Direktor Fabarius vom 20.8.01; DITSL Archiv der Deutschen Kolonialschule, Schülerakte P. Weise Ebd. DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Schreiben Weise vom 17.9.1901 DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Schreiben Fabarius vom 24.9.1901 DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Schreiben vom 27.10.1901 Ebd. Hermann Consten, „… und ich weine um dich, Deutsch-Afrika“. Stuttgart 1926, S. 73. DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Schreiben v. 27.10.1901; 10.000 Reichsmark in Gold würden heute etwa € 147.000,– entsprechen. Ferdinand Wohltmann, Die wirtschaftliche Entwicklung in den Kolonien. In: Der Tropenpflanzer, 7. Jg. Nr. 2, Febr. 1903. Hemileia vastratix, eine Krankheit des Kaffeeblatts. Wohltmann, a.a.O. HBO, Akte RHPG Nr.75, Schreiben Akkersdijk vom 30.12.1901 Hermann Consten, „… und ich weine um Dich, Deutsch-Afrika“. Mit 10 Kohlezeichnungen von H. Aschenborn. Verlag von Strecker und Schröder in Stuttgart 1926. Auszug aus „Weihnachten“, „ … und ich weine um dich, Deutsch-Afrika“, S. 78 ff. HBO, Akten RHPG Nr.74, Schreiben Akkersdijk vom 7.1.1902 HBO, Akten RHPG Nr.74, Schreiben Akkersdijk vom 12.1.02 HBO, Akten RHPG Nr.75, Schreiben v. St. Paul-Illaire vom 13.2.1902 HBO, Akten RHPG Nr. 75, Schreiben Akkersdijk vom 27.1.1902 HBO, Akten RHPG Nr.75, Schreiben RHPG an Akkersdijk vom 19.2.1902
569
ANHANG 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Schreiben vom 7.4.1902 Consten bezieht sich auf den oben zitierten Brief St. Paul-Illaires an Akkersdijk v. 19.2.1902. Darin ist allerdings von der Deutschen Kolonialschule nirgends die Rede; D.G. DITSL, Archiv der DKS, a.a.O. HBO, Akten der RHPG Nr.75, Schreiben Akkersdijk vom 10.4.1902 HBO, Akten der RHPG, Protokoll der Gesamtvorstandssitzung vom 27.4.1902 HBO, Akten der RHPG, Vorstandsprotokoll vom 3.6.1902 HBO, Akten der RHPG Nr. 75, Schreiben RHPG an Akkersdijk (Den Haag) vom 11.6.1902 HBO, Akten der RHPG Nr. 75, Schreiben Akkersdijk vom 16.6.1902 HBO, Akten der RHPG Nr. 75, Schreiben Akkersdijk vom 19.6.1902 HBO, Akten der RHPG Nr. 75, Schreiben Akkersdijk vom 10.7.1902 HBO, Akten der RHPG Nr. 75, Schreiben Gerlich an Akkersdijk vom 24.8.1902 HBO, Akten der RHPG Nr. 75, Schreiben Akkersdijk vom 22.9.1902 Vgl. dazu: Th. Pakenham, The Boer War, London 1979; Peter Wawrick (ed.) The South African War. The Anglo-Boer War 1899–1902, London 1980; Hans Rosenbach, Das Deutsche Reich, Großbritannien und der Transvaal 1896-1902, Göttingen 1993; Ulrich Kröll, Die internationale Burenagitation, Münster o.J. s. Rosenbach, S. 275 ff. Für viele Illegale bot sich als Alternative zum Strafantritt die Order, sich nach China einzuschiffen und dort an der Niederschlagung des Boxeraufstandes teilzunehmen. „… und ich weine um dich, Deutsch-Afrika“, S. 52 ff. Kis. Bwana mkuba: Weißer Herr Kis. kanga: einfach geschnittenes weißes Baumwollhemd Bwana Jusuf: Joseph Friedrich, ein früherer Druckereibesitzer aus Straßburg. Boma: Festung; gemeint ist hier das Bezirksamt von Tanga Gouverneur von Deutsch-Ostafrika war in jenen Jahren Graf Adolf von Götzen (1901–1906) Afrikaans: Gott möge ihn verdammen. Schlacht am Tugela Hill: Im Februar 1900 gelang es dort den Engländern, nach monatelangen verlustreichen Auseinandersetzungen mit den Buren und ausländischen Freiwilligenverbänden, die blockierte Verbindung nach Ladysmith freizukämpfen. Entsendung der Gelderland, nachdem das Auswärtige Amt in Berlin auf persönliche Anordnung Kaiser Wilhelms II. Krüger die Passage auf einem deutschen Linienschiff mit Rücksicht auf eine mögliche Verärgerung Londons verweigert hatte. Vgl. Wawrick, S. 177; Rosenbach, S. 291. Deutsch-Ostafrikanische Zeitung vom 27.10.1900 Internet-Recherche: http://edocs.ub.unifrankfurt.de/volltexte/2007/9041/pdf/1900_10.pdf d.h. der Buren Der Deutsche Kulturpionier, 4. Jg. 1903/04, S. 79 f. DITSL, DKS-Bildarchiv Akte 1300, Bl. 1291 (Missionsstation Ngambo), 1294 (Bei Sterneburg, Gefangene nach der Friedenserklärung), 1296 (Bauernkommando), 1299 („Town garde“, Eingeborene zur Verteidigung der Stadt gegen die Bauern). Hermann Consten, Weideplätze der Mongolen Bd. II, Berlin 1920, S. 67 PAdAA, Akten betreffend den Krieg 1914, Unternehmungen und Aufwiegelungen gegen unsere Feinde (Afghanistan und Persien). Der Weltkrieg Bd. 1, Nr. 11 e (Russland), R 21028-1, Schreiben Consten an AA vom 20.8.1914. PAdAA, Akten des Kaiserlichen Deutschen Konsulats in Moskau, Nr. 14/2 (alt XII.2; Blatt 5, Inventar Nr. 464) PAdAA, Akten betreffend den Krieg 1914, Unternehmungen und Aufwiegelungen gegen unsere Feinde (Afghanistan und Persien). Der Weltkrieg Bd. 1, Nr. 11 e (Russland), R 21028-1, Schreiben Consten an AA vom 20.8.1914. „… und ich weine um dich, Deutsch-Afrika“, S. 178 ff. Deutsch-Ostafrikanische Zeitung vom 25.7.1903 Internet-Recherche: http://edocs.ub. uni-frankfurt.de/volltexte/2007/pdf/1903_07/pdf
570
ANMERKUNGEN 125 126 127 128
129 130
131 132 133 134 135 136
137
138 139 140 141 142
143
144
145 146
Ebd. Ebd. „… und ich weine um dich, Deutsch-Afrika“, S. 157 ff. Die Formulierung habe ich der Dissertation von Utz Anhalt entnommen; vgl. Utz Anhalt, Tiere und Menschen als Exoten – Exotisierende Sichtweisen auf das „Andere“ in der Gründungs- und Entwicklungsphase der Zoos. Diss. Hannover 2007, S 13. Internet: www.tib.uni-hannover.de/spezialsammlungen/dissertationen/hannover/diss_07.pdf Constens Afrika-Sammlung wurde 2011 versteigert; D.G. Einem Antrag des Aachener Rechtsanwalts Dr. Sonanini vom 7. Mai 1906 auf Ausstellung eines Heimatscheins für den damals in Russland weilenden Consten war zu entnehmen, dass dieser am 1. April 1903 aus Afrika nach Aachen zurückgekehrt war. Landesarchiv NRW, Akten des Regierungspräsidenten der Stadt Aachen betr. Heimatscheine, Staatsangehörigkeit, Bd. 60, Az. 13519 Mitteilung Hagenbeck-Archiv an die Autorin vom 21.4.2008 Kis. Uleia: Europa Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 482. Internet: www.ub.bildarchiv-dkg.uni-frankfurt.de/Bildprojekt/Lexikon/ Vgl. Jagdschutzverordnung für das Deutsch-Ostafrikanische Schutzgebiet, in: Amtlicher Anzeiger für Deutsch-Ostafrika, IV. Jg, No. 14, Daressalam 13.6.1903 Internet-Recherche: http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2007/pdf/ 1903_06/pdf Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S.561 Umbanyika; sehr flache, wildreiche Gras- und Dornbusch-Steppe am Nordfuß der Usambara-Berge, im einstigen Grenzgebiet zwischen Deutsch- und Britisch-Ostafrika. Benannt nach dem sie durchfließenden Umba-Fluss. Vgl. Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 572 Emin Pascha: Eduard Schnitzer (1840–1892), deutscher Arzt und Forschungsreisender; zeitweise in osmanischen Diensten in Khartum tätig, später Gouverneur der ÄquatorialProvinz. Ab 1890 im deutschen Kolonialdienst an der Erschließung des ostafrikanischen Hinterlandes beteiligt. Wurde 1892 ermordet. „… und ich weine um dich, Deutsch-Afrika“, S. 61 ff. Hermann Consten: „Zwischen Halbgöttern und Banditen in der Mongolei. Erinnerungen eines Forschungsreisenden“ (Sendemanuskript WDR II, Kultur vom 11.5.1957) PAdAA, Akten des Kaiserlichen Deutschen Konsulats in Moskau, Matrikel Blatt 103, Nr. 112 Den Datumsangaben liegt der Gregorianische Kalender zugrunde; nach dem russischen Kalender „alten Stils“, dem Julianischen, fiel Port Arthur im Dezember 1904. In dem 2007 erschienenen Werk „The Russo-Japanese War in Global Perspective“ vertritt der Autor David Wolff die These, es habe sich bei diesem Krieg bereits um den ersten globalen Konflikt des 20. Jahrhunderts, den „Weltkrieg Nr. Null“ gehandelt. S. auch R. Kowner, Rethinking the Russo-Japanese War. Centennial Perspectives. Global Oriental, London 2006 Zu den deutsch-russischen Beziehungen vgl. Lothar Gall: Aufstieg und Niedergang großer Reiche. Russland und Deutschland in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Vortrag im Deutschen Historischen Institut Moskau (18.10.2006), Druckfassung als pdfVersion, S. 8 ff. Constens Umzug nach Russland am 15. Oktober 1904 ist in den Akten des Regierungspräsidenten von Aachen, betreffend Heimatscheine, Staatsangehörigkeit, Band 60 unter dem Aktenzeichen 13519 vom 7.5.1906 vermerkt, die sich im Landesarchiv NRW in Düsseldorf befinden. Er selbst hat dieses Datum nirgends erwähnt. Seine eigenen verifizierbaren Angaben variieren zwischen 1905, 1902 und 1903. Constens Adresse fand sich in den Akten des Deutschen Generalkonsulats Moskau. Das „Yar“ ist ein noch heute bestehendes Moskauer Luxusrestaurant. 1826 gegründet, gehörten Aleksandr Puškin, Lev Tolstoj, Fedor Šaljapin und andere Prominenz zu den
571
ANHANG 147
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
158
159
160 161 162
163
164
Stammgästen. Die Speiseräume sind mit Spiegeln ausgekleidet und die verzierte Kuppeldecke wird von schweren Säulen gestützt. Stepan Rjabušinski, Moskauer Bankier, Industrieller und Kunstmäzen. Seine Villa, einer der schönsten Jugendstilbauten Moskaus, war in der Lenin-Ära ein psychoanalytisches Kinderheim. Unter Stalin lebte dort der sowjetische Schriftsteller Maxim Gorki. Das Haus beherbergt heute das Gorki-Museum. Im Frühjahr 1913 empfing Rjabušinski als stellv. Vorsitzender des Moskauer Börsenvereins eine mongolische Regierungsdelegation, die Finanzhilfe von Russland erhoffte. Diesen Kontakt hatte Hermann Consten vermittelt, der die Delegation auch begleitete. PAdAA, Akten betr. Innere Angelegenheiten Chinas, Bd. 8, R 17767-1, A 4535, Deutsches Generalkonsulat Moskau an Bethmann Hollweg 1.3.1913; vgl. auch D. Götting, Etzel Teil II, Kap. 5 und Michael Underdown, Aspects of Mongolian History 1901–1915, in: Zentralasiatische Studien des Seminars für Sprachu. Kulturwissenschaft der Universität Bonn, Nr. 15 (1981), S. 174 ff. russ.: Großbauer; hier im Sinne von Ausbeuter, Blutsauger verwendet. russ.: Macht nichts! russ.: Dummkopf, Narr russ.: poklon; Verbeugung Consten meint Kosaken, er verwendet in seinen Aufzeichnungen durchgängig seine persönliche Verschriftung Kasack entsprechend der russischen Aussprache des unbetonten o. russ.: Kosakenpeitsche Straße in Moskau Hermann Consten: Der rote Lama. Ein Erlebnis aus dem innersten Asien, Stuttgart 1928, S. 4 ff. Moskauer Szene aus dem Anfangskapitel des Romans. Moskau hatte 1905 etwa 1,5 Millionen Einwohner. Zu den Ereignissen von 1904/1905 vgl. Martin Aust: Das Jahr 1905. Die erste Revolution im Zarenreich. In: Ralf Beil (Hg.): Russland 1900. Kunst und Kultur im Reich des Zaren. Köln 2008, S. 273ff.; Heinz-Dietrich Löwe: Der Russisch-Japanische Krieg und die russische Innenpolitik: Vom „kleinen erfolgreichen Krieg“ in die erste Revolution von 1905. In: Maik Hendrik Sprotte et al. (Hg.): Der Russisch-Japanische Krieg 1904/05. Anbruch einer neuen Zeit? Wiesbaden 2007, S. 147-171 Eine lebendige Schilderung der Verhältnisse der Deutschen in Moskau in den Jahren vor der Oktoberrevolution findet sich im ersten Teil der Lebenserinnerungen des 1906 in Moskau geborenen Klaus Mehnert: „Ein Deutscher in der Welt“, Stuttgart 1981, S. 11-38; für eine ausführliche Darstellung siehe Victor Dönninghaus: Die Deutschen in der Moskauer Gesellschaft, Symbiose und Konflikte (1494–1941), Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Band 18, Göttingen 2002 Informationen über die Lage der Deutschen in Moskau während der Revolutionswirren von 1905 sind einem Vortrag entnommen, den Generalkonsul Kohlhaas im Jahr 1912 in Berlin gehalten hat. PAdAA, Akten des Kaiserlichen Deutschen Konsulats in Moskau, R 5/III, 1, 5/2, Handakte Kohlhaas. Ottomar Rausch, Artillerieoffizier, Lehrer an der Militärschule in Jüterbog bei Berlin. Antrag und Heimatschein befinden sich in den Akten des Aachener Regierungspräsidenten, Landesarchiv NRW, Düsseldorf, Band 60, Az. 13519 vom 7. 5.1906. 1827 gegründet, bestand das Lazarev-Institut bis 1919, ab 1920 wurde es nach mehrfachen Umbenennungen und Reorganisationen bis 1954 als Moskauer Orientalisches Institut fortgeführt. Nach seiner Schließung wurden die Lehrstühle für indische Sprachen und den Nahen Osten in das Institut für Internationale Beziehungen eingegliedert. Für die Auskunft danke ich Prof. D. Funk, Moskau. Vsevolod Fedorovič Miller (1848–1913), Volkskundler, Linguist, Ethnograph, Archäologe. 1897–1911 Direktor des Lazarev-Instituts für orientalische Sprachen. Miller hat 1889 die erste ethnografische Zeitschrift Russlands – „Etnografičeskoe Obozrenie“ – gegründet. 1911 wurde er zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg ernannt. Imperatorskoe Obščestcvo Ljubitelej Estestvoznanija Antropologii i Etnografii i ego Geo-
572
ANMERKUNGEN
165 166
167 168 169 170
171 172 173
174 175 176 177 178 179
grafičeskogo Otdelenija. Nicht zu verwechseln mit der Kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft, die ihren Sitz in St. Petersburg hatte. Hermann Consten wurde vermutlich in die Moskauer „Gesellschaft der Freunde“ aufgenommen. Er selbst gab in einem Lebenslauf an, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 zum korrespondierenden Mitglied der weitaus prominenteren Geographischen Gesellschaft ernannt worden zu sein. Dmitri Nikolaevič Anučin (1843–1923), Naturwissenschaftler, Archäologe, Anthropologe und Geograph; Übersetzer westlicher wissenschaftlicher Werke seiner Forschungsbereiche; Gründer der Moskauer Museen für Völkerkunde und für Geographie. „Auf Schleichwegen nach Tibet“, so der deutschsprachige Titel von Prževalskis 1875/76 erschienenem Werk „Mongolija i strana Tangutov“ („Die Mongolei und das Gebiet der Tanguten“); Faksimile-Ausgabe der 1881 in Jena erschienenen autorisierten deutschsprachigen Ausgabe „Reisen in der Mongolei, im Gebiet der Tanguten und den Wüsten Nordtibets“, aus dem Russischen und mit Anmerkungen versehen von Albin Kohn; neu herausgegeben v. Detlef Brennecke, Ed. Erdmann, Lenningen 2004. Die Ausgrabungen in Char Chot erfolgten 1907–1909; seine letzte Mongolei-Expedition unternahm Kozlov in den Jahren 1923–1926. Einen guten Überblick über Russlands Explorationen in Zentralasien gibt Aleksej V. Postnikov, Central Asia, Russian Exploration. In: Jennifer Speake (Hrsg.) Literature of Travel and Exploration, an Encyclopedia, Vol 1, A-F, S.214 ff. (2003) Auf Agvan Doržiev (1854–1938) wird im Zusammenhang mit Hermann Consten näher einzugehen sein. Fürst Uchtomski hatte den Zaren 1890/91 auf dessen Prinzenreise durch mehrere Länder Asiens begleitet; seiner Auffassung nach lag Russlands Zukunft in Asien, wobei ihm eine Rolle seines Landes als „wohlwollender Vormund“ und „Träger der Kultur im Fernen Osten“ vorschwebte. Als Generaldirektor der Russisch-Chinesischen Bank hatte Uchtomski maßgeblichen Anteil an russischen Versuchen einer wirtschaftlichen Durchdringung der Mongolei. Was die wirtschaftliche Erschließung und Industrialisierung vor allem Chinas betraf, so sollte Russland nach Uchtomskis Konzept Türöffner für das wirtschaftlich potentere Deutschland sein. Bekannt wurde Uchtomski in Deutschland vor allem durch die Veröffentlichung seines Buches über die Orientreise des Carevič (2 Bde., Leipzig 1894 u. 1899) und seine Sammlung buddhistischer Kunst. Vgl. Udo B. Barkmann, Geschichte der Mongolei, Bonn 1999, S. 80; R. Utz, Die Orientreise Nikolaus II. und die Rolle des Fernen Ostens im russischen Nationalismus. In: M. H. Sprotte et al. (Hg.), Der Russisch-Japanische Krieg 1904/05. S. 128 ff. Consten erwähnt die beiden Doggen in der Einleitung zum ersten Band seiner „Weideplätze der Mongolen“, Berlin 1919, S. 3 Zit. nach Hermann Consten „Zwischen Halbgöttern und Banditen in der Mongolei. Erinnerungen eines Forschungsreisenden.“ (Sendemanuskript WDR II, Kultur v. 11.5.1957) Zu Geschichte und Bedeutung der Schädelforschung in Deutschland sowie ihrer Verquickung mit Rassismus und Kolonialismus am Beispiel Ostafrikas vgl. Martin Baer und Olaf Schröter: Eine Kopfjagd. Deutsche in Ostafrika. Spuren kolonialer Herrschaft. Berlin 2001 Consten hatte offenbar sein Jagdgewehr, seine Schrotflinte und seine Mauser-Pistole aus seinen afrikanischen Jahren mit nach Russland genommen. PAdAA, Akten des Deutschen Generalkonsulats Moskau, R 23/18, K 2/1, Bl. 94 Hermann Consten „Zwischen Halbgöttern und Banditen in der Mongolei“ (Sendemanuskript WDR, a.a.O.) Hermann Consten „Weideplätze der Mongolen. Im Reiche der Chalcha“, Band I, Berlin 1919, S. 4 (Kap. 1, Auf der sibirischen Bahn) Vor 1925 startete die Transsibirische Eisenbahn nicht, wie heute, vom Jaroslawler Bahnhof, sondern vom schräg gegenüber liegenden Kazaner Bahnhof aus. (Quelle: Wikipedia) Hermann Consten, Der Kampf um Buddhas Thron. Mysterien. Bücherei eines Freien Le-
573
ANHANG 180
181
182 183 184 185 186
187 188
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
sebundes Band II und III, Vossische Buchhandlung Berlin 1925. Der Rote Lama, Ein Erlebnis aus dem Innersten Asien. Verlag Strecker und Schröder, Stuttgart 1928 Über die Rolle deutscher Konsulate in Russland bei der geheimen Beschaffung militärischer Informationen über das Gastland durch oft als Handelsreisende oder Sprachschüler getarnte Agenten siehe Jürgen W. Schmidt: Gegen Russland und Frankreich – Der deutsche militärische Geheimdienst 1890–1914. Ludwigsfelde 2006, S. 106 Aleksej Matveevič Pozdneev (1851-1920) Einer der führenden Ostasienforscher Russlands im ausgehenden 19. Jahrhundert. Seine bekanntesten Werke über die Mongolei: Mongolija i Mongolii (Die Mongolei und die Mongolen), St. Petersburg 1892–96; Buddhistische Klöster und buddhistische Geistlichkeit in der Mongolei. St. Petersburg 1898 (Das unveröffentlichte Manuskript einer deutschen Übersetzung durch Hermann Consten befindet sich im Zentralasienseminar der Universität Bonn; D.G.). Außerdem war Pozdneev Verfasser eines kalmückisch-russischen Wörterbuchs. Er lehrte Ethnologie und asiatische Sprachen in St. Petersburg. Seine Kunstsammlung befindet sich heute im Museum für Asiatische Kunst in Moskau. Zum russisch-japanischen Geheimvertrag vgl. Udo B. Barkmann, Geschichte der Mongolei, Bonn 1999, S. 85 f.; Masato Matsui, The Russo-Japanese Agreement of 1907; its causes and the progress of negotiations“, in: Modern Asian Studies No. 6,1 (1972), S. 33 ff. So nannten die Japaner ihren mongolischen Einflussbereich; vgl. Michael Weiers, Geschichte der Mongolen, Stuttgart 2004, S. 223 f. Alex Marshall, The Russian General Staff and Asia. London 2006, S. 98. Lifanyuan; deutsch oft mit „Kolonialamt“ übersetzt. Nach dem Sturz der Qing-Dynastie und der Auflösung der Kaiserlichen Behörden gelangte in den 20er oder 30er Jahren ein Teil dieser historischen Verwaltungskarten in den Pekinger Antikhandel. Und es war ausgerechnet der damals in Peking lebende Hermann Consten, der diese Mongoleikarten zu sammeln begann. Er hat seine aus 180 Karten bestehende Sammlung bei seiner Ausweisung aus China im Jahr 1950 nach Deutschland gebracht. Nach seinem Tod 1957 gelangte sie zunächst an die Westdeutsche Bibliothek in Marburg und später an die Berliner Staatsbibliothek. Für die historische und mongolistische Forschung ist Constens Kartensammlung von unschätzbarem Wert. Denn sie vermittelt ein genaues Bild der Gebietsverhältnisse der Mongolei zu Beginn des 20. Jahrhunderts und enthält etwa 15.000 Ortsnamen. Eine ausführliche Beschreibung der Karten (verfasst von Klaus Sagaster) findet sich bei Walther Heissig, Mongolische Blockdrucke, Handschriften, Landkarten. In: Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland, Bd. 1, Stuttgart 1961, S. 335 ff. Seit 2009 kann man Constens Kartensammlung auch im Internet einsehen unter http://crossasia.org/digital/mongolische-karten/ Zu den mongolisch-chinesischen Spannungen um 1907 vgl. Barkmann, S. 74 ff.; Weiers, S. 222 ff.; Baabar, History of Mongolia. From World Power to Soviet Satellite. Cambridge 1999, S. 130 ff. In den Memoiren seiner späteren Frau Eleanor von Erdberg findet sich ein Hinweis, wonach Consten in Sibirien Anteile an Kohlezechen und Land besessen habe, die durch die Oktoberrevolution 1917 verlorengegangen seien. E. v. Erdberg „Der strapazierte Schutzengel. Erinnerungen aus drei Welten“, Waldeck 1994, S. 148 Weideplätze I, S. 11 Weideplätze I, S. 12 Weideplätze I, S. 13 Weideplätze I, S. 13 Alfons Paquet, Im zaristischen Russland. Gesammelte Werke Bd. 3, Stuttgart 1970, S. 38 Vgl. dazu Bruce Lincoln, Die Eroberung Sibiriens, dt. München 1996, S. 261 ff., S. 304 ff. Weideplätze I, S. 14 russ. stancija, Station Benannt nach Zar Nikolaus II; die Umbenennung in Novosibirsk erfolgte 1925. Weideplätze I, S. 15 f.
574
ANMERKUNGEN 199 Die Karteisammlung aus dem Nachlass, die sich heute in der Staatsbibliothek Berlin befindet, enthält unter dem Stichwort Kiachta – Urga eine kurze Landschaftsbeschreibung der Route mit Querverweis TB I p. 24, d.h. auf sein Reisetagebuch aus dem Jahr 1907, das leider nicht mehr existiert. 200 Ich Chüree–Urga–Ulaanbaatar. Die Bezeichnung geht auf den Namen der mongolischen Hauptstadt zurück. Gegründet 1639 am Šireet Cagaan Nuur als Örgöö (Palastjurte), wurde die Siedlung entsprechend ihrer wachsenden Bedeutung 1706 in Ich Chüree (Großes Kloster), 1778 in Ich Chüree Chot und 1911 in Nijslel Chüree (Hauptkloster) umbenannt. Seit 1924 heißt sie Ulaanbaatar (Ulan Bator; Roter Held). Der Name Urga wurde ihr von den Russen gegeben. Die chinesische Bezeichnung lautete Kulun. Zur Stadtgeschichte vgl. Weiers, S. 195 ff., Pozdneev, Mongolija i Mongolii, S. 44 ff., Walther Heissig, Die Mongolen. Ein Volk sucht seine Geschichte. Düsseldorf/Wien 1979. 201 von chin.: maimai, wörtlich: kaufen und verkaufen; Handel treiben. 202 Vgl. Karteikarten-Eintrag Constens, Stichwort Kiakhta (Kiachta); Karteikästensammlung aus dem Nachlass, urspr. Zentralasienseminar, der Universität Bonn, heute Staatsbibliothek Berlin, Sondersammlung Ostasien. 203 Karteikarteneintrag Constens, Stichwort Kiachta – Urga 204 Obo; ovoo. Steinsetzung auf Passhöhen oder an markanten Wegkreuzungen, die als Wohnstatt einer Ortsgottheit angesehen werden. Vorbeiziehende Nomaden oder Pilger umrunden solche Ovoos dreimal im Uhrzeigersinn und legen Gaben ab, um die dort anwesende Naturgottheit milde zu stimmen. Dieses schamanistische Brauchtum ist später in den Buddhismus integriert worden und wird bis heute gepflegt. 205 Vgl. Udo B. Barkmann, Bogd Uul – Der heilige Berg. Bemerkungen zu einem der ältesten Naturreservate der Welt. In: Mongolische Notizen – Mitteilungen der Deutsch-Mongolischen Gesellschaft e.V., Heft 9 (2000), S. 45 ff. 206 Eine detaillierte Beschreibung der einstigen Tempelstadt Da Chüree, des alten MajdarTempels und des zwischen 1907 und 1910 errichteten Choijin-Lamyn-Tempels (des noch heute erhaltenen Tempels des Staatsorakels im Stadtzentrum von Ulaanbaatar) durch Consten enthalten die Weideplätze Bd. II, S. 54-59. Eine hervorragende neuere Untersuchung ist die der ungarischen Wissenschaftlerinnen Zsuzsa Majer und Krisztina Teleki: Monasteries and Temples of Bogdiin Khьree, Ikh Khьree or Urga, the Old Capital City of Mongolia in the First Part of the Twentieth Century. Ulaanbaatar 2006. 207 Hermann Consten, Weideplätze Bd. II, S. 48 208 Die heutige Klosteranlage entspricht nicht mehr der einstigen Größe, da in den Jahren der sozialistischen Herrschaft ein Teil der Gebäude abgetragen oder zerstört wurde. Beschreibung des Klosterkomplexes durch Consten in Weideplätze Bd. II, S. 61-63. 209 Beschreibung des Totenfelds hinter dem Gandan-Kloster bei Consten, Weideplätze Bd. II, S. 65. Zu Toten- und Beisetzungsriten in der Mongolei vgl.: M. A. Pozdneev, Buddhistische Klöster und buddhistische Geistlichkeit in der Mongolei. Maschinenschr. deutsche Übers. in Auszügen, unveröff. im Nachlass Consten, S. 461 ff. Heike Michel, The Open-air Sacrificial Burial of the Mongols. http://userpage.fu-berlin.de/~corff/im/Texte/burial.html 210 Avalokiteśvara, skr. Manjusri, mong. Jenresig, Bodhisattva des allumfassenden Mitleids. Die Dalai Lamas Tibets gelten als seine Inkarnationen. 211 Der Deutsche Kulturpionier, Mitteilungen der Deutschen Kolonialschule Witzenhausen, Jahrgang 1924/25, Nr. 1, Briefe alter Kameraden. Hermann Consten: S. 36 ff. 212 Charles Bell, Der Große Dreizehnte. Das unbekannte Leben des XIII. Dalai Lama von Tibet. Dt. Bergisch Gladbach 2005, S. 83 213 Hermann Consten, Briefe alter Kameraden, S. 38 214 Der alte Majdar wurde nach einem Brand 1913 abgerissen. Constens Beschreibung und Fotografien des alten Majdar im 2. Band der „Weideplätze“ (Tafel 7-11) halten somit eine schon früh verlorengegangene Ansicht der historisch gewachsenen Tempelstadt fest. 215 John Snelling lastet ein Gutteil des Negativ-Images von Agvan Doržiev Wilhelm Filchner und dessen Informanten Cerenpil an. Vgl. John Snelling, Buddhism in Russia. The Story
575
ANHANG
216 217 218 219
220 221 222
223
224 225
226
of Agvan Doržiev, Lhasa's Emissary to the Tsar. Shaftesbury 1991, S. 112, 122, 275 (FN 18). Dazu passt die Bemerkung des dt. Gesandten in London, v. Kühlmann, in einer Depesche an Bethmann Hollweg: „der Intriguant Dorjieff ist bereits wieder in Lhasa eingetroffen“ (PAdAA, Akten betr. Innere Angelegenheiten Chinas Bd. 8, R 17766-1, A15161 v. 31.8.1912). Michael Underdown, Aspects of Mongolian History, S. 182 f. Auch laut Udo B. Barkmann (Geschichte der Mongolei, S. 119) „ist nicht auszuschließen, dass Agvan Doržiev ein Agent des russischen Generalstabs war, der langfristig aufgebaut worden war“. Dagegen unternimmt Helen Hundley, Tibet’s Part in the Great Game – Agvan Dorjiev, in: History Today, vol 43 (Oct. 1993), S. 45 ff, den Nachweis, dass er keineswegs der „russische Meisterspion“ gewesen sei, für den ihn seine Zeitgenossen hielten. Rockhill an Roosevelt 8.11.1908, zitiert n. Snelling, S. 133. O’Connor an R. Ritchie, Peking, 1.12.1908, zitiert nach Snelling, S. 134 Ljuba, Viktor Fedorovič, zunächst Dolmetscher und Sekretär am russischen Konsulat in Urga, ab 1905 Konsul. So schildert Consten in dem zitierten Aufsatz von 1924 sich selbst als jemand, der schon 1907 weltpolitisch zu denken verstanden haben will: „Im wirbelnden Tanze der Ereignisse hineingezogen, wurde ich von Ostafrikas Küsten, dem „Lande der Verheißung“, hinweggerissen, um endlich im fernsten innersten Asien zu landen und für Deutschlands Größe und Ehre dort auf eigene Faust zu wirken. Wie ich schon im Vorwort meiner ‚Weideplätze der Mongolen‘ sagte, ‚ohne dafür daheim beim alten Regime das nötige Verständnis zu finden‘. Damals wurde der Sturm über Asien entfesselt, dessen Luftdruck wir heute noch spüren, ohne dass die führenden Männer es verstanden, die außerordentliche Gunst des Augenblicks zu ergreifen, um in dem losbrechenden asiatischen Orkan das über Europa drohende Unwetter sich im Osten entladen zu lassen.“ Der Deutsche Kulturpionier 1924/25 Nr. 1, S. 36; s. auch Weideplätze I, Vorwort Weideplätze II, S. 5 Der VIII. Jebtsundampa Chutagt (1874–1924); 29.12.1911 Inthronisation als Bogd Chan der Mongolei, 1919 durch China abgesetzt, nach der Einnahme Urgas durch „weißrussische“ Kosaken unter Roman von Ungern-Sternberg erneute Bestätigung als Bogd Chan. Diese große Klosteranlage im Orchontal, etwa 350 Kilometer westlich von Urga gelegen, wurde im 16. Jahrhundert aus den steinernen Überresten Karakorums, der um 1220 gegründeten und 1388 von den Chinesen zerstörten einstigen Hauptstadt des Mongolischen Weltreichs, errichtet. Erdene Zuu (andere Schreibungen: Ärdäni Dsuu; Erdeni Joo) gehört zu den wenigen Klöstern der Mongolei, die in sozialistischer Zeit nicht völlig zerstört, sondern als Vorzeigeklöster mit Museumscharakter erhalten wurden. Das weiße Geviert ihrer aus 108 Tschörten und vier mächtigen Toren bestehenden Umfassungsmauer ist weithin sichtbar. Die Anlage gehört mit dem Orchontal und den von deutschen und mongolischen Archäologen ausgegrabenen Ruinen des alten Karakorum zum UNESCO-Weltkulturerbe. Consten schrieb, das Kloster berge noch manchen Schatz aus der Zeit Čingis Khans, darunter 1241 während der Schlacht bei Liegnitz erbeutete Waffen des deutsch-polnischen Ritterheers. Vgl. Der Deutsche Kulturpionier, ebd., S. 38 f. Albert Tafel (1876–1935), Weggefährte des Ehepaars Filchner bei Filchners erster TibetExpedition 1904/05. Allein besuchte er Kumbum ein zweites Mal in der Zeit, als sich der XIII. Dalai Lama dort aufhielt; s. Albert Tafel, Meine Tibetreise, 2. Aufl., Stuttgart 1923, S. 313 ff. Charles Bell, S. 94 Laut W.A. Unkrig brachte Agvan Doržiev den Shambala-Mythos in Verbindung mit dem Potential einer Regeneration des Buddhismus in Zentralasien. Siehe dazu seinen Brief an R. Loewenthal vom 17.12.1954 in: Hartmut Walravens (Hrsg.) W.A. Unkrig (1883–1956) Korrespondenz mit Hans Findeisen, der Britischen Bibelgesellschaft und anderen über Sibirien und den Lamaismus. Wiesbaden 2004 „Erleuchteter“ wörtl.: Verwandlungskörper. Ein aus dem Kreislauf der leidvollen Existenzen befreiter religiöser Lehrer (= Lama).
576
ANMERKUNGEN 227 Agvan Doržiev ist Alexandra David-Néel 1898 in Paris begegnet; vgl. Snelling, S. 60 228 Anspielung auf Albert Grünwedel, dessen Begegnung mit Agvan Doržiev auch in seinen eigenen Aufzeichnungen belegt ist. 229 Gemeint ist Ögedej Chaan, dessen Tod in der Hauptstadt Karakorum 1241 den Vormarsch der Mongolen in Mitteleuropa beendete; vgl. Michael Weiers: Geschichte der Mongolen. Stuttgart 2004, S. 97 ff. 230 Hermann Consten, Der rote Lama, S. 152 f. Bei den in dem Zitat erwähnten Herren des Berliner Völkerkundemuseums, die sich um den tibetischen Lama kümmern, dürfte Consten auf die führenden Museumsleute jener Zeit, den Tibetologen und bekannten Archäologen Albert Grünwedel, den Turkologen F.W.K. Müller und den Ethnologen und Archäologen, Museumsdirektor Albert von Le Coq, angespielt haben. Vor allem mit Grünwedel stand Consten in den zwanziger Jahren persönlich in Kontakt. Näheres dazu in Teil IV dieses Buches. 231 Charles Bell, S. 96. 232 Snelling, S. 136 233 Snelling, S. 153 f.; Consten in: Der deutsche Kulturpionier, S. 43 234 Vgl. E. O. Batsaikhan, Bogdo Jebtsundamba Khutuktu, the last King of Mongolia, Ulaanbaatar 2009, S. 13 ff.; Barkmann, Geschichte der Mongolei, S. 90 f. 235 So formuliert in einem am 30. Januar 1914 verfassten Handschreiben, in dem Kohlhaas die Chancen sondiert, Consten für seine Informantendienste mit einem preußischen Orden auszuzeichnen. In seinem letzten selbstverfassten Lebenslauf aus den 50er Jahren gab Consten an, er habe den Kronenorden 1914 „für Forschungsarbeit in Zentralasien“ erhalten. Vgl. PAdAA, Akten des Deutschen Generalkonsulats, R 17769-1, A 2296; Lebenslauf Consten (unveröffentlicht im Nachlass). 236 Gung Chajsan (Haisan Gün) (um 1862–1917) 237 Ob sich hinter der Gestalt Ming Baos tatsächlich der berühmte Gung Chajsan, einer der Väter der Unabhängigkeitserklärung von 1911 verbarg, lässt sich nicht mit letzter Gewissheit sagen. Vergleiche mit der einschlägigen historischen Literatur, von Fotografien und persönliche Recherchen in der Mongolei legen den Befund jedoch nahe. 238 Weideplätze II, S. 3; die faszinierendste Betrachtung zum Thema Kartographie und Geopolitik findet sich m. E. bei Karl Schlögel „Im Raume lesen wir die Zeit“, München 2003 239 Weideplätze I, S. 5 f. 240 Weideplätze II, S. 241 241 Consten schildert an anderer Stelle, dass die Russen entgegen den Grenzvereinbarungen mit China ihre Wachtposten entlang der gesamten gemeinsamen Grenze mit China um 1910 etwa 500 Werst auf mongolisches Gebiet vorgeschoben haben. Um evtl. Grenzscharmützel mit Russland zu vermeiden, hatte Peking einen Sicherheitskordon gelassen. Consten vermutete schon 1911, dass sich Russland das Gebiet später aneignen würde. 242 russ. jamščik; Postkutscher 243 russ. kinžal; Dolch 244 Schlacht bei Zülpich; Consten bezieht sich auf den Sieg der Franken unter Chlodwig I. über die Alemannen im Jahr 496 u. Z. 245 Originalbrief mit Briefkopf Hermann Consten jr. Moskau im Nachlass (Sgl. Corts). 246 Vertrag von Ili: gemeint ist der russisch-chinesische Vertrag von St. Petersburg (1881) über die Einrichtung russischer Konsulate in Ich Chüree, Chovd und Uliastaj und die Rahmenbedingungen für den russischen Handel in der Mongolei, der im Jahr 1911 auslief. Er sollte nach Vorstellung Chinas neu verhandelt werden, denn Peking wünschte die Streichung russischer Handelvorrechte. St. Petersburg fürchtete daher den Verlust seiner Einflussmöglichkeiten in der Mongolei. Vgl. Barkmann, Geschichte der Mongolei, S. 101 247 Weideplätze II, S. 243 ff. 248 Weideplätze II, S. 244 249 PAdAA, Akten betr. Innere Angelegenheiten Chinas. China 2: Akten betr. Differenzen zwischen China und Russland wg. Rückgabe des Kuldscha (Ili)-Distrikts an China,
577
ANHANG 250 251 252 253 254 255
256 257 258 259
260 261 262 263
264 265
266 267
Bd. 8. A 13205. (Unterstreichungen im Original von unbekannter Hand.) Char us (Kara ussu), großer See südöstlich von Chovd Weideplätze II, S. 257; es könnte sich lt. Auskunft Barkmann um den Zavchan handeln. Weideplätze II, S. 257 Es handelt sich um die Aimags Cecen Chan, Tüšeet Chan, Zasagtu Chan und Sajn Noyon Chan. Barkmann, S. 94 Da Lama Cerenčimed (1872–1914), aus einfachen Verhältnissen stammend, brachte es anfangs des 20. Jh. zu einem führenden Mitglied des buddhistischen Klerus der Mongolei und zum Sekretär des VIII. Jebtsundampa Chutagt. Er gehörte neben Gung Chajsan zu den treibenden Kräften für die staatliche Unabhängigkeit der Mongolei und war der erste Ministerpräsident nach der Unabhängigkeitserklärung von 1911. Während der russischchinesischen Verhandlungen von 1912 beharrte er auf der Einbeziehung der Inneren Mongolei in den jungen Staatsverband und wurde deshalb seines Postens enthoben. Consten attestierte ihm in den „Weideplätzen“, nicht vor der Beseitigung politischer Gegner durch Zyankali zurückgeschreckt zu haben. Čin Van Chanddorž (1869–1915) Fürst des nordmongolischen Tüšeet Khan Aimag, Außenminister der ersten Regierung der unabhängigen Mongolei. Zur Entsendung der ersten mongolischen Delegation nach Russland s. E.O. Batsaikhan, S. 25; Diluv Khutagt, Political Memoirs, S. 70; Barkmann, S. 94, Baabar, S. 133 f. Zartul Beese (mong. Sartuul Bejs) oder Zezen Beese (mong. Cecen Bejs) in den „Weideplätzen“; seine Weidegründe befanden sich westlich von Uliastaj. Žalchanc Chutagt Damdinbazar (1874–1923); der hohe Lama, dessen Kloster und Weidegebiet sich südwestlich des Hövsgöl-Sees befand, wurde 1911 vom Bogd Chan mit der Befriedung der Westmongolei betraut. Ab 1921 amtierte er als Premierminister in Nijslel Chüree (Urga), empfing 1922 die deutschen Diplomaten Gipperich und Asmis, äußerte den Wunsch nach Abschluss eines deutsch-mongolischen Handelsvertrags. Vgl. dazu auch Budbayar Ishgen, Die mongolisch-deutschen Beziehungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Berlin 2009, S. 65 ff. Weideplätze I, S. 154 Weideplätze I, S. 173 f. Aachener Volkszeitung vom 9.3.1953; Bericht über einen Vortrag Constens. Weideplätze II, S. 22; bei dem von Consten erwähnten Geheimkurier könnte es sich um den burjatischen Intellektuellen Žamsran Ceveen (1880–1940) gehandelt haben, der ein enger Vertrauter Agvan Doržievs wie auch des Delegationsmitglieds Da Lama Cerenčimed war. Er war der Erste, der die Delegation nach ihrer Rückkehr aus Russland an der Grenze begrüßt haben soll. Žamsran Ceveen leitete in Nijslel Chüree die erste öffentliche Schule der Mongolei und gründete mit russischem Geld die erste mongolische Zeitung. In den zwanziger Jahren amtierte er als Direktor des Instituts für Schrifttum, der späteren Mongolischen Akademie der Wissenschaften. Die Einladung an Hermann Consten, am Ausbau des Instituts mitzuarbeiten (1925), geht vermutlich auf eine Initiative Žamsrans zurück. Vgl. E.O. Batsaikhan, S. 75, 152 ff.; Snelling, S. 98 Angestoßen durch eine Initiative mongolischer Historiker und Politiker beging die Mongolei 2011 erstmals 1911 als das Jahr ihrer Gründung des unabhängigen Staates. Kaiser Kangxi (1661–1722), einer der herausragenden Herrscher der Qing-Dynastie; während seiner Herrschaft begaben sich die Chalch-Fürsten 1691 nach Jahrzehnten kriegerischer Streitigkeiten der mongolischen Stämme untereinander unter den Schutz des Mandschu-Kaisers. Der Herrschaftsbereich der Qing wurde dadurch bis an die russische Grenze ausgedehnt. s. Weiers, S. 194 ff.; Barkmann, S. 42 ff. Weideplätze II, S. 64 Gun, Gün oder Gung als Adelstitel gab es in zwei Rängen: Ulsad Tuslagch Gung und Ulsyn Tushee Gun, wobei letzterer den höheren Rang, also den eines Herzogs, bezeichnete. Vgl. E.O. Batsaikhan, Glossar S. XVI.
578
ANMERKUNGEN 268 Die anderen vier waren laut Auskunft des Mongolischen Staatsarchivs in Ulaanbaatar der schwedische Missionar und Kaufmann F.A. Larson, der deutsch-baltische Kosakenführer Roman von Ungern-Sternberg, der den Bogd Chan nach dessen Sturz durch die zurückgekehrten Chinesen 1921 nach der Rückeroberung Urgas in sein Amt als Staatsoberhaupt wiedereinsetzte, sowie zwei weitere russische Militärs. 269 Nachlass Consten (Sgl. Strölin) 270 Für Hilfe bei der Lesung und Deutung der chinesischen Namenszeichen danke ich Prof. Roderick Whitfield, London; D.G. 271 PAdAA, Akten des Kaiserlichen Deutschen Konsulats in Moskau, K 4, R 4/1 (alt II, adh 7), Bl. 18 272 PadAA, ebda.; handschrift. Antwortvermerk auf dem unter FN 271 genannten Schreiben. 273 PAdAA, ebd., Bl. 33 274 Archiv des Amtsgerichts/Registergerichts der Stadt Aachen; Auszug aus dem Handelsregister, HRB 276 (alt), Eintrag vom 4.10.1912. 275 Kohlhaas hatte vom AA für September 1912 und im August 1913 Dienstreisen nach Taschkent, Samarkand und ins Fergana-Tal bewilligt bekommen. Seine Reisekostenabrechnungen befinden sich in den Akten des Generalkonsulats Moskau, PAdAA, K 7, „Specielle Personalakten“. 276 PAdAA, China I, Bd. 98, R. 17729-4, A 12312 277 Hier handelte es sich entweder um ein Missverständnis des Vizekonsuls Hauschild oder um eine Fehlinformation Constens. Groth war Geschäftsführer, später Inhaber der Goldminengesellschaft „Mongolor“, nicht chinesischer Gouverneur. Im Originaldokument ist diese Stelle von Hand unterstrichen und mit einem Fragezeichen am Rand versehen. Zu Mongolor s. auch Barkmann, S. 72 und 79 f. 278 PAdAA, China I, Bd. 99, R 17730-2, A 13386 279 Ebd. 280 Die Strecke Urga–Kalgan wurde erst ab 1917 regelmäßig mit Automobilen befahren; die Reisezeit betrug vier Tage. Längs der Strecke wurden Benzinlager eingerichtet, die von Mongolen bewacht wurden. Dieser sog. „Gobi-Express“ wurde durch ein amerikanisches Unternehmen von Kalgan aus betrieben; D.G. 281 Die Brüder Mannesmann besaßen seit 1906 in Marokko Bergwerke, landwirtschaftliche und industrielle Unternehmungen sowie mehrere Handelsgesellschaften. 1911 gab es erhebliche Probleme wegen zunehmender Unruhen im Land, aber auch wegen Spannungen mit Frankreich, das Ansprüche auf Marokko geltend machte. Das Auftauchen des deutschen Kriegsschiffes „Panther“ vor der marokkanischen Küste, der berühmte „Panthersprung v. Agadir“, wurde von Kritikern mit der wirtschaftlichen Präsenz Mannesmanns in Marokko in Verbindung gebracht und als Beweis für den starken Einfluss der deutschen Großindustrie auf die Politik Kaiser Wilhelms II. angesehen. Während der Schlussverhandlungen zum deutsch-französischen Marokko-Kongo-Abkommen 1911 wurde die Gründung einer binationalen Bergbaugesellschaft vorgeschlagen, in die Mannesmann seine Konzessionen einbringen und als Gegenwert dafür 40% des Aktienkapitals erhalten sollte. Weitere 40% sollte die Union des Mines Marocaines bekommen. Die restlichen 20% sollte eine dritte Gruppe erhalten, in der französisches Kapital bestimmend war. Eine Einigung kam jedoch nicht zustande. Noch einmal fanden in den Jahren 1912–1914 Verhandlungen statt, die jedoch ebenfalls zu keinem Ergebnis führten. Mit Ausbruch des 1. Weltkriegs endeten 1914 alle Marokko-Unternehmungen Mannesmanns, 1918 wurde der Besitz enteignet. Angesichts der Schwierigkeiten in Marokko erwogen die Brüder Mannesmann schon länger, in anderen Ländern ihr Glück zu versuchen. Reinhard Mannesmann rüstete 1911 eine Expedition nach Peru aus, die nicht nur nach Erzen schürfte, sondern auch nach Kautschuk suchte. (Firmenarchiv Mannesmann im Archiv des Deutschen Museums München, FA 009/031 und FA 009/032). Der Auftrag an Hermann Consten, eine Evaluierungsstudie über die Bodenschätze und den Nutzen einer wirtschaftlichen Erschließung der Mongolei vorzunehmen, gehört in diesen Kontext.
579
ANHANG 282 PAdAA, China I, Bd. 99, R 17730-2, A 13386 283 PAdAA, China I, Bd. 99, R 17730-2, A 14599, Langwerth und Mirbach an Hauschild (Entwurf), 4.8.1912 284 Zum Mordfall Dittenhofer vgl. PAdAA, Akten des Kaiserlich Deutschen Konsulats in Moskau, K4, R 4/1, Bl. 19, Bl. 27, Bl. 41, Bl. 99; K 4/2, Bl. 17 und Bl. 24 285 Weideplätze I, S. 87 f. 286 Moskovskaja Torgovaja Ekspedicija v Mongoliju. Moskva 1912 287 Weideplätze I, S. 183 288 Der Begriff „Dritter Partner“ ist eigentlich eine Wortschöpfung mongolischer Politiker. Nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems 1990 strebten sie durch Öffnungspolitik in Richtung Westeuropa, vor allem Deutschlands, gezielt einen Ausweg aus ihrer geostrategischen Lage zwischen den beiden Nachbarländern Russland und China an. Damit knüpften sie an ein bereits 1911 von Consten verfolgtes Konzept an; D.G. 289 Manlaj Baatar Damdinsüren (1871–1920); der aus der Inneren Mongolei stammende Damdinsüren diente der Bogd-Khan-Regierung als stellvertretender Kriegsminister und Oberkommandierender der in die West-Mongolei entsandten Truppen, die im August 1912 die Chinesen aus Chovd vertrieben und die Stadt zerstörten. 1920 verhafteten ihn die Chinesen; er starb im Gefängnis. 290 Weideplätze I, S. 154 291 Weideplätze I, S. 158 292 mongol. Gegeen; „Erleuchteter“, Lebender Buddha. 293 Weideplätze I, S. 158 294 Gung Chajsan (Ming-Bao) war dem Žalchanc Chutagt als stellvertretender Beauftragter für die Befriedung der West-Mongolei attachiert. Die von Consten geschilderte Sitzordnung verdeutlicht den Rangunterschied zwischen den beiden. Ihm selbst gebührte nach der mongolischen Etikette dagegen der Platz des Ehrengastes zur Rechten des Herrn der Jurte. Zur Funktion Gung Chajsans in jener Zeit vgl. O. Lattimore, F. Isono, The Diluv Khutagt. Memoirs and Autobiography of a Mongol Buddhist Reincarnation in Religion and Revolution. Asiatische Forschungen Bd. 74, Wiesbaden 1982, S. 250 295 Weideplätze I, S. 159 296 Weideplätze I, S. 161 f. 297 Diluv Chutagt Žamsranžav (1884–1964), Delobin Gegen in den „Weideplätzen“. Schon mit 15 Jahren als Schreiber in der Verwaltung tätig, übernahm er ab 1919 Aufgaben für die Regierung, u.a. als Sekretär im Finanzministerium. Nach der sozialistischen Revolution war er Mitglied der Mongolischen Revolutionären Volkspartei und hatte mehrere wichtige Ämter inne, u.a. als Erster Sekretär der Mongolischen Botschaft in Moskau. 1928 fiel er in Ungnade; ihm wurde ein politischer Prozess gemacht. Nach einem Freispruch auf Bewährung flüchtete er 1931 in die Innere Mongolei, reiste viel, u.a. auch nach Japan. Anfang 1939 tauchte er bei Hermann Consten in Peking auf. Vgl. Teil VI, Kap. 4. Nach der japanischen Besetzung Pekings begab er sich nach Shanghai und später nach Chungking, wo er zeitweise als Berater Chiang Kaisheks tätig war. Diluv Chutagt emigrierte 1949 in die USA; er starb 1964 in New York. Vgl. O. Lattimore, The Diluv Khutagt, a.a.O., Introduction S. 9 ff. 298 Weideplätze I, S. 165 299 Fürst Palta war ein Prinz der westmongolischen Torguten, die ihre Weidegründe im Gebiet des heutigen Xinjiang hatten. Kaiserinwitwe Cixi erteilte ihm die Erlaubnis, an der japanischen Militärakademie in Tokyo zu studieren. Unter Präsident Yuan Shikai bekleidete er verschiedene Ämter im Generalstab der chinesischen Armee. Er starb 1920. Vgl. Ce Shaozhen (Cedendorji, ein Sohn Fürst Paltas): Flaneur im alten Peking. München 1987, S. 13 f. 300 Weideplätze I, S. 181 301 Zagan-Tonké in den „Weideplätzen“ 302 Ivan Jacovlevič Korostovec (1862–1933); 1905 Sekretär Minister Wittes bei den russisch-
580
ANMERKUNGEN
303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326
327 328 329 330 331 332 333 334
japanischen Friedensverhandlungen in Portsmouth, 1907–1912 Gesandter des Zaren in Peking, 1912/13 Bevollmächtigter für die russisch-mongolischen Verhandlungen in Urga, während des 1. Weltkriegs russischer Gesandter in Teheran. Nach der Oktoberrevolution (1917) im Exil. Weideplätze I, S. 210 Weideplätze I, S. 182 Weideplätze I, S. 208; beide Beutel und den Armreif trägt Consten auch auf dem erwähnten „Fürsten-Porträt“. Alle Gegenstände befinden sich noch im Nachlass. Weideplätze I, S. 209 Weideplätze I, S. 232 Baidarik in den „Weideplätzen“. Weideplätze I, S. 234 Weideplätze I, S. 239-247 Weideplätze I, S. 247 Weideplätze I, S. 251 Weideplätze I, S. 258 f. Weideplätze I, S. 274 Weideplätze I, S. 291 Weideplätze I, S. 294 Weideplätze I, S. 301 Weideplätze I, S. 302 Weideplätze II, S. 6 I. J. Korostovec, Devjat’ Mesjacev v Mongolii. Dnevnik russkogo upolnomočennogo v Mongolii Avgust 1912–Maj 1913 g. (Neun Monate in der Mongolei. Tagebuch des russischen Bevollmächtigten in der Mongolei August 1912–Mai 1913); herausgegeben von E. O. Batsaikhan, Institut für Internationale Studien der Mongolischen Akademie der Wissenschaften, Ulaanbaatar 2009, S. 172, Eintrag unter dem 14.11.1912; Übers. d. Zitats a.d. Russischen durch die Autorin. I. J. Korostovetz, Von Cinggis Khan zur Sowjetrepublik, Berlin/Leipzig 1926, S. 222 Weideplätze II, S. 8 Korostovec, Devjat’ Mesjacev v Mongolii, S. 178 Ebd., S. 184, Eintrag vom 28.11.1912 Weideplätze II, S. 24 ff. Bint Van Gončigsüren; Fürst aus der Inneren Mongolei, der 1912 im Auftrag Yuan Shikais den Bogd Chan zur Rückkehr der Mongolei unter die Suzeränität der Republik China bewegen sollte. Stattdessen trat er in die Dienste des Bogd Chan und begleitete Da Lama Cerenčimed auf einer Reise nach Japan, von der sich die mongolische Regierung größeres Entgegenkommen als von den Russen erhoffte. Bint Van starb 1913, vermutlich an einer Vergiftung. Vgl. Lattimore, Diluv Khutagt; a.a.O. S. 239, Consten Weideplätze II, S. 8, Korostovec, Von Cinggis Khan zur Sowjetrepublik, a.a.O., S. 257, 263 Weideplätze II, S. 42 Vgl. Doris Götting, Jenseits der Exotik. Hermann Consten als Fotograf; in: Bilder aus der Ferne. Historische Fotografien des Mongoleiforschers Hermann Consten (Ausstellungskatalog), Bönen 2005, S. 22 Weideplätze II, S. 45 Die Regierungsdevise des Bogd Chan lautete: „Olana orguglegsen“ („Erhoben durch alle“); gemeint war seine einstimmige Ernennung zum Staatsoberhaupt der Mongolei durch die versammelten mongolischen Fürsten. Vgl. Batsaikhan, S. 152 ff. mongol. damnuur: eigentlich Trage, Schulterjoch; hier in der Bedeutung Deichsel Weideplätze II, S. 47 Weideplätze II, S. 49 Zum deutschen Interesse an Tibet und am tibetisch-mongolischen Vertrag von 1913 s. Underdown, S. 182 ff. Vgl. dazu auch Wilhelm Filchner, Wetterleuchten im Osten. Erleb-
581
ANHANG 335 336 337 338 339 340 341 342 343
344
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
355 356 357 358
nisse eines diplomatischen Geheimagenten, Berlin 1928. Englische Übersetzung des Vertragstextes bei Snelling, S. 150 f. PAdAA, Akten des kaiserl. Deutschen Konsulats Moskau, K4, R 4/1 (alt II/7), Bl. 99 v. 27.6.1913 Toschto Gun in den „Weideplätzen“. Togtoch Guns Chochun befand sich im Aimag des Sajn Noyon Chan. Laut Diluv Chutagt war er hoch gebildet und in seiner politischen Einstellung anti-chinesisch. S. Lattimore, S. 259, Weideplätze II, S. 107 Weideplätze II, S. 104 ff. Vgl. Joachim Stübner et al. (Hg.) Auf Goldsuche in der Mongolei. Chronik der Geologenexpedition der DDR in der MVR. Dresden 2005; dort v.a. S. 278 ff. Weideplätze II, S. 207 ff. Es handelte sich um die Ost-Warentransportgesellschaft, ein russisches Transportunternehmen, das im Handel mit Persien aktiv war. PAdAA, R 17767-3, zu A 10333, Kohlhaas an Bethmann Hollweg, 15.1.1913 PAdAA, China-Akten R 17766, A 10333. Konsulat Moskau an Bethmann Hollweg v. 15.1.1913 Zum Besuch der mongolischen Regierungsdelegation unter Fürst Čin Van Chanddorž in St. Petersburg vom Dezember 1912 bis März 1913 s. Barkmann, Geschichte der Mongolei, S. 125 f.; Baabar, History of Mongolia, S. 152 f.; Korostovec, Von Cinggis Khan zur Sowjetrepublik, S. 229 f. Ausstellungsbericht in der Aachener Tageszeitung Echo der Gegenwart vom 19. Oktober 1913; ein Bericht „Der Forschungsreisende H. Consten in der Wüste Gobi“, 22.10.1913 und ein von Consten verfasster Artikel „Die Lage in der Mongolei“ in: Asien – Organ der Deutsch-Asiatischen Gesellschaft, Nr. 2 November 1913. In dem Artikel äußerte sich Consten übrigens sehr kritisch über die Mongolei; D.G. PAdAA, R 17768, A 13006 PAdAA, R 17768, A 24087 PAdAA, R 17768, A 25638; eine eingehende Analyse der Einzelheiten und Hintergründe des Vertrags liefert Barkmann, Geschichte der Mongolei, S. 128 ff. PAdAA, R 17768, A 24132 Vgl. EN 147 Kohlhaas an Bethmann Hollweg, PAdAA, R 17769, A 2704; Kopien dieses Berichts gingen an die Gesandtschaften in St. Petersburg, Peking und Tokyo; s. auch Underdown, Aspects of Mongolian History, S. 174, 179 Akten des Generalkonsulats Moskau, PAdAA, R 17769, A 2296 Echo der Gegenwart v. 19.10.1913 Meldung Consten an das Kriegsministerium, erwähnt in einem handschriftlichen Vermerk Wesendoncks zu Consten vom 19.10.1914. PAdAA, R 21031-2, A 27326. Die Belagerung von Lüttich dauerte vom 4. bis 9. August 1914, als die Zitadelle in deutsche Hände fiel. Zur Belagerung von Lüttich s. Lothar Wieland, Belgien 1914 (Frankfurt 1984), S. 19ff; Alan Kramer, „Greueltaten“. Zum Problem der deutschen Kriegsverbrechen in Belgien und Frankreich 1914, S. 87 ff. Zitiert nach New York Times vom 23.9.1914; Übersetzung d. Zitats durch die Autorin E. J. Dillon, A Scrap of Paper. The Inner History of German Diplomacy and Her Scheme of World-Wide Conquest. London 1914, S. 200 f.; Übersetzung d. Zitats durch die Autorin ÖHHStA/Kriegsarchiv, Karton 3670, Nr. Nabt. Na 13428 v. 25.5.1918 Max Ronge (1874–1953), letzter Chef des k.u.k. Militärgeheimdienstes (Evidenzbüro) in Wien. Schüler und Nachfolger von Oberst Alfred Redl, der 1913 als Doppelagent enttarnt worden war. Auch nach dem Ende der Doppelmonarchie war Ronges Erfahrung weiter gefragt. Nach dem Anschluss Österreichs an das Hitlerreich kurzzeitig im KZ Dachau inhaftiert. Kam auf Intervention von Admiral Canaris frei. Zu Ronges Biografie vgl. Verena Moritz et al., Im Zentrum der Macht. Die vielen Gesicher des Geheimdienstchefs Maximilian Ronge. Wien 2007.
582
ANMERKUNGEN 359 ÖHHStA/Kriegsarchiv, Nachlass Max Ronge NL B/126:4, Bl. 156 360 Diese Vermutung galt bekanntlich der deutschen Reichsregierung und dem Großen Generalstab als Vorwand für einen präventiven deutschen Einmarsch in Belgien. Vgl. dazu: Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1914, Band III, Berlin 1922, S. 137 (Nr. 663), S. 139 (Nr. 667), S. 150 (Nr. 682), S. 160 (Nr. 710), S. 173 (Nr. 718); Band IV, S. 36 (Nr. 788), S. 39 (Nr. 793), S. 46 (Nr. 804). 361 Gemeint ist die Verletzung der belgischen Neutralität durch Deutschland im Jahr 1870; D.G. 362 Berliner Lokalanzeiger Nr. 410, Abendausgabe vom 14.8.1914, S. 1, Sp. 4 f.; zu den Versuchen der Reichsregierung, Frankreich als den Aggressor hinzustellen und so den Einfall der deutschen Truppen ins neutrale Belgien zu rechtfertigen vgl. Immanuel Geiss, Julikrise und Kriegsausbruch 1914, Hannover 1964, Band 2, S. 610 ff. 363 Vgl. Abb. 1 364 Nanny Lambrecht (1868–1942) Unterhaltungs- und Jugendschriftstellerin. Verfasserin von Kriegsromanen. Viele ihrer Werke spielen im deutsch-belgischen Grenzgebiet. 1904– 1918 lebte und publizierte sie in Aachen. 365 Hermann Consten, Weideplätze der Mongolen Bd. I, Berlin 1919, S. V 366 In Aachen existierte eine Zweigstelle des Vaterländischen Frauenvereins vom Roten Kreuz. Der Verein stand in Kriegszeiten unter der Oberleitung des Preußischen Vereins zur Pflege im Feld verwundeter und erkrankter Krieger. 367 Alfred Mannesmann an Max v. Oppenheim v. 15.8.1914, PAdAA, R 21028, Akten betr. den Krieg 1914, Unternehmungen und Aufwiegelungen gegen unsere Feinde, Afghanistan und Persien, Der Weltkrieg Bd. 1, Nr. 11e, Bl. 53 368 Telegrammwechsel AA – Oberkommando Aachen; PAdAA, R 21028 ebd. 369 Archiv des Deutschen Museums München, Firmenarchiv Mannesmann FA 009/149, ohne Datum 370 Das undatierte Typoskript, in dem Oppenheim für das Auswärtige Amt die Propagierung und Umsetzung eines „Heiligen Krieges“ in der islamischen Welt entwickelte, befindet sich im Hausarchiv des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie. Köln, Nachlass Max von Oppenheim Nr. 42. 371 Vgl. dazu Wolfgang G. Schwanitz, Max von Oppenheim und der Heilige Krieg. Zwei Denkschriften zur Revolutionierung der islamischen Gebiete. In: Sozialgeschichte Nr. 19 (2004), H 3, S. 28-59, dort bes. S. 31 ff.; Tilman Lüdke, Jihad made in Germany. Ottoman and German Propaganda and Intelligence Operations in the First World War, Münster 2005, S. 11 ff., 16 f., 31 ff.; Gottfried Hagen, German Heralds of Holy War: Orientalists and Applied Oriental Studies. In: Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 24/2 (2004), S. 149 ff.; Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht, S. 109 ff. 372 Ernst Jäckh (1875–1959), Publizist und Orientreisender; u.a. Herausgeber der Zeitschrift „Das Größere Deutschland“; während des Ersten Weltkriegs Mitarbeiter der Zentralstelle für Auslandsdienst des AA und Leiter der Zentralstelle zur Ausbeutung des Osmanischen Reiches. Vgl. dazu Klaus Thörner, „Der ganze Südosten ist unser Hinterland“, Diss. Oldenburg 2000, S. 252 ff. 373 PAdAA R 21028, Akten betr. den Krieg 1914, Consten an AA, datiert Berlin 20.8.1914. 374 Nach dem Abschluss seiner Mongolei-Mission war Korostovec als Gesandter Russlands nach Teheran entsandt worden. Er wurde im Februar 1915 von dort abberufen; vgl. PAdAA R 21035-1, A 5014, Wangenheim an AA, 8.2.1915. 375 Kohlhaas starb im Jahr 1914. 376 Den Kronenorden IV. Klasse hat Consten daraufhin umgehend erhalten. 377 Wie sehr Reinhard Mannesmann zur Diskretion neigte, beschreibt seine Tochter Ruthild Brandt-Mannesmann in ihrem Buch „Max Mannesmann, Reinhard Mannesmann. Dokumente aus dem Leben der Erfinder“. Remscheid 1964 S. 162. 378 PAdAA, R 21028, Akten betr. den Krieg 1914 Consten an AA ebd. 379 PAdAA R 21028, Telegrammentwurf Zimmermann an Preußische Gesandtschaft Hamburg, 19.8.1914 ; vgl. auch Renate Vogel, Die Persien- und Afghanistanexpedition Oskar
583
ANHANG 380 381
382
383
384 385 386
387
388
389 390
391
Ritter von Niedermayers 1915/16 (Diss. Münster 1972); veröffentlicht in: Studien zur Militärgeschichte, Militärwissenschaft und Konfliktforschung Band 8, Osnabrück 1975, S. 49 Vgl. Thörner, S. 232 ff. Ludwig Roselius (1874–1943), Gründer der Bremer Kaffeerösterei HAG mit weltweiten Geschäftsbeziehungen, die er auch politisch im Sinne seiner nationalkonservativen Überzeugungen zu nutzen verstand. 1917 wurde er zum Generalkonsul für Bulgarien ernannt. Er gehörte während der Weimarer Republik zum politischen Beraterkreis Hindenburgs und Stresemanns und sympathisierte mit dem Nationalsozialismus. Roselius machte sich auch als Mäzen einer nordisch-deutschen Kunst einen Namen und setzte sich mit der Bremer Böttcherstraße ein Denkmal. Zur Entstehungsgeschichte des Büros Mannesmann-Roselius s. Brandt-Mannesmann, S. 162; zu den Geheimaktivitäten des Büros s. Erhard Geissler: Biologische Waffen – nicht in Hitlers Arsenalen. Biologische und toxische Kampfmittel in Deutschland von 1915 bis 1945. Münster 1999, S. 101 ff. – Erbeutete Akten des Auswärtigen Amtes über Geheimaktivitäten von Mannesmann-Roselius in Bulgarien in den Jahren 1914–1916 (Weltkrieg 11.o.secr., Band 1-8) befinden sich in den National Archives in Kew bei London (Abk. NAK), GFM 21/389-390. Vgl. dazu Jürgen Elvert: Mitteleuropa! Deutsche Pläne zur europäischen Neuordnung. Stuttgart 1999, S. 36; Claudia Glunz et al. (Hrsg.): Information Warfare. Die Rolle der Medien bei der Kriegsdarstellung und Deutung der Kriegspropaganda: Historische Entwicklungen. Krieg und Literatur Vol. XIII/2006, Schriften des Erich-Maria-Remarque Archivs Osnabrück, S. 21; Erhard Geissler, S. 101 ff. ADMM, FA 009/168 Streng vertraulicher Bericht des Deutsch-Türkischen Komitees aus dem Jahr 1914 mit Vorschlägen für eine wirtschaftliche Modernisierung der Türkei nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. PAdAA R 21028-1, A 17312, Wangenheim an AA 14.8.1914. Dr. Alfred Zintgraff (1884–1967), Jurist und Regierungsrat, zeitweise deutscher Geschäftsträger in Addis Abeba, 1908/09 in Diensten Kaiser Meneliks II. Später NSDAPMitglied und Leiter der außenpolitischen Schulung des NS-Studentenbundes. Nach dem 2. Weltkrieg Konservator der Sammlung Goldschmidt in Heidelberg. Zintgraff an Zimmermann, 4.9.1914; NAK, GFM 19158 (AA-Beuteakte, Der Weltkrieg No. 11e, Aufwiegelungen gegen unsere Feinde.) Renate Vogel hat in ihrer Dissertation zwar ein Interesse, aber nicht eine Urheberschaft Mannesmanns am Expeditionsvorhaben in Erwägung gezogen; s. R. Vogel, Die Persien- und Afghanistanexpedition Oskar Ritter von Niedermayers, S. 145 ff. Eine vorzügliche Analyse der Ambivalenz der Kriegsentscheidungen aus der türkischen Perspektive bietet die Arbeit von Mustafa Aksakal: The Ottoman Road to War in 1914. The Ottoman Empire and the First World War. Cambridge University Press 2008. Schon 1918 hatte der US-Botschafter bei der Hohen Pforte, Henry Morgenthau, in seinen Memoiren “Ambassador Morgenthau’s Story” (New York 1918) die durch das deutsche Drängen zum Kriegseintritt hervorgerufenen inneren Spannungen im türkischen Kabinett ausführlich, wenn auch recht einseitig beschrieben. BA/MA, RM 40-456, Bl. 371, Humann an Souchon 22.4.1915; zit. n. Aksakal, S. 17 PAdAA R 21028-1, A 10940 (Abschrift) v. 4.8.14, Wünsche des Großen Generalstabs betr. Persien: „Persien ist aufzufordern, die günstige Gelegenheit zu benutzen, das russische Joch abzuschütteln und wenn möglich gemeinsam mit der Türkei vorzugehen.“ Vgl. auch Carl Mühlmann, Das deutsch-türkische Waffenbündnis im Weltkriege, Leipzig 1940, S. 69 ff. und 267 f. Neben der bekannten älteren Memoirenliteratur wurden folgende Untersuchungen zur Vorgeschichte des deutsch-türkischen Militärbündnisses und zum Eintritt der Türkei an der Seite des Deutschen Reiches in den Ersten Weltkrieg herangezogen: Lothar Rathmann, Stoßrichtung Nahost 1914-1918. Zur Expansionspolitik des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg. Berlin 1963; Ulrich Trumpener, Germany and the Ottoman
584
ANMERKUNGEN
392 393
394
395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405
406 407 408 409 410
Empire 1914–1918. Princeton 1968; Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht. Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18. Düsseldorf 1977; Mustafa Aksakal, The Ottoman Road to War in 1914. Cambridge 2008, Sean McMeekin, The Berlin-Baghdad Express. The Ottoman Empire and Germany’s Bid for World Power. Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2010. PAdAA R 21028-1, Sitzungsprotokoll Nr. 3: „Die Oberaufsicht über die Ausrüstung wird Herrn Mannesmann übertragen, die Instradierung wird vom Auswärtigen Amt in die Wege geleitet werden.“ Dem Ziel, den Einfluss der Hauptrivalen des Deutschen Reiches in dieser Region einzudämmen, diente bereits der Bau der 1903 begonnenen Bagdad-Bahn. Sie sollte eine direkte Verbindung zwischen Berlin und Basra herstellen und damit die nötige Infrastruktur für die Erschließung der dort vermuteten reichen Bodenschätze durch deutsche Firmen schaffen. Doch war das Bauvorhaben bei Kriegsausbruch längst nicht abgeschlossen. PAdAA R 21028, A 17312, Wangenheim an AA 14.8.1914; ADMM, FA 009/168 v. 12.9.1914, Gesprächsnotiz Reinhard Mannesmann: „Er (Direktor H. Schönleder, Deutsche Orientbank), hätte schon von allen Seiten in Konstantinopel gehört, dass die Türken schon vor einiger Zeit Emissäre nach Ober-Ägypten, dem Sudan, nach Arabien, in den Kaukasus und selbst nach Indien und China geschickt hätten, um eine eventuelle Erhebung vorzubereiten.“ PAdAA R 21028-1, Botschaft Stockholm an Zimmermann 25.8.1914. Dass eine solche Kontaktnahme nicht stattgefunden hat, ist in der Dissertation von Renate Vogel (S. 55) belegt. Sven Hedin, Zu Land nach Indien durch Persien, Seistan und Belutschistan. 2 Bde., Leipzig 1910. PAdAA R 21028-1, Botschaft Stockholm an AA, 25.8.1914 PAdAA R 21028-1, Entwurf Schreiben Expeditionskommission an Wangenheim, 26.8.1914 PAdAA R 21028-1, Wangenheim an Zimmermann 30.8.1914 PAdAA R 21028, Schreiben Holtzendorff an v. Prittwitz, 6.9.1914; später erklärte Holtzendorff jedoch im Zusammenhang mit der Beschwerde Constens bei R. Mannesmann vom 2.10.14 gegenüber Wesendonck, die Frage der Führerschaft sei seinerzeit gar nicht berührt worden. „Irgendwelche Zusagen seien seines Wissens weder Consten noch anderen Mitgliedern der Expedition gemacht worden.“ (PAdAA, handschriftl. Vermerk Wesendonck zu A 26491 und A 26517) PAdAA R 21031-2, A 27438, Niedermayer an Oppenheim, 2.10.1914, Abschrift für AA. PAdAA R 21029, A 22320; Oppenheim an stellv. Kriegsminister 15.9.14, Durchschrift für AA. Gemeint ist das an Afghanistan angrenzende Russisch-Turkestan, heute Usbekistan; D.G. PAdAA R 20936 Russland 104 Nr. 11, A 23666; handschriftliche Gesprächsnotiz Wesendonck vom 22.9.14. PAdAA R 21028-1, zu A 19593. Handschriftlicher Entwurf Jagow an Bethmann Hollweg (Generalhauptquartier) v. 30.8.14 mit Anlage des Schreibens v. Böttinger, v. Loeben und Reinhard Mannesmann an Jagow vom 28.8.14 (Anfrage zur rechtlichen Stellung der Expeditionsteilnehmer). Antwort Reichskanzler an AA vom 2.9.14; vertragliche Zusagen an die Teilnehmer vom 3.9.14. ADMM FA 009/168, Angebot der Gewehrfabrik Ernst Steigleder (Berlin) an Reinhard Mannesmann, 1.9.1914 PAdAA R 21028-2, Personalbogen Afganistan-Expedition. Schon 1912 war Consten ein Teil des väterlichen Erbes nur deshalb ausgezahlt worden, um allfällige Schulden zu begleichen. Vgl. geheimdienstliche Auskunft über Consten für Oberst Max Ronge ÖHHStA, Kriegsarchiv, Nachlass Ronge, NL B/126:4, Bl. 156. PAdAA R 21028-1, handschriftlicher Entwurf einer vertraglichen Vereinbarung mit den
585
ANHANG Expeditionsteilnehmern und Sitzungsprotokoll vom 3.9.1914 411 PAdAA R 21029, A 22087, Bl. 53 ff., Oppenheim an AA 17.9.1914. 412 Endgültige Fassung des Handschreibens: PAdAA, Weltkrieg 11 e adh., A 10454 413 PAdAA R 21029-1, A 22012, Wangenheim an AA 13.9.1914. Wangenheim fügte noch etwas verwundert an: „Die Teilnehmer scheinen von der Voraussetzung auszugehen, dass die Türkei eine offizielle militärische Expedition ausrüste, an der Deutsche in Offizierseigenschaft teilnehmen. Solange sich die Türkei mit England nicht im offenen Kriegszustande befindet, würde die Mission nach türkischer Auffassung alles unnötige Aufsehen, daher auch Betonen ihres militärischen Charakters zu vermeiden haben. Eine Aufnahme deutscher Teilnehmer in die Türkei ist türkischerseits bisher nicht erwogen.“ 414 PAdAA R 21029-1, zu A 21795, Prittwitz an Innenministerium betr. Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung für die Firma Mannesmann nach Budapest. „Die Sendung (1 Waggon“) wird deklariert als „Maschinenteile“. Im Anhang werden neben den „Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen für eine Expedition für 6 Herren, div. Bücher, wissenschaftl. Werke und Karten“, Reitsätteln, Messinstrumenten und einer kompletten medizinischen Ausrüstung noch folgende Waffen aufgeführt: „Zwei Maschinengewehre mit 100.000 Patronen, 17 Gewehre mit 4.100 Patronen, 20 Mausergewehre mit 30.000 Patronen, 20 Faschinenmesser.“ 415 Zu den Wanderungsbewegungen der Reitervölker vgl. Michael Weiers, Aufbruch der Reitervölker – Das Weltreich Čingis Chaans. In: Udo B. Barkmann (Hrsg.) Čingis Chaan und sein Erbe. Das Weltreich der Mongolen. (Konferenzmaterialien des DAAD und der DFG anlässlich der Čingis-Chaan-Ausstellung in Bonn 2005), Mongolisch und Deutsch, Ulaanbaatar 2007, S. 259 ff. 416 PAdAA R 21029-2, A 23117 und A 23217, Generalkonsulat Budapest an AA, 20. und 21.9.14. 417 PAdAA R 21029-2 zu A 23217, Mannesmann Mulag an Schenker Budapest, 23.9.14. 418 Gemeint ist der deutsche Konsul in Bukarest, v. d. Bussche; D.G. 419 PAdAA R 21029-2, A 24390, Konsulat Bukarest an AA 23.9.14 mit Bestätigung der Auszahlung von 500 Lei; im Anhang Constens Schreiben an Wesendonck v. 22.9.14. 420 Ebd. 421 In der Firmenakte Mannesmann (Archiv des Deutschen Museums München) fand sich die Kopie eines Schreibens von Reinhard Mannesmann an das AA vom 31.8.1914, das unter Bezugnahme auf eine entsprechende „Geheimordre“ an Roselius, rumänischen Politikern für den Fall des Kriegseintritts gegen Russland „weitergehende Geldzusagen“ zu machen, ein chiffriertes Telegramm von Roselius aus Bukarest zum Stand der Dinge in Klartext weiterreicht. Darin heißt es u.a.: „Geldablieferungen bisher aus eigenem Bestande vorgenommen. Sobald wir euren Vorrat brauchen, geben Nachricht.“ ADMM FA 009/168. 422 ADMM FA 009/168 423 PAdAA R 21029-3, A 25369, Konsulat Bukarest an AA, 5.10.1914; Wiedergabe einer entsprechenden Information durch Roselius; R 21035-1, A 4516 Roselius an Bergen 3.2.1915, Schilderung seines diesbezüglichen Gesprächs mit Consten in Bukarest. 424 PAdAA R 21029-1, A 21403, 10.9.1914, Kostenaufstellung „Konto Fritz“ 425 PAdAA R 21031-1, A 26517 Consten an Mannesmann 2.10.1914 (Abschrift) 426 Der Bahnhof Sirkeci wurde nach Plänen August Jasmunds 1890 im Duktus des europäischen Orientalismus errichtet. 427 PAdAA R 21031-1, A 27546 Wassmuss an Bethmann Hollweg, datiert Tarsus 1.10.1914 428 PAdAA R 21031-1, A 26491, Wangenheim an AA, Notizen von Herrn Consten 10.10.1914 429 PAdAA R 21029-2, A 32934, Wangenheim an AA, 25.9.1914. 430 PAdAA R 21029-2, A 23943, Steinwachs an AA, 25.9.1914. 431 PAdAA R 21029-2, A 25733, Bussche an Wangenheim, 8.10.14, mit Bezugnahme auf ein Telegramm Roselius an Consten vom 26.9.14. Später bekannte Roselius, dass er für seine Information eine ihm „durch Indiskretion bekanntgewordene gehässige Äußerung des
586
ANMERKUNGEN
432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
445 446 447 448
449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
460
rumänischen Finanzministers Costinescu, den Zentralmächten und der Türkei das Getreide zu entziehen“, benutzt habe, um die Dringlichkeit seines Anliegens zu unterstreichen. „Consten hat mein Telegramm an Enver Pascha übergeben. Enver Pascha hat vier Stunden später die Dardanellen geschlossen.“ siehe PAdAA R 21035-1, A 4516 v. 3.2.1915. PAdAA R 21031-1, A 26517, Consten an R. Mannesmann, 2.10.1914 Henry Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story, Chapter IX; zit. nach der Online-Version: http://net.lib.byu.edu/estu/wwi/comment/morgenthau/Morgen09.htm; Übersetzung des Zitats durch die Autorin. Ebd. PAdAA R 21035-1, A 4516, Schreiben Roselius v. 3.2.1915. PAdAA R 210231-1, A 26211, Wangenheim an AA 10.10.1914 Vgl. EN 400 PAdAA R 21029-1, A 24609, mit Randvermerk Wesendonck: Films wird die Firma Mannesmann besorgen und nach ... unfrei senden. PAdAA R 21031-1, A 26491, Botschaft Constantinopel, Notizen von Herrn Consten, 10.10.1914 PAdAA R 21031-1, A 26517, Consten an Mannesmann, 2.10.1914 Vgl. Aksakal, S. 16 f. und 138. HBO, NL MvO/42; Kopie des Typoskripts. PAdAA R 21031-1, A 26491, Notizen von Herrn Consten, 10.10.1914 Consten-Vortrag über Mesopotamien vermutl. 1921 in Berlin. Im Nachlass befindet sich ein handgeschriebenes Manuskript; darin deutet er an wenigen Stellen an, dass er das Land auch persönlich bereist hat, nimmt aber keinerlei Bezug auf den Kriegszusammenhang; D.G. Vgl. Pomiankowski, S. 184 PAdAA R 21031-2, A 27438, Niedermayer an Oppenheim, datiert Pera 2.10.1914 (Abschrift) Ebd. Vgl. Ulrich Gehrke, Persien in der deutschen Orientpolitik während des Ersten Weltkrieges. Darstellungen zur Auswärtigen Politik Band 1 (II), Stuttgart o.J. (1960), Anhang B, Fußnote 23. Tatsächlich stellte sich heraus, dass mit den Teilnehmern des ursprünglichen deutschen Kontingents nicht einmal rechtskräftige Verträge geschlossen worden waren; vgl. PAdAA R 21032-1, Bl. 62, Notiz AA, 20.11.1914. PAdAA R 21031-2, A 27730, Niedermayer an Wesendonck, 18.10.1914 PAdAA R 21031-2, A 27546, Wassmuss an Bethmann Hollweg 1.10.1914 (Kopie mit handschriftlichen Streichungen bzw. Einklammerungen von Constens Doktortitel) PAdAA R 21031-2, A 27544 Wangenheim an AA 15.10.1914 PAdAA R 21031-2, A 28270, K.u.K. Außenministerium an Bethmann Hollweg, 19.10. 1914 PAdAA, R 21030-2, Vermerk Zimmermann zu A 25733 In dem diesbezüglichen Depeschenwechsel sind die Währungsangaben mal in Mark, mal in Francs, an einer Stelle sogar in Lei; vielleicht liegt hier die Ursache für spätere Differenzen hinsichtlich der jeweiligen Umrechnungsbeträge; D.G. PAdAA R 21031-1, A 26211, Wangenheim an AA, 10.10.1914. Umgerechnet entspräche sie heute ca. € 14 Mio.; D.G. König Carol I. von Rumänien, ein Hohenzoller, war am 10. Oktober 1914 plötzlich verstorben. PAdAA R 2103, A 26670, Konsulat Bukarest an AA, 14.10.1914 PAdAA R 21031-3, A 28217, Wangenheim an AA, 26.10.1914; mit Randvermerk Zimmermann: „Sofort mit Herrn Mannesmann zu besprechen“ und Randvermerk Wesendonck: „Mit Herrn Steinwachs besprochen, der die erforderliche Auskunft beschaffen will. Bitte hierzu noch das Schreiben Constens über sich selbst beifügen.“ (Gemeint war Constens Bewerbungsschreiben an das AA vom August 1914, D.G.) d. i. Ludwig Roselius; D.G.
587
ANHANG 461 BA/MA RM 40/659, Akte Consten, ehemals Geheimakte der Admiralität PG/60815/NID. Die Schreiben sind jeweils im Original, in mehreren Abschriften sowie in französischer Übersetzung enthalten. Nr. 1. Original maschinenschriftlich mit Unterschrift Consten und Datum Bukarest 17/10 in Bleistift. Mit amtlichem Vermerk: Für Herrn Korvettenkapitän Humann. 462 BA/MA RM 40/659 Nr. 2, 23.10.1914 463 d. i. Ludwig Roselius; D.G. 464 BA/MA R 40/659 Nr. 4, Konsulat Bukarest an Botschaft Konstantinopel, mit Vermerk: Telegramm von Consten an Humann für Ismail Hakki Pascha, 5.11.1914 465 Ebd. 466 BA/MA R 40/659 Nr. 6, Consten an Bussche 9.11.1914; darunter Rotstift-Vermerk: Flotte mitgeteilt. 467 Karl Emil Schabinger von Schowingen (1877–1967) Diplomat und Orientalist. Enger Mitarbeiter Max von Oppenheims und ab 1915 sein Nachfolger als Leiter der „Nachrichtenstelle für den Orient“ in Berlin. 1918–1924 Leiter der Orientabteilung des Auswärtigen Amtes. Memoiren: Weltgeschichtliche Mosaiksplitter. Erinnerungen eines kaiserlichen Dragomans (1967) 468 PAdAA R 21031-4 A 30801, Gesandtschaft Bukarest an AA; A 30840, Gesandtschaft Bukarest an AA, 14.11.1914; A 31509 Telegrammentwurf Wesendonck an Gesandtschaft Bukarest, 15.11.1914. 469 Vgl. M. Friese, St. Geilen (Hrsg.) Deutsche in Afghanistan. Die Abenteuer des Oskar Ritter von Niedermayer am Hindukusch. (Reprint der Originalausgabe von 1925), Köln 2002, S. 23 470 PAdAA R 21032-2 Bl. 56, AA an Botschaft Konstantinopel, Nov. 1914. 471 PAdAA R 21032-2, A 33444 Wangenheim an Wesendonck, 4.12.1914, ebd. Oppenheim an AA, 5.12.1914. 472 PAdAA R 21035-1, A 4516, Consten an Roselius, datiert Aleppo 30.12.1914. 473 Reuf Bey (Hüseyin Rauf Orbay; 1881–1964) Absolvent der Marine-Akademie in Konstantinopel; während des Balkan-Kriegs Kapitän des Kreuzers Hamadiye. Während des 1. Weltkriegs Sondergesandter Enver Paschas in Afghanistan, Kommandeur der Iran-Front, Stabschef der Osmanischen Marine. 1917 leitete er die türkische Delegation bei den Verhandlungen mit Russland über den Austausch von Kriegsgefangenen in Kopenhagen; 1918 Mitglied der türkischen Delegation bei den Friedensverhandlungen von Brest-Litovsk. Oktober 1918 Marineminister. 474 Friedrich Frh. Kress von Kressenstein (1870–1948), Angehöriger der deutschen Militärmission in Konstantinopel, während des 1. Weltkriegs Stabschef des VIII. türkischen Armeekorps und Oberkommandierender der Palästina-Truppen. 1918 Kommandant der deutschen Militärmission im Transkaukasus. 475 PAdAA R 21035-1, A 4516 Consten an Roselius 30.12.1914 476 Ebd. 477 Ebd. 478 PAdAA R 21034-1, Anlage z. A 1438, Paschen an Mannesmann, datiert Aleppo 29.12.1914 479 Consten an Roselius, ebd. 480 Consten an Roselius, ebd. 481 NAK WO 106/52 Frederick Diary. Chronologische Zusammenfassung durch den britischen Übersetzer. Die Reisejournale einiger deutscher Expeditionsmitglieder waren bei deren Verhaftung in Persien 1916 in die Hände des britischen Auslandsgeheimdienstes gelangt. 482 Herauszufinden, welchen militärischen Rang Hermann Consten, der von sich selbst behauptete, er sei ein türkischer Major gewesen, tatsächlich bekleidet hat, erwies sich trotz tatkräftiger Recherchehilfe seitens der beiden türkischen Historiker Prof. Sinan Kuneralp (Istanbul) und Dr. Mustafa Aksakal (Washington D.C.), denen ich hiermit nochmals ausdrücklich danke, als außerordentlich schwierig. Eine ins Internet gestellte Rangliste
588
ANMERKUNGEN
483 484 485
486
487
488 489 490 491 492 493 494 495 496 497
498 499
500 501 502 503
schwedischer und deutscher Offiziere in türkischen Diensten wies Hermann Consten als Teğmen aus, was in etwa unserem Leutnant entspricht. Vgl. http://forum.axishistory.com, Full List of the Swedish Officers in Ottoman Army. Consten will den Majorsrang im Jahr 1915 erhalten haben; dies wurde jedoch 1918 auf eine entsprechende Anfrage des ungarischen Außenministeriums von offizieller türkischer Seite dementiert. PAdAA R 21034-1, A 1438, Wangenheim an Bethmann Hollweg, 4.1.1915; A 1183, Wangenheim an AA, 10.1.1915. PAdAA R 21034-1, A 1247, Wassmuss an Wangenheim, 11.1.1915 Der Verlauf der Reise von Aleppo nach Bagdad stützt sich chronologisch auf die in den National Archives in Kew unter WO 106/52 aufbewahrten Tagebücher von Fredrich und Griesinger, die 1916 von britischen Agenten in Persien erbeutet wurden. Constens eigene Journale der Afghanistan-Expedition existieren nicht mehr. Sie waren zusammen mit anderen geheimen Unterlagen aus den Weltkriegsjahren nach Eisenach gelangt und wurden nach der Übergabe Thüringens an die Rote Armee 1945 von der Hüterin seiner Schätze, Grete Jacobi-Müller, vernichtet, um sie dem Zugriff des sowjetischen Militärgeheimdienstes zu entziehen. PAdAA R 21035-1, A 4516, Roselius an v. Bergen (AA), 3.2.1915; dazu als Anlage Constens Schreiben, datiert Aleppo 30.12.1914; außerdem eine handschriftliche Stellungnahme v. Bergen für Wesendonck; handschriftlich Wesendonck, Entwurf Depesche an Wangenheim mit Korrekturen Zimmermann. PAdAA, R 21037, A 8555, Wangenheim an Bethmann Hollweg, 28.2.1915. Wangenheim fügte der Information ein Dementi an, dass er Consten zweckbestimmte Gelder für Bestechung gegeben hätte. Es habe sich um reguläre Mittel aus dem Expeditionsfonds gehandelt. PAdAA R 21038-3, Niedermayer an Wangenheim, 6.3.1915. PAdAA R 21038-3, Vermerk Wesendonck zu A 9519. PAdAA R 21038-3, A 11672, Wangenheim an Bethmann Hollweg, mit Anhang Konsulat Bagdad an Wangenheim, 6.3.1915, Bericht über Consten. Konsulat Bagdad an Wangenheim, ebd.; die Schilderung der vorangegangenen Szene ist eine Paraphrase des amtlichen Berichts über Constens Austritt aus der Expedition. Konsulat Bagdad an Wangenheim, ebd. Zu den Persienplänen des Deutschen Reiches vgl. Pomiankowski, S. 150 f.; Gehrke, S. 54 ff. Vgl. PAdAA R 21042-2, A 16402, Kopie eines Berichts von Prof. Sarre (aus Bagdad) für Nadolny, stellv. Generalstab, III b vom 20.4.1915 PAdAA R 21037-2, A 8909, Wangenheim an AA, 11.3.1915. Werner Otto von Hentig (1886–1984). Vor dem 1. Weltkrieg Attaché in Peking, Konstantinopel und Teheran. 1915–1917 Mitglied der Afghanistan-Expedition Niedermayers, nach Ausweisung der Gruppe Flucht durch Zentralasien nach China. Vgl. u.a. NAK KV 2/393 (Information und Personenbeschreibung Werner Otto von Hentig); CAB 37/132/10-14 (Information über deutsche Agenten in Persien); CAB 37/139/66 (Information vom 30.12.1915 über Ankunft der Deutschen in Afghanistan); WO 106/946 (German Parties in Persia and Afghanistan). Im privaten Nachlass existiert ein von Heinz Munz geschaffenes Ölgemälde, das Hermann Consten in türkischer Feld-Uniform auf der Saglavi-Stute zeigt. Die Beschreibung basiert auf dem Bericht eines deutschen Soldaten, der 1917 das JesidenHeiligtum besucht hat. BA/MA MSg 3/1780, Mitteilungen des Bundes der Asienkämpfer Jg. 17/6, S. 68 f. Constens eigene Aufzeichnungen sind vernichtet. Doch finden sich Anklänge an diesen Ort in seinem Roman „Der rote Lama“. PAdAA R 21038-1, A 11672, Wangenheim an Bethmann Hollweg, 25.3.1915. Dazu handschr. Vermerk Wesendonck: Herr Steinwachs ist bezüglich Constens orientiert worden. Zur Stimmungslage in Konstantinopel s. Pomiankowski, S. 147 ff. PAdAA R 21040-1, A 12447, Wangenheim an AA, 9.4.1915. Ebd.
589
ANHANG 504 PAdAA R 21040-2, A 12618, Dahme an AA, April 1915 505 Ebd., Antwort an Dahme handschriftl. Vermerk Wesendonck 19.4.1915, mit einem weiteren Vermerk über Einstellung der Zahlungen. 506 PAdAA R 21038-3, A 11681 Wangenheim an Bethmann Hollweg, 26.3.1915; Weiterleitung eines Telegramms des Prinzen Reuß aus Bagdad vom 21.3.15, in dem er über Niedermayer berichtet, dieser habe seine Gruppe „nach Ausmerzung ungeeigneter Elemente“ nun fest in der Hand. 507 Colmar v. d. Goltz (1843–1916) Generalfeldmarschall, Militärhistoriker und Schriftsteller; Reformer des osmanischen Heeres. 1914 Generalgouverneur des besetzten Königreichs Belgien. 1915 Militärberater des Sultans und Oberkommandierender der 6. Osmanischen Armee in Mesopotamien. Sieger der Schlacht von Kut-el-Amara gegen die Briten. Starb im April 1916 in Bagdad an Typhus. 508 PAdAA R 21035-1, A 4532, v d. Goltz an Zimmermann, Konstantinopel 13.1.1915 509 PAdAA R 21038-2, A 10701, Bl. 142, Vermerk Wesendonck v. 28.3.1915 510 Zur geheimen Militärexpedition Rabe von Pappenheims vgl. Jürgen W. Schmidt, The Diversionary Operation of a German Military Attache in China in 1915. In: International Intelligence History Study Group – Newsletter 7.2, S. 25-27. Ders.: Die Beschaffung geheimer Informationen durch amtliche Einrichtungen des Deutschen Reiches in China 1896–1917. In: Spakowski, Milwertz et al., Women and Gender in Chinese Studies. Berliner China-Hefte, Vol. 29, S. 102-120. Münster 2006. 511 PAdAA R 21035-1, A 4353, Botschaft Stockholm an AA, 3.2.1915; Weiterleitung eines Telegramms des Gesandten von Hintze aus Washington. Der damals an der Botschaft in Washington als Attaché tätige W. O. v. Hentig sollte seinerzeit die Leitung der Zentralstelle in Shanghai übernehmen, traf aber erst 1917 dort ein. Vgl. EN 496 512 PAdAA 21038-2, A 10701, Bl. 143 AA an Schatzamt v. 28.3.1915. 513 PAdAA R 21041-1, A 13229, Wangenheim an AA, 16.4.1915 514 Zur Neuorientierung der deutschen Persienpolitik s. Gehrke, S. 60 ff. 515 Vgl. PAdAA R 21042-2, A 15793, Wangenheim an AA, 12.5.1915 516 Vgl. PAdAA R 21042-2, A 16402, Sarre an Nadolny, Bagdad 20.4.1915. Sarre berichtete u.a., nur Landlose würden den Zwangsrekrutierungen Folge leisten, die Wohlhabenderen würden sich freikaufen. Christen und Juden im Irak sehnten ein baldiges Ende der türkischen Herrschaft herbei, nachdem die britischen und französischen Missionsstationen geschlossen worden seien. Auch aus Zentral-Arabien werde völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem „Heiligen Krieg“ gemeldet. Sarre unterrichtete Nadolny ferner vom Selbstmord Suleiman Askeri Beys nach dem Zusammenbruch der rechten Flanke der Sechsten Armee bei Basra. 517 PAdAA R 21028-3; handschriftl. Vermerk Wesendonck zu A 9519 vom 1.4.1915. 518 Prinz Heinrich XXVII. Reuß (jüngere Linie) (1858–1928), General der Kavallerie. Regierender Fürst bis 1918. 519 D. Totchkoff, Abgesandter des nationalrevolutionären Mazedonischen Komitees. Er stand in Verbindung mit dem Büro Mannesmann-Roselius und lebte nach der Kapitulation Bulgariens 1918 in Berlin. Vgl. EN 525 520 PAdAA R 21042-1, A 15636, Consten an Roselius, Konstantinopel 16.4.1915 521 Die kleine Messingplatte mit dem in Spiegelschrift eingravierten Namen Hermann Consten Bey befindet sich im privaten Nachlass Constens, Sgl. Strölin 522 Pomiankowski, S. 109 523 PAdAA R 21042-1, A 15636 Wangenheim an Bethmann Hollweg, 5.5.1915 524 Zum türkisch-bulgarischen Verhältnis im 1. Weltkrieg vgl. Gerard E. Silberstein, The Troubled Alliance. German-Austrian Relations 1914 to 1917, Lexington (Kentucky) 1970, S. 119 ff.; Aksakal, S. 113 ff. 525 Im Firmenarchiv Mannesmann, Deutsches Museum München, fand sich in der Akte FA 009/168 (Politische Lage in diversen Ländern, Korrespondenz mit Ludwig Roselius) folgende Notiz Reinhard Mannesmanns zu Totchkoff: „Dr. Totchkoff, der Abgesandte des
590
ANMERKUNGEN
526 527 528 529 530 531
532 533 534 535 536 537 538 539
540 541 542 543 544 545 546 547 548 549
Mazedonischen Komitees, äußerte uns gegenüber, er glaube, dass Bulgarien neutral bleiben werde, dass ein Vorgehen Bulgariens an unserer Seite möglich sei, wenn wir mit deutsch-österreichischen Truppen in Serbien einfallen und die Verbindung mit Bulgarien hergestellt hätten. Für Letzteres scheinen momentan keine Truppen unsererseits verfügbar zu sein. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einer sofortigen anderweitigen Aktion, um die Massen in Bulgarien nicht in ein für uns zu feindliches Fahrwasser gelangen zu lassen. Die Mazedonier scheinen uns treu zu sein, sind aber wegen ihrer geringen Zahl (jetzt 15.000, später 25.000 Mann ausgerüstet) nur ein, nicht der bestimmende Faktor. Immerhin können sie zur Anfachung des Brandes sehr nützlich sein.“ Constens Erwähnung von Informationen Suleiman Askeri Beys für Totchkoff deutet ferner auf Verbindungen der osmanischen Geheimorganisation Teşkilat-ı-Mahsûsa mit dem Mazedonischen Komitee. PAdAA R 19996-1, A 21490, Fürstenberg an Bethmann Hollweg, 13.7.1915 Die Angabe ist enthalten in einem streng vertraulichen Bericht aus Budapest über Hermann Consten; Nachlass des österreichisch-ungarischen Geheimdienstchefs Max Ronge, ÖHHStA/Kriegsarchiv Karton 3670, Nabt. Na 13428 Zu den Kriegsnachrichtenstellen auf dem Balkan s. Generalmajor a.D. Gempp „Geheimer Nachrichtendienst und Spionageabwehr des Heeres“ (sog. Gempp-Bericht) Band 4, Bl. 115 f. und Bl. 245, Band 7, S. 35 f., S. 106. BA/MA RW 5/v. 43 und 47 PAdAA R 19995-1, A 21177, Fürstenberg an Bethmann Hollweg, 9.7.1915 PAdAA R 19999-3, A 22573, Consten an Bethmann Hollweg, 27.7.1915 (Weiterleitung durch das Generalkonsulat Budapest) PAdAA R 20000-2, A 23268, Consten an Bethmann Hollweg, 3.8.1915 (Weiterleitung durch Generalkonsul v. Fürstenberg mit dem Vermerk, eine Kopie des Telegramms sei direkt an den Karlsruher Polizeipräsidenten geschickt worden; handschriftl. Randvermerk der Reichskanzlei: Pa 9/8.15 Abt. III erg. vorgelegt z.g.K. Der Vorgang enthält Nachrichten, die für die Militärbehörde von Interesse waren.) PAdAA R 20007-1, A 25718, handschriftliche Notiz Pannwitz an Pourtalès, datiert Pera 1.9.1915 PAdAA R 20008-1, A 26027, Fürstenberg an AA, 4.9.1915 PAdAA R 20008-3, zu A 26027, AA an Botschaft Konstantinopel, 6.9.1915 PAdAA R 20009-1, A 26440, Hohenlohe an AA, 9.9.1915 Ebd. PAdAA R 20010-1, zu A 26440, Pannwitz an Fürstenberg, 13.9.1915 Abkürzung für Nachrichtenoffizier Budapest; D.G. PAdAA R 19999-1, A 22392, Fürstenberg an Bethmann Hollweg 26.7.1915: „Eurer Exzellenz beehre ich mich anliegend einen weiteren Bericht des Herrn Hermann Consten über die Lage in Russland mit der Bitte zu überreichen, mich hochgeneigtest mit Weisung versehen zu wollen, ob auf die fernere Vorlage der Berichte Wert gelegt wird.“ Die Zählung der Consten-Berichte erfolgte anhand der im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes im Original oder in Kopie noch vorhandenen Dokumente, die die Verfasserin einsehen konnte. Insgesamt können es auch mehr gewesen sein. PAdAA R 20032, A 35463, Consten an Oberste Heeresleitung, 6.12.1915 PAdAA R 20002, A 23983, Consten an Bethmann Hollweg, 12.8.1915 PAdAA R 20005, A 22507, Consten an Bethmann Hollweg, 23.8.1915 PAdAA R 20028, A 33831, Consten an OHL, 19.11.1915, telefonisch aus Predeal „durch nicht erprobten Vertrauensmann“. PAdAA R 20031. A 34955, Consten an OHL, 30.11.1915 PAdAA R 20029, A 34470, Consten an Bethmann Hollweg, 24.11.1915 PAdAA R 20015-3, A 28615, Oberste Heeresleitung an AA, ohne Datum. BA/MA RW 5/v., Gempp-Bericht Band 7, S. 35; zur Neugliederung von IIIb daselbst Bd. 10, S. 3. Gempp-Bericht, Teil II, 7. Abschnitt, S. 2 (Anlage 10 zu S. 102)
591
ANHANG 550 Alsdorf im Weltkriege 1914–1918. In: Albert Krämer et al., Alsdorf – Geschichte einer Stadt, Kap. 10.07, S. 4 ff. 551 Im Wesentlichen war dies auch der allgemeine Kenntnisstand über Constens Rolle im 1. Weltkrieg bis ins Jahr 2002, als die Verfasserin erstmals Einsicht in die Consten-Akten im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes nehmen konnte. 552 Lt. Anweisung der Abteilung IIIb, Brose an den Innenminister der Rheinprovinz, 5.1.1915, Landesarchiv NRW, Akten des Regierungspräsidiums Aachen, Nr. 1157, Bl.326 553 Patentanträge und -genehmigungen samt diesbezüglicher Korrespondenz befinden sich im Archiv des Deutschen Museums in München; D.G. 554 ADMM, FA 009/149 555 ADMM, FA 009/31 556 ADMM, FA 009/35, zit. nach N.N., Max Mannesmann. Ein deutscher Ingenieur und Erfinder. Bergisches Wirtschaftsblatt 6/1940 557 ADMM, FA 009/166. vgl. auch Memoirs of Michael Karolyi. Faith without Illusion, London o.J., S. 92 zu Hermann Consten: “He was the head of the German Military Intelligence, camouflaged as a commercial representative in Budapest.” 558 Jenö Rákosi (Eugen Kremsner 1842–1929). Schriftsteller, Dramenautor und Publizist. Mitglied des Magnatenhauses seit 1902. In der von ihm gegründeten Zeitung Budapesti Hirlap vertrat er nationalkonservativ-chauvinistische Ideen. Constens Bekanntschaft mit Rákosi ist belegt durch eine streng vertrauliche Auskunft des k.u.k. Generalstabschefs in Budapest an den Chef des Evidenzbüros in Wien, Oberst Max Ronge v. 25.5.1918; ÖHHStA/Kriegsarchiv, Karton 3670, Nabt. Na 13428. 559 Vgl. Paul Lendvai, Die Ungarn. Eine tausendjährige Geschichte. München 2001, S. 345 ff., 370 ff. 560 In etwa sind sie deckungsgleich mit den turksprachigen Völkern. 561 Zur Deutsch-Asiatischen Gesellschaft s. Jürgen Kloosterhuis, Friedliche Imperialisten. Deutsche Auslandsvereine und auswärtige Kulturpolitik 1906-1918. Teil I, S. 713 562 Vgl. Gergely Varga, Ungarns Platz unter der Sonne. In: Wlodzimierz Borodziej (Hrsg.), Option Europa – Deutsche, polnische und ungarische Europapläne des 19. und 20. Jahrhunderts. Band 3, Göttingen 2005, S. 218. 563 Varga ebd. 564 Vgl. Michael Graf Károlyi, Gegen eine ganze Welt. Mein Kampf um den Frieden. München 1924, S. 332 565 Vgl. dazu Gotthard Jäschke, Der Turanismus der Jungtürken. Zur osmanischen Außenpolitik im Weltkriege. Leipzig 1941, u.a. S.11 ff., S. 18 f., S. 22. 566 Pál Graf Teleki de Szék (1879–1941) gehörte nach dem Ende des 1. Weltkriegs zur ungarischen Delegation bei den Friedensverhandlungen in Versailles. 1920/21 amtierte er unter Horthy als Ministerpräsident. Überzeugter Nationalist und Antisemit; nach dem Anschluss Österreichs 1938 an das Deutsche Reich kämpfte er vehement für den Erhalt der nationalen Autonomie Ungarns. 1941 nahm er sich das Leben. Teleki war außerdem einer der Führer der ungarischen Pfadfinderbewegung. 567 Imre Graf Károlyi (1873–1943), Präsident der Ungarischen Bank und Handels AG, einer Budapester Privatbank, die 1890 mit französischem und belgischem Kapital gegründet worden war. Unter den sechs bedeutendsten Banken Ungarns war sie die kleinste; gemessen am Profit stand sie allerdings an dritter Stelle. Vgl. Thomas Barcsay, Banking in Hungarian Economic Development 1867–1919. In: Business and Economic History, 2nd series, vol. 20 (1991), p. 219 f. Laut Mihály Károlyi stammte ein Gutteil des Bankvermögens aus Einnahmen von Bestechungsgeldern und Kriegsgeschäften. Vgl. Károlyi, Gegen eine ganze Welt, S. 315. 568 Hermann Consten, Reisejournale Mongolei-Expedition 1928–1929 (Hrsg. Doris Götting), unveröffentlichte Abschrift 2007, Eintrag vom 10. Februar 1929. 569 Ein Abgleich der Genealogien der gräflichen Familien Ungarns im 19. und 20. Jahrhundert führte die Verfasserin schließlich zu Emma Gräfin Keglevich (1889–1985) als der ein-
592
ANMERKUNGEN
570
571 572 573 574 575
576
577 578 579
580
581 582
zig denkbaren Person. Sie war eine geborene Gräfin Almásy; ihre Mutter, eine geborene Gräfin Károlyi, war die Schwester des Consten-Freundes und Budapester Bankiers Imre Károlyi. Emma v. Almásy hatte 1909 geheiratet und zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter; ihr erster Mann, Nikolaus Graf Keglevich, starb 1919 an den Folgen einer Kriegsverletzung. In zweiter Ehe heiratete sie 1928 in Wien einen Baron Erös de Bethlenfálva. Über die Jahre zwischen den beiden Ehen gibt es keine genealogischen Angaben, ebenso wenig darüber, welche persönlichen Schicksale sich hinter diesen dürren Auskünften verborgen haben. Vgl. u.a. Genealogisches Handbuch des Adels, Bd. 23 (Gräfliche Häuser), Limburg 1960, S. 7 BA/MA, RW 5v 50, Gempp-Bericht, Band 10, S. 12 f. betr. Ausführungen des Major Nicolai über „Ehrengefährdung im Nachrichtendienst“. Die Anweisung untersagte jedem Nachrichtenoffizier, persönlichen Kontakt mit Agenten oder bezahlten V-Leuten zu pflegen, da diese eine „Gefahr für seine Standesehre“ bedeuteten. ÖHHStA/Kriegsarchiv, Karton 3670, Nabt. Na 13428. ÖHHStA/Kriegsarchiv, ebd. Auskunft des Staatsanwalts Tornau, ehemaliger Leiter der politischen Gruppe der Abteilung IIIb, 1923 auf eine entsprechende Anfrage des AA zu Consten. ÖHHStA/Kriegsarchiv, ebd. Emil Szittya (1886–1964) Sein bürgerlicher Name war Adolf Schenk. Szittya lebte seit 1906 nicht mehr in Ungarn, publizierte aber häufig in den dortigen Zeitungen. Er verfasste Romane und Erzählungen und war auch als Maler bekannt. Sein 1923 erschienener Prosatext „Die Künstler in Zürich während des Krieges“, veröffentlicht in dem von Paul Raabe herausgegebenen Sammelband „Expressionismus. Aufzeichnungen und Erinnerungen der Zeitgenossen“ (Olten 1965, S. 163 ff.) gibt Aufschluss über seine genaue Kenntnis der Zürcher Agentenszene im Ersten Weltkrieg. Szittya starb Ende der 40er Jahre in Paris. Vgl. Eszter Kisery, Interkulturalität als Lebensform (Emil Szittya), www.inst.at/studies/s_0716_d.htm, 1999 und die Dissertationen von Christian und Elisabeth Weinek, beide Salzburg 1987. Sándor (Alexander) Wekerle (1848–1921). Donauschwäbischer Herkunft. Als erster nichtadliger Ministerpräsident der ungarischen Monarchie war er ein Verfechter magyarischer Vorherrschaft. Wekerle amtierte insgesamt dreimal – 1892–1895, 1906–1910 und 1917/18 – als Regierungschef. Er verlor sein Amt in der „Asternrevolution“ mit dem Sturz der ungarischen Monarchie im Oktober 1918. Pester Lloyd Nr. 111, Abendausgabe vom 11.5.1918; die Schilderung der Vorgänge im Budapester Parlament und ihre Folgen beruhen im wesentlichen auf der Berichterstattung dieser Zeitung, die von der Österreichischen Nationalbibliothek ins Internet gestellt wurde. István Tisza v. Borosjeno et Szeged (1861–1918); 1903–1905 und 1913–1917 Ministerpräsident des Königreichs Ungarn. Er wurde am 31.10.1918 als eines der wenigen Opfer der „Asternrevolution“ von Aufständischen ermordet. Mihály Károlyi gehörte viele Jahre der Unabhängigkeitspartei an, hatte sich dann aber wegen politischer Meinungsverschiedenheiten mit einigen anderen Mitgliedern abgespalten und eine eigene Partei gegründet. Die Károlyi-Partei war innenpolitisch eine Verfechterin der Arbeiterrechte und trat außenpolitisch offen gegen das Militärbündnis Österreich-Ungarns mit dem Deutschen Reich auf. Diese und die folgenden Passagen zusammengefasst und in Auszügen zitiert aus dem im Pester Lloyd vom 12.5. 1918, S. 6 ff. veröffentlichten Parlamentsprotokoll. Eine ausführliche Darstellung der „Affäre Konsten“ und ihrer Vorgeschichte findet sich auch in den Memoiren Mihály Károlyis, Gegen eine ganze Welt. Mein Kampf um den Frieden, München 1924, S. 313 ff., 329 ff. sowie verkürzt in: Faith without Illusion, Memoirs of Michael Karolyi, London o.J., S. 90 ff. (Kap. 8: German Secret Service in Hungary). Mihály Károlyis Mutter war drei Jahre nach seiner Geburt gestorben; er und seine ältere Schwester wurden zeitweise vom Onkel Tibor Graf Károlyi, dem Vater Imres, aufgenommen. Imre Károlyis Offener Brief und die Erwiderung Mihály Károlyis wurden in deutscher
593
ANHANG 583 584
585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612
Übersetzung im Pester Lloyd vom 21.1.1918 im Wortlaut veröffentlicht; die Neue Freie Presse (Wien) folgte am 22.1.1918 mit einer Zusammenfassung. Mihály Károlyis Landsitz im Matra-Gebirge, Nord-Ungarn. In seinen Memoiren erwähnt er, es habe sich um mehrere Körbe mit schmutziger Wäsche gehandelt, die dort gewaschen werden sollte. Vgl. Mihály Károlyi, Gegen eine ganze Welt, S. 329 Károlyi hielt sich im Sommer 1914 auf der Rückreise von einem USA-Besuch in Frankreich auf und wurde dort nach Kriegsausbruch als Ausländer interniert. Er war freigekommen, nachdem er schriftlich erklärt hatte, er werde nach seiner Rückkehr nach Ungarn nicht in die Armee eintreten. Vgl. M. Károlyi, Gegen eine ganze Welt, S. 108 ff. Gyúla Graf Andrássy jr. war im Kabinett Tisza Innenminister. Mihály Graf Károlyi war mit Andrássys Stieftochter Katalin verheiratet. Gemeint war der frühere Justizminister Vilmos Vászonyi (1868–1926), einer der entschiedensten politischen Gegner Mihály Károlyis. Zur Verbindung zwischen Hermann Consten und Imre Graf Károlyi s. Mihály Graf Karolyi, Gegen eine ganze Welt, S. 334; Consten Tagebücher, Eintrag vom 30.3.1929 Vgl. Mihály Károlyi, Gegen eine ganze Welt, S. 338 In den einschlägigen ungarischen Dokumenten wie auch in der Wiener und Budapester Presse wird Constens Name durchgängig mit -K- geschrieben. Im Falle von Originalzitaten wird die dortige Schreibung übernommen; D.G. Pester Lloyd, 12.5.1918, S. 8 Pester Lloyd, ebd. ÖHHStA, Akten des Ministeriums des Äußeren. Politischer Index 1914-1918, Karton 138, Chiffriertes Telegramm Nr. 8155 vom 12.5.1918. PAdAA R 2355, A 20587 v. 12.5.1918, Fürstenberg an Hertling PAdAA R 2355, A 20636, Fürstenberg an AA, 15.5.1918 Die Akten bezogen sich vermutlich auf ein Militärgerichtsverfahren gegen den katholischen Priester István Török, der angeblich Briefe Mihály Károlyis an die Entente befördert hatte. Vgl. Mihály Károlyi, Gegen eine ganze Welt, S. 317 ff. Vgl. PAdAA, IA Deutschland, Geheime Akten betr. Agenten: R 15840, A 21021, Fürstenberg an Hertling v. 14.5.1918 und Pester Lloyd v. 13.5.1918 Major Fleck, Liaison-Offizier der Abteilung IIIb beim K.u.k. Evidenzbüro. Vgl. Ronge Memoiren, S. 96 PAdAA R 15840, A 21021, ebd. PAdAA R 15840, A 21406, Stellv. Generalstab der Armee, Abt. IIIb, T.-B. V. Nr. 8241 AX Geheim an AA, datiert Berlin 18.5.1918 PAdAA R 15840, A 21272, Fürstenberg an Hertling, 20.5.1918 PAdAA R 15841, A 21982, Fürstenberg an Hertling, 21.5.1918 Zitiert nach Pester Lloyd, Abendausgabe vom 22.5.1918, Rubrik Gerichtshalle. Vgl. auch PAdAA R 15841, A 21983, Fürstenberg an Hertling, 23.5.1918 PAdAA R 15841, A 22013, GHQ, Frhr. v. Berckheim an AA, 25.5.1918 Ebd. PAdAA R 15841, A 22179, Brose an AA. PAdAA R 15481, A 22377, Fürstenberg an v. Kühlmann, 27.5.1918 PAdAA R 15841, A 22734, stellv. Gen.stab IIIb (Brose) an AA, Politische Abteilung. ÖHHStA/Kriegsarchiv, AOK Evidenzbüro, Karton 3669, Fz. 1-11. Gegenstand: Consten, Hermann – deutscher Vertrauensmann in Budapest. Verf. Seifert Hptm. Vgl. Max Ronge, Kriegs- und Industriespionage. Zwölf Jahre Kundschafterdienst. Wien, Zürich, Leipzig 1930, pp. 280, 372, 378 f. ÖHHStA/Kriegsarchiv, Karton 3669, Na. Nr. 684 res. vom 28.3.1918 PAdAA R 15847, A 3666, Generalstab Nachrichtengruppe, Sektion III, Nr. 1967/III Geheim an AA, Zentralbüro, 3.2.1919. „Das die Angelegenheit Consten bearbeitende Referat des stellvertretenden Generalstabs IIIb ist aufgelöst. Die Akten Consten sind vernichtet.“ ÖHHStA/Kriegsarchiv, Karton 3669, Nabt. Na. 8321/1 v. 7.5.1918, Nabt. Na. 11768 v.
594
ANMERKUNGEN
613 614 615 616
617 618
619 620 621
622 623 624 625
626 627
628 629
18.5.1918; Karton 3670 Nabt. Na. 15420 v. 27.6.1918; Karton 3671, Na. Nr. 17898/I, Verschlusssache Dringend, Hptm. Seifert an Landesverteidigungsminister Baron Szurmay m. Vermerk: Persönlich, 30.7.1918. Unter der Durchschrift die für Ronge bestimmte Anmerkung Seiferts „pro domo“: Abt I des Honvedministeriums (Hptm: Knaus) bittet telephonisch am 29.7.18 um neuerliche Beteilung mit Zuschriften über Consten, da selbe nirgends auffindbar sein sollen. Möglicherweise lag der Versuch vor, die Angelegenheit im telephonischen Wege kurz auszutragen und ad acta zu legen. ÖHHStA/Kriegsarchiv, Karton 3671, Nabt. Na. 16279 v. 8.7.1918 Deutsche Oberste Heeresleitung; D.G. ÖHHStA/Kriegsarchiv, Karton 3670, Na. Nr. 15097 vom 19.6.1918 Zuständig für die Ausstellung von Agentenpässen war die wissenschaftliche Abteilung von IIIb, die während des Ersten Weltkriegs auch ein neues Geheimschriftverfahren anstelle der gebräuchlichen Satzbücher entwickelte. Vgl. Gempp-Bericht Bd. 10, Abschn. 9, S. 37. BA/MA, RW 5/v. 50. PAdAA R 15842, A 29974, Fürstenberg an AA, 13.7.1918 „Das Kriegsministerium teilt mir mit, dass Hermann Consten keineswegs osmanischer Offizier ist und versichert, das Konsulat könne gegebenenfalls auf jegliche Anfragen in der Angelegenheit in diesem Sinne antworten.“ (Übers. a.d. Französ. durch die Autorin); Başbakanlık Osmanlı Arşivi, File 2456, Dok 42, Fond HR, SYS. Osmanisches Außenministerium (Ahmed Wezi Bey) an Konsulat Budapest (Hikmet Bey), 14.8.1918 PAdAA R 15842, A 31419, Fürstenberg an AA 25.7.1918. ÖHHStA/Kriegsarchiv, Karton 3671, Na. Nr. 17898, Generalkommando Budapest an Evidenzbüro v.24.7.1918; inliegend „Durch Kurier! Streng Geheim!“ Na. Nr 1851 res. Generalstabsabteilung des k.u.k. Militärkommandos Budapest an Evidenzbüro v. 20.7.1918 Die Pressezensur fiel während des Krieges ebenfalls in die Zuständigkeit der Abteilung IIIb. Vgl. Markus Pöhlmann, German Intelligence at War, 1914-1918. In: Journal of Intelligence History, vol. 5-2, Münster 2005, S. 31, u. den Aufsatz v. Florian Altenhöner, Total War – Total Control? German Military Intelligence on the Home Front 1914-1918, Ebd. S. 55 ff. Zur Vorgeschichte und Entstehung der Weimarer Republik vgl. Hagen Schulze, Weimar. Deutschland 1917 bis 1933. Die Deutschen und ihre Nation, Bd. 4, Berlin 1982, S. 141 ff. Altenhöner, S. 71 Zur Asternrevolution und den Folgen vgl. Paul Lendvai, Die Ungarn, a.a.O., S. 402 ff. Feldmarschall v. Hindenburg verfügte am 17. November 1918 die Auflösung der Abteilung IIIb; die Verfügung trat am 20. November in Kraft. An ihre Stelle trat eine „Nachrichtensektion“ des Generalstabs unter Leitung von General Brose, die nur noch für die Informationsbeschaffung im Ausland zuständig war. Im Februar 1919 sollte sie in eine Major Gempp unterstellte „Nachrichtengruppe“ umorganisiert werden. Vgl. Jürgen W. Schmidt, Counter Intelligence and Newspaper Research 1914-1918. In: Journal of Intelligence History, a.a.O., S. 87 f. Doris Götting (Hrsg.), Hermann Consten, Reisejournale Mongolei-Expedition 1928-1929, unveröffentlichter Privatdruck, 2007, S. 108 BA/MA Freiburg MSg 2/2152 Sgl. Ahrens über den Krieg in der Türkei und in Persien. Die Einreisesperre war 1919 auf Betreiben der britischen Regierung gegen insgesamt 74 Personen mit der Begründung der Neutralitätsverletzung und kriegerischer Handlungen verhängt worden. Constens Name auf der Liste wurde zwei Jahre später wieder gestrichen, mit dem Hinweis, er habe die Expedition Niedermayer bereits in Aleppo verlassen. Vgl. Mitteilungen des Bundes der Asienkämpfer 1/1, Dez. 1919 und 3/9, Sept. 1921. Dieter Klotz (Mitarbeit: Hermann Krause), Es war das reinste Völkerkundemuseum. Eine Nachbetrachtung aus dem alten Bad Blankenburg zwischen 1918 und 1927. GreifensteinBote Nr. 1/2005, S. 7 Wohl in der irrtümlichen Annahme, er habe die Wohnung für Margarete Strölin (später Jacobi-Müller) eingerichtet, die Consten aber erst nach seiner Trennung von Emma 1927 kennenlernte.
595
ANHANG 630 631 632 633 634 635 636 637 638
639 640
641 642 643 644
645
Greifenstein-Bote, a.a.O.; Erinnerung von Hermann Krause. Der Großteil der Kartensammlung befindet sich heute in der Berliner Staatsbibliothek. DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten Bl. 86, Consten an Binder 16.4.1925 Vgl. Jürgen John: Das Land Thüringen in der Weimarer Republik. Thüringische Blätter zur Landeskunde, Erfurt 2004 Vgl. Gerlinde Gräfin von Westphalen, Anna Luise von Schwarzburg. Die letzte Fürstin, Jena 2005, S. 97 Vgl. Hagen Schulze, Weimar, S. 193 ff. Auskunft Stadtarchiv Bad Blankenburg. Nachlass Consten, Sgl. Corts Ferdinand Ossendowski (1876–1945) hatte ein ähnlich wildbewegtes und geheimnisumwittertes Leben wie Consten. Nach einem naturwissenschaftlichen Studium in St. Petersburg und Paris diente er im Russisch-Japanischen Krieg als Marineoffizier in Ostsibirien, wo er sich der revolutionären Bewegung anschloss. Nach dem Zusammenbruch wurde er verhaftet und verbrachte mehrere Jahre in Gefängnissen und Straflagern. Nach seiner Freilassung soll er für den russischen Geheimdienst gearbeitet haben. Während des Ersten Weltkriegs hielt er sich in der Mongolei auf; 1918 schloss er sich der Kolčak-Regierung in Omsk an und flüchtete bei deren Zusammenbruch vor den Bolševiki über die Mongolei, China und Tibet nach Indien, von wo aus er in die USA weiterreiste. Dort bestritt er seinen Lebensunterhalt mit der Veröffentlichung mehrerer Bücher über seine persönlichen Erlebnisse während der historischen Vorgänge in Zentralasien, die Welterfolge wurden, ihm in Europa aber auch viel Kritik einbrachten. Vor allem Sven Hedin wies Ossendowski eine Fülle von Falschangaben und Plagiaten nach. Vgl. Martin Compart, Nachwort zur Neuausgabe von Tiere, Menschen und Götter, Erkrath 2001, S. 278 ff. Die Angabe verdanke ich Michael Balk von der Berliner Staatsbibliothek. Albert Grünwedel (1856–1935), Kunsthistoriker und Linguist für asiatische Sprachen, war seit 1881 am Museum für Völkerkunde in Berlin tätig. Durch zahlreiche Veröffentlichungen zur buddhistischen Kunst, zur Archäologie Zentralasiens und den Sprachen des Himalaya wurde er bekannt und erhielt eine Ehrenprofessur der Berliner Universität. Nachdem er 1899 gemeinsam mit den russischen Orientalisten Radloff und Salemann eine erste Forschungsexpedition nach Xinjiang unternommen hatte, folgten 1902 und 1907 drei deutsche Expeditionen in das Turfan-Gebiet, deren Ausbeute er 1912 in dem Buch „Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-Turkistan“ vorstellte. Nach seiner Pensionierung lebte Grünwedel in Bayern, wo er bis kurz vor seinem Tod an der Übersetzung des Kâlacakra Tantra aus dem Tibetischen arbeitete. Weideplätze Bd. II, S. 55 ff. Albert Grünwedel: Die Teufel des Avesta und ihre Beziehungen zur Ikonographie des Buddhismus in Zentralasien. Berlin 1924, S. II,46 John Bruce Norton: The Rebellion in India. How to prevent another, London 1857 Consten stützte sich vor allem auf russische Quellen, darunter die Werke Pozdneevs („Buddhistische Klöster und buddhistische Geistlichkeit in der Mongolei“; 1878), Kotvichs und Majskis, von denen er umfangreiche Passagen selbst ins Deutsche übersetzt hat bzw. hat übersetzen lassen. Ein handschriftliches Manuskript mit der deutschen Übersetzung von Vladimir Kotvichs „Kompendium der Geschichte und der gegenwärtigen politischen Lage der Mongolei“(1914) fand sich in dem Teil des Nachlasses, der an das Zentralasienseminar der Universität Bonn gelangt ist. Die Handschrift war allerdings nicht Constens eigene. Dass er in den zwanziger Jahren auch Majskis Werk „Sovremennaja Mongolija“ übersetzt haben will, behauptete er jedenfalls in seiner Stellungnahme zum Diplomatenbericht Asmis. PAdAA R 9208 2359; ein entsprechendes Manuskript war allerdings nicht auffindbar. Vgl. Doris Götting: Jenseits der Exotik. Hermann Consten als Fotograf. In: Doris Götting (Hrsg.) Bilder aus der Ferne – Historische Fotografien des Mongoleiforschers Hermann Consten. Ausstellungskatalog Bönen 2005, S. 20 ff.
596
ANMERKUNGEN 646 Zit. nach Hartmut Walravens u. Martin Gimm (Hg.): Wei-jiao-zi-ai – „Schone dich für die Wissenschaft“: Leben und Werk des Kölner Sinologen Walter Fuchs (1902–1979) in Dokumenten und Briefen. Wiesbaden 2010, S. 33 647 Zitiert n. Curt Alinges Bericht über Consten vom 21.5.1929. PAdAA R 9208, A 3563. Akten der Deutschen Gesandtschaft Peking II, Expeditionsakte Consten, Bl. 22. 648 Owen Lattimore: Nomaden und Kommissare – Die Mongolei gestern und heute. Stuttgart 1964, S. 243 649 Prof. Enchtajvan und Prof. Barkmann an D. Götting, 12.2.2010 650 Constens Vortrag zu Mesopotamien befindet sich als handschriftliches Manuskript im Nachlass. Es befasst sich ausschließlich mit der Antike des Zweistromlandes. Nur in gelegentlichen Seitenbemerkungen zu Klima, Landwirtschaft und Bräuchen deutete Consten an, dass er die Region persönlich bereist hatte, verschwieg aber den Charakter seiner Mission. 651 Joseph Marquart (1864–1930) Nach dem Abbruch einer Ausbildung zum Priester studierte er orientalische Sprachen und Ethnologie in Bonn und Tübingen. Nach der Promotion 1892 arbeitete er am Völkerkundemuseum in Leiden, habilitierte sich an der dortigen Universität und folgte 1912 der Berufung auf den Lehrstuhl für iranische und armenische Philologie an der Berliner Universität. Darüber hinaus befasste er sich vor allem mit den Verwandtschaftsbeziehungen asiatischer Sprachen sowie Geographie, Geschichte und Kultur des asiatischen Raums. Seine umfangreiche Bibliothek befindet sich heute im Päpstlichen Bibel-Institut des Vatikan. Als intimer Kenner der armenischen Kultur hat es Marquardt in der Zeit der Massaker an den Armeniern in der Türkei 1915 abgelehnt, armenische Briefe für Max von Oppenheims „Nachrichtenstelle für den Orient“ zu übersetzen. Als Begründung nannte er die „völlig entstellte und erlogene“ Berichterstattung über die „schauerlichen Metzeleien“ an den Armeniern in der deutschen Presse. PAdAA R 14088, A 29589 zit. n. www.armenocide.net 652 Vgl. Jürgen Kloosterhuis: „Friedliche Imperialisten“ – Deutsche Auslandsvereine und auswärtige Kulturpolitik 1906-1918, Teil I, S, 695 ff. 653 Im noch im Nachlass vorhandenen handschriftlichen Redemanuskript Constens steckten Lesezeichen, die sich nach ihrer Zusammensetzung als zerschnittene Teile einer Einladung der Deutsch-Persischen Gesellschaft zu einer anderen Veranstaltung im Dezember 1920 in Berlin entpuppten. 654 Zu den Feldzügen Galdans vgl. Michael Weiers: Geschichte der Mongolen S. 193 ff. 655 DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Bl. 85. Consten an Bindel 27.3.1925 656 Vgl. Albert Grünwedel: Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei. Leipzig 1900; ders: Die Teufel des Avesta und ihre Beziehung zur Ikonographie des Buddhismus in Zentralasien. Berlin 1924 657 Orientalistische Literaturzeitung 1926 Nr. 7, S. 522; Consten selbst war überzeugt, dass Ossendowskis Buch Tiere, Menschen und Götter „viel Richtiges enthielt“. Vom Verfasser selbst hatte er allerdings keine hohe Meinung. Vgl. seine Schreiben an Bindel vom 13.6.1924, DITSL, Schülerakte Consten, Bl. 77 und 78. 658 PAdAA R 9802, A 3563, Alinge an Gesandtschaft Peking 21.5.1929, Bl. 23 659 Mitteilungen des Bundes der Asienkämpfer, 8. Jahrgang Nr. 1, Januar 1926 und Nr. 3, März 1926, S. 26 ff. Dieselbe Rezension erschien auch in den Braunschweiger Neuesten Nachrichten. 660 Consten, Mysterien, S. 129 661 Ebd., S. 150 662 Fußnote Consten: Gesser Khân, Kriegsgott der Khalkhamongolen. 663 Fußnote Consten: Ärlik Khân, Gott des Totenreiches. 664 Ebd., S. 183 f. 665 Hermann Consten: Der Kampf um Buddhas Thron, Berlin 1925, S. 40 666 Fußnote Consten: Galab, Weltperiode. 667 Ebd., S. 207 f.
597
ANHANG 668 Ebd., S. 141 669 Žal Lama (Dambijžancan) war russischer Staatsbürger. Auf Ersuchen der unter seinen Grausamkeiten leidenden Mongolen in der westmongolischen Provinz Urianchaj hatte ihn russische Polizei 1914 verhaftet. Zu Žal Lamas Rolle bei den Kämpfen um Chovd 1912 vgl. auch Constens Bericht in den „Weideplätzen der Mongolen“, Bd. II, S. 211 ff.; eine sehr eingehende Beschreibung der Persönlichkeit, seiner Grausamkeit und seiner schließlichen Ermordung im Jahre 1922 findet sich bei O. Lattimore, F. Isono (Hrsg.): The ,Diluv Khutagt, Wiesbaden 1982, Autobiography, S. 163 ff., Political Memoirs S. 124 670 Es handelt sich um den Kriegsgott Žamsran (Beg-ts’e); D.G. 671 Hermann Consten: Der rote Lama, Stuttgart 1928, S. 178 f. 672 Vgl. seine Parlamentarismus-Attacke im „Roten Lama“, S. 57 673 Vgl. Hansjoachim W. Koch: Der deutsche Bürgerkrieg. Eine Geschichte der deutschen und österreichischen Freikorps 1918–1923, Berlin 1978, S. 300 ff. 674 Der Name ist dort Consten-Klaudy geschrieben; D.G. 675 Vgl. Dieter Klotz: Es war das reinste Völkerkundemuseum. Eine Nachbetrachtung aus dem alten Bad Blankenburg zwischen 1918 und 1927. Greifensteinbote 2005/01, S. 7 676 Stadtarchiv Bad Blankenburg, Auskunft Kreidel vom 10.9.2007; Greifensteinbote Nr. 1/2005. 677 Hoover Institution Archives (HIA, Stanford), Ethel John Lindgren-Utsi Papers, Box 4, Folder 1 Etcetera & Mongolica. Unpubliziertes Typoskript, Vorwort, S. ii: “Certainly Consten’s own accounts to me of little errands in Mesopotamia, to say nothing of dark exploits in stringing up communists in the Thüringerwald after the war, might either or both explain this impression, or its grounds.” 678 Rudolf Herrmann, In Erinnerung an Hermann Consten. In: Burschenschaftliche Blätter, 78. Jg., Heft 3, März 1963, S. 66 679 Zum Sturm auf den Annaberg s. Matthias Sprenger: Landsknechte auf dem Weg ins Dritte Reich? Zu Genese und Wandel des Freikorpsmythos. Paderborn 2008, S. 155 ff.; Karsten Eichner: Briten, Franzosen und Italiener in Oberschlesien 1920–1922. Beihefte zum Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, Bd. XIII, St. Katharinen 2002, S. 185 ff., 257 f.; H. W. Koch, S. 242 ff. 680 DITSL, Schülerakte Consten Bl. 70: Consten an Bindel 15.10.1923; ebd. Bl. 71: Consten an Dr. Fabarius 15.10.1923 681 Vgl. Volker R. Berghahn: Der Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten 1918–1935. Düsseldorf 1966, S. 48 ff. 682 Vgl. Wilhelm Hoegner: Die verratene Republik – Geschichte der Gegenrevolution. München 1958, S. 137 683 Zur Gesamtgeschichte der Freikorps und ihrer Nachfolgeorganisationen vgl. auch Hagen Schulze: Weimar. Die Deutschen und ihre Nation 1917–1933, S. 112 ff; Ingo Korzetz: Die Freikorps in der Weimarer Republik: Freiheitskämpfer oder Landsknechtshaufen? Aufstellung, Einsatz und Wesen bayerischer Freikorps 1918–1920, Marburg 2009 684 Hoegner, S. 156 685 Berghahn, S. 49 f. 686 Theodor Bindel (1879–1927), besuchte die Deutsche Kolonialschule 1901–03. Nach Jahren in Afrika kehrte er als Dozent und Berater nach Witzenhausen zurück; amtierte außerdem als Geschäftsführer des „Verbands Alter Herren“ der DKS. 687 Consten an M. Strölin, Peking 5.9.1930 (Nachlass Consten). Zur Persönlichkeit Kriebels und seiner Frau vgl. Erwin Wickert: Mut und Übermut. Geschichten aus meinem Leben. Stuttgart 1991, 212 ff. 688 Berghahn, S. 45 f. 689 Berghahn, S. 46; Hoegner, S. 152 690 Vgl. Jürgen John: Das Land Thüringen in der Weimarer Republik. Thüringische Blätter zur Landeskunde. Erfurt 2004 691 BA Lichterfelde (ehem. British Document Centre), NSDAP-Zentralkartei, Mitgliedsnr. 15484, Eintritt am 1.2.1933
598
ANMERKUNGEN 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711
712 713 714 715 716
717 718
719
DITSL, Schülerakte Consten Bl. 72, Molkerei der DKS an Consten, 19.10.1923 Vgl. die Parlamentsberichte im Pester Lloyd vom November 1918 PAdAA R 23275, II Ung 811/23 v. 15.6.1923 Károlyi kehrte erstmals 1947 nach Ungarn zurück, vertrat sein sozialistisch gewordenes Land einige Jahre als Botschafter in London, begab sich abermals ins Exil und starb 1955 in Vence; vgl. Lendvai, S. 411 f. PAdAA R 23275, II Ung. A 811/23, Schreiben Reichswehrministerium an AA, 15.6.1923 PAdAA R 23275, II U 1468, Fürstenberg an AA, 30.10.1923 PAdAA R 23275, II Ung. 3, 183/24, Heeresleitung an Roeder v. 24.7.1923; Antwort Roeder auf demselben Blatt ohne Datum. Ebd., Stellungnahme Tornau v. 17.8.1923 Michael Karolyi: Gegen eine ganze Welt. Mein Kampf um den Frieden. München 1924 PAdAA R 23275, zu II U 3, 183; Eilt! Geheim! Reichsministerium der Justiz an Reichswehrministerium Heeresleitung v. 12.3.1924, mit angefügter Aufzeichnung des Auswärtigen Amtes über den Aktenvorgang Consten. Ebd. DITSL, Archiv der DKS, Akte des Altherrenverbands; Einladung zum ersten Stiftungsfest am 15./16.7.1922, datiert Witzenhausen 22.6.1922 DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Bl. 65 Ebd.; Postkarte vom 7.6.1923 DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Bl. 76, Consten an Bindel 7.5.1924 Ebd. Bl. 77, undatiert. Der Artikel erschien in der Ausgabe 1924/25 Nr. 1 von Der deutsche Kulturpionier unter der Rubrik „Briefe alter Kameraden“, S. 36 ff. Der deutsche Kulturpionier Jg. 1924/25 Nr. 1, S. 43 DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten Bl. 78, Consten an Bindel, 13.6.1924 Es dürfte sich um Volksbildungsminister Erdene Batchaan gehandelt haben, der seinen Besuch bei Consten ankündigte. Aleksej N. Vasiljev (1880–1941) wurde 1918 zum russischen Konsul in Urga ernannt und amtierte seit 1924 als erster Botschafter der UdSSR in der Mongolischen Volksrepublik. Später wechselte er als Generalkonsul nach Mukden (Shenyang). Ab 1926 arbeitete er in der Ostabteilung des Exekutivkomitees der Komintern. In der Mongolei unterstützte er die nationaldemokratische Gruppe um Elbegdorž-Rinčino, E. Batchaan und C. Žamsarano; vgl. Irina Morozova, The Comintern and Revolution in Mongolia, Cambridge 2002, S. 58 DITSL, ebd., Bl. 75, Consten an Bindel, 25.4.1924 Ebd., Bl. 83, Consten an Bindel, 17.9.1924 Im Nachlass existiert als Fragment noch die Korrekturseite einer Afrikageschichte für die Jugend mit dem Titel „Der Geburtstag“; D.G. Hermann Consten, Reisejournale Mongolei-Expedition 1928–1929, Eintrag vom 10.2.1929. Welchen konkreten Hintergrund die Bemerkung über die Mongolei-Erfahrung Emmas hatte, ließ sich leider nicht ermitteln. Rudolf Asmis (1879–1945), in den 20er Jahren Konsul in Tschita (1922), Botschaftsrat in Moskau (1923) und Peking (1924/25), Gesandter in Bangkok (ab 1925). In den 40er Jahren Leiter des Kolonialpolitischen Amtes der NSDAP und Reichskommissar für die Kolonialgesellschaften. Asmis starb 1945 in sowjetischer Haft. Veröffentlichungen: Als Wirtschaftspionier in Russisch Asien (1924) Hermann Gipperich (1882–1959), Konsulatssekretär an der Deutschen Gesandtschaft in Peking. In den 30er Jahren deutscher Generalkonsul in Hongkong. So soll Lenins Frau, N.K. Krupskaja, das pädagogische Modell Gustav Wynekens studiert und wohlwollend kritisch beurteilt haben. Vgl. Ludmila Obraszowa: Wickersdorf als Vorbild? Gustav Wynekens Wirkungen in das vor- und nachrevolutionäre Russland. In: Historische Jugendforschung – Jahrbuch der deutschen Jugendbewegung, Neue Folge Bd. 3/2006, S. 187 ff. PAdAA R 9208-2359 (früher Bundesarchiv Lichterfelde), Akten der Deutschen Botschaft
599
ANHANG 720 721
722
723 724 725 726
727 728 729
730
731 732 733 734
China zur Mongolei (Mongolische VR). Gesandtschaft Peking an AA, Bericht Gipperich vom 18.8.1922 (Geheim), Bl. 298 Vgl. Barkmann: Geschichte der Mongolei, S. 218 PAdAA R 9208-2359, u.a. Bl. 113 ff. Bericht Gipperich vom Sept. 1922; S. 292 ff. Gesandtschaft Peking an AA, 25.8.1922, handschriftl. Bericht Gipperich über die politischen Verhältnisse in Urga; Bl. 156 ff. Bericht Asmis (Geheim Russland), 25.8.1922 „Wirtschaftliche Möglichkeiten für Deutschland in der Mongolei“; Gesandtschaft Peking, K. Nr. 400, Notiz über die Reise des Legationssekretärs Gipperich nach Urga, 6.10.1923. PAdAA R 9208-2359, Bl. 61, AA an Gesandtschaft Peking, 8.9.1923: „Nachdem das Auswärtige Amt Herrn Hermann Consten auf seine Bitte Abschriften aus den nebenbezeichneten Berichten übersandt hatte, reichte Herr Consten zwei Schreiben hier ein[…], ohne dass ihr Inhalt hier auf seinen Wert nachgeprüft werden konnte.“ Agvan Doržiev. Warum Consten den Namen hier in Anführungszeichen setzte, ist nicht ganz klar. Möglicherweise wollte er damit signalisieren, dass er ihn für einen Decknamen und Agvan Doržiev für einen russischen Spion hielt. Ebd. Bl. 68 Ebd. Bl. 71 Ebd. Bl. 61 „Das Werk ist, obwohl von einem rein russischen specifischen MenschewikiStandpunkt aus geschrieben, übersichtlich, reich an Material und huldigt im übrigen dem Standpunkte: Du sollst keine fremden Götter neben mir haben.“ Majskis Buch war 1921 in Moskau erschienen. Constens Übersetzung ist im Nachlass nicht mehr vorhanden. Ebd. Bl. 65 Ebd. Bl. 71 Lindgren 1926: “Consten had only ill to say of him, also a story to the effect that he had escaped from the Soviets in Siberia during the Revolutionary years, begged his way through Mongolia and Turkestan to India disguised as a Lama, arrived in Tientsin literally in rags, there to be helped by a German called Balthazar. On his way back to Germany through Russia he was supposed to have made his peace with the present regime;“ HIA, E.J. Lindgren-Utsi Papers Box 4, Folder 4-1-, p.ii Erdene Batchaan (Erdene Batukhan; N. F. Batukhanov 1888-1942). Burjate, lebte seit 1912 in der Mongolei, zunächst als Lehrer, dann als Sekretär der Regierung des Bogd Chan; seit 1921 Mitglied der Mongolischen Volkspartei, 1923/24 ZK-Mitglied. 1922–1924 zuständig für Bildungsangelegenheiten im Außenministerium, Dozent am Institut für Schrifttum. 1924–1928 Minister für Volksbildung, Mitglied im ZK der MRVP. Entmachtung nach dem VII.Parteitag der MRVP (Okt./Nov. 1928). 1937 Verhaftung und Verbannung in ein sowjetisches Straflager, Verurteilung 1940. Starb in der Haft. DITSL, ebd., Bl. 84, Consten an Bindel, 11.2.1925 DITSL, ebd., Bl. 85, Consten an Bindel, 27.3.1925 PAdAA R 9208-2359, Bl. 198, AA an Gesandtschaft Peking, 16.5.1925 Zur Entsendung mongolischer Schüler und Praktikanten, zu ihren Ausbildungsjahren in Deutschland und den ideologisch-politischen Hintergründen ihrer Rückführung 1929/30 siehe u.a.: Doris Götting: Das pädagogische Experiment. Mongolische Schüler und Berufspraktikanten in Deutschland 1926–1930. In: Mongolische Notizen. Mitteilungen der Deutsch-Mongolischen Gesellschaft e.V. Nr. 13/2004, S. 17-63; dies.: Schuljahre junger Mongolen in Wickersdorf und Letzlingen. Ein wenig bekanntes Kapitel aus den Anfängen der mongolisch-deutschen Kulturbeziehungen. In Historische Jugendforschung, Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung. NF 3/2006, S. 197-215; Budbayar Ishgen: Die mongolisch-deutschen Beziehungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Berlin 2009, S. 117 ff.; Uta Schöne: Zu den Wegen und Besonderheiten bei der Entwicklung der Intelligenz in der Mongolischen Volksrepublik nach 1921. In: asien, afrika, lateinamerika, Jahrgang 18, Heft 3, Berlin 1990, S. 456 ff.; R. Tördalaj: Mongol-German sojol, blovsrolyn charilcaa: Mongol ojuutan, surag id ulsad suralcan n’ 1926–1930. [Mongolisch-deutsche Kultur- und Bildungsbeziehungen. Die Ausbildung mongolischer Studen-
600
ANMERKUNGEN
735
736
737 738 739 740 741 742
743 744 745
746 747 748 749 750 751
752 753 754
ten und Schüler in Deutschland 1926-1930.] Magisterarbeit, Ulaanbaatar 2004; Serge M. Wolff, Mongol Delegations in Western Europe 1925-1929.In: Journal of the Royal Asian Society, vol. XXXII, Part I, London 1945, S. 289 ff., part II S. 76 ff.; ders.: Mongolian Educational Venture in Western Europe 1926-1929. In: Zentralasiatische Studien des Seminars für Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens der Universität Bonn, Nr. 5, Wiesbaden 1971, S. 247 ff. Prof. Haenisch akzeptierte 1927 den 20-jährigen D. Nacagdorž als seinen Assistenten und arbeitete mit dessen Hilfe an der Übersetzung der „Geheimen Geschichte“, der berühmten Chronik der Mongolen und ihres Aufstiegs zur Weltmacht unter Čingis Chaan und seinen Nachfolgern. Nacagdorž, der 1937 unter ungeklärten Umständen starb, gilt als der große Nationaldichter der modernen Mongolei. Zu seiner Zeit in Leipzig vgl. Erika Taube: Auf der Suche nach Spuren Nacagdoržs in Leipzig. In: asien, afrika, lateinamerika, Jahrgang 16, Heft 5, Berlin 1988. HIA, Lindgren-Utsi Papers Box 4-1, p. ii. 1926 konnte Lindgren in Constens Haus auch ein großes Porträt Batchaans bewundern. Vermutlich hatte es der Hannoveraner Künstler Heinz Munz gemalt, von dem auch das große Consten-Porträt im mongolischen Fürstengewand stammt. Über den Verbleib des Bildes ist nichts bekannt. Die Mongolen. Von Dr. Consten, Weser-Zeitung 29.3.1925 PAdAA R 9208-2359, Bl. 299, Bericht Gipperich v. 25.7.1922; vgl. auch Budbayar, S. 65 ff. Vgl. Owen Lattimore: The Diluv Khutagt. S. 9 ff. Die Umbenennung der MVP in MRVP war 1924, nach der Gründung der Mongolischen Volksrepublik erfolgt. DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten Bl. 87, Consten an Bindel, 1.7.1925 Heinrich Prinz der Niederlande (1876–1934) entstammte der dritten Ehe des Großherzogs Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin. Seine Mutter war eine Prinzessin Schwarzburg-Rudolstadt. 1901 heiratete er Königin Wilhelmina der Niederlande. Der Prinzgemahl galt als politisch absolut desinteressiert. Während der Weimarer Zeit stand er aber in engem Kontakt mit rechtskonservativen Kreisen. DITSL, Schülerakte Consten, Bl. 90, Consten an Bindel 8.2.1926 Nachlass Consten (Sgl. Scheluchin), Heinrich der Niederlande an Consten, Haag 16.6.1927 Consten erwähnt dies in seinem Reisetagebuch unter dem 15.11.1928. Emmas Abschiedsbrief und ein Foto von ihr hatte er auf der Expeditionsreise bei sich. Während das Foto noch im Nachlass erhalten ist (s. Abb. 19), wurde der Brief offenbar später von Consten vernichtet. Nachlass Consten (Sgl. Strölin), Consten an Margarete Müller-Jacobi, Peking, 10.11.1938 ungar. bácsi ist eine Ehrenbezeichnung für eine ältere bzw. ranghöhere Person. Consten Reisejournal 4, Eintrag v. 15.11.1928: „Und der Vater hat mir soviel geholfen.“ Vermutlich war er ein führender Regierungsvertreter im ungarischen Innen- oder Justizministerium, der Constens Undercover-Aktivitäten gegen Károlyi gedeckt hatte. Lt. Auskunft von Prof. Katalin Uray-Köhalmi (Budapest) ist „Pöty“ eigentlich ein Kosename für Kinder. Nachlass Consten (Sgl. Corts), Ede bácsi an Consten, Budapest 1.1.1926 Lt. Auskunft Corts gab es zwischen den beiden Brüdern in den zwanziger Jahren mehrmals heftige Briefwechsel wegen Geld. C. Alinge erwähnte in seiner Beschwerde über Consten, nach seinen Ermittlungen habe der Bruder seine Geldzahlungen mit der Begründung eingestellt, Hermann solle endlich anfangen, „anständig zu arbeiten“. PAdAA, R 9208 3563, Bl. 23 (IVCh Nr. 1878), Akte „Expedition Consten“. Nachlass Consten (Sgl. Corts), Theo Dahme an Consten, Laurensberg 15.3.1927 Lt. Auskunft Klaus Strölin HIA, E.J. Lindgren Papers, Box 4, folder 1: „Etcetera & Mongolica, p. i: To this delay Consten agreed during Dr. Power’s stay in Bad Blankenburg, but on her departure intimated to me that he could not wait so long for a decision and showed me written evidence of being in demand for an expedition to East or South Africa.” In keinem der bei
601
ANHANG
755
756 757
758 759 760 761
762 763 764
765 766 767
Consten selbst vorhandenen Notizen und Dokumente aus der Zeit war je von Plänen einer Afrika-Reise die Rede. Außerdem hatte Consten im Fingieren von Briefen einschlägige Erfahrung. Vgl. Michael Graf Károlyi: „Gegen eine ganze Welt“, S. 336 Laut Altschlaraffisches Archiv Bern wird die Colonie Schlaraffia Palatium Salevelde unter Reych Nr. 270 geführt. Offizielle Gründung im Mai 1927 als Ableger der Athenae Jenenses. Zu den Gründungsmitgliedern gehörte Dr. Arthur Müllejans (Jupp der Rheinbarde), der auch die Patenschaft für Hermann Consten (Junker Männe mit den sieben Löwen) übernahm. Für diese Recherche danke ich Dr. Cai Witt (Schwalbach/Ts.). Aus den im Stadtarchiv Saalfeld noch vorhandenen Unterlagen geht hervor, dass die Vereinigung 1935 verboten und ihr Vermögen eingezogen wurde. Die Protokolle wurden von der Gestapo beschlagnahmt. 1937 erfolgte die Selbstauflösung. (Stadtarchiv Saalfeld Akte Nr. 3217/1928 und Amts- und Nachrichtenblatt Nr. 52/1937) Nachlass Consten (Sgl. Strölin); E. v. Erdberg an Grete Jacobi-Müller und Fam. Strölin, Aachen 7.5.1983 Vgl. Rita Mielke Wanderer zwischen den Welten. Hermann Consten und Eleanor von Erdberg. In: Aixcours, CHIO-Journal des Aachen-Laurensberger Rennvereins, Heft 10 (2000), S. 30 f.; dies.: Erinnerungen an einen fast Vergessenen – Der Mongoleiforscher Hermann Consten (1878–1957). In: Mongolische Notizen Nr. 11/2002, S. 32 ff; überarbeitete Fassung in: Doris Götting (Hrsg.), Bilder aus der Ferne – Fotografien des Mongoleiforschers Hermann Consten. Bönen 2005, S. 12 ff. Doris Götting (Hrsg.): Bilder aus der Ferne. Historische Fotografien des Mongoleiforschers Hermann Consten. Bönen 2005 Consten Reisejournal 5. 6.2.1929 Hermann Gipperich: Lebenserinnerungen. Typoskript, Detmold 1960 (StuDeO-Archiv, Nr. 314) Gipperich ebd. S. 82; Ignaz Trebitsch-Lincoln (1879–1943), ein gebürtiger Ungar jüdischen Glaubens, wechselte in seinem Leben mehrmals seine Staatsbürgerschaft und sein Religionsbekenntnis. Er betrieb undurchsichtige Geschäfte mit Erdölaktien, übernahm religiöse Ämter bei Protestanten und Quäkern, brachte es in Großbritannien bis zum Unterhausabgeordneten, betätigte sich während des Ersten Weltkriegs als Militärzensor für die Deutschen auf dem Balkan. Er wurde von den Engländern als Spion verhaftet und angeklagt, flüchtete nach New York, kehrte nach dem Krieg von dort nach Deutschland zurück. Während der Weimarer Zeit war er Pressesprecher der Kapp-Putschisten, flüchtete nach dem Scheitern des Putschs nach Wien und von dort nach China, wo er sich dem Buddhismus zuwandte. In den 30er Jahren war er Mitarbeiter des japanischen Militärgeheimdienstes in Shanghai. Trebitsch-Lincoln starb dort 1943 an einer Krankheit. Vgl. auch Lendvai, S. 436 ff. Dass I. für Ethel stand, hing wohl mit Constens Vorliebe für die Verschriftung von Namen nach dem Gehör zusammen; D.G. PAdAA R 9208/3563, Akten der Deutschen Gesandtschaft in Peking (II), IV Chi 1833, Nr. 2552 (Expedition Consten) Forschungsarbeiten Lindgrens u.a.: Notes on the Reindeer Tungus of Manchuria. Diss. Cambridge 1936; An example of Culture Contact without Conflict: Reindeer Tungus and Cossacks of Northwestern Manchuria. In: American Anthropologist, vol. 40-4, Oct.-Dec. 1938, pp. 605-621; Die schamanistische Séance (kamlanie) bei den Rentier-Evenken in der Taiga Nordost-Chinas (dargestellt unter Verwendung der Feldaufzeichnungen von Frau Dr. Ethel John Lindgren). In: Jahrbuch des Museums für Völkerkunde Leipzig, Band 61, S. 105-112. PAdAA R9208/3563, IV Chi, Nr. 1878 v. 21.5.1929 (Eingang 13.6.1929), Bl. 5 Im StuDeO-Archiv befindet sich ein Exemplar der „Weideplätze“ mit persönlicher Widmung: „Herrn Bernhard Waurick zur frdl. Erinnerung an unser Zusammentreffen in Berlin. Hermann Consten“, datiert 18.5.1922. Vgl. Teil IV, EN 712
602
ANMERKUNGEN 768 769 770 771 772
773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783
784 785 786
787 788
HIA, Lindgren-Utsi Papers, Etcetera & Mongolica, p.v Ebd. p. ii Vgl. Teil IV, Kap. 3, S. 372 Lindgren, p. iii Der Nordfeldzug war ursprünglich ein gemeinsames Unterfangen der GuomindangArmee Chiang Kaisheks und der chinesischen Kommunisten im Machtkampf gegen die Warlords in mehreren chinesischen Provinzen. Im Frühjahr 1927 hatte die GuomindangArmee Shanghai und Nanjing erobert. Im April putschte Chiang Kaishek, gründete in Nanjing eine „Nationalregierung“ und provozierte den offenen Bruch mit dem linken Flügel seiner Partei und der KP. Letztere wiederum organisierte im Sommer 1927 Aufstände in einer Reihe von Provinzen des Kernlandes, was den linken Flügel der GMD zur Abkehr von den Kommunisten und Chiang Kaishek zum Rücktritt bewog. Erst Anfang 1928 konnte er als Oberbefehlshaber wieder alle Macht in seinen Händen vereinen. Vgl. Wolfgang Franke, Brunhild Staiger (Hrsg.), China-Handbuch. Düsseldorf 1974, S. 988990; Robert C. North, Der chinesische Kommunismus, München 1966, S. 82 ff.; Jürgen Osterhammel, Shanghai, 30. Mai 1925 – Die chinesische Revolution. München 1997, S. 196 ff. HIA, Lindgren-Utsi Papers, Etcetera & Mongolica, p. iv Ebd. p. xiii Ebd. p. iv ; Lindgren hatte sich vermutlich im Monat geirrt. Laut den Akten des Deutschen Generalkonsulats Tientsin stellte Consten seinen Reiseantrag für die Mongolei Ende März 1928. PAdAA R 9208/3563, IV Chi 1833 Nr. 2552, AA an Gesandtschaft Peking, 30.7.1927 (Eingangsvermerk: 17.8.1929), Michelsen war damals Leiter des Asien-Referats im AA; D.G. Ebd. Bl. 78; Scha = Scharffenberg; D.G. Adolf Boyé (1869–1934) war seit 1921 Gesandter in Peking. 1928 fand ein Wechsel statt. Sein Nachfolger wurde Herbert von Borch. Ebd. Bl. 77, Dirksen an Gesandschaft Peking, 29.7.1927; Bleistiftvermerk: „von Dr. Consten übergeben“. Ebd. Bl. 75 Ebd. Bl. 74; amtliche Übersetzung aus dem Chinesischen. Ebd. Handschriftl. Kbn.[= Legationssekretär Kühlborn]: Ich bestätige, den Reisepass des Waichiaopu erhalten und von dem Inhalt des Schreibens des Waichiaopu vom 14. d. Mts. Kenntnis genommen zu haben. Peking den 17. Januar 1928 (gez. Consten) Der offizielle Antrag durch das Deutsche Generalkonsulat in Tientsin samt Übersetzung ins Russische durch Curt Alinge sowie Constens Anschreiben, Passfotos und der Feststellung der Regierung, gegen seine Einreise beständen keine Einwände, befinden sich im Archiv des Außenministeriums der Mongolei; Fonds 01, Nr. 277 Ffrench of Monivea, Internetrecherche Lindgren ebd. p. iv Frau Renate Jährling vom StuDeO-Archiv vermittelte freundlicherweise den Kontakt zu Frau Heidi Kemper-Didaskalu (Hamburg), bei deren Großeltern Junkel Hermann Consten während seines Aufenthaltes in Tientsin 1927/28 Hausgast gewesen ist. So ließ sich die Identität einer weiteren Frau in Constens Leben, die Rätsel aufgab, klären – seiner „Taitai“: Nena (Lotte) Junkel (1889–1976) hatte eine chinesische Mutter und einen spanischen Vater. Ihr Stiefvater war ein Deutscher aus Qingdao (Tsingtao). Sie wuchs in China auf, besuchte dort eine deutsche Schule und war als junge Frau mehrmals in Deutschland zu Besuch gewesen. Sie hatte aber auch enge Kontakte zu ihrer chinesischen Verwandtschaft. In ihre Ehe mit Dr. Otto Junkel brachte sie ihre Tochter Ena aus 1. Ehe mit. Ihr gemeinsames Kind Gisela („Diededa“, von Consten auch „kleine Heimat“ genannt) – die spätere Mutter von Frau Kemper-Didaskalu – kam 1922 zur Welt. Der Arzt Dr. Otto Junkel (1882–1962) stammte aus Bergneustadt und lebte von 1913 bis 1955 in China. Reisejournal 2, Eintrag vom 23.6.1928 Reisejournal 2, Eintrag vom 17.10.1928
603
ANHANG 789 Vgl. dazu auch Doris Götting: Aus „Etzels“ Welt – Hermann Constens Tagebücher. In: Götting (Hrsg.) Bilder aus der Ferne. Historische Fotografien des Mongoleiforschers Hermann Consten (2005), S. 126 ff. 790 Grand Hotel Wagon de Lits in der Pekinger Legation Street, wo Consten abgestiegen war. 791 Vgl. Bernd Braun: Die Reichskanzler der Weimarer Republik – zwölf Lebensläufe. Heidelberg 2003, S. 79 792 Der Gürtel befindet sich noch im Nachlass Consten, Sgl. Strölin. 793 Die Schreibung der chinesischen Dorfnamen wurde in den Zitaten weitgehend in der von Consten gewählten phonetischen Form belassen, die keinem der damals gängigen Umschriftsysteme folgte; D.G. 794 Pai Men; chin. Weißes Tor 795 Der Warlord Zhang Zuolin beherrschte seit Beginn der 20er Jahre als Oberbefehlshaber die Mandschurei und drang im Verlauf der Bürgerkriegsereignisse mit seinen Truppen bis Peking und Tientsin vor. Er fiel am 4.6.1928 während einer Bahnfahrt einem Bombenanschlag zum Opfer. 796 Yuan Shikai (1859–1916) Erster Ministerpräsident der Republik nach dem Zusammenbruch des chinesischen Kaiserreichs 1911. Als früherer Berater des Kaisers Guang Xü und der Kaiserinwitwe Cixi unternahm Yuan 1916 den vergeblichen Versuch einer Wiederherstellung der Monarchie mit sich selbst als Kaiser. Auf seinen Tod folgten jahrelange Kämpfe der Provinzgouverneure sowie zwischen Guomindang und Kommunisten um die Zentralgewalt in China. 797 Reisejournal 1, Eintrag vom 28.5.1928; Barm. = Abk. f. Barometer 798 Ebd. 799 Der mongolische Stamm der Čachar war vor allem im Ordos-Gebiet verbreitet. 800 buuchia; mongol. Kurier, Postreiter; befördern Briefe und Pakete in gestrecktem Galopp. 801 Reisejournal 1, Eintrag vom 15.5.1928; Hervorhebung durch Consten. 802 Joseph Mullie (1886–1976) war 1909 von der Mission Scheut nach Nordwestchina (Vikariat Ost-Mongolei) entsandt worden. Er versah seinen Dienst zunächst in Dayingzi bei Pater Heyns, leitete später in Hata eine christliche Schule und ging 1926 nach Jehol. Neben seiner Missionarstätigkeit machte er sich als Sprachforscher und Archäologe einen Namen. Anfang der 30er Jahre kehrte er nach Belgien zurück, wo er junge Missionare in der nordchinesischen Umgangssprache unterrichtete. 1939 übernahm er den Lehrstuhl für chinesische Sprache und Literatur an der niederländischen Universität Utrecht. Seine umfangreiche Bibliothek bildet heute den Grundstock der Ostasiatischen Bibliothek an der Katholischen Universität in Leuven. 803 Reisejournal 1, Eintrag vom 30.5.1928 804 Joseph Mullie, Les anciennes villes des empires des grands Leao au Royaume mongol des Bārin. In: T’oung Pao, 21 (1922) S. 105-231 805 Vgl. Dieter Kuhn, Einführung in die chinesische Archäologie der Liao. In: Hsueh-man Shen, Schätze der Liao – Chinas vergessene Nomadendynastie. Zürich 2006, S. 27 806 Im Nachlass finden sich auf einem herausgerissenen Blatt von Constens Tagebuchkladde Angaben mit Einzelheiten chinesischer Übergriffe auf belgische Missionseinrichtungen. Belege, wonach er die Vorfälle der Deutschen Gesandtschaft zur Kenntnis gegeben hat, fanden sich in den eingesehenen Dokumenten des AA zu Consten nicht. 807 Buddhistische Holzskulpturen enthalten in ihrem ausgehöhlten Inneren i.d.R. kostbare Reliquien u. heilige Schriften. Erst sie verleihen den Skulpturen ihren sakralen Charakter. 808 kung = gong dian; chin. Palast, Schloss 809 Reisejournal 1, Eintrag vom 1.6.1928; zwei Jahre später unternahm Sven Hedin mit dem Völkerkundler Gösta Montell und dem schwedischen Missionar Georg Söderblom eine Autoreise nach Jehol und schrieb über seine Eindrücke ein ganzes Buch. Dt.: „Jehol. Die Kaiserstadt.“ Leipzig 1932 810 Albert Grünwedel, Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei. Führer durch die lamaistische Sammlung des Fürsten E. Uchtomski. Leipzig 1900
604
ANMERKUNGEN 811 Reisejournal 1, Eintrag vom 2.6.1928 812 Rote Speerträger, Bauernmiliz, mit der Consten während seiner Reise noch näher Bekanntschaft machen wird. 813 Reisejournal 1, Eintrag vom 4.6.1928 814 Reisejournal 1, ebd. 815 Der 1862 in Belgien gegründete katholische Missionsorden Scheut übernahm in der Inneren Mongolei die Missionsstationen der französischen Lazaristen. Der Orden hatte sich die Konversion der Mongolen zum Christentum als Ziel gesetzt, den meisten Zulauf erhielt er aber von chinesischen Flüchtlingen und landlosen Bauern. Im Ordos-Gebiet und in der Tümed-Ebene (heute Provinz Liaoning) gründete die Scheut-Mission christliche Bauerndörfer, indem sie von den mongolischen Fürsten große Weideflächen aufkaufte und chinesischen Bürgerkriegsflüchtlingen für den Acker- und Gartenbau überließ, wenn sie am Katechismus-Unterricht teilnahmen, ihre Kinder in die Missionsschulen schickten und sich später taufen ließen. Dies brachte die Missionare in Konflikt mit chinesischen Grundbesitzern und Beamten sowie mit den mongolischen Nomaden, die auf schlechtere Weidegebiete abgedrängt wurden. Während des Boxer-Aufstands kam es zu Angriffen auf belgische Missionsstationen, mehrere Ordenspriester wurden umgebracht. Die Scheuter Missionare wirkten bis 1954 in der Inneren Mongolei und mussten unter Mao Zedong ihre Arbeit in China ganz einstellen. Erst in den letzten Jahren konnten sie wieder dort tätig werden. Inzwischen unterhält die Mission Scheut auch eine Station in Ulaanbaatar. Vgl. Alain Hanssen, Les méthodes d’évangélisation des Pères de Scheut durant l’entre-deux-guerres en Mongolie. In: BTNG-RBHC Nr. 17, 1986, S. 461-486 (als pdf. Datei im Internet); Patrik Taveirne, Han-Mongol Encounters and Missionary Endeavours. Leuven 2004; http://www.catholic.org.sg/web_links/scheut-cicm/china/index.php 816 Reisejournal 2, Eintrag vom 4.6.1928 817 Reisejournal 2, Eintrag vom 5.6.1928 818 Reisejournal 2, ebd. 819 Reisejournal 2, ebd. 820 Reisejournal 2, Eintrag vom 10.6.1928 821 Reisejournal 2, Eintrag vom 12.6.1928; Entwurf des Telegramms mit der Chiffrierung des Textes befindet sich im Nachlass Consten, Sgl. Scheluchin. 822 Über die Grabfunde in der Inneren Mongolei vgl. Hsueh-man Shen, Schätze der Liao – Chinas vergessenen Nomadendynastie (907–1125). Zürich 2006 823 Im Juni 1928 nahmen die Guomindang-Truppen Tientsin und Peking ein. Chiang Kaisheks Macht über ganz China war damit soweit gefestigt, dass seine nationalchinesische Regierung auch international anerkannt wurde. 824 Reisejournal 2, Eintrag vom 19.6.1928 825 Reisejournal 2, Eintrag vom 23.6.1928 826 Consten an Frau Herrmann, 24.6.1928 827 Reisejournal 2, Eintrag vom 25.6.1928 828 Reisejournal 2, Eintrag vom 26.6.1928 829 Reisejournal, ebd.; mit den Worten „… und weine um dich“ zitiert Consten den Titel seines Afrika-Buchs. 830 Der Halbsatz bezieht sich vermutlich auf Constens Beschäftigung mit der Unterwerfung der Chalch-Mongolen unter die Schutzherrschaft Kaiser Kangxis während der Belagerung ihrer Hauptstadt Ich Chüree durch den Oiratenführer Galdan, dem historischen Stoff für seinen Roman „Kampf um Buddhas Thron“. Der Erste Jebtsundampa Chutagt Zanabazar war mit etwa 140.000 seiner Untertanen in das fragliche Gebiet geflüchtet, deren Bewohner bereits dem Qing-Kaiser unterstanden. Die Chalch-Fürsten ersuchten Kaiser Kangxi um Unterstützung gegen Galdan. Sie wurde 1691 beim Fürstentreffen in Doloon Nuur feierlich besiegelt. Vgl. Michael Weiers, Geschichte der Mongolen , S. 195 f. 831 Reisejournal 2, Eintrag vom 16.7.1928 832 Reisejournal 2, Eintrag vom 19.7.1928
605
ANHANG 833 Consten hatte wohl von Mullie oder Kerwyn erfahren, dass bei Fürstenbestattungen die Körper der Toten einbalsamiert und mit Netzen aus Silber- oder Kupferdraht umhüllt wurden. Eine goldene Maske bedeckte das Gesicht. Vgl. auch Shen, Schätze der Liao, S. 98 834 Vermutlich Überreste der hölzernen Sarkophage, in denen die Toten beigesetzt waren. 835 Reisejournal 2, Eintrag vom 20.7.1928 836 Reisejournal 2, Eintrag vom 21.7.1928 837 Die Liao waren Anhänger des Buddhismus. Religiöse Darstellungen zeigen Buddhas und Bodhisattvas auch bei ihnen ohne Bart. Sehr wohl aber sind auf Wandmalereien in den Gräbern dort begrabene vornehme Herren mit Lippen- und Kinnbart dargestellt. Es ist also eher anzunehmen, dass es sich bei der von Consten beschriebenen Felsskulptur um eine aufrecht sitzende Herrscher- oder Wächterfigur handeln könnte. Vgl. auch Shen, Schätze der Liao, S. 114 f. 838 Reisejournal 2, Eintrag vom 4.8.1928 839 Reisejournal 2, Eintrag vom 6.8.1928 840 Bad Blankenburg 841 Reisejournal 2, Eintrag vom 26.8.1928 842 Reisejournal 2, Eintrag vom 31.8.1928 843 Doloon Nuur, Handels- und Verwaltungsstadt in der Inneren Mongolei, mit zwei bedeutenden kaiserlichen Klöstern, dem Šar (Gelben) und dem Chöch (Blauen) Süm mit mehreren tausend Lamas. Anweisungen der Pekinger Lama-Hierarchie für sämtliche Klöster der Inneren Mongolei erfolgten während der Qing-Dynastie in der Regel über Doloon Nuur, wo sich auch die Hauptdruckerei für lamaistische Schriften befand. Vgl. Robert J. Miller, Monasteries and Culture Change in Inner Mongolia. Asiatische Forschungen Band 2, Wiesbaden 1959. 844 Consten an Müllejans, 15.9.1928; Durchschrift im Nachlass, Sgl. Scheluchin. 845 IX. Panchen Lama Chökyi Nyima (1883–1937). Seine Residenz war das tibetische Kloster Tashilunpo. Er flüchtete nach einem Disput mit dem Dalai Lama im Dezember 1923 in die Innere Mongolei und unterstützte von dort den Protest der Lamas der Mongolischen VR gegen die Beschneidung ihrer Privilegien durch die sozialistische Regierung. Später gehörte er der Kommission für Mongolische und tibetische Angelegenheiten der chinesischen Nationalregierung an. 846 Erst im Oktober 2011 ist wieder ein offizieller Nachfolger des VIII. Jebtsundampa Chutagt zum Bogd Gegeen der mongolischen Buddhisten ernannt worden; Barkmann an Götting, 18.11.2011. 847 Reisejournal 3, Eintrag vom 20.9.1928; Hervorhebung durch Consten. Kopien zweier Briefe im Nachlass Consten, Sgl. Scheluchin. 848 Bei den von Consten erwähnten „mongolischen Pässen“ handelt es sich nicht um seine offiziellen Einreisepapiere, sondern um einen Schutzbrief des deutschen Generalkonsulats in Tientsin, in dem die mongolischen Grenzbehörden in Deutsch, Mongolisch und Russisch ersucht werden, Consten die Einreiseformalitäten zu erleichtern sowie um ein Schreiben des Wang der Abaga-Mongolen an den Grenzposten der Mongolischen Volksrepublik mit der Bitte, Constens Begleiter und die Kameltreiber ungehindert passieren zu lassen. Originale im Nachlass, Sgl. Scheluchin. 849 Reisejournal 3, Eintrag vom 30.9.1928 850 S. dazu auch Lattimore, Isono (Hrsg), The Diluv Khutagt, Autobiography, S. 176 f. 851 Reisejournal 3, Eintrag vom 15.10.1928; Erwähnung der „Demütigungen“ offenbar in Anspielung auf den ihm aufgenötigten Arbeitsvertrag mit Ethel John Lindgren 852 Reisejournal 3, Eintrag vom 18.10.1928; Hervorhebungen von Consten 853 Durchschriften der Telegramme im Nachlass Consten, Sgl. Scheluchin 854 Reisejournal 4, Eintrag vom 22.10.1928 855 Consten zitiert hier aus seinem Roman „Kampf um Buddhas Thron“. 856 Zum VII. Parteitag der MRVP s. Barkman, Geschichte der Mongolei, S. 278 857 tabun; russ. Pferdeherde
606
ANMERKUNGEN 858 Reisejournal 4, Eintrag vom 5.11.1928 859 Original der russisch geschriebenen, von Gorodeckii, Rabinovič und Kočetov unterzeichneten Erklärung im Nachlass, Sgl. Scheluchin. 860 Reisejournal 4, Eintrag vom 2.12.1928 861 Hinweis auf das „Sippung“ genannte wöchentliche Treffen der Schlaraffen in Saalfeld 862 russ. Zwieback 863 Journal 4, Eintrag vom 7.12.1928 864 Journal 4, Eintrag vom 12.12.1928; zwei Tage zuvor, am 10.12.1928, war nach 45 Tagen Dauersitzung der VII. Parteikongress der MRVP zu Ende gegangen, bei dem sich ein radikaler ideologischer Kurswechsel mit weitreichenden politischen Folgen durchzusetzen vermochte; vgl. Barkmann, S. 278. 865 Journal 4, Eintrag vom 23.12.1928 866 Journal 4, Eintrag vom 25.12.1928 867 Brief Consten an Dr. Schmelzer (Bad Blankenburg), 4.1.1929. Durchschrift im Nachlass, Sgl. Scheluchin. 868 Journal 5, Eintrag vom 2.1.1929 869 Brief Consten an „Ede bácsi“ (Budapest), 13.1.1929; Durchschrift im Nachlass, Sgl. Scheluchin 870 Brief Consten an Familie Dahme, 1.1.1929; Durchschrift im Nachlass, Sgl. Scheluchin. 871 Journal 5, Eintrag vom 17.1.1929 872 Brief Consten an Frau Herrmann (Karlsruhe), 6.1.1929; Durchschrift im Nachlass, Sgl. Scheluchin. 873 Ebd. 874 Brief Consten an Dr. Schmelzer, 6.1.1929; Durchschrift im Nachlass, Sgl. Scheluchin. 875 Journal 5, Eintrag vom 24.1.1929; über die Hintergründe des Machtkampfs zwischen dem nationaldemokratischen Flügel und den Befürwortern der Umwandlung der MRVP in eine Klassenpartei nach sowjetischem Vorbild, die mit dem ideologischen Sieg der Letzteren auf dem VII. Parteitag vom Oktober 1928 und dem Sturz der Regierung Amar endete, informiert ausführlich Barkmann, Geschichte der Mongolei, S. 276 ff. 876 Stormong war eine sowjetische Aktiengesellschaft, die seit 1927 Rohstoffe in der Mongolei aufkaufte und sowjetische Produkte verkaufte. Sie koordinierte und leitete außerdem die sowjetisch-mongolischen Handelsaktivitäten. Vgl. Barkmann, S. 274 877 Journal 5, Eintrag vom 5.2.1929 878 Vgl. L. Frédéric, Les Dieux du Bouddhisme. Paris 1992, S. 236; H. W. Schumann: Buddhistische Bilderwelt. Ein ikonographisches Handbuch des Mahayana- und TantrayanaBuddhismus. Köln 1986, S. 194 879 chadag; im tibetischen Buddhismus verbreiteter Segensschal aus weißer, gelber oder blauer Seide. 880 bumba; Flaschenbehälter für geweihtes Wasser. 881 gabala (sanskr. kapāla); Auffangschale, gelegentlich ein halbierter, mit Silber ausgekleideter Menschenschädel. 882 Journal 5, Eintrag vom 10.2.1929 883 towarišč; russ. Genosse, Kamerad; gemeint ist wohl in diesem Fall eine Frau: Ethel John Lindgren. 884 Journal 5, 10.2.1929 885 Erich Haenisch (1880–1966), Ordinarius für Sinologie an der Universität Leipzig, Mongolist, Übersetzer der Chronik „Geheime Geschichte der Mongolen“; hielt sich 1928/29 in der Mongolei und Peking auf. Die in der Akte „Expedition Consten“ des Auswärtigen Amtes vorhandenen Dokumente belegen ferner, dass sowohl das Generalkonsulat in Tientsin als auch die Deutschen Gesandtschaften in Peking und Moskau bereits ab Spätherbst 1928 mehrfach Nachforschungen nach dem Verbleib Hermann Constens angestellt hatten. Auch lag eine schriftliche Mitteilung Pater Daelmans vom Februar 1929 über Constens Verhaftung vor; vgl. PAdAA, IV Chi.R 9208/3563, Bl. 70/71-62
607
ANHANG 886 Reisejournal 5, Eintrag vom 17.2.1929 887 Reisejournal 5, Eintrag vom 20.2.1929 888 Laut Handelsregistereintrag vom 15.1.1929 hatte das Amtsgericht Aachen am 5. Dezember 1928 das Konkursverfahren über das Vermögen der Consten GmbH eröffnet. Handelsregister Aachen HRB 276, Bl. 3 889 Reisejournal 5, Eintrag vom 4.3.1929 890 Brief Consten an den Ehrenrat der „Arminia“ v. 30.1.1930, veröff. in: Bundesbrief der Karlsruher Burschenschaft „Arminia“, Jg. 2, Nr. 1, Februar 1930, S. 2 891 Vgl. Doris Götting, Das pädagogische Experiment – Mongolische Schüler und Berufspraktikanten in Deutschland (1926–1930). In: Mongolische Notizen Nr. 13/2004, S. 26; Udo B. Barkmann, Geschichte der Mongolei. Bonn 1999, S. 275; R. Turdalaj, Mongol-German sojol, bolovsrolyn charilcaa: Mongol ojuutan, suragčid German ulsad suralcan n’ 1926-1930. Ulaanbaatar 2004, S. 150 892 Zitat aus der geheimen Prozessakte E. Batchaans vom September 1937; wiedergegeben mit frdl. Genehmigung von A. Saruul (Ulaanbaatar), die auch die Übersetzung ins Deutsche vornahm. 893 Reisejournal 5, Eintrag vom 28.2.1929 894 Constens Desinteresse hatte – angestiftet durch Curt Alinge – eine gemeinsame Beschwerde deutscher, schwedischer und Schweizer Ingenieure aus Ulaanbaatar beim Deutschen Generalkonsulat in Tientsin zur Folge. Dieser habe es, als einziger Deutscher bisher, während seines sechswöchigen Aufenthaltes in der mongolischen Hauptstadt nicht für nötig befunden, sich mit dem Industrialisierungsprogramm der mongolischen Regierung, den dazu eingekauften deutschen Maschinen und Anlagen und den in Ulaanbaatar für das Programm tätigen Personen bekannt zu machen. Sie warnten die deutschsprachige Öffentlichkeit und die Medien in Tientsin eindringlich, irgendwelchen Behauptungen Constens Glauben zu schenken. PAdAA R 9208/3563, Bl. 45, 4.4.1929 895 Alinge hat u.a. Constens Antrag auf Einreiseerlaubnis und den Schriftverkehr des Generalkonsulats mit dem mongolischen Außenministerium ins Russische übersetzt; vgl. Archiv des Außenministeriums der Mongolei, Fond 1, Nr. 277 896 Reisejournal 5, Eintrag vom 7.3.1929. Im Nachlass (Sgl. Scheluchin) befindet sich eine russisch geschriebene Bankvollmacht Constens für Alinge, wo sein Name tatsächlich als Konstejn verschriftet erscheint; D.G. 897 Ethel John Lindgrens eigene Aufzeichnungen über ihre Ausweisung aus der Mongolei lassen auf politische Gründe schließen. Sie stand bei den mongolischen Behörden in dem Verdacht der Verbindung zu weißrussischen Kreisen. An anderer Stelle erwähnt sie wohl, die Tatsache, dass sie im Alter von 23 Jahren noch nicht verheiratet war und allein reiste, habe bei einigen Mongolen bzw. Burjaten, mit denen sie während ihres Aufenthaltes in Ulaanbaatar in Kontakt war, Verwunderung ausgelöst. Außerdem scheint sie schon kurz nach ihrer Ankunft im Juli 1928 vom sowjetischen Geheimdienst beschattet worden zu sein. HIA, Lindgren-Utsi Papers Box 4-1, Etcetera & Mongolica p. xx; Box 417 Urga Notes, p. 19, 24 898 Abschrift im Reisejournal 5, Eintrag vom 8.3.1929 899 Die Consten-Akte im Archiv des Außenministeriums der Mongolei enthält u.a. ein von Vizeminister Amgalan unterzeichnetes Schriftstück vom 7.3.1929, in dem die Aushändigung der beschlagnahmten Expeditionsausrüstung an Consten angeordnet wird. Fond 01, Nr. 223 900 Die Auskunft verdanke ich Dr. T. Galbaatar von der Mongolischen Akademie der Wissenschaften. 901 Reisejournal 6, Eintrag vom 28.3.1929 902 Reisejournal 6, Eintrag vom 8.4.1929 903 PAdAA R 9208/3563, Bl.54-60 904 Es handelte sich um einen mexikanischen Reitsattel samt Zaumzeug, den Consten während seiner Karawanenreise benutzt hatte. E. J. Lindgren hatte ihn C. Alinge als Dank für
608
ANMERKUNGEN
905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917
918
919
920 921
922
923 924 925
seine Hilfe zum Geschenk gemacht. Consten hatte zugesagt, Alinge den Sattel, „ein Prachtstück“, persönlich zu überbringen; er hatte dies jedoch nicht getan; vgl. Bericht Alinge PAdAA R 9208/3563, Bl. 11 Constens Schreiben an Lindgren vom 14.4.1929 ist im Anhang der Beschwerdeschrift Alinges zitiert. PAdAA R 9208/3563, Bl. 46 Reisejournal 5, Eintrag vom 11.2.1929 PAdAA R 9208/3563, Nr. 1878, Alinge an v. Borch 21.5.1929, Eingang Peking 13.6.1929 Gemeint war Margarete Strölin; D.G. Ebd. Bl. 4 f.; Alinges Bemühungen um Constens Weiterreise werden durch die im Archiv des Mongolischen Außenministeriums aufbewahrten Dokumente zum Fall Consten bestätigt. Ebd. Bl. 5 f. Ebd. Bl. 8 Ebd. Bl. 9 Ebd. Bl. 17 huqiao; chin. Einfuhrbescheinigung. In Constens Nachlass befindet sich ein chinesisches Dokument, auf das er nachträglich mit Bleistift „Einfuhr Kamele“ geschrieben hat. Ebd. Bl. 19 Ebd. Bl. 15 f. O. Bertram arbeitete in Peking für die Luft-Hansa; vgl. ADO 1930/31 (Adressbuch für das Deutschtum in Ostasien, herausgegeben von der Deutschen Wissenschaftlichen Buchhandlung G.C. Hirschfeld Gomei Kaisha, Kobe, Tokyo, Osaka und der Max Nössler & Co. GmbH in Shanghai.) Wilhelm Schmidt (1885–1933). Wie Hermann Consten war Schmidt ein guter Reiter, auch verbanden sie Erfahrungen mit der Türkei. Schmidt starb im April 1933 bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe des Chiemsees. Vgl. Kascha Gudrun Kloos: Mein Vater Wilhelm Schmidt – Mitbegründer der Eurasia Fluggesellschaft. In: StuDeO-Info April 2010, S. 17 ff. Paul Scharffenberg war Kanzler der Deutschen Gesandtschaft in Peking. Nach der Anerkennung der Regierung Chiang Kaisheks durch die Reichsregierung wurde er 1935 nach Nanking versetzt. Er war Zeuge der japanischen Massaker 1937 und berichtete über die Einrichtung einer Sicherheitszone für die chinesische Bevölkerung durch den deutschen Geschäftsmann John Rabe an das Auswärtige Amt. 1938 starb er in Nanking an den Folgen einer Lebensmittelvergiftung. Vgl. Erwin Wickert (Hrsg.) John Rabe. Der gute Deutsche von Nanking. Stuttgart 1997, S. 277 ff. Rudolf Sterz vertrat die Junkers Flugzeugwerft AG Dessau in Peking. Dupont an Consten, 19.6.1929. Dupont informierte Consten u.a., dass seine drei chinesischen Kameltreiber heil aus China zurückgekehrt seien und dass die belgischen Missionsstationen in der Inneren Mongolei im September 1929 geräumt und an chinesische Missionare übergeben werden müssten. Original d. Schr. im Nachlass, Sgl. Scheluchin. Betz hatte Consten schon am 23.3. in einem nach Ulaanbaatar gesandten Telegramm aufgefordert, den Forderungen Alinges unverzüglich nachzukommen. Seine Verärgerung schlug sich im Geschäftsbericht des Generalkonsulats Tientsin vom Februar 1930 nieder, wo Betz u.a. auf die Ausweisung der deutschen Fachleute aus der Mongolei im Sommer 1929 einging und in dem Zusammenhang noch einmal kritisch auf Consten zu sprechen kam: „In diesem Zusammenhange sei erwähnt, dass der sogenannte „Forschungsreisende“ Dr. (?) Hermann Consten durch sein nicht immer einwandfreies und offenbar ungeschicktes Verhalten bei einer Reise nach der Mongolei die Intervention des Generalkonsulats wiederholt notwendig machte.“ PAdAA R 9208, IV Chi zu Nr. 1133/30 Peiping (= nördlicher Friede) wurde die Stadt Peking (Beijing = nördliche Hauptstadt) nach dem Verlust ihres Hauptstadt-Status 1928 genannt, als Chiang Kaishek den Sitz seiner nationalchinesischen Regierung nach Nanking (Nanjing = südliche Hauptstadt) verlegte. PAdAA R 9208-3563, IV Chi Nr. 1415/29, Betz an Borch, 8.6.1929 PAdAA 9208-3563 IV Chi Nr. 1415/29, Borch an Betz, 13.6.1929
609
ANHANG 926 Zum sowjetisch-mongolischen Geheimvertrag s. Barkmann, S. 280 ff. 927 Alinges Bericht waren sechs Anlagen in Kopie beigefügt, darunter mehrere schriftliche Aufforderungen an Consten, die Ausrüstung zu übergeben, das Beschwerdeschreiben von sechs in Ulaanbaatar lebenden deutschen, schwedischen und Schweizer Bürgern über Constens Missachtung der von ihnen geleisteten Beiträge zum mongolischen Industrialisierungsprogramm und seinen Umgang mit den Ungarn Geleta und Roth sowie das bereits zitierte Schreiben Constens an Ethel J. Lindgren vom 15.4.1929. 928 Ebd. Betz an Borch, 17.6.1929 929 Ebd. Borch an Betz, 19.6.29 930 Dupont an Consten, 19.6.1929 931 Zhang Xueliang (1898–2001), auch „Der junge Marschall“ genannt. Sohn des 1928 ermordeten Marschalls Zhang Zuolin. Er schloss 1936 ein Geheimabkommen mit den Kommunisten zur Beendigung der innerchinesischen Kämpfe. Anschließend ließ er Chiang Kaishek in Xi’an gefangen setzen, um ihn zur Aufgabe des Bürgerkriegs und zur Bildung einer antijapanischen Einheitsfront mit den Kommunisten zu bewegen. Auf Druck Moskaus musste Chiang jedoch wieder freigelassen werden. Dieser ließ Zhang nach seiner Rückkehr nach Nanking vor Gericht stellen, das ihn zu zehn Jahren Haft verurteilte. Umwandlung der Haft in langjährigen Hausarrest, der nach Chiangs Niederlage und Flucht auf Taiwan fortgesetzt wurde. Zhang Xueliang kam erst nach dem Tod von Chiang Kaisheks Sohn und Nachfolger Chiang Chingguo im Jahr 1990 frei und wanderte kurz darauf nach Hawaii aus, wo er 2001 über hundertjährig starb. Vgl. China Handbuch, Düsseldorf 1974, Sp. 516; Dieter Heinzig: Die Sowjetunion und das kommunistische China 1945-1950. Baden-Baden 1998, S. 23 ff.; Wikipedia. 932 Zum chinesisch-sowjetischen Schlagabtausch 1929 s. Otto Hoetzsch: Der Konflikt zwischen Russland und China. In: Osteuropa Heft 4 (1928/29), S. 727 ff.; Udo Ratenhof: Wirtschaft, Rüstung und Militär in der Chinapolitik des Deutschen Reiches 1871-1945. Diss. Freiburg 1985, S. 357 933 Nachlass Consten, Sgl. Scheluchin. 934 Nach dem Abbruch der Beziehungen China-UdSSR und dem erneuten Aufwerfen der „mongolischen Frage“ durch Chiang Kaishek wurde die MRVP durch die Komintern angewiesen, die Mongolei nun auch außenpolitisch „gegen alle Tendenzen diplomatischer Tricks der internationalen Imperialisten“ zu immunisieren. Näheres bei Barkmann, S. 278 ff., S. 285 ff. 935 PAdAA R 9208 Nr. 2195/30 Lindgren-Mamen an Fischer 2.3.1931; das Visitenkarten-Klischee befindet sich im Nachlass Consten, Sgl. Strölin. 936 Die Korrespondenz von Orin de Motte Walker (Tientsin) mit der Gesandtschaft Peking befindet sich in der Akte „Expedition Consten“, PAdAA R 9208-3563, Nr. 1417, Bl. 54-57 937 Ein Brief vom Bundesbruder Consten. Bundesbrief der Karlsruher Burschenschaft „Arminia“, 2. Jg. Nr. 1, Februar 1930, S. 1 ff. 938 Consten an Grete Jacobi-Müller (früher Strölin), 8.10.1937 939 Karl Heinz Abshagen, Im Lande Arimasen. Stuttgart 1948, S. 324 940 Bundesbrief Arminia, S. 2 941 Reisejournal 5, 20.-22.3.1929 942 Reisejournal 2, Eintrag vom 14.7.1928 943 Bundesbrief Arminia,. S. 3 944 „Buch für Alle. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens“. Hermann Consten befand sich dort in Gesellschaft von Autoren wie Karl May, J. F. Cooper, Ottilie Wildermuth und Else Ury. 945 PAdAA R 9208-3563, Nr. 619 Union Deutsche Verlagsgesellschaft an Gesandtschaft Peking 30.1.1930 946 Hermann Kriebel war im Mai 1929 als Nachfolger des verstorbenen Oberst a. D. Bauer zum Leiter der deutschen Militärmission bei Chiang Kaishek berufen worden. Nach nur einem Jahr wurde er von Oberst a.D. Georg Wetzell abgelöst. Vgl. Ratenhof, S. 391;
610
ANMERKUNGEN 947
948 949 950 951
952
953
954
955 956
957
Astrid Freyeisen, Shanghai und die Politik des Dritten Reiches (Diss) Würzburg 2000, S. 73 ff.; zu Kriebels Rolle beim Putschversuch in München 1923 vgl. Teil IV, Kap. 3 DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Bl. 97, Strölin an Arning 12.8.1930; eine weitere Variante des Scheiterns der letzten Consten-Expedition findet sich bei Eleanor v. Erdberg, Der strapazierte Schutzengel, S. 148. Danach war er an der mongolischen Grenze von „den Russen“ gefangen genommen worden, die ihn umgehend liquidiert hätten, wenn er nicht so bekannt gewesen wäre. Zwar sei er „nach einigem diplomatischen Hin und Her“ freigekommen, doch hätten „die Russen“ seine Karawane und alle seine Habe behalten. Chef der Nachrichtenabteilung im Generalstab des Feldheeres für den Balkan war seinerzeit Major v. Roeder; vgl. Teil IV, Kap. 3 Margarete Strölin hatte wohl ganz richtig angenommen, dass es sich um Agentenberichte handelte. Consten an Strölin, 5.9.1930; Abschrift des Briefes in DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Bl. 106 Consten hatte sich hilfesuchend an die Studienkommission des Reichsverbandes der deutschen Industrie gewandt, die sich – nach mehrfachen Terminverschiebungen wegen der Bürgerkriegssituation – von März bis Juni 1930 in China aufhielt. Vgl. Ratenhof, S. 385; Schreiben Mayer an Arning vom 13.10.1930, DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten Bl. 113 Zu inneren Problemen in der deutschen Militärberaterschaft in Nanking vgl. Bernd Martin, Das Deutsche Reich und Guomindang-China 1927–1941. In: Guo Hengyu (Hrsg.): Von der Kolonialpolitik zur Kooperation: Studien zur Geschichte der deutsch-chinesischen Beziehungen. München 1986, S. 339 ff.; Ratenhof, S. 383 und 391 f., 398; Freyeisen, S. 73 f. Die Nanking-Regierung richtete 1928 als Nachfolgebehörde des Lifanyuan (Amt für die Verwaltung der Außenvölker) ein Komitee für mongolische und tibetische Angelegenheiten ein, um ihre Territorialansprüche auf die beiden Gebiete aufrechtzuerhalten. Noch 1985 konnte die Autorin im Büro Chiang Weiguos, des jüngsten Sohnes Chiang Kaisheks, in Taipei eine an der Wand hängende Landkarte studieren, auf der sowohl die Äußere Mongolei als auch Tibet als zu China gehörende Territorien ausgewiesen waren. Erst 1998 unter dem Demokraten Lee Tenghui gab die Republik China (Taiwan) ihren Anspruch auf und erkannte die inzwischen demokratisch gewordene Mongolei völkerrechtlich an. Sein Nachfolger Chen Shuibian lud den Dalai Lama als Staatsgast ein. Zu den Territorialansprüchen der Guomindang vgl. auch Sabine Dabringhaus: Territorialer Nationalismus in China: historisch-geographisches Denken 1900–1949. Köln/Weimar 2006, S. 160 f. Die Entsendung der Militärberater zu Chiang Kaishek war auf Betreiben der deutschen Rüstungsindustrie, vor allem der Unternehmen Stinnes, Krupp, Rheinmetall und Mauser erfolgt. Das Reichswehrministerium und das Auswärtige Amt waren mit Rücksicht auf die Westmächte und Japan gegen die Entsendung, konnten sie aber nicht verhindern. Vgl. Ratenhof, S. 377, 382 ff., 396 ff. Consten an Strölin, 5.9.1930 Consten an Strölin ebd. Das, was vom Archiv des Union-Verlags nach der Zerstörung des Verlagshauses in Stuttgart 1945 noch übrig ist, befindet sich heute im Historischen Archiv des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Frankfurt. Leider erbrachte die Recherche nach Gottlob Mayer und seiner besonderen Verbindung zu Hermann Consten kein Ergebnis. Auch im Stadtarchiv von Mayers späterem Wohnsitz Tübingen war nichts über einen eventuellen Nachlass des einstigen Verlagslektors bekannt. Was Fürstengräber in den Permafrostgebieten Zentralasiens an großartigen Schätzen bergen können, kam 2001 bei der Öffnung eines skythenzeitlichen Fürstenkurgan in Aržan (Russische Republik Tuva) durch eine deutsch-russische Archäologengruppe unter Leitung von Hermann Parzinger zu Tage; dort konnten ca. 6.000 Goldobjekte geborgen werden.
611
ANHANG 958 Consten an Strölin, 5.9.1930 959 DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten Bl. 113, Arning an Mayer 13.10.1930. Was Kriebels Stellung betraf, so hatte Consten Angaben aus seinem früheren Schreiben korrigiert. 960 DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten Bl. 115, Mayer an Arning 14.10.1930 961 Die Industrievertreter und die deutschen Handelshäuser in China empfanden die direkten, teilweise illegalen Waffengeschäfte der Militärberater als Konkurrenz. Vgl. Martin S. 353 f. 962 Gemeint sind die „Weideplätze der Mongolen“; D.G. 963 Mayer an Arning, 14.10.1930 964 Vgl. Teil IV, Kap. 4 965 Mayer an Arning ebd. 966 Mayer an Arning ebd. 967 Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, gegr. 1920 von Fritz Hahn und Friedrich Schmidt-Ott; Umbenennung in Deutsche Gemeinschaft zur Erhaltung und Förderung der Forschung (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 1929; Gleichschaltung 1934. Neugründung 1949. 968 Arning hat sich wohl im Januar 1931 in Berlin um ein Gespräch mit Schmidt-Ott über eine eventuelle Unterstützung für Consten bemüht. Über ein Ergebnis ist aber nichts bekannt. Arning an Mayer, 13.1.1931; DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten Bl. 130. Zur Unterstützung Lessings durch die Notgemeinschaft s. Susanne Grieder: Für mich heißt leben: Arbeiten. Ferdinand Lessing und Sven Hedins sino-schwedische Expedition in Briefen und Zitaten. In: Baessler-Archiv – Beiträge zur Völkerkunde, Bd. 50, Berlin 2002, S. 125 f. 969 Strölin an Arning 7.10.1930, DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten Bl. 117 970 Vgl. Ratenhof S. 391 f.; Berleb S. 126 971 Arning an Zanthier, 16.10.1930, DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Bl. 121 972 Arning an Escherich 17.10.1930, DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten Bl,. 123; Kriebel erklärte später, er habe den Brief nicht erhalten und äußerte die Vermutung, Escherich, mit dem er sich bereits 1922 überworfen hatte, habe ihn nicht weitergeleitet; vgl. Kriebel an Arning 14.4.1931, DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Bl. 132 973 Consten an Arning 6.10.1930, DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Bl. 127 974 Constens erste Adresse lautete Shi Yang Yi Er, Sung Shu Yuan 12 (ADO 1930/31). Nach dem Umzug wohnte er in der Lao Chien Yü, Pao Chan Ta Miao 16. Beide Viertel sind im Zuge der Modernisierung Pekings unter Mao und seinen Nachfolgern verschwunden. Für Auskünfte über die Topografie Pekings in den 20er und 30er Jahren und die Lage von Constens Anwesen danke ich Renate Jährling und Anita Günther vom StuDeO-Archiv sowie Marino Riva (Pavia). 975 Dass es sich um die für die Expedition angeschafften amerikanischen Sättel handelte, wird bestätigt bei E. v. Erdberg: Der strapazierte Schutzengel, S. 150: „Die Sättel waren amerikanisch. Etzel hatte einen echten Cowboy-Sattel [d.i. der mexikanische Sattel, den Lindgren Alinge für seine Dienste in Ulaanbaatar versprochen hatte; D.G.], ich einen von den Marinesoldaten abgelegten; die Steigbügel waren aus gebogenem Holz mit einem festen Lederschurz vor der Fußspitze. All dies war weit bequemer als europäisches Sattelzeug …“ 976 Laut Freyeisen, S. 74 ff. war Kriebel 1930 zunächst nach Shanghai versetzt worden. Zwischenzeitlich hielt er sich in Deutschland auf und kehrte 1934 als Generalkonsul nach Shanghai zurück. Aus der im Bundesarchiv/Militärarchiv in Freiburg aufbewahrten Korrespondenz Wetzells mit Brinckmann geht jedoch hervor, dass sich Kriebel noch 1933 in China aufhielt. Er kann also nur kurzzeitig in Deutschland gewesen sein, bevor er 1934 als Generalkonsul nach Shanghai kam. Vgl. Wetzell an Brinckmann 28.5.1933. BA/MA, MSg 160/4, Bl. 108 977 Kriebel an Arning 14.4.1931, DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Bl. 132
612
ANMERKUNGEN 978 Consten an Mayer 31.7.1931, DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Bl. 141 979 Vgl. K.W. Streit: John W. R. Taylor, Geschichte der Luftfahrt. Sigloch Service Edition 1975, S. 207 ff.; Max Springweiler: Flugpionier in China, Hamburg 1996, S. 40 ff.; Klaus Koppe: „Wurden beschossen – landen – am Buir Nor“ (Buudla – Buula Buir Noor) – Ein deutsch-chinesisches Luftfahrtunternehmen vor 65 Jahren. In: Mongolische Notizen Nr. 5/1996, S. 32 ff. 980 Renate Scharffenberg, „Eine Kindheit in Peking“. Vortrag bei philoSOPHIA Marburg 10.5.2007; als pdf-Datei im Internet veröffentlicht. 981 Arning an Mayer 18.12.1931, DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Bl. 142 982 Hertha Bälz-Wermbter an Renate Jährling 26.5.2008 983 Soldaten der japanischen Kwantung-Armee hatten am 18.9.1931 bei Mukden einen angeblich von Chinesen verübten Bombenanschlag vorgetäuscht und dies zum Anlass für die Besetzung der Mandschurei und eine Invasion in Nordchina genommen, gegen die Zhang Xueliang machtlos war. Derweil waren Chiang Kaisheks Truppen durch Kampagnen gegen die Kommunisten im Süden gebunden. Erst im Januar 1932 konnte der japanische Vormarsch in den Kämpfen um Shanghai gestoppt werden. Vgl. Stefan Berleb: „… for China’s Benefit“. The Evolution and Devolution of German Influence on Chinese Military Affairs, 1919-1938. (Diss.) Brisbane 2005, S. 135 984 Mayer an Arning, 23.12.1931, DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten Bl., 146; der Hinweis auf die Amerikaner, die in der Nähe von Constens Fundstelle graben würden, bezieht sich vermutlich auf die Expedition des US-Naturwissenschaftlers Roy Chapman Andrews, der u.a. in der Nähe des Bajdrag-Gebiets auf versteinerte Dinosaurier-Eier gestoßen war und mit seinen Funden weltweites Aufsehen erregt hatte. Diese Expedition lag aber schon einige Jahre zurück. Auch Andrews und seinem Team war 1929 die weitere Arbeit in der Mongolei vom dortigen Regime untersagt worden. 985 Vgl. Donald McKale: The Nazi Party in the Far East, 1931-45. In: Journal of Contemporary History Nr. 12 (April 1977), S. 292; Freyeisen, S. 65 ff. 986 Lt. Auszug Zentralkartei der NSDAP im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde. 987 Zitat aus dem Tagebuch eines jungen Mannes, dessen Vater mit Consten befreundet war. Unveröff. Privatmanuskript. 988 Ebd. „C. wird oberster Nazi-Hauptmann und trinkt infolge seiner plötzlichen Bedeutung auf jedermanns Kosten.“ 989 Lt. Auskunft Paul W. Wilm v. 20.6.1996; Gesprächsnotiz von R. Jährling und A. Günther (StuDeO e.V.) 990 Ce Shaozhen, Flaneur im alten Peking. München (dtv) 1990, S. 181 f. 991 Ebd. 992 Noch 2010 bekannte Dr. Renate Scharffenberg, Tochter des damaligen Botschaftskanzlers Paul Scharffenberg, gegenüber der Autorin: „Er konnte wunderbar erzählen, spannende Geschichten, Abenteuer, sprach aber wenig über sich selbst.“ Dennoch war ihr schon als Kind bekannt, dass er als Spion gearbeitet hatte – „was ihn noch interessanter machte“. Man habe ihn deswegen bewundert. 993 ADO 1934/35; NSDAP-Zentralkartei im Bundesarchiv Lichterfelde. Eine Kopie des Parteiausweises muss sich auch im Nachlass Consten befunden haben; Jährling an Götting 10.4.2008: „Bei unserem letzten Besuch bei Frau Prof. v. Erdberg sahen wir unter den für die Consten-Biographie gesammelten Dokumenten eine Kopie des Parteiausweises von Herrn Consten.“ 994 Eleanor von Erdberg, Der strapazierte Schutzengel, Waldeck 1994, S. 148 f. 995 Lt. Auskunft Klaus Strölin; D.G. 996 Der Stahlhelm wurde unter der Bezeichnung Nationalsozialistischer Deutscher Frontkämpferbund in die SA eingegliedert und 1935 ganz aufgelöst. 997 E. v. Erdberg erwähnt in ihren Memoiren, die Deutsche Botschaft in Tokyo sei im Zusammenhang mit einem Japan-Besuch Constens 1936 vorgewarnt worden, dass sich „ein gewisser Consten“ um eine Stelle in Japan bemühen könnte. E. v. Erdberg, S. 165.
613
ANHANG 998 Siehe Constens Bemerkung über Ossendowski, den „Judenschützling“ (Consten an Bindel 13.6.1924, DITSL, Archiv der DKS, Schülerakte Consten, Bl. 78); vgl. auch E.J. Lindgrens Vorurteilsstudie, in der sie bei Consten antisemitische Ressentiments feststellte (HIA, Lindgren-Utsi Papers, Box 4-6, Psychological Memoranda, S. 4, 6) 999 Vgl. Reisejournal 3, Eintrag vom 25.9.1928, beim Abschied von Uniutai: Und morgen wandere ich weiter, der „Ewige Jude“! 1000 Bestätigt wird diese Einschätzung durch das Schreiben von Frau Renate Jährling (StuDeO e.V.) an die Autorin vom 10.4.2008 1001 Eleanor von Erdberg (1907–2002), Tochter eines baltischen Barons und einer Amerikanerin, in Berlin geboren, Kunsthistorikerin. Nach der Promotion in Bonn spezialisierte sie sich an der Harvard Universität (Radcliffe College) auf ostasiatische Kunst, mit Studienjahren in Tokyo und Kyoto. 1936 heiratete sie Herman Consten und lebte mit ihm bis 1950 in Peking. 1950/51 gemeinsame Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland, wo Eleanor von Erdberg-Consten an der TH Aachen eine Professur für ostasiatische Kunst und chinesische Architektur erhielt. Nach Constens Tod 1957 übernahm sie außerdem Lehraufträge an den Universitäten Bonn und Köln sowie Gastprofessuren in den USA. Sie beteiligte sich an Ausgrabungen auf den Philippinen und veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten über die Kunst Ostasiens, u.a. über altchinesische Bronzen, Literatenmalerei, japanische Volkskunst und Architektur. In zweiter Ehe verheiratet mit ihrem Vetter Robert von Erdberg, der in den USA lebte und den sie neun Jahre lang nur in ihrer vorlesungsfreien Zeit sehen konnte. Ab 1970 lebten sie zusammen in Aachen, wo er 1987 starb. Sie selbst starb 2002, ebenfalls in Aachen. 1002 E. v. Erdberg, S. 142 1003 Ebd. S. 143 1004 Ebd. S. 145 1005 Ebd. S. 146 1006 Ebd. S. 164 1007 Ebd. S. 164 1008 Ebd. S. 145 1009 Consten bezieht sich auf das Heike Monogatari, die Geschichte der kriegerischen Auseinandersetzungen zweier mächtiger Clans im Japan des 12. Jahrhunderts, die er in einer deutschen Übersetzung kennenlernte und offenbar direkt in romanhafter Form niederschrieb. E. v. Erdberg erwähnte in einem Brief an Klaus Strölin vom 7.1.1995 ein fertiges Manuskript zu diesem Thema, das jedoch keinen Verlag gefunden habe. Es war im Nachlass nicht mehr auffindbar. Der Mongoleneinfall Chubilaj Chaans meint die beiden gescheiterten Angriffe mongolischer Flotten 1274 und 1281 auf die japanische Insel Kyushu. Es handelte sich um die einzigen ausländischen Invasionsversuche in der japanischen Geschichte vor 1945, als die Amerikaner das Land besetzten und Japan zur Kapitulation zwangen. Die beiden mongolischen Angriffe konnten dank heftiger Stürme (kamikaze = Götterwind) abgewehrt werden. 1010 Consten an Jacobi-Müller (Strölin), 28.8.1936 1011 Consten an Jacobi-Müller, Anfang Nov. 1938 1012 E. v. Erdberg, Der strapazierte Schutzengel, S. 182 1013 Consten an Jacobi-Müller (Strölin), 7.6.1937 1014 okusan; jap. ehrenhafte Bezeichnung für eine verheiratete Frau; entspr. chin. taitai. 1015 Consten an Jacobi-Müller, 7.6.1937 1016 KdF: Abkürzung für das nationalsozialistische Massenerholungsprogramm „Kraft durch Freude“; D.G. 1017 Consten an Jacobi-Müller, 7.6.1937 1018 Günther Huwer, Erinnerungen eines deutschen Arztes. Unveröffentlichtes Typoskript, S. 118; StuDeO-Archiv Nr. 2049 1019 Hermann Consten: Hunnenzüge (Zentralasien) um 100 v. Chr.; Farbzeichnung im Maßstab 1:50.000; 29 x 18 cm; StuDeO-Archiv
614
ANMERKUNGEN 1020 Hermann Consten: Handelsstraßen zwischen China und Afghanistan um 100 n. Chr.; Farbzeichnung 1: 5 Mio., 36 x 25 cm; StuDeO-Archiv 1021 E. v. Erdberg, Der strapazierte Schutzengel, S. 184 1022 So soll Consten einmal im Zorn seinen kostbaren Jadearmreif nach seiner Frau geworfen haben. Der Reif traf sie nicht, sondern zerschellte an der Wand. Sie hat die Einzelstücke von einem Restaurator mit Silberklammern wieder kunstvoll zusammenfügen lassen. In dieser Form existiert der Armreif noch im Nachlass. 1023 E. v. Erdberg, S. 214 ff. 1024 Ebd. S. 217 1025 Consten an Grete Jacobi-Müller, 10.7.1937 1026 Consten an Grete Jacobi-Müller, 4.9.1937 1027 Ebd. 1028 Consten an Grete Jacobi-Müller, 8.10.1937 1029 E. v. Erdberg, S. 244 1030 Ebd. S. 222 1031 Freyeisen, S. 206 f. 1032 Zur China-Politik des Dritten Reiches s. Martin, S. 360 ff. 1033 Consten an Grete Jacobi-Müller, 8.10.1937 1034 Ebd. 1035 E. v. Erdberg, S. 240 1036 Lily Eversdijk-Smulders (1903–1994) verbrachte 40 Jahre auf Reisen durch die Welt, um Menschen aller Rassen und Volkszugehörigkeiten zu porträtieren. Sie hinterließ etwa 1000 solcher Pastellzeichnungen, fotografierte, schrieb Aufsätze und Bücher. Besprechung ihrer Ausstellungen in Peking in der South China Morning Post, 19.8.1938 1037 E. von Erdberg erwähnt in ihren Memoiren, dass Constens Hemden aus amerikanischen Bettlaken angefertigt wurden; s. Der strapazierte Schutzengel, S. 259 1038 Bilder aus der Ferne – Historische Fotografien des Mongoleiforschers Hermann Consten. Forum für Fotografie Köln, Juni-August 2005 1039 Andriesse an Götting, 28.10.2005; 17.11.2005 1040 Laut A. Pozdneev (Buddhistische Klöster und buddhistische Geistlichkeit in der Mongolei; St. Petersburg 1878) unterweist ein Gelen (Gälün), also ein Lama und Lehrer, der die höheren Weihen abgelegt hat, jüngere Mönche und Adepten, aber auch Laien. Er ist ein gelehrter Steppenlama, der viel auf Reisen ist. In Constens Nachlass (Seminar für Sprache und Kultur Zentralasiens, Universität Bonn) fand sich das Typoskript einer möglicherweise von Consten selbst stammenden deutschen Übersetzung der wichtigsten Kapitel von Pozdneevs Werk. Dort werden die Aufgaben eines Gelen ab S. 169 ff. eingehend beschrieben. 1041 Zur Kartensammlung Consten s. Teil II, Kap. 2 1042 Consten an Grete Jacobi-Müller 12.2.1939 1043 Owen Lattimore, The Diluv Khutagt, S. 11 1044 Ebd. 1045 Consten an Grete Jacobi-Müller, 19.11.1938 1046 Consten an Grete Jacobi-Müller, Anfang November 1938 1047 Ebd. 1048 Consten an Grete Jacobi-Müller, 12.2.1939 1049 Ebd. 1050 E. v. Erdberg, S. 254 f. 1051 Zur Geschichte der Furen-Universität s. John Chujie Chans Dissertation 2003 und Ce Shaozhen, S. 129 1052 E. v. Erdberg, S. 246 1053 Hermann Consten: Die Geisterstraße. Ein Ritt zur Totenstadt der Ming-Dynastie. In: Bibliothek des Wissens und der Unterhaltung, Bd. VI, Jg. 1932, S. 148-165 1054 Consten an Grete Jacobi-Müller, 10.11.1938 u. 12.2.1939
615
ANHANG 1055 E. v. Erdberg, S. 258; zu „XX.Century“ s. Klaus Mehnert, Ein Deutscher in der Welt – Erinnerungen 1906-1981. Stuttgart 1981, S. 258 ff.; Freyeisen, S. 286 ff.; Michael Kohlstruck, Klaus Mehnert und die Zeitschrift XX. Century. In: Armbrüster/Kohlstruck/Mühlberger: Exil Shanghai 1938-1947. Berlin 2000, S. 247 f.; einer der Aufsätze Eleanor von Erdbergs, „Landscape Painting – East and West“, wurde von der University of Hawaii ins Internet gestellt: http://libweb.hawaii.edu/libdept/russian/XX/PDF/21-Volume2.pdf 1056 E. v. Erdberg, S. 257 1057 E. v. Erdberg, S. 286 1058 Ebd.; vermutlich stammte von dem Russen ein Eintrag von fremder Hand zum Stichwort „Mongolei-Reise u. Karawanenroute“ über die ersten russischen Handelskarawanen in die Mongolei im frühen 18. Jahrhundert. Staatsbibliothek Berlin, Nachlass Consten Hs.Or.Sim.7242, Kasten 26, Bl.45688/89 1059 Max Loehr (1903–1988), lebte von 1940–1949 in China. Er war auf altchinesische Bronzen spezialisiert, veröffentlichte aber auch Arbeiten über Jade-Objekte, Malerei und Landschafts-Holzschnitte. Später lehrte er in München, Ann Arbor und Harvard. 1060 Staatsbibliothek Berlin, Nachlass Consten Hs.Or.Sim.7242, Kasten 19, Bl. 35378 u. 35384 1061 Auskunft StuDeO-Archiv 11.4.2008 1062 E. v. Erdberg, S. 287 1063 Auf die Systematik und eine wissenschaftliche Beurteilung der Zettelsammlung zur „Encyclopedia Mongolica“ soll im Schlusskapitel näher eingegangen werden; D.G. 1064 Die Identifikation und Zuordnung der einzelnen Namen verdanke ich Frau Renate Jährling vom StuDeO-Archiv. 1065 E. v. Erdberg, S. 286 f. 1066 Paul W. Wilm: Damals – Erinnerungen aus China, der Mongolei und dem übrigen Fernen Osten. Studien, Quellen und Perspektiven zum Leben der Deutschen in Ostasien, Bd. 1, hrsg. Vom Studienwerk deutsches Leben in Ostasien e.V. Bonn 2000, S. 270 1067 E. v. Erdberg, S. 265 1068 Wilm, S. 274 1069 E. v. Erdberg, S. 260 f. 1070 Vgl. Emily Lehman: Scheitern, um zu begreifen. Als Missionarin und Pfarrfrau in China 1936–1949. Berlin 1997, S. 353 1071 Lehman, S. 357 1072 Vgl. Mehnert, S. 293 ff., Lehman, S. 359 1073 Die Bekanntschaft ist in den Memoiren Eleanor von Erdbergs nicht erwähnt, doch äußerte sie gegenüber Rita Mielke, Heissig habe sein Pferd in Constens Stall in Peking stehen gehabt und man wäre einander fast täglich begegnet. Heissig selbst will Consten in jener Zeit nur ein oder zweimal länger gesprochen haben. (Mielke an Götting 24.1.2001) 1074 Über Walther Heissig und das Shanghaier Kriegsverbrechertribunal s. Herbert Tichy: Was ich von Asien gelernt habe. Wien 1984, S. 81 ff.; eine polemische Darstellung des Shanghaier Kriegsverbrecherprozesses findet sich bei C.W. Liau: Nazis in Shanghai. In: Die Weltbühne, 11.1.1949, S. 55 ff.; 18.1.1949, S. 88 ff.; 15.3.1949, S. 375 ff. 1075 E. v. Erdberg, S. 288 1076 E. v. Erdberg, S. 296 1077 Zur militärischen Lage in China nach 1945 vgl. Chen Jian: China in 1945: From AntiJapanese War to Revolution. In: Gerhard Krebs, Christian Oberländer (Hg.): 1945 in Europe and Asia. Reconsidering the End of World War II and the Change of the World Order. Monographien aus dem Deutschen Institut für Japanstudien der Philipp-von-SieboldStiftung Band 19, München 1997, S. 213 ff. 1078 E. v. Erdberg, S. 298 f. 1079 Consten an Klaus Strölin, 8.12.1948 1080 Ebd. 1081 E. v. Erdberg, S. 302; sie gibt irrtümlich die Woche vor Weihnachten 1948 an. 1082 Ebd. S. 302 ff.
616
ANMERKUNGEN 1083 Ebd. S. 309; Riva an Götting, 24.11.2008: „Am 27. September 1950 wurde mein Vater sowie unser deutscher Nachbar, Herr Genthner und unser japanischer Nachbar, Herr Yamaguchi festgenommen. Die drei Familien wurden für die Dauer von etwa zwei Monaten unter Hausarrest gestellt. Am 8. August 1951 wurden mein Vater und Herr Yamaguchi erschossen. Tags darauf erfuhren die Familien, dass sie eines Komplotts zur Ermordung von Mao bezichtigt waren.“ 1084 E. v. Erdberg, S. 311 f. 1085 Ebd., S. 314 1086 Ebd., S. 316 ff. 1087 Ebd., S. 325 1088 Ebd., S. 328 1089 Ebd., S. 331 f. 1090 Aachener Volkszeitung, 9.3.1953 1091 Aachener Volkszeitung, 28.12.1954 1092 E. v. Erdberg, S. 331 1093 Ebd. 1094 Information Strölin, 30.8.2007 1095 Ebd., S. 341 f. 1096 Ebd., S. 342 1097 Ebd., S. 343 1098 Ebd., S. 339 1099 Hermann Consten: Zwischen Halbgöttern und Banditen in der Mongolei. Erinnerungen eines Forschungsreisenden. Sendemanuskript WDR, Sendetermin: 11.5.1957; Kopie des Sendemanuskripts im Nachlass (Sgl. Scheluchin). Eine Anfrage beim Schallarchiv des WDR ergab, dass das Sendeband im Zuge der Digitalisierung alter Tondokumente gelöscht worden ist. Auch im Rundfunkarchiv in Frankfurt befindet sich keine Kopie der Sendung mehr; D.G. 1100 E. v. Erdberg, S. 348; Consten starb am 4.8.1957 1101 E. v. Erdberg an Klaus Strölin, 3.7.1986 1102 E. v. Erdberg an Fam. Strölin, 17.9.1986 1103 E. v. Erdberg an Fam. Strölin, 7.1.1995 1104 Ebd. 1105 Ebd. 1106 Einige der Fotos aus dem Besitz des Bonner Zentralasien-Seminars konnten 2005 in der Ausstellung „Bilder aus der Ferne“ – Historische Fotografien des Mongoleiforschers Hermann Consten gezeigt werden; D.G. 1107 Michael Balk: Consten’s Universal Dictionary. Erscheint in: Unknown Treasures of the Altaic World in Libraries, Archives and Museums. Proceedings of the 53rd PIAC, St. Petersburg July 2010. Edited by Tatiana Pang, Simone-Christiane Raschmann and Gerd Winkelhane. Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker Bd. 13, Klaus Schwarz Verlag. Berlin 2013 1108 Doris Götting: Hermann Constens Nachlass in der Berliner Staatsbibliothek. Ein Bestandsbericht. In: Mongolische Notizen – Mitteilungen der Deutsch-Mongolischen Gesellschaft e.V. Nr. 11/2002, S. 38 ff. 1109 Weg 2 war Constens Route 1928. Der Eintrag ist außerdem ein Hinweis darauf, dass er sich schon 1922 mit dem Gedanken getragen hat, eine weitere Mongolei-Reise zu unternehmen, diesmal über China; D.G. 1110 Consten hat sich bei diesem Eintrag nicht mehr die Mühe gemacht, in seinem eigenen Werk die Seiten aufzusuchen, auf denen der Begriff Obo vorkommt; D.G.
617
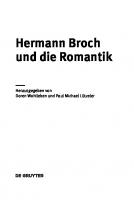






![Schweigers Outdoorküche: Die besten Rezepte für Abenteurer und Feinschmecker [2 ed.]
9783833879630, 9783833884672, 3833879637](https://ebin.pub/img/200x200/schweigers-outdoorkche-die-besten-rezepte-fr-abenteurer-und-feinschmecker-2nbsped-9783833879630-9783833884672-3833879637.jpg)
![Der Chemiker als Forscher: Die Grundlagen des chemischen Wissens [2. Auflage. Reprint 2019]
9783486772135, 9783486772128](https://ebin.pub/img/200x200/der-chemiker-als-forscher-die-grundlagen-des-chemischen-wissens-2-auflage-reprint-2019-9783486772135-9783486772128.jpg)