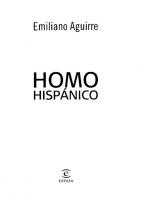Homo Pictor 9783110955583, 9783598774188
247 59 28MB
German Pages 403 [468] Year 2001
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
I
Repräsentation - Präsentation - Präsenz. Auf den Spuren des homo pictor
Spiegel, Spur und Blick. Zur Genese des Bildes
Der Philosoph als Maler - der Maler als Philosoph. Zur Relevanz der platonischen Kunsttheorie
II
Ein Bild vor dem Bild? Die ältesten menschlichen Artefakte und die Frage des Bildes
„Hieroglyphisch denken“. Bild und Schrift im alten Ägypten
Zur Genese des „Bildes“ in geometrischer und archaischer Zeit
„Wozu Menschen oder Blumen malen?“. Medienanthropologische Begründungen der Malerei zwischen Hochmittelalter und Frührenaissance
Über Phantasie und Kunst
„Nicht von Menschenhand“. Zur fotografischen Entbergung des Grabtuchs von Turin
Mickey Mao. Glanz und Elend der virtuellen Ikone
III
Wenn Gedächtnis Erinnerungsbild wird: Husserl und Freud
Das nachlebende Bild. Aby Warburg und Tylors Anthropologie
IV
Der Eigensinn der Götterbilder in antiken religiösen Diskursen
Warum im Jerusalemer Tempel kein anthropomorphes Kultbild gestanden haben dürfte
Bildresistenz des Göttlichen und der menschliche Versuch, Unsichtbares sichtbar zu machen. Feindschaft und Liebe zum Bild in der Geschichte der Mystik
V
Die imagines maiorum: ein Problemfall römischer und neuzeitlicher Ästhetik
Der Politiker am Fenster. Zur historischen Ikonographie eines „lebenden Bildes“
VI
Bezeichnung und Bedeutung. Wortgeschichtliche Streifzüge im Sinnbezirk des Bildes
Kritzeln, Schaben, Übermalen. Bild-Löschung als narratives Verfahren bei Hoffmann, Balzac, Keller und Hofmannsthal
VII
Epilog
Tafelanhang
Recommend Papers

File loading please wait...
Citation preview
Colloquium Rauricum Band 7 Homo Pictor
Colloquia Raurica Die Colloquia Raurica werden alle zwei Jahre vom Collegium Rauricum veranstaltet. Sie finden auf Castelen, dem Landgut der Römer-Stiftung Dr. René Clavel in Äugst (Augusta Raurica) bei Basel, statt. Jedes Colloquium behandelt eine aktuelle geisteswissenschaftliche Frage von allgemeinem Interesse aus der Perspektive verschiedener Disziplinen. Den Schwerpunkt bilden dabei Beiträge aus dem Bereich der Altertumswissenschaft. U m möglichst vielseitig abgestützte Erkenntnisse zu gewinnen, erörtern die eingeladenen Fachvertreter das Tagungsthema im gemeinsamen Gespräch. Die Ergebnisse werden in der Schriftenreihe „Colloquia Raurica" publiziert. Das Collegium Rauricum Joachim Latacz Jürgen von Ungern-Sternberg Hansjörg Reinau Peter Blome
Colloquium Rauricum Band 7
Homo Pictor Herausgegeben von
Gottfried Boehm Redaktion: Stephan E. Hauser
K • G • Saur München • Leipzig 2001
Gedruckt mit Unterstützung von Herrn und Frau Dr. Dr. h. c. Jakob und Antoinette Frey-Clavel, Basel
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme H o m o pictor / hrsg. von Gottfried Boehm. München ; Leipzig : Saur, 2001 (Colloquium Rauricum ; Bd. 7) ISBN 3-598-77418-4 © 2001 by K. G. Saur Verlag GmbH, München und Leipzig Printed in Germany Alle Rechte vorbehalten. All Rights Strictly Reserved. Jede Art der Vervielfältigung ohne Erlaubnis des Verlages ist unzulässig. Layout des Tafelteiles: Karin Stötzer Gesamtherstellung: Druckhaus „Thomas Müntzer" GmbH, 99947 Bad Langensalza
GOTTFRIED B O E H M
Vorwort Mit diesem Band erweitern die Colloquia Raurica erstmals das Terrain auf die stummen Zeugen der Geschichte. Die besondere Widmung der Aufmerksamkeit, die bei diesen Gesprächen der Alten Welt gilt, war bislang vom Vorrang des Wortes geprägt, der in einem Gegensatz steht zur Fülle der materiellen Zeugnisse jener Vergangenheit. Aber nicht nur die Steine sprechen, sondern auch die bildnerischen Hervorbringungen jedweder Art, die von den Tiefen der Prähistorie bis in die Gegenwart eine eindrucksvolle und zunehmend dichte Kontinuität beweisen. Hinter jener bildnerischen Uberlieferung wird in diesem Band ein anthropologisches Bedürfnis vermutet, das sich im Namen des homo pictor personifiziert. Seitdem Hans Jonas dieses Wort in den sechziger Jahren als Analogiebildung zum homo faber oder auch zum homo habilis ins Gespräch gebracht hatte, wohl auch in der Annahme, dass zur Existenzweise des Menschen nicht nur der Logos, sondern ebenso sehr sein bildnerisches Vermögen zählt, hat sich das Interesse an diesem Aspekt deutlich verstärkt. Die Bildpotenz rückte von der Peripherie humaner Tätigkeiten und vom Rande der kulturellen Welt zunehmend ins Zentrum. Die Rede von einer „Wende zum Bild" ist in diesen Jahren in vieler Munde. Sie verweist, bei aller Floskelhaftigkeit, auf tiefgreifende Veränderungen im Bildbewusstsein und Bildgebrauch, wie sie durch die experimentelle künstlerische Moderne und durch die digitale Revolution ausgelöst wurden. Damit verbindet sich aber nicht nur eine große Aufmerksamkeit für das Bild, sondern auch für die mit ihm verbundenen Problemstellungen. Neuerdings ist von den Möglichkeiten einer „Bildwissenschaft" die Rede, die in Analogie zur phasenweise überaus erfolgreichen und tonangebenden „Sprachwissenschaft", Grammatik und Syntax der visuellen Ausdrucksformen erkunden soll oder möchte. Allenfalls die Konturen eines solchen Projektes sind gegenwärtig erkennbar und die Frage ist offen, ob sich hinreichende Fundamente überhaupt schaffen lassen, um ihr einen sicheren Stand zu geben. Es hat den Anschein, als sollten Begriffe wie Anthropologie oder Bildwissenschaft die Dominanz der Geschichte oder der Historiographie untergraben bzw. verdrängen. Diese Absicht möchte der Herausgeber dementieren. Wohl aber räumt er die Verlegenheit ein, dass die Kategorie des Historischen nicht nur im Hinblick auf die Kunst, sondern noch viel mehr mit Blick auf die alte Realität der Bilder ihre Selbstsicherheit eingebüßt hat. Wie eine Geschichte der Bilder - das natürliche Pendant einer Bildwissenschaft — aussehen könnte, ist eine offene Frage.
VI Aber gerade diese offenen Horizonte, die starken Turbulenzen, die von der Peripherie her die zentralen Bestimmungen der Geistes- und Kulturwissenschaften erfasst haben, fordern heraus. Sie veranlassen zu einer Orientierung und Reformulierung der gemeinsamen Aufgaben. Die Rolle des Bildes bietet sich dabei als Leitkategorie für eine ganze Reihe von Fächern und Diskursen an. Es ist eine Gesprächsgemeinschaft aus zahlreichen Disziplinen, die in diesem Band Einblick in ihre Debatten gibt, in der Meinung, damit dem rapiden Fortgang der Entwicklungen zu folgen. Wie immer, so war auch dieses Symposion nur möglich durch ein Opfer: das Opfer von Zeit, Aufmerksamkeit und Arbeitskraft der Beteiligten, die sich verlocken ließen nicht nur während jener Tage, sondern auch vorbereitend und nachbessernd an ihren Texten zu arbeiten. Zu Zeiten einer Kolloquienflut ist dieses Engagement immer weniger selbstverständlich und ihm gilt mein erster Dank. Ihm verbindet sich die besondere Referenz gegenüber den Direktoren der Reihe der Colloquia Raurica, die mir diese Veranstaltung anvertrauten und der Frey-Clavel-Stiftung, die auch diese Folge der Gespräche finanziell und durch den bevorzugten Ort der Villa, über dem römischen Trümmerfeld in Castelen bei Äugst, vor den Toren Basels, ermöglicht hat. Ein besonderer Gruß gilt der Mitstifterin, Frau Antoinette Frey-Clavel, die im Jahr dieses Colloquiums ihren achtzigsten Geburtstag feiern konnte und auch diese Veranstaltung durch ihr persönliches Interesse animiert und ausgezeichnet hat. Besonderen Dank schuldet der Herausgeber Hans Belting, dessen Projekt einer Bildanthropologie mannigfache Anregungen bot. Gerhard Neumann zögerte nicht sich der schweren Aufgabe des Epilogs zu widmen, in dem sich einzelne Facetten der Debatten rückblickend noch einmal reflektieren. Mit den Unterrednern ist sich der Herausgeber bewusst, dass der Kreis der Teilnehmer stets stellvertretend agiert, ein Gespräch in Gang bringt, das der Publikation bedarf, um alle jene anderen, die daran kritisch oder zustimmend ein Interesse finden, einzuschließen. An diese der Sache so oder so Geneigten wendet sich dieser Band. Herr lic.phil. Stephan E. Hauser hat die Aufgabe der Gesamtredaktion sowie die notwendigen Ubersetzungen übernommen. Für seine Passion und Präzision zu Gunsten der Sache danke ich ihm besonders. Frau Elisabeth Hobi hat, wie stets, Umsicht und Durchblick walten lassen. Frau Anne-Marie Gunzinger hat zum Abschluss ihrer Tätigkeit für die Stiftung noch einmal die Last der Organisation auf sich genommen. Ohne diese vielfältigen Hilfen und Sympathien wäre auch dieses Kolloquium nicht möglich gewesen. Frau Dr. Elisabeth Schuhmann vom K. G. Saur Verlag GmbH hatte schon den letzten Band betreut, ihrem steten Nachdruck und ihrer Kompetenz verdankt auch dieses Buch viel. Basel, im April 2001
Teilnehmer und Teilnehmerinnen 1. Referenten und Referentinnen Prof. Dr. phil. Hans Belting, Staatliche Hochschule fur Gestaltung, Lorenzstraße 19, D - 7 6 1 3 5 Karlsruhe Prof. Dr. phil. Peter Blome, Direktor des Antikenmuseums und der Sammlung Ludwig, St. Alban-Graben 5, C H - 4 0 1 0 Basel Prof. Dr. phil. Gottfried Boehm, Universität Basel, Kunsthistorisches Seminar, St. Alban-Graben 16, C H - 4 0 5 1 Basel Prof. Dr. phil. Gabriele Brandstetter, Universität Basel, Deutsches Seminar, Nadelberg 4, C H - 4 0 5 1 Basel Dr. phil. Iris Därmann, Universität Lüneburg, Philosophie, F B III Kulturwissenschaften, D - 2 1 3 3 2 Lüneburg Prof. Dr. phil. Georges Didi-Huberman, Centre d'Histoire et Théorie des Arts, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 54, Boulevard Raspail, F - 7 5 0 0 6 Paris Dr. phil. Peter Geimer, Universität Konstanz, Fachgruppe Literaturwissenschaft, Kunstwissenschaft, Fach D 152, D - 7 8 4 5 7 Konstanz Prof. Dr. phil. Fritz Graf, Andrew Fleming West Professor o f Classics, Department o f Classics, 117 East Pyne, Princeton University, Princeton, N.J. 0 8 5 4 4 5264, U S A Prof. Dr. phil. emerit., Dr. theol. h. c. Alois Haas, Universität Zürich, Deutsches Seminar, Schönberggasse 9, C H - 8 0 0 1 Zürich Prof. Dr. phil. emerit. Erik Hornung, Universität Basel, Archäologisches Seminar, Schönbeinstraße 20, C H - 4 0 5 6 Basel Prof. Dr. phil. Othmar Keel, Université de Fribourg, Faculté de Théologie, Institut biblique, Miséricorde, C H - 1 7 0 0 Fribourg Dr. phil. Christiane Kruse, Universität Konstanz, Philologische Fakultät, Fachgruppe Literaturwissenschaft, Kunstwissenschaft/Kunstgeschichte, Fach D 152, D - 7 8 4 5 7 Konstanz Prof. Dr. phil. Jean-Marie Le Tensorer, Universität Basel, Seminar fur U r - und Frühgeschichte, Petersgraben 9—11, C H - 4 0 5 1 Basel
Vili Prof. Dr. phil. Achatz von Müller, Universität Basel, Historisches Seminar, Hirschgässlein 21, CH-4051 Basel Prof. Dr. phil. Gerhard Neumann, Ludwig-Maximilian-Universität München, Institut für Deutsche Philologie, Schellingstraße 3, D-80799 München Prof. Dr. phil. Oswald Panagl, Universität Salzburg, Institut für Sprachwissenschaft, Mühlbacherhofweg 6, A-5020 Salzburg Prof. Dr. phil. habil. Hanna Philipp, Penzberger Straße 21, D-81373 München Prof. Dr. phil. Arbogast Schmitt, Philipps-Universität Marburg, Seminar für Klassische Philologie, FB Fremdsprachliche Philologien, Wilhelm Röpke Straße 6, D-35032 Marburg Prof. Dr. phil. Victor I. Stoichita, Université de Fribourg, Départment d'histoire de l'art et de musicologie, Chaire d'histoire de l'art moderne et contemporain, Miséricorde, CH-1700 Fribourg Prof. Dr. phil. Bernhard Waidenfels, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Philosophie, Gebäude GA, 3/136, Universitätsstraße 150, D-44780 Bochum
2. Collegium
Rauricum
Prof. Dr. phil. Peter Blome, a. o. Prof. für Klassische Archäologie, Direktor des Antikenmuseums und der Sammlung Ludwig, St. Alban-Graben 5, CH-4051 Basel Prof. Dr. phil. Joachim Latacz, o. Prof. für Griechische Philologie, Universität Basel, Seminar für Klassische Philologie, Nadelberg 6, CH-4051 Basel Dr. phil. Hansjörg Reinau, Universitätslektor in Klassischer Philologie, Universität Basel, Seminar für Klassische Philologie, Nadelberg 6, CH-4051 Basel Prof. Dr. phil. Jürgen von Ungern-Sternberg, o. Prof. für Alte Geschichte, Universität Basel, Seminar für Alte Geschichte, Heuberg 12, CH-4051 Basel
3.
Gäste
Regierungsrat Peter Schmid, Vorsteher der Erziehungs- und Kulturdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Präsident der Römer-Stiftung Dr. René Clavel, C H 4410 Liestal Frau Antoinette Frey-Clavel, Rebenstraße 48, CH-4125 Riehen
IX Prof. Dr. phil. Andreas Cesana, a. o. Prof. für Philosophie, Universität Basel, Mitglied des Direktoriums der Jakob Burckhardt-Gespräche auf Castelen', Philosophisches Seminar, Nadelberg 6/8, CH-4051 Basel Prof. Dr. phil. h. c. mult. emerit. Germán Colón, o. Prof. fíir Ibero-romanische Philologie, Universität Basel, Mitglied des Direktoriums der Jakob BurckhardtGespräche auf Castelen', Holeestraße 3, CH-4054 Basel Prof. Dr. phil. Fritz Graf, o. Prof. für Lateinische Philologie, Universität Basel, Seminar für Klassische Philologie, Nadelberg 6, CH-4051 Basel Dr. phil. h. c. Heinrich Krämer, ehem. Geschäftsführer des Verlages B. G. Teubner Stuttgart und Leipzig Dr. phil. Elisabeth Schuhmann, Redaktionsleitung Altertumswissenschaft, K. G. Saur München und Leipzig, Luppenstr. lb, 04177 Leipzig
Inhaltsverzeichnis Gottfried B o e h m Vorwort
V
I Gottfried B o e h m Repräsentation — Präsentation — Präsenz. Auf den Spuren des homo pictor.
3
Bernhard Waldenfels Spiegel, Spur und Blick. Zur Genese des Bildes
14
Arbogast Schmitt Der Philosoph als Maler — der Maler als Philosoph. Zur Relevanz der platonischen Kunsttheorie
32
II Jean-Marie Le Tensorer Ein Bild vor dem Bild? Die ältesten menschlichen Artefakte und die Frage des Bildes
57
Erik Hornung „Hieroglyphisch denken". Bild und Schrift im alten Ägypten
76
Hanna Philipp Zur Genese des „Bildes" in geometrischer und archaischer Zeit
87
Christiane Kruse „Wozu Menschen oder Blumen malen?" Medienanthropologische B e gründungen der Malerei zwischen Hochmittelalter und Frührenaissance . . .
109
Hans Belting Uber Phantasie und Kunst
143
Peter Geimer „Nicht von Menschenhand". Zur fotografischen Entbergung des Grabtuches von Turin
156
XII Victor I, Stoichita Mickey Mao. Glanz und Elend der virtuellen Ikone
173
III Iris Därmann Wenn Gedächtnis Erinnerungsbild wird: Husserl und Freud
187
Georges Didi-Huberman Das nachlebende Bild. Aby Warburg und Tylors Anthropologie
205
IV Fritz Graf Der Eigensinn der Götterbilder in antiken religiösen Diskursen
227
Othmar Keel Warum im Jerusalemer Tempel kein anthropologisches Kultbild gestanden haben dürfte
244
Alois M. Haas Bildresistenz des Göttlichen und der menschliche Versuch, Unsichtbares sichtbar zu machen. Feindschaft und Liebe zum Bild in der Geschichte der Mystik
283
V Peter Blome Die imagines maiorum: ein Problemfall römischer und neuzeitlicher Ästhetik
305
Achatz von Müller Der Politiker am Fenster
323
VI Oswald Panagl Bezeichnung und Bedeutung. Wortgeschichtliche Streifzüge im Sinnbezirk des Bildes
341
Gabriele Brandstetter Kritzeln, Schaben, Ubermalen Bild-Löschung als narratives Verfahren bei Hoffmann, Balzac, Keller und Hofmannsthal
VII Gerhard Neumann Epilog Tafelanhang
I
GOTTFRIED BOEHM
Repräsentation
- Präsentation -
Präsenz
Auf den Spuren des homo pictor M I T TAFELN
I-IV
I. Das Bild als Faktum und als Akt Der kulturelle Gebrauch der Bilder hatte seit alters sowohl mit Kunstfertigkeiten als auch mit der Domestizierung jener Kräfte zu tun, die ihnen zugeschrieben wurden. Lange bevor das Genie und der R u h m von Künstlern gefeiert wurde, war von den geheimnisvollen Wirkungen der Bilder die Rede. Auf sie verweisen ethnologische, archäologische oder religionsgeschichtliche Befunde. Auch M y then, Märchen oder Geschichten von lebenden, gewährenden oder strafenden Bildwerken erlauben es, alte Einschätzungen zu rekonstruieren. N i m m t man sie beim Wort, so scheint das Bild nach dem Muster von Lebewesen verstanden: dem materiellen Körper des Artefakts wird so etwas wie eine Kraftseele, werden Ausstrahlung und Charisma zugeschrieben. Nicht zuletzt scheinen sie mit dem Vermögen des guten oder des bösen Blickes ausgestattet. Solche Werke sind respektiert, verehrt oder auch gefürchtet worden. Die wiederkehrenden Bilderstürme und die sie begleitende Bildkritik haben es nicht vermocht, die R e d e von der Macht der Bilder obsolet erscheinen zu lassen. Ein aufgeklärtes Publikum wird sich von lebenden Bildern nicht mehr erschrecken lassen, und es bedarf schon eines Mozarts, u m die physische Intervention eines steinernen Gastes akzeptabel erscheinen zu lassen. Dasselbe Publikum aber lässt sich vom Zauber ausgezeichneter Gemälde fesseln, es redet von ihrer besonderen, ihrer mehr als physischen Präsenz. So vage dieser Sprachgebrauch auch sein mag, er meint anderes als bloße materielle Vorhandenheit, er u m schreibt eine gesteigerte Gegenwart des Bildes, die über historische, referentielle oder dokumentarische Funktionen hinaus reicht. Gewiss ist es richtig, hinter solchen Zuschreibungen ein psychologisches Bedürfnis der Subjekte zu vermuten. Dafür spricht nicht zuletzt die lange Geschichte der Kunst und des Geschmacks, die vom Schwanken, selbst vom Untergang etlicher Präsenzvermutungen zu berichten weiß. Gehört die Macht der Bilder deshalb vor allem in eine Geschmacksgeschichte oder in eine Soziologie des Publikums? Das Faktum subjektiver Zuschreibung allein scheint uns kaum geeignet, die Kategorie der Präsenz
4
Gottfried B o e h m
aus der Bildreflexion fern zu halten. D e n n wie immer man sie einschätzen mag, dass Bilder nicht nur Fakten, sondern auch Akte sind, sinngenerierende Gegenstände, fuhrt uns zum sachlichen Zusammenhang von Präsenz und Repräsentation zurück. Dass dasjenige, was wir anblicken, uns anblickt, ist - wie Georges DidiH u b e r m a n gezeigt hat - ein Befund nicht der Psychologie, sondern der MetaPsychologie. 1 Ü b e r eine subjektive Empfindung oder eine Projektion bloßer Vorurteile sind wir gegebenenfalls schon hinaus, weil der Betrachter angesichts der Präsenz eines Werkes eine Mitanwesenheit, ein Dabeisein im emphatischen Sinne erfährt. Da ist nichts, was sein Eingenommenwerden behindert. Eine P h ä n o m e n o logie der Bilderfahrung liefert zahlreiche Hinweise darauf, dass es die Präsenz ist, die eröffnet, und nicht der bare Entschluss eines Subjektes, das partout sehen will. Umso mehr, wenn Bilder nicht von vorn herein auf einen sekundären Status reduziert werden, der sich darin erfüllt, im Visuellen oder Greifbaren lediglich zu wiederholen, was zuvor besser und überprüfbar mit kognitiven Mitteln gesagt worden ist. Das Bild als Abbild markiert eine sachliche und theoretische Schonstufe, die es keinem gestattet, dem Phänomen der Präsenz näher zu rücken. Dennoch bleibt es stets eine methodische Schwierigkeit, über Kräfte zu reden. D e n n wir erkennen sie nur an den Wirkungen wieder, die sie hervor gebracht haben.
II. Präsenz/Absenz Dessen ungeachtet ist das Verhältnis von Präsenz und Repräsentation der Bildreflexion tief eingeprägt. Leon Battista Alberti ist dafür ein unanstößiger und charakteristischer Zeuge, weil er viel altes rhetorisches Wissen und Denken mit eigenen humanistischen, d.h. szientifischen Absichten verbindet. Er versteht die Präsenz als eine starke Kraft aktiver Vergegenwärtigung, die er unter Bezug auf das soziale Phänomen der Freundschaft erläutert: Die Malerei birgt in sich eine wahrhaft göttliche Kraft, indem sie nicht bloß gleich der Freundschaft bewirkt, dass ferne Menschen uns gegenwärtig sind, sondern noch mehr, dass die Toten nach vielen Jahrhunderten noch zu leben scheinen, so dass wir sie mit hoher Bewunderung für den Künstler auch mit großer eigener Lust wieder und wieder betrachten." 2 Die Anwesenheit des definitiv Abwesenden und Verschwundenen ist Beweis für die Präsenz, und sie ist zugleich ihr größter Triumph. Es handelt sich freilich u m eine gewandelte Gegenwart. Eine handgreifliche Auferstehung der Toten ist selbstverständlich nicht gemeint. Das Bild ist weder Wiedergänger noch Double und niemand wird ein Bildnis mit dem Dargestellten verwechseln,
1 G. D i d i - H u b e r m a n , Was wir sehen, blickt uns an. Z u r Metapsychologie des Bildes, M ü n chen 1999. 2 L. B. Alberti, Drei Bücher über die Malerei (Deila pittura), in: Ders., Kleinere kunsttheoretische Schriften, hrsg. von H. Janitschek, W i e n 1877, 88.
Repräsentation - Präsentation - Präsenz
5
sich aber gleichwohl davon e i n n e h m e n lassen, dass die Darstellung, u n d n u r sie, die Lebendigkeit eines A b w e s e n d e n glaubwürdig erscheinen lässt. Alberti u n t e r scheidet ganz deutlich zwei Aspekte. Kulturgeschichtlich gesprochen einen m e morialen u n d einen künstlerischen. In K a t e g o r i e n der Bildreflexion gedacht, bringt er das V e r m ö g e n der Vergegenwärtigung eines A b w e s e n d e n mit einer Selbstpräsentation der Kunst bzw. des Bildes z u s a m m e n . Es zeigt etwas u n d dabei sich selbst. M i t der Folge, dass sich das Werk in besonderer Weise an d e n B e trachter adressiert, bei i h m Lust u n d B e w u n d e r u n g erregt, i h m j e n e E r f a h r u n g des E i n g e n o m m e n s e i n s vermittelt. Aber w o r i n besteht d a n n die Präsenzleistung der Re-präsentation? Was b e g r ü n d e t die Verwandtschaft der Begriffe in u n s e r e m Titel? Soweit wir ausgehend v o m Z e u g n i s L e o n Battista AJbertis argumentieren k ö n n e n , bezeichnet das Präfix R e - w e d e r eine bloße W i e d e r h o l u n g n o c h eine W i e d e r b e l e b u n g . Was m e i n t es dann? D i e Darstellung ersetzt nicht, was sie sichtbar macht. R e - p r ä s e n t i e r e n b e deutet nicht: n o c h einmal präsentieren. Es ist weniger u n d m e h r zugleich. D a r stellung unterbietet was der Dargestellte war o d e r ist, i n d e m sie sich ganz d e n Möglichkeiten von Leinwand u n d Farbe, v o n Stein oder Bronze anvertraut. Sie überbietet ihn, i n d e m sie ihn — der längst abgeschieden o d e r in Staub zerfallen ist - dauerhaft mit d e m Status der Lebendigkeit beleiht. Erst v o m Bild her wird er ü b e r h a u p t gegenwärtig, zu d e m , was er ist oder sein kann. Das Präfix R e - in der R e - p r ä s e n t a t i o n bewirkt m i t h i n eine Intensivierung. Sie v e r m e h r t das Sein des Dargestellten durch ein Surplus. D i e göttliche Kraft, von der L e o n Battista Alberti redet, wäre d e m n a c h das V e r m ö g e n , Z u w a c h s zu schaffen. 3 E r d e n k t dabei vermutlich an die Vergegenwärtigungsleistung von Porträts. D i e Verlebendigung der Toten wird n a t u r g e m ä ß im skulpturalen Grabmal unterstrichen, in d e m allerdings sehr verschiedene Modalitäten der Präsenz aufscheinen k ö n n e n , handle es sich n u n u m eine „représentation au vif", eine „représentation de la m o r t " , u m d e n Toten als Verwesenden („transi"), u m d e n T r a u e r n d e n („gisant") o d e r u m eine andere Darstellung bzw. M i s c h u n g von Darstellungen. 4 A m R a n d e der Grabmalskunst bleiben Realrepräsentanzen i m Spiel: das Skelett des Heiligen, möglicherweise angetan mit seinen eigenen Kleidern, vertritt ihn — dargeboten in einer ikonischen Inszenierung innerhalb des Kirchenraums - als d e n j e n i g e n , f ü r d e n er gelten soll: z u m Beispiel als der w i r k m ä c h t i g e u n d w u n s c h e r f ü l l e n d e lokale Patron einer G e m e i n d e . D i e Lebendigkeit verlagert sich von der kunstvollen Darstellung auf diejenige unsichtbarer Gnadenkräfte. D e r A b w e s e n d e ist dank der physischen Materialität seines Leichnams in der Präsentation g e g e n w ä r tig, fast k ö n n t e m a n sagen: er „ist" die Präsentation. U n b e n o m m e n u m Inhalt u n d u m religiöse o d e r standesrechtliche Interessen u n d R o l l e n handelt es sich aber d u r c h w e g u m Vergegenwärtigung. Sie re-prä3 4
Gadamer 1986, 149. E. Panofsky, Grabplastik, Köln 1964, 86 f.
6
Gottfried B o e h m
sentieren die Person des Abwesenden, indem sie seinen Körper - in welchem Status auch immer (glänz- und würdevoll oder verwesend) auf Dauer darbieten, ihn der zeitlichen Sukzession entziehen und ihm damit einen O r t in der Welt schaffen. Die Re-präsentation geschieht als Präsentation. Die Präsenz wiederum verdankt sich einer spezifischen Erscheinung des Zeigens. Re-präsentation darf man deshalb auch eine Zeigehandlung nennen, die über eine besondere Temporalität gebietet. Ihre Qualität besteht darin, den Dargestellten, der dem Zeitlauf unterworfen war, so darzubieten, dass er eine Gegenwart gewinnt, die Evidenz oder Enargeia besitzt. 5 Der zeitlichen Sukzession entziehen - was kann damit gemeint sein? Was tut die Darstellung, wenn sie einem Toten oder Abwesenden Gegenwart verleiht? Gelten für ikonische Repräsentationen nicht ebenso die Gesetze der Entropie, unterliegt sie, selbst materiell, nicht der O r d n u n g der Materie? Keine Frage. Was die Repräsentation temporal auszeichnet ist deshalb auch nicht die Vermeidung der Sukzession. — W i r sehen stets: die repräsentierte Person hat gelebt. — Was sie auszeichnet, ist vielmehr etwas, das in der Zeigeleistung selbst liegt: den Betrachter zur Wiederkehr aufzurufen, den Dargestellten als den Gleichen vorzuweisen, der immer wieder neu und anders als dieser Gleiche mit all seinen erinnerungswerten Eigenschaften oder seinen Vorbildlichkeiten gesehen werden kann. Die „göttliche Kraft" des Bildes, von der Leon Battista Alberti redet, und die dazu geeignet ist, sogar Toten Gegenwart zu geben — hat mit bloßer Abbildung definitiv nichts zu schaffen. Das lässt sich auch daran ablesen, dass Repräsentationen nicht eben selten ein rechtlicher Rang, d.h. Legitimität, zugekommen ist. Der Begriff der repraesentatio hat ja selbst starke Wurzeln im Rechtsbereich, offenbar deshalb, weil mit ihm der Gedanke verbunden war, den Dargestellten in der Darstellung legitimer Weise fassbar zu machen. 6 Ein schwacher Widerschein dieses rechtlichen Status ist uns aus dem Photo des Identitätsausweises noch geläufig. Es ist der entscheidende Prüfstein, das eigentliche Zeigemittel, u m eine verbal behauptete und modifizierte Identität zu belegen und dem Inhaber bestehende R e c h t e faktisch zuzuerkennen. Das Porträtphoto erst macht die Person mit sich identisch — wie manch einer beim Grenzübertritt erfahren musste. Uberhaupt haben sich in der Geschichte der Photographie alte Repräsentationsmodelle erhalten und weiterentwickelt. Man denke an den Bereich der privaten Memorialphotographie, an das Photoalbum im Familienverband, einer Gattung, deren Besonderheiten u.a. Roland Barthes nachgegangen ist. 7
3 G. B o e h m , Bildbeschreibung. Ü b e r die Grenzen von Bild und Sprache, in: G. B o e h m und H. Pfotenhauer (Hrsg.), Beschreibungskunst/Kunstbeschreibung, M ü n c h e n 1995, 31 ff. 6 H . H o f m a n n , Repräsentation. Studien zur W o r t - und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, Berlin 1974. 7 R . Barthes, Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie, Frankfurt a. M . 1985.
Repräsentation — Präsentation -
Präsenz
7
III. Die Grenzen der Repräsentation Repräsentation bindet sich an Abwesenheit und Tod. Sie antwortet darauf und gewinnt durch die Folie der Vergänglichkeit und der Nichtigkeit erst den Glanz und die Kraft ihrer Präsenz. Zugrunde liegt diesem Verständnis die Vorstellung der binären Opposition: Gegenwärtigkeit/Absenz. Das Bildwerk ist die dialektische Reaktion auf die Faszination und die Namenlosigkeit des Todes. D e m Abwesenden und sogar dem Abgeschiedenen ein Gesicht zu geben, seinen Namen mit Anschauung und Gegenwart auszustatten, ist seine vorzüglichste Eigenschaft. Die europäische Kultur hat die Versammlung der Bilder tendenziell ausgedehnt und damit auch das R e i c h der Präsenz. Zunächst auf einfache Stein-Male beschränkt, dann in Pyramiden monumentalisiert oder in Tempeln rituell begangen, wurde es zum peripathetischen Denkraum von Agora oder Museion, zur Repräsentationskette von Heiligtümern, Friedhöfen oder schließlich von Museen. Die Grenzen der Präsenz haben sich ständig erweitert, und wenn man die technischen Möglichkeiten heutiger Bildproduktion bedenkt, hat es den Anschein als ließe sich der R a u m der Präsenz progredierend immer weiter ausdehnen und der des Abwesenden immer mehr zurückdrängen. In der schönen neuen Welt der Simulation wird sogar daran gearbeitet, ihn eines Tages ganz aufzuheben. Die Idee der Präsenz besitzt die Züge einer kulturellen Utopie, die mit vielerlei Organen danach strebt, sich zu realisieren. Wenn sich erst einmal das genetische Material des menschlichen Körpers in der rechten Weise formen ließe, dann wäre endlich die Lücke zwischen Darstellung und Dargestelltem geschlossen, der Mensch zu seinem eigenen Repräsentanten und seinem dauernden Denkmal erhoben. Aber spätestens an dieser Mythe von der Rückgewinnung eines irdischen Paradieses wird deutlich, dass das Verhältnis von Präsenz und Absenz, von Repräsentation und dem Nicht-Repräsentierbaren einer genauen Bestimmung bedarf. Denn Präsenzen entstehen und vergehen unaufhörlich, und selbst in den stabilsten, Jahrtausende überdauernden Werken ist die Präsenz etwas, das fortwährend generiert werden muss, denn einem bloßen - zum Beispiel prähistorischen — Relikt wird man zwar Zeugenschaft aber gewiss noch keine Präsenz zubilligen. Es ist lediglich mit seiner Materialität identisch. Wenn wir die Darstellung aber einen Akt genannt haben, der das Faktum, das ihm zugrunde liegt, ständig überbietet, dann wohnt die verbale Form des repräsentierens der substantivischen, der Repräsentation ein, als ihre eigentliche, treibende Kraft. Es geht deshalb jetzt darum, diese innere Bewegung freizulegen. Sie hat mit Temporalität zu tun. Der Zeigeakt ist zeitlich determiniert, auch wenn er eine außerweltliche oder weltlose Ewigkeit evoziert. Damit wird wieder deutlich, dass Repräsentation etwas ist, das sich durch seine eigenen Grenzen fortbestimmt. Diese Grenzen sind offen nach zwei Seiten. Sie grenzen aus und schließen ein, und sie steuern darüber hinaus die Verbindung zwischen Innen und Außen. Mit anderen Worten: in der Repräsentation selbst ist das Abwesende nicht nur gegenwärtig, sondern es ist
8
Gottfried Boehm
w i r k s a m . Es begleitet, r h y t h m i s i e r t u n d S c h a t t e n das Licht.
strukturiert
die D a r s t e l l u n g w i e
der
D e r a u f m e r k s a m e B e t r a c h t e r v o n B i l d w e r k e n w e i ß davon s c h o n allerlei. Z u m Beispiel aus der B l i c k l e n k u n g , die i h m d a r g e b o t e n , zu d e r er veranlasst w i r d . E r fokussiert seine A u f m e r k s a m k e i t a u f dieses o d e r j e n e s Detail, will es g e n a u wissen u n d k e h r t d o c h an j e n e n e n t s c h e i d e n d e n P u n k t z u m Sehen z u r ü c k , w o d e r Blick auf das Bild u m s c h l ä g t in die W a h r n e h m u n g des Bildes. N i c h t in A b r e d e zu stellen ist selbstverständlich d e r Fluss an I n f o r m a t i o n u n d E i n s i c h t e n , d e r aus e i n z e l n e n Z e i c h e n g e w o n n e n w i r d , die i m ü b r i g e n a u c h die Schaulust b e f r i e d i g e n , d u r c h Pracht, Virtuosität, s k r u p e l h a f t e G e n a u i g k e i t o d e r die E n t h ü l l u n g v o n Tabus. Von e i n e r bildlichen Präsenz r e d e n w i r a b e r erst d a n n , w e n n w i r das N a c h e i n a n d e r des auf d e r Bildfläche feststellbaren als L e i s t u n g e i n e r Präsentation e r k e n n e n . Gewiss s t e h e n die e i n z e l n e n S i c h t e n ins Bild h i n e i n , auf die u n t e r schiedlichen B r e n n p u n k t e h i n i m m e r s c h o n i m H o r i z o n t des T o t u m s d e r Fläche. A b e r erst w e n n w i r d i e s e m G a n z e n N a c h d r u c k verschaffen, unsere A u f m e r k s a m keit so s t e u e r n , dass sie g e n a u w i r d — in B e z u g a u f die Grenzen d e r D a r s t e l l u n g u n d das G a n z e , das sie einschließt - erst d a n n sind w i r b e t r a c h t e n d b e i m Bild a n g e k o m m e n . D e r U m s c h l a g v o n i k o n i s c h e n Sachverhalten zur i k o n i s c h e n W i r k u n g hat m i t d e m Wechsel d e r v o m Bild a n g e b o t e n e n O r d n u n g zu t u n . W i r e n t d e c k e n in d i e s e m u n d in j e n e m — d e r Parataxe — erste R e l a t i o n e n . D a n n b a u t sich darin eine H y p o t a x e auf u n d ü b e r f u h r t ihr Potenzial in R i c h t u n g e i n e r s i m u l t a n e n U b e r s c h a u , e i n e r w i r k l i c h e n „ S y n t a k t i k " . Es ist eine alte Einsicht, dass f ü r die ikonische Präsenz die Z w i s c h e n - u n d L e e r r ä u m e , das U n a u s d r ü c k liche — das d e r f o k u s s i e r e n d e Blick verdrängt — eigentlich b e d e u t s a m sind. G e g e n die E r f a h r u n g visueller Simultaneität ist i m m e r w i e d e r p o l e m i s i e r t w o r d e n , u.a. weil ihr kein n e u r o p s y c h o l o g i s c h messbares Ä q u i v a l e n t entspreche. D e m w ä r e freilich e n t g e g e n z u h a l t e n , dass die N e u r o p s y c h o l o g i e a u f dieser Basis a u c h n i c h t zu e i n e r k o n s i s t e n t e n B i l d t h e o r i e g e l a n g e n k a n n . E i n m ü ß i g e r K o n flikt v e r m u t l i c h , d e r d a v o n a b l e n k t , dass die Spannung z w i s c h e n B l i c k p u n k t e n u n d Simultansicht das eigentliche S c h l ü s s e l p h ä n o m e n darstellt. U n d zwar deshalb, weil w i r m i t d e m Blick aufs G a n z e die Fülle der Details „ ü b e r s e h e n " , in e i n e n u n a u s d r ü c l d i c h e n Z u s t a n d „versetzen", — wie wir umgekehrt mit d e m Blick aufs Detail die W e i t e des B i l d h o r i z o n t e s u n d seine i n t e g r i e r e n d e Kraft „verdrängen". Es h a n d e l t sich h i e r b e i u m g a n z u n v e r m e i d l i c h e Vorgänge, g l e i c h sam u m d e n u n a u s l ö s c h l i c h e n b l i n d e n Fleck in u n s e r e r W a h r n e h m u n g , u m die Trägheit unseres O r g a n s , in d e r die eigentliche ikonische P r o d u k t i v i t ä t e n t h a l t e n ist. A b s e n z steuert m i t a n d e r e n W o r t e n u n s e r e A u f m e r k s a m k e i t , schattiert sie u n d v e r m i t t e l t die erforderliche A d a p t i o n . Das A u g e partizipiert, a b e r in e i n e r s t ä n d i g e n B e w e g u n g . Sie folgt d e n B a h n e n d e r Temporalität, die v o n d e r R e p r ä sentation als Prozess entfaltet w e r d e n . A u c h h i e r w i r d d e u t l i c h , dass es des T e r t i u m s e i n e r Präsentationsleistung, e i n e r Deixis b e d a r f , w e n n die R e p r ä s e n t a t i o n P r ä s e n z e n stiften soll.
9
Repräsentation - Präsentation - Präsenz
Was die P h ä n o m e n o l o g i e der Bildwahrnehmung zu Tage
fördert,
hat seine
Äquivalente in der Geschichte der Gestaltung und der sie begleitenden R e f l e xion. Vasari beispielsweise macht einige B e m e r k u n g e n zum entfalteten Malstil Tizians, die sich als ein Kurztheorem seiner späteren Malerei lesen lassen. E r erwähnt ganz ausdrücklich die Andromeda, „die an den Felsen gefesselt durch Perseus von dem M e e r u n g e h e u e r erlöst wird", ferner „Diana, die mit ihren N y m phen im Q u e l l badet und Aktäon in einen Hirsch verwandelt", „außerdem malte er eine Europa, die auf dem Stiere durchs M e e r reitet" (Abb. 1). Bezogen auf diese und andere Gemälde trifft er eine Feststellung, die sie von der Arbeit seiner früheren Zeit unterscheidet. E r lobt zunächst die „Lebendigkeit, die Tizian den Figuren durch die Farben gegeben hat, wodurch er sie fast lebendig und natürlich gemacht hat." Dieser Ausweis einer besonderen Präsenz basiert auf einer Verfahrensweise, die sich von deijenigen seiner Jugend unterscheidet „in dem er seine ersten Arbeiten mit einer gewissen Feinheit und mit unglaublichem Fleiß ausführte, so dass man sie sehr wohl aus der Nähe als auch aus der Ferne betrachten k a n n . " Jetzt aber nistet sich zwischen N a h - und Fernblick ein Widerstand ein, weil die Bilder n u n m e h r „ohne Vorzeichnung gemalt, dick und fleckig aufgetragen, derart sind, dass sie aus der N ä h e nicht gesehen werden dürfen, aus der Ferne aber als vollendet erscheinen." 8 Vasaris sparsame B e m e r k u n g e n sind ungewöhnlich aussagekräftig für das Verhältnis von Repräsentation und Präsenz, insonderheit für die R o l l e des Unausdrücklichen im Bild, also dessen, was sich nicht einlösen lässt und deshalb Abwesenheit im Spiel hält. Aus dieser Charakteristik geht zunächst hervor, dass Vasari Tizians späteren Bildern einen Vorrang des G a n zen vor den Teilen zubilligt, dem Fernsicht angemessen, das einem fokussierenden Sehen aber verwehrt ist. D a n n unterstreicht er die R o l l e von Undurchsichtigkeiten — die er sogar in die N ä h e des Hässlichen rückt — um damit Durchblicke zu eröffnen. Es ist also nicht Albertis „Offenes Fenster", das ihm als M o d e l l vorschwebt, die völlig transparente Projektionsfläche, die am ehesten durch das Verfahren der geometrischen Perspektivkonstruktion begründet werden kann, sondern es ist die völlige Intransparenz der dicken Farbe, die jetzt Blicke eröffnet. Opazität begründet Transparenz des anschaulichen Sinnes. Tizian trübt das Bildfenster auf ganz kunstvolle Weise, u m es so zu seiner größten Leistungskraft zu führen. E r entrichtet dafür freilich einen Preis, den Vasari, was Tizian selbst anbelangt (nicht j e d o c h seine Schüler und Nachfolger) akzeptiert. D i e Erscheinung des Sinnes ist aus der N ä h e nicht wahrzunehmen. Darauf bezogen verzögert sich die Präsenz, gewinnt dann aber in der Fernsicht eine u m so größere Intensität. Diese H e m m u n g durch die ikonische Opazität repräsentiert auch eine innere Reflexivität, die sich zwischen malerischer Faktur und erscheinender Szene einstellt. U n d drit-
8 G. Vasari, Künstler der Renaissance. Lebensbeschreibungen der ausgezeichnetsten italienischen Baumeister, Maler und Bildhauer, hrsg. von H. Siebenhüner, Leipzig 1940, 5 2 1 .
10
Gottfried B o e h m
tens lässt sich festhalten, dass Tizian - so w i e ihn Vasari charakterisiert — sich u m eine Steigerung der Präsenz bzw. der Lebendigkeit b e m ü h t . Aus einer „dicken u n d fleckigen" Malschicht entspringt ein h ö h e r e r Grad von Vorhandenheit. Diese Steigerung verdankt sich der E r s c h e i n u n g einer Ferne, mit B e n j a m i n u n d seiner D e f i n i t i o n der Aura m ö c h t e m a n sagen: „so n a h e sie sein m a g . " 9 W e r sich i m Fernblick v o n der Faszination des L e b e n d i g e n e i n n e h m e n lässt, d e m verbirgt sich gleichsam u n t e r der Szene u n d ihrer anschaulichen Vielfalt ein M o m e n t des N a m e n l o s e n . D i e malerische Faktur erscheint der Nahsicht w i e eine Mauer, w i e die völlige Abwesenheit j e d e s Sinnes, die Verschlossenheit u n d Hässlichkeit schlechthin. E i n e m simultanen Fernblick dagegen tritt der Sinn glanzvoll daraus hervor, i h m ö f f n e t das Bild seine A u g e n . Es blickt zurück, a n t w o r t e t auf den, der es anschaut. W e n n diese G e n e r i e r u n g einer Blickbeziehung uns bereits als ein Charakteristikum von h o h e r Präsenz gegolten hat, d a n n wird auch deutlich, dass es dazu einer ausdrücklichen Präsentation, einer Leistung des Bildes bedarf. Sie negiert j e d e Auskunft im Detail, lässt das darauf eingestellte A u g e erblinden. Dieses U n a u s d r ü c k l i c h e ist aber andererseits auch die u n a b d i n g bare Voraussetzung dafür, dass wir Bild sehen, dass es j e n e höchste Präsenz gew i n n t , die Philipp II. u n d Vasari b e w u n d e r t haben. D i e Kunst der Malerei wird m i t h i n jetzt als die M e i s t e r u n g der fruchtbaren Differenz beschrieben, in der sich die Repräsentation u n d das Unrepräsentierbare m i t e i n a n d e r verschränken. R e präsentation n i m m t dank der Spezifik ihrer Präsentationslogik das „Ausdruckslose" so in sich auf, dass aus i h m j e n e s schattierte Bild entstehen k a n n , das Tizians reife Arbeit besonders auszeichnet.
IV. D i e Logik der Präsentation I m m e r m e h r tritt die Z e i g e h a n d l u n g , in der die R e p r ä s e n t a t i o n Präsenz entsteh e n lässt, in d e n M i t t e l p u n k t der Aufmerksamkeit. Sie ist auch das besondere R e s i d u u m der historischen bzw. der interpretatorischen Analyse. Es geht n u n d a r u m , ihrer R o l l e etwas g e n a u e r n a c h z u g e h e n , w o b e i zwei Beispiele gewählt w e r d e n , die als E c k p u n k t e eines d e n k b a r weiten Spektrums gelten k ö n n e n , in d e m die Valenz des h o m o pictor zur G e l t u n g k o m m e n kann. D i e B e w o h n e r der melanesischen Insel N e u i r l a n d partizipierten an einer T o tenfeier, aus der das vorliegende Bildwerk s t a m m t (Abb. 2). Es besteht aus e i n e m K o p f - im P h o t o v o n einer Stange gehalten — der im Kult wahrscheinlich einer geschnitzten Holzfigur aufsaß. E n t s c h e i d e n d ist n u n zu sehen, dass dieser K o p f der Schädel desjenigen ist, dessen m a n im Totenritus gedachte. M i t Wachs u n d
9 W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in: Illuminationen, Ausgewählte Schriften, Band 1, Frankfurt a. M . 1961, 154.
Repräsentation - Präsentation - Präsenz
11
Kreidepaste wurde er plastisch überformt und sparsam mit Ocker bemalt. An die Stelle der Augen traten die Schalen von Turboschnecken. Die plastische Gestaltung mittels Körperteilen berührt uns weniger fremd, wenn wir uns der bereits erwähnten christlichen Präsentationspraktiken von M u m i e n oder Skeletten erinnern. Immerhin: das Signifikat fungiert hier gleichzeitig als Signifikant und irritiert unsere gängige Erwartung, die eine Distanz zwischen der Eigenrealität des Werkes und seinem Sujet voraussetzt. Dennoch: was wir sehen ist keine präparierte Leiche, wie diejenige Lenins im Mausoleum des Kreml, zu dauernder Betrachtung bestimmt. Es ist der Schädel, der durch Gestaltungsmaßnahmen in den Zustand einer anderen Lebendigkeit versetzt wurde. Wir sehen, dass es sich nicht u m eine statische Beziehung handelt, in der die Darstellung den Dargestellten „vertritt". Es geht u m die Evokation einer Lebendigkeit, die nach Wirkung und Glaubwürdigkeit strebt. Der Einbezug des Schädels sichert der Darstellung die in ihm erfahrene seelische Kraft. Sie wird mittels plastischer Uberformung aus der Sphäre des Naturrelikts in diejenige des Artefaktes verschoben, mit einem Gesicht und vor allem mit einem ungerichteten omnipräsenten Blick ausgestattet. An die Stelle der leeren Augenhöhlen und der Dinglichkeit des Schädelknochens tritt eine dem Kopf eingeformte Energie. Was wir sehen ist der Kreuzungspunkt zweier Gehalte: es geht um die gesteigerte Gegenwart eben dieses Verstorbenen. Sofern er in die Welt der Ahnen eingegangen ist, die in dieser Kultur als die Schöpfer der Welt gelten, geht es aber auch um die anonyme Gegenwart der kosmischen Urheber, die außerhalb der Kette der Generationen, gleichsam in der Fülle der Zeit erfahren werden. Der Tote stirbt nicht in ein alltägliches Vergessen. Das Bildwerk macht ihn sichtbar als das Gedankenbild seiner Ahnen, als die Verkörperung der mit ihnen verbundenen Kräfte. Diese Repräsentation beruht auf einem Chiasmus. Die Darstellung leiht dem verschwundenen Dargestellten seinen Bildwert, macht ihn damit präsent. U n d u m gekehrt leiht das Urbild des Dargestellten dem Bilde seine Kraft. Gadamer sprach generell davon, dass das Dargestellte sein Sein „wesenhaft im Sich-Zeigen" habe, 1 0 die Realität in den Prozess der Darstellung übertritt, weil sie selbst bildhaft wird. Es ist die jeweilige Präsentationslogik, die über die Art der Präsenz entscheidet. Sie lässt das Dargestellte nicht unverwandelt. Es gibt nicht die „Sache", und dann gibt es auch noch ihr „Bild". Starke Bilder verleihen dem Dargestellten ein Surplus, einen „Zuwachs an Sein". 1 1 Giacometti hat den Kopf von der Neuirlandinsel im Basler Völkerkundemuseum mit großer Wahrscheinlichkeit gesehen. Sein „Kopf auf der Stange"
10
Gadamer 1986, 147. Gadamer 1986, 149. - G. B o e h m , Zuwachs an Sein. Hermeneutische Reflexionen und bildende Kunst, in: H . - G . Gadamer (Hrsg.), Die M o d e r n e und die Grenze der Vergegenständlichung, M ü n c h e n 1996, 95 ff. 11
12
Gottfried B o e h m
(Abb. 3) von 1947 im Basler Kunstmuseum versucht sich an einer Übersetzung in eigene Präsentationsstrategien. Der Kopf ist durch die Nackenlage aus dem Dialog mit dem Betrachter gerissen. Auf die Stange aufgespießt zieht er sich aus dem Zusammenhang der Lebewesen und ihrer Körper zurück. Und doch ist auch hier Lebendigkeit formuliert: die eines aufgesperrten Mundes, der Erstarrung. Der Tod lässt einen heftigen Affekt zu einer Lebensspur gerinnen. Sie wurde mit Ocker, der alten Farbe des Lebens, in dieses Gesicht eingezeichnet, spricht sich darin mit Entsetzen aus. Ging es im Kopf von Neuirland darum, den Tod als Passage zu den Ahnen darzustellen, um an ihrer Lebenskraft zu partizipieren, geht es bei Giacomettis Werk um das Sterben. Darum, dass „in der Wahrnehmung . . . das Lebenskontinuum plötzlich abbricht." 1 2 Die Präsenzleistung dieser Darstellungsweise arbeitet Angst und Schrecken heraus. Es ist die Drohung des Todes, deren lebhafte Gegenwart ortlos vor uns schwebt. 1 3 Giacomettis Präsentationslogik pointiert sich in temporaler Hinsicht. Sein Verfahren legen Arbeiten wie j e n e mit der Frau auf dem „Wagen" (Abb. 4) offen dar. Nicht die Figur fährt, sie wird gefahren und zwar frontal auf den Betrachter zu. Ihr feierliches, passives Stehen und die virtuelle Bewegung des Gefährts erscheinen ganz unverbunden. Gerade deshalb hat Präsenz hier nicht mit einfachem Dasein zu tun, sondern mit einem In-Erscheinung-Treten. Giacometti hat hier die Illusion einer physischen oder motivischen Bewegung unterdrückt, weil es ihm um eine ganz andere gegangen ist: das Entstehen einer gesteigerten Anwesenheit, um Repräsentation im verbalen Sinne. Giacometti gibt seinen Figuren oft eine epiphanische Qualität. Darstellung bewirkt den Ubergang von der materiellen Vorhandenheit ins Erscheinen. Ein Vollzug, im Bilde fortwährender Ruhe. Giacomettis Präsentationslogik hat mit der Entformung des menschlichen O r ganismus zu tun. Er wird seiner Vorhandenheit entkleidet und zu einem Phänomen. 1 4 Einem Sehen aus der Ferne erscheinen diese Körper lebendig und intangibel. Das Absente wirkt in diesen Prozess hinein: nichts oder fast nichts auf der Oberfläche dieser Figuren lässt sich im Hinblick auf Körperlichkeit benennen und zuordnen. Zwischen Sachverhalt und Präsenz klafft eine wirksame Kluft, die dafür sorgt, dass wir betrachtend bei der Figur als Körper nie ankommen, das Faktische des Körpers uns als dichte Erscheinung entgegentritt. D e m Blick des
1 2 F. Meyer, Alberto Giacometti, in: A. Giacometti, Werke und Schriften, Zürich 1998, 1 3 - 2 4 , hier 19. 1 3 Yves Bonnefoy zählte dieses Werk zu den „schrecklichsten Darstellungen des Todes und der Aggressivität des Nichts, die ein moderner Künstler j e entworfen . . . hat", in: Y. Bonnefoy, Alberto Giacometti. Eine Biographie seines Werkes, Bern-Bümpliz 1992, 2 9 2 . 1 4 G. B o e h m , Das Problem der Form bei Alberto Giacometti, in: A. Matthes (Hrsg.), Wege zu Giacometti. Louis Aragon mit anderen, M ü n c h e n 1987, 39f.
Repräsentation - Präsentation -
13
Präsenz
Betrachters antwortet die augenlose Blickenergie der Oberfläche, die das Sehen vom M o t i v des Auges gelöst hat. D i e Figuren .entstehen' im Akt der B e t r a c h tung, der sich einnehmen lässt von den Kräften der Präsenz. „ ,Entstehen' b e deutet: Nichtentstanden zu sein und Entstanden zu sein . . . "
In diesem Satz
umschrieb Jean Luc N a n c y das P h ä n o m e n der Präsenz und er fugte erläuternd hinzu: wie denken bedeutet „ n o c h nicht gedacht haben und bereits gedacht haben."15 D e r Bildprozess, der zur Präsenz fuhrt, hat eine paradoxe Struktur. Deswegen lässt sich ein Anfang und ein E n d e in der Zeit nicht b e n e n n e n . E i n e Wissenschaft, die sich mit der inneren Verknüpfung von Repräsentation, Präsentation und Präsenz befasst, ist deshalb notwendigerweise eine Wissenschaft des Vollzugs und der Erfahrung. Ihr Impuls besteht darin, alles was sich historisch oder analytisch verfestigt hat, in die Aktualität der W a h r n e h m u n g und des Nachdenkens als einer kritischen Instanz zurück zu übertragen. Ihr Diskurs dient der Einsicht, dass Bilder ebenso sehr Körper sind, die sich historischen Determinanten unterwerfen, wie W i r k u n g e n und Kräfte, die sie generieren und die Geltung b e a n spruchen können. W e n n Repräsentationen vor allem Präsenzen begründen w o l len, dann erfüllt sich der Sinn der Bilder im Akt der Wahrnehmung,
dann,
wenn sie dem Betrachter eine Mitpräsenz ermöglichen, wenn, was wir ansehen, auch uns ansieht, der Blick dem Blick begegnet.
Abgekürzt zitierte Literatur Gadamer 1986
H . - G . Gadamer, Wahrheit und Methode, in: Ders., Gesammelte Werke, I, Tübingen 5 1 9 8 6 .
Bildlegenden Abb. 1: Abb. 2: Abb. 3: Abb. 4:
Tizian, R a u b der Europa, 1562, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston. Anonymus, Uberformter Totenschädel aus Neuirland, Museum der Kulturen, ehem. Museum für Völkerkunde, Basel. Alberto Giacometti, K o p f auf Stange (Tete sur tige), 1947, Kunstmuseum Basel. Alberto Giacometti, Der Wagen (Le chariot), 1947, Kunsthaus Zürich.
1 5 J . - L . Nancy, Entstehung zur Präsenz, in: C. L. Hart Nibbrig, Was heißt: „Darstellen"?, Frankfurt a. M . 1994, 103.
B E R N H A R D WALDENFELS
Spiegel, Spur und Blick Zur Genese des Bildes D i e m e i s t e n B i l d k o n z e p t i o n e n k r a n k e n daran, dass sie zu h o c h ansetzen, n ä m l i c h auf d e r E b e n e v o n B i l d w e r k e n u n d B i l d m e d i e n . D a m i t g e r a t e n die K l ü f t e u n d A b g r ü n d e d e r B i l d e r f a h r u n g aus d e m Blick. Dieser V o r w u r f trifft a u f p h i l o s o p h i s c h e B i l d t h e o r i e n e b e n s o zu w i e a u f e i n e K u n s t t h e o r i e , K u n s t g e s c h i c h t e u n d M u s e u m s p r a xis, die verlernt hat, d a r ü b e r zu s t a u n e n , dass es so etwas w i e Bilder gibt. D o c h d e r w i e d e r h o l t e W e c h s e l v o n B i l d b e g e i s t e r u n g u n d B i l d e r s t u r m lässt auf e i n e Bildfaszination schließen, die w e i t ü b e r e i n e n k u l t u r e l l e n Bildervorrat h i n a u s g e h t . D i e f o l g e n d e n Ü b e r l e g u n g e n kreisen u m e i n e G e n e s e des Bildes, die g e e i g n e t ist, die Geschlossenheit e i n e r i m s c h ö n e n o d e r n i c h t m e h r s c h ö n e n S c h e i n b e f a n g e n e n ästhetischen Welt a u f z u s p r e n g e n , so dass s o w o h l p r ä - w i e postästhetische M o t i v e d e r K u n s t freigesetzt w e r d e n . D i e K u n s t verlangt n a c h e i n e r G e n e a logie, die Nietzsches G e n e a l o g i e d e r M o r a l o d e r Husserls G e n e a l o g i e d e r Logik e b e n b ü r t i g ist. D i e K o n t i n g e n z v o n O r d n u n g e n , die „es g i b t " , o h n e dass sie auf e i n e m festen B o d e n r u h e n , weist s o w o h l h i n t e r die b e s t e h e n d e n O r d n u n g e n z u r ü c k w i e ü b e r sie hinaus, u n d beides in unlöslicher V e r q u i c k u n g . D e m être brut e n t s p r i c h t eine art brut, die n i c h t b e i sich selbst b e g i n n t u n d n i c h t bei sich selbst e n d e t . 1 Dies l e h r t n i c h t n u r die p h i l o s o p h i s c h e B e s i n n u n g auf die O r d n u n g des Sichtbaren u n d B i l d h a f t e n , s o n d e r n a u c h die m o d e r n e Bildpraxis, i n n e r h a l b d e rer archaische u n d revolutionäre M o m e n t e sich i m m e r w i e d e r b e r ü h r e n u n d v e r stärken. D i e H o f f n u n g auf e i n e z u n e h m e n d e D e s i l l u s i o n i e r u n g , in d e r e n Verlauf die Bilder i m m e r m e h r als Bilder d u r c h s c h a u t u n d aller außerästhetischer W i r k u n g e n entledigt w e r d e n , erweist sich selbst als trügerisch. D i e Frage: „Was ist ein Bild?" stellt sich m i t e i n e r D r i n g l i c h k e i t , j e m e h r n e u e B i l d f o r m e n unsere E r f a h r u n g in Beschlag n e h m e n . 2 G e m e s s e n a n d e r Vielfalt zu b e r ü c k s i c h t i g e n d e r
1 Zur Ordnungskonzeption, die den folgenden Bildbetrachtungen zugrunde liegt, vgl. vom Verf., O r d n u n g im Zwielicht, Frankfurt am Main 1987. Anhand der beigefügten ,Ordnungsbilder' habe ich dort zu zeigen versucht, was in den Texten zur Sprache kommt. 2 Ich verweise auf den gleichnamigen, von Gottfried Boehm herausgegebenen Band (Boehm 1994), in dem die historische und aktuelle Vielfalt unserer Bildvorstellungen sich dokumentiert. Zur gegenwärtigen Infragestellung liebgewordener kunsthistorischer Vorstellungen findet sich viel Nachdenkenswertes bei Belting 1995.
Spiegel, Spur und Blick. Zur Genese des Bildes
15
Aspekte sind die folgenden phänomenologisch inspirierten Analysen betont karg angelegt. Es geht mir in erster Linie darum, einige neuralgische Punkte zu markieren, die für eine Rückfrage nach der Genese von Bildern unerlässlich sind. Wenn es ,das Bild' gibt, so nur im Schnittpunkt verschiedener Bilddimensionen. 3
1. Bild und Bildauffassung Beginnen wir mit einigen minimalen Bedingungen, denen ein Bild gehorchen muss, um als Bild gelten zu können. In phänomenologischer und hermeneutischer Manier können wir Erfahrung dahingehend bestimmen, dass etwas als etwas auftritt. Diese Urdifferenz zwischen dem, was etwas ist, und der Art und Weise, wie es gegeben, gemeint oder aufgefasst ist, bezeichne ich als signifikative Differenz.4 Sobald wir es mit einer visuellen Erfahrung zu tun haben, besagt dies, dass etwas als etwas sichtbar wird. 3 Von Bilderfahrung sprechen wir, wenn etwas als etwas im Bild sichtbar wird. Das Bild ist also zunächst nicht etwas, das wir zusätzlich auch noch sehen; als Medium des Sehens gleicht es der Sonne, in deren Licht wir sehen, was wir sehen. Sonnenfinsternisse erinnern an etwas, das Piaton zu so weitläufigen Gedanken angeregt hat: W i r sehen nicht einfach die Sonne, sondern sehen etwas in der Sonne, bedroht von Blendung und Erblindung, sobald wir geradewegs in die Sonne schauen. Das Bild unterliegt nun seinerseits einer ikonischen Differenz, einer Differenz zwischen dem, was bildhaft sichtbar wird, und dem Medium, worin es sichtbar wird. Ahnlich wie beim Zeichen können wir zwischen (Ab)bildendem und (Ab)gebildetem unterscheiden. Das Bild selbst verdoppelt sich. Im Falle malerischer Bildnisse materialisiert sich die Differenz zu einer pikturalen Differenz; am Bildnis sind materiale und formale bzw. funktionale Momente zu unterscheiden. Dreh- und Angelpunkt dieser Bildkonzeption ist das winzige Als, das weder dem
3 Ich setze hier fort, was ich an anderer Stelle begonnen habe. Waidenfels 1990, Kap. 1 3 - 1 4 : Das Rätsel der Sichtbarkeit. Kunstphänomenologische Betrachtungen im Hinblick auf den Status der modernen Malerei und D e r herausgeforderte Blick. Zur Orts- und Zeitbestimmung des Museums; ders. 1999, Kap. 5 - 7 : Ordnungen des Sichtbaren und Anderssehen, insbesondere Kap. 6: D e r beunruhigte Blick, woran ich unmittelbar anknüpfe. Zu den Anregungen, die ich von Merleau-Ponty empfangen habe, vgl. meinen Beitrag in: Deutsch-Französische Gedankengänge, Frankfurt am Main 1995, Kap. 9: Das Zerspringen des Seins. Ontologische Auslegung der Erfahrung am Leitfaden der Malerei. Die erwähnten Vorarbeiten erlauben mir, an dieser Stelle einige Probleme zu pointieren, ohne das theoretische Umfeld in extenso auszuleuchten. 4 Vgl. hierzu ausfuhrlicher vom Verf., Phänomenologie unter eidetischen, transzendentalen und strukturalen Gesichtspunkten, in: Ders., Grenzen der Normalisierung. Studien zur Phänomenologie des Fremden, Frankfurt am Main 1998, passim und speziell 21. 5 Ich gehe hier wie zumeist von dem engen Begriff eines visuellen Bildes aus, doch in der Entfaltung der Bildaspekte erweist sich eine Ausweitung des Begriffs als unvermeidlich.
16
Bernhard Waldenfels
intentionalen Akt des Bildherstellers oder Bildbetrachters, n o c h d e m Bildgehalt zugerechnet w e r d e n kann. Das Als markiert d e n Auftritt des Bildes als Bild; o h n e dieses Als gäbe es w e d e r Bildgehalte n o c h Bildintentionen. D e m p h ä n o m e nologischen u n d h e r m e n e u t i s c h e n Als, das uns bei Husserl u n d H e i d e g g e r b e gegnet, entspricht also ein ikonisches bzw. pikturales Als. Im ähnlichen Sinne, w i e Husserl u n d M e r l e a u - P o n t y von f u n g i e r e n d e r F u n k tionalität, f u n g i e r e n d e m Ich, f u n g i e r e n d e m Leib o d e r f u n g i e r e n d e r Sprache sprechen, k ö n n e n wir das Bild, das etwas als solches sichtbar macht, als fungierendes Bild bezeichnen, dessen Fungieren durch keine T h e m a t i s i e r u n g einzuholen ist. W e n n das Bild nicht n u r einen sekundären Zusatz darstellt, sehen wir im Bild, bevor wir das Bild sehen. Das Als entspringt einer Art von SelbstdifTerenzierung. Das Bild unterscheidet sich nicht bloß von anderem, s o n d e r n es unterscheidet sich in u n d von sich selbst; ähnlich w i e der Leib, der als Leib f u n g i e r t u n d zugleich als K ö r p e r d i n g in der Welt v o r k o m m t . Das Rätsel der Sichtbarkeit liegt n u n darin, dass das Sichtbarwerden u n d S i c h t b a r m a c h e n selbst mit d e n Mitteln des Sichtbaren geschieht. In diesem Sinne habe ich an anderer Stelle von einer p o t e n z i e r t e n Sichtbarkeit gesprochen. Dies alles ist m e h r als selbstverständlich. D i e P r o b l e m e setzen ein, sobald wir die R o l l e des Bildes näher in Augenschein n e h m e n . Traditionelle u n d n e u e r e B i l d k o n z e p t i o n e n beschwören die doppelte G e f a h r herauf, dass die BildaufFassung e n t w e d e r in einer Bilderflut versinkt o d e r aber in allzu seichte Gewässer abtreibt. D i e erste G e f ä h r d u n g k ö n n e n wir als Ontologisierung des Bildes bezeichnen. D i e ikonische Differenz wird a u f g e h o b e n , w e n n Bilder sich in eine Bildrealität o d e r u m g e k e h r t Realitäten sich in Realbilder verw a n d e l n . D i e T e n d e n z dazu findet sich in e i n e m Piatonismus, in d e m S i n n e n dinge von sich aus als sinnliche Abbilder ideeller U r b i l d e r begriffen werden, o d e r in neuzeitlichen Bewusstseinstheorien, in d e n e n die D i n g e der physischen A u ß e n w e l t durch mentale Bilder einer paraphysischen Innenwelt verdoppelt w e r d e n . D i e ikonische Differenz setzt sich allerdings hinterrücks i m m e r w i e d e r durch. 6 Z u m einen verdoppelt sich die Welt in S i n n e n - u n d Ideenwelt, in A u ß e n - u n d Innenwelt, z u m anderen verdoppeln sich die platonischem Bilder in sinnliche Abbilder u n d ideelle Urbilder, so w i e die neuzeitlichen Vorstellungsbilder (ideas) in lebendige u n d verblasste Bilder zerfallen. Dieser Bilderspuk n i m m t ein E n d e , sobald wir von e i n e m gestuften Erfahrungsgefuge ausgehen u n d das Bild- o d e r Zeichenbewusstsein auf einer G r u n d s c h i c h t unmittelbarer E r f a h r u n g a u f r u h e n lassen. 7 H i e r zeigt sich j e d o c h eine andere G e f ä h r d u n g , d e n n diese Sichtweise f u h r t zu einer A b s c h w ä c h u n g der Bildererfahrung. D e m Bild liegt
6 Vgl. zu diesen Differenz-Begriffen Waldenfels 1990, 219; ders., 1999, 115, 132f. sowie B o e h m 1994, 29 ff. 7 Z u dieser Bildkonzeption, die bei Husserl, Fink und Ingarden grundgelegt und bei Sartre zu einer negativen Bildauffassung verschärft wird, vgl. G. D. Bensch, Vom Kunstwerk zum ästhetischen Objekt. Z u r Geschichte der phänomenologischen Ästhetik, M ü n c h e n 1994.
Spiegel, S p u r u n d B l i c k . Z u r G e n e s e des Bildes
17
nunmehr eine bildfreie Realität zugrunde, und dies aufseiten des Abzubildenden und, sofern man mit der Möglichkeit eines realitätsfreien Bildes rechnet, zumindest aufseiten des abbildenden Bildträgers. Dies hat weiterhin zur Folge, dass das Bildgeschehen, in dem etwas sichtbar wird, auf die Bildintentionen eines Bildvorstellers oder Bildherstellers, eines Bildbetrachters oder Bildbenutzers zurückgeführt wird. Die bildlose Realität bedarf eines Bildsubjekts, das die Wirklichkeit mit Bildern bevölkert. 8 Die ontologische Übersteigerung des Bildes in eine Bildrealität schlägt um in eine semiologisch-funktionale Herabstufung des Bildes zum bloßen Hilfsmittel oder Werkzeug. Im ersten Falle sind Bilder selbst real, im zweiten Falle vertreten sie die Realität. Es fragt sich nur, ob die bildhafte Ordnung und die Rolle des Bildes damit adäquat erfasst sind. U m die Ubermacht der Realität zu brechen und um das Bildmedium in seinem Fungieren zu thematisieren, bedarf es einer besonderen Art phänomenologischer Epoche. Es bedarf eines Blicks, der an sich hält, was mehr besagt, als sich des Urteils über die Realität zu enthalten oder gar die Realitätssetzung zu negieren. Vielleicht kann man behaupten, dass die bildende Kunst in dem, was sie tut, wenn auch nicht unbedingt, indem was sie von sich selbst denkt, eine solche Epoche praktiziert, und zwar in der Weise, dass sie nicht bloß etwas im Bild sichtbar macht, sondern die Sichtbarkeit selbst mit ins Bild bringt. Die natürliche Bildeinstellung würde damit durchbrochen, und die bereits erwähnte Potenzierung des Sichtbaren würde eine weitere Stufe erreichen. 9 Ähnlich wie laut R o man Jakobson die poetische Funktion der Sprache darin besteht, sich auf das eigene Medium zu beziehen, bestünde die pikturale Funktion des Bildes darin, sich auf das Bildmedium und, so fuge ich hinzu, auf das Bildgeschehen insgesamt, auf das Ins-Bild-Treten und das Ins-Bild-Setzen beziehen. Nehmen wir ferner mit Karl Bühler und R o m a n Jakobson an, dass an jedem Sprachereignis alle Funktionen der Sprache beteiligt sind, nur eben mit wechselnder Dominanz, so dürfte ähnliches für das Seh- und Bildgeschehen gelten, ohne dass eine Angst vor dem Referenten oder eine Verachtung des Referenten um sich greifen müsste. So wäre denkbar, dass Bilder sich Bilddingen und Dinge sich Dingbildern
8
F ü r R e i n h a r d B r a n d t , der sich in diesem P u n k t an die Imaginationslehre des frühen S a r -
tre anschließt, wird die d e m M e n s c h e n vorbehaltene N e g a t i o n z u m G e b u r t s a k t des Bildes, das definitionsgemäß etwas darstellt, was es nicht ist. V g l . die j ü n g s t e r s c h i e n e n e , systematisch a n g e legte u n d lehrreiche U n t e r s u c h u n g , Brandt 1 9 9 9 , die m e i n e n e i g e n e n Versuchen in diesem entscheidenden P u n k t u n d somit auch in der E i n s c h ä t z u n g des K u n s t g e s c h e h e n s zuwiderläuft. Ich füge hinzu, dass bei Husserl die /lferintentionalität keineswegs das letzte W o r t hat, dass diese v i e l m e h r a u f ein passives, nicht v o m Ich gesteuertes Erfahrungsgeschehen zurückverweist. V g l . E . Husserl, Passive Synthesis (Husserliana; X I ) , D e n Haag 1 9 6 6 . 9
V i e l l e i c h t k ö n n t e man in diesem Falle von e i n e m künstlerischen M e h r w e r t des Bildes
sprechen, der implizit b l e i b e n o d e r explizit hervortreten kann. Z u r P o t e n z i e r u n g der S i c h t b a r keit in e i n e r Dreistufung von realitätsgebundener Bildlichkeit, separatem Bildnis und künstleris c h e m B i l d vgl. Das R ä t s e l der Sichtbarkeit, in: Waldenfels 1 9 9 0 , 2 1 0 - 2 1 7 .
18
Bernhard Waidenfels
a n n ä h e r n , o h n e dass die ikonische D i f f e r e n z in d e r D e c k u n g v o n Bild u n d D i n g kurzschlussartig kollabiert. 1 0 I m F o l g e n d e n w e r d e ich die skizzierten Fragen vertiefen, i n d e m ich drei Bildaspekte w i e S u c h b i l d e r einsetze: das Abbild i m Kontrast z u m U r b i l d , das F e r n bild u n d das Fluchtbild, drei A s p e k t e also, die als Spiegel, S p u r u n d Blick p r o t o typisch in d e r E r f a h r u n g verankert sind. D a b e i g e h e ich v o n der U b e r z e u g u n g aus, dass eine gewisse F u n k t i o n a l i s i e r u n g des Bildes u n e n t b e h r l i c h ist, u m das Bild als Bild freizusetzen, dass aber alles, was ü b e r die F u n k t i o n a l i s i e r u n g h i n a u s g e h t , n i c h t global als O n t o l o g i s i e r u n g des Bildes a b z u t u n ist. Letzteres gilt in b e s o n d e r e m M a ß e f ü r das platonische B i l d d e n k e n , das sich trotz aller b e r e c h t i g ten Teilkritik so leicht nicht beiseite schieben lässt.
2. Abbild, U r b i l d u n d V e r ä h n l i c h u n g D i e Abbildlichkeit des Bildes erscheint als e b e n s o n a h e l i e g e n d w i e f r a g w ü r d i g . N i e m a n d w ü r d e sagen, Z e u x i s h ä t t e T r a u b e n gemalt u n d d a m i t Vögel angelockt, w e n n die g e m a l t e n T r a u b e n ganz u n d gar anders ausgesehen h ä t t e n als die essbaren. P i a t o n u n d viele andere vor i h m u n d n a c h i h m w ü r d e n n i c h t so sehr g e g e n d e n Bildzauber a n k ä m p f e n , w e n n n i c h t das, was i m Bild erscheint, d e m , was es ist, bis z u m Verwechseln ähnlich sehen k ö n n t e . U n d w e n n Aristoteles in seiner Poetik d e n M e n s c h e n als ^i|iiyuixcbTon:ov b e z e i c h n e t , so ist gewiss a u c h an eine g e n u i n e N a c h a h m u n g s l u s t u n d N a c h a h m u n g s f ä h i g k e i t zu d e n k e n u n d n i c h t gleich an sublime u n d deshalb a u c h w e n i g e r spezifische F o r m e n der Darstellung. Es ist n i c h t zu bezweifeln, dass ein K i n d m i t d e m N a c h m a c h e n u n d N a c h r e d e n b e g i n n t u n d e b e n d a m i t sein eigenes W o r t u n d sein eigenes T u n findet. S c h l i e ß lich k a n n alle künstlerische Raffinesse n i c h t vergessen m a c h e n , dass es j e n e Spiegel- u n d Schattenbilder gibt, die P i a t o n zwar ans u n t e r e E n d e der Bildhierarchie r ü c k t , auf die er d a n n aber i m m e r w i e d e r z u r ü c k k o m m t . Das Spiegel- u n d Schattenbild, das aus d e m Z u s a m m e n s p i e l v o n Lichteffekten, O b e r f l ä c h e n e i g e n schaften u n d Umrissgestalten entsteht, g e h ö r t z u m Gaukelspiel d e r N a t u r , das zwar e i n e n B e t r a c h t e r fordert, d e r eines i m a n d e r e n w i e d e r e r k e n n t , das aber auf k e i n e n Hersteller angewiesen ist. A m R a n d e sei b e m e r k t , dass selbst eine m i t allen Wassern d e r m o d e r n e n Sprachlogik g e w a s c h e n e Semiotik, w i e die von Peirce das Ikon g e n a n n t e , Bildzeichen v o m S y m p t o m u n d S y m b o l e b e n d a d u r c h unterscheidet, dass h i e r d e r B e z u g zwischen B e z e i c h n e n d e m u n d B e z e i c h n e t e m auf Ähnlichkeit b e r u h t , n i c h t auf Kausaleffekten o d e r auf K o n v e n t i o n e n .
10 Ich sehe darin eine Alternative zur Selbstaufhebung der Kunst und zu dem Abgesang auf die moderne Kunst, mit dem die zuvor erwähnte Untersuchung von R . Brandt ausklingt (vgl. Brandt 1999, 222ff.).
Spiegel, Spur u n d Blick. Z u r Genese des Bildes
19
Natürlich gibt es ein Arsenal von Einwänden, das uns nur zu gut vertraut ist. Wird das Bild als Abbild gekennzeichnet, das dem Abzubildenden ähnlich ist, so messen wir die Bilder bereits an einer bilderlosen Wirklichkeit — aber gibt es diese überhaupt? Das Problem der bildlichen Vermittlung ähnelt in dieser Beziehung dem der Sprachvermittlung. Heutige Sätze wie „Alles, was wir wissen, wissen wir aus den M e d i e n " deuten durch Übertreibung an, w o r u m es geht. Hinzu k o m m e n Einwände, die das M o m e n t der Ähnlichkeit unmittelbar betreffen. Dass auch Dinge einander ähneln wie im Falle von Zwillingen, zeigt an, dass Ähnlichkeit zur Charakterisierung von Bildlichkeit auch dann nicht ausreicht, wenn man ihr einen gehörigen Kredit einräumt. Ferner kann man darauf hinweisen, dass Ähnlichkeit keine Relation ist, die man den Dingen als solchen ansehen kann, ohne einen Gesichtspunkt einzunehmen, unter dem etwa eine Person der anderen oder ein Portrait der porträtierten Person ähnelt, sei es der Gesichtspunkt der Größe, der Hautfarbe, des Alters oder der der Körperhaltung. Die Ähnlichkeit gleicht darin Raumpositionen wie links und rechts, deren Z u schreibung ohne Angabe eines Standortes oder Fixpunktes nichtssagend wäre. 11 Gewiss sollte man nicht verkennen, dass eine Ähnlichkeit förmlich ins Auge springen kann, nämlich dann, wenn ein gemeinsamer Aspekt sich vordrängt, ohne dass wir einen ausdrücklichen Vergleichsmaßstab anlegen. Es gibt, wie Husserl ausfuhrlich gezeigt hat, vorprädikative Ähnlichkeitserfahrungen. Gleichwohl schließt dies alles nicht aus, dass das, was in der Ähnlichkeitserfahrung einander angeglichen wird, nicht an sich schon gleich ist. Keine Ähnlichkeit ist von Natur gegeben, ihr ist stets ein M o m e n t des Künstlichen und Kontingenten beigemischt. 1 2 Schließlich gibt es Einwände, die aus der Kunstpraxis und der Kunstgeschichte stammen. M a n kann sich darauf berufen, dass es von altersher O r n a mente gibt, also Bildwerke, die nichts abbilden, so etwa in der islamischen Wandkunst, und dass die sogenannte gegenstandslose Kunst schon längst darauf verzichtet hat, etwas abzubilden. Monets Seerosen und Cezannes Äpfel wären dann nur schwache Vorwände für ein autonomes Spiel von Farbe und Form, auf
11 Selbst qualitative Differenzen wie Rechts- und Linkshändigkeit oder die politische Flügelbildung in R e c h t e und Linke weist auf die Körpereinstellung des Hantierenden bzw. auf die parlamentarische Sitzordnung zurück. Die A n n a h m e schlichtweg vorgegebener Ahnlichkeitsassoziationen bei H u m e stößt hier auf ihre Grenzen. Z u r Phänomenologie der Assoziation als einer Form der Sinnbildung vgl. die grundlegende Studie von E. Holenstein, Phänomenologie der Assoziation. Z u Struktur und Funktion eines Grundprinzips der passiven Genesis bei E. Husserl, D e n Haag 1972. Z u r Frage der Ähnlichkeit im Bild vgl. auch Brandts Auseinandersetzung mit N. G o o d m a n , in: Brandt 1999, 1 8 6 - 2 0 3 ; ich kann dem Autor, der auf weite Strecken sehr erfrischend argumentiert, auch hier nicht folgen, wenn er dem Kulturalismus geschlossener Symbolsysteme das „natürliche Festland von kulturinvarianten Erfahrungen und optisch evidenten Z u o r d n u n g e n " entgegenstellt (197). 12 Nietzsches Formel vom „Gleichsetzen des Nicht-Gleichen" (Kritische Studienausgabe, Berlin 1980, 1, 880), von der ich wiederholt Gebrauch gemacht habe, bewährt sich auch hier.
20
B e r n h a r d Waldenfels
die m a n auf die D a u e r verzichten kann. O b es ganz so ist? G e h ö r e n Texturen u n d Lichtspiele nicht zur Natur? Eine negative Kennzeichnung wie .nicht-gegenständlich' oder ,unbewusst' wirft m e h r Fragen auf, als sie löst. In j e d e m Fall bleiben genug Einwände, die sich nicht einfach entkräften lassen, u n d dies ist auch nicht m e i n e Absicht. Vielmehr m ö c h t e ich zeigen, dass in d e m M o t i v der Ähnlichkeit m e h r steckt, als solche Einwände vermuten lassen. D a m i t k o m m e ich nochmals auf Piaton zurück. W e n n Piaton die Sinnendinge als Abbilder (umfpaTa, ö^oitbp.axa) u n d Bildwerke als Abbilder von Abbildern bezeichnet, so nicht im Hinblick auf eine bildlose Realität (wie in den neuzeitlichen T h e o r i e n der Bewusstseinsbilder), sondern im Hinblick auf ein Urbild (iöea), das durchaus geschaut wird, wenngleich mit den Augen der Seele oder des Geistes. M a n macht es sich zu einfach, w e n n m a n Piaton allzu schnell auf einen Ideenrealismus festlegt. 1 3 Entscheidend ist zunächst einmal, dass Piaton keineswegs einen Dualismus von Wirklichkeit u n d Bild zugrundelegt, sondern von einer Selbstverdoppelung u n d Selbstvervielfältigung des bildhaft Sichtbaren ausgeht. Die Tatsache, dass x y ähnelt besagt: x sieht aus wie y. Dieses W i e verk n ü p f t Sichtbares mit Sichtbarem, ausgehend von einer T r e n n u n g von x u n d y. In diesem Sinne ist es durchaus angebracht, von einer Bildhaftigkeit in den D i n g e n zu sprechen, die der Bildhaftigkeit von Bildnissen vorausgeht. Das sprachliche Pendant dieser Ähnlichkeit, in der eines für das andere eintritt, bildet die Metapher14 Diese Überlegungen führen auf die Spuren einer Genese des Bildes, die mit d e m Sichtbarwerden der Dinge verknüpft ist. Allerdings bedarf das platonische Paradigma entsprechender Korrekturen. 1. G e h e n wir aus von kontingenten Sehordnungen, die einer Geschichte des Sehens zugehören, u n d nicht etwa von e i n e m kosmischen Panorama, das alle Sichtbarkeit in sich versammelt u n d j e nach M e h r oder Weniger an Sein abstuft, so verschiebt sich das Gefälle der Sichtbarkeit von der ontologischen Vertikale auf die zeitlich-genetische Horizontale. Das Urbild wäre dann zu verstehen als Produkt einer Urbildung, einer Stiftung, die ein Gesichtsfeld eröffnet u n d Sehmöglichkeiten erzeugt. Das unsichtbare U r bild, das wir mit den A u g e n des Geistes erschauen, so etwa der mathematische Idealkreis, das unvermischte Weiß oder das „Gleiche selbst", verwandelt sich in
13 A u s d r ü c k l i c h so B r a n d t 1999, 21, 1 1 4 - 1 1 6 , 2 2 8 . D e r A u t o r b e t r a c h t e t das e i g e n e Spiegelbild d u r c h a u s als d e n „ U r s p r u n g d e r B i l d w e r d u n g " (43), d o c h b i n d e t er die S p i e g e l u n g an e i n e „kognitive L e i s t u n g des B e t r a c h t e r s " (32), die ihrerseits d e m Spiegelungsprozess nichts v e r d a n k t . Ich, der ich bin, sehe m i c h als e i n e n , d e r ich nicht bin - e b e n i m Bild. Vgl. d a g e g e n die f o l g e n d e n Ü b e r l e g u n g e n . 14 Vgl. die aristotelische B e s t i m m u n g der M e t a p h e r : „ G u t zu ü b e r t r a g e n (nsxatpoQEiv) b e d e u t e t das A h n l i c h e s e h e n . " (Poetik, 1 4 5 9 a 8) sowie die A u s w e r t u n g dieser B e s t i m m u n g bei P. Ricoeur, La m e t a p h o r e vive, Paris 1975, speziell 3 4 (dt. D i e l e b e n d i g e M e t a p h e r , M ü n c h e n 1986, 30).
Spiegel, Spur und Blick. Zur Genese des Bildes
21
ein Vor-Bild, das einen Kometenschweif von Nach-Bildern nach sich zieht. Dieses ,nach' ist im doppelten Sinne zu verstehen, als .nachher' (frz. après) u n d ,gemäß' (frz. d'après, selon). Darin unterscheidet sich eine Gestaltbildung in der Zeit von der Aneinanderreihung abzählbarer Elemente, die jeweils schon sind, was sie sind. W i r sehen mehr, als wir tatsächlich sehen, o h n e dass dieses M e h r einer getrennten Sphäre des Ubersinnlichen angehört. — 2. D e r strikte Gegensatz von reinem Urbild u n d b l o ß e m Abbild, von Primär- u n d Sekundärbild, weicht einer Skala der Sichtbarkeit, die an Grenzen der Sichtbarkeit stößt — wie im Falle des schwarzen Quadrats von Malevitsch —, aber keine Kluft zwischen Sichtbarem u n d Unsichtbarem aufreißt. Ein Urbild, das sich in wiederholten Nachbildern als solches bewährt, ist kein reines Urbild mehr; umgekehrt verliert das Nachbild das O d i u m bloßer Abbildlichkeit, da es selbst zur Gestaltbildung beiträgt. Ein reines Urbild, auf das wir nicht im wiederholten Sehen zurückkämen, wäre wie ein Blitz, der uns mit Blindheit schlägt; das bloße Abbild wäre umgekehrt ein Sehklischee, d e m ein stereotypisierter Blick entspräche. D e r Prozess des Sichtbarwerdens im Bild unterliegt d e m Paradox einer Wiederholung, in der das Selbe als Anderes wiederkehrt. - 3. Sofern die Gestaltbildung an der Herausbildung von etwas als etwas, von j e m a n d als j e m a n d beteiligt ist, sind wir berechtigt, von einer kreativen oder produktiven Bildlichkeit zu sprechen, die sich nicht auf eine vorhandene Realität stützt. In der Spiegelung, diesem so schlicht a n m u t e n d e n N o c h - e i n m a l u n d Immer-wieder, wird etwas zu dem, was es ist u n d niemals endgültig sein wird — so wie der Blick in den Spiegel uns, sobald der Firn der G e w ö h n u n g abblättert, uns mit uns selbst konfrontiert u n d nicht n u r ein b e kanntes Bild zurückwirft. In diesem Sinne gibt es ebenfalls eine kreative oder produktive Mimesis, so schon b e i m Kind, das sich in der elterlichen Imago e n t deckt, so b e i m Künstler, der im Kopieren alter Meister seine eigene Handschrift findet. Selbst die M i m i k r y bedeutet eine erfinderische Angleichung an die U m welt, in der Gestalten gebildet u n d nicht n u r vorhandene nachgemacht werden. — 4. In die Verähnlichung u n d N a c h a h m u n g gehen i m m e r schon Bedeutungselemente ein; es handelt sich u m „inkarnierte B e d e u t u n g e n " (Merleau-Ponty), die der platonischen N a c h a h m u n g von Ideen ein gewisses R e c h t einräumen. W e n n Erfahrung besagt, dass etwas als etwas auftritt, so gilt dies auch für die bildhaft vermittelte Erfahrung. N e h m e n wir ein Beispiel aus der gegenständlichen Erfahrung, das Husserl in seiner Bedeutungstheorie verwendet: W i r d N a p o l e o n p o r trätiert, so als kraftvoller Sieger von Jena oder als Verlierer von Waterloo, als Kaiser oder als Feldherr usf., niemals aber als N a p o l e o n schlechthin. Nichts wird ins Bild gebracht, o h n e dass es als etwas ins Bild gebracht wird. Die Selektion von Aspekten entspricht den erwähnten Gesichtspunkten der Ähnlichkeit. E b e n deshalb k ö n n e n verschiedene Bilder dasselbe D i n g oder dieselbe Person darstellen. Im Bild begegnen sich Sinnlichkeit u n d Sinn, so dass man mit Husserl u n d Plessner von einer genuinen Asthesiologie sprechen kann. Das Aussehen-wie gehört zu den Fäden, aus denen sich das G e w e b e der E r f a h r u n g knüpft, so dass
22
Bernhard Waidenfels
w i r — einen b e k a n n t e n Ausspruch a b w a n d e l n d — v o n einer Verfertigung von Bildern in der E r f a h r u n g sprechen dürfen. D i e elementare Bildlichkeit der E r f a h r u n g potenziert sich in der H e r v o r b r i n g u n g v o n Bildnissen, die auf gewisse Weise schriftlichen D o k u m e n t e n gleichen. W e n n D o k u m e n t e eine „virtuelle M i t t e i l u n g " zustande b r i n g e n , die sich von aktuellen Situationen u n d K o n t e x t e n ablöst, 1 5 so k ö n n t e m a n Bildnissen eine virtuelle Form des Sichtbarmachens zuschreiben. Es w ü r d e sich durchaus l o h n e n zu fragen, o b u n d wieweit die Differenz von M ü n d l i c h k e i t u n d Schriftlichkeit ihr visuelles Pendant hat. Hierbei wäre nach der R o l l e des Leibes zu fragen, u n d es stünde zu erwarten, dass der Körpersprache eine ebenso eigenartige K ö r p e r i k o nik entspricht. Diesen G e d a n k e n m ö c h t e ich hier nicht weiterverfolgen, 1 6 w o h l aber k o m m t es mir darauf an zu zeigen, dass j e d e F o r m der Bildherstellung in e i n e m Prozess des SichtbarWerdens verankert ist, von dessen Reflexivität jedes Sichtbarmachen zehrt. Insofern behält auch die Bildkunst etwas von der R ä t s e l haftigkeit der Spiegelung, die uns überrascht, bevor wir ihre Effekte i n s t r u m e n teil einsetzen. D i e Reflexivität des sinnlich G e g e b e n e n verweist auf eine „sinnliche R e f l e x i o n " unseres Leibes, der sehend ist u n d zugleich gesehen w i r d . 1 7 Dass etwas aussieht w i e . . . , b e d e u t e t , dass etwas in a n d e r e m sichtbar wird. D i e eintönigen Prozesse bloßer A b b i l d u n g u n d b l o ß e r N a c h a h m u n g r ü c k e n erst d a n n in d e n Vordergrund, w e n n die E n t s t e h u n g der O r d n u n g u n d ihre Spielr ä u m e in e i n e m festen O r d n u n g s b e s t a n d verschwinden; partielle u n d schillernde Ähnlichkeiten verwandeln sich d a n n in Identitäten die m a n notfalls durch andere ersetzt, o h n e dass sie ineinander ü b e r g e h e n .
3. Fernbild u n d Vergegenwärtigung D i e Selbstverdoppelung u n d Selbstvervielfältigung des Sichtbaren in F o r m von U r b i l d e r n u n d N a c h b i l d e r n f u h r t auf die B a h n e n der Verähnlichung u n d der W i e d e r h o l u n g . Etwas tritt n o c h einmal u n d i m m e r w i e d e r auf u n d g e w i n n t damit seine Gestalt, die sich im Bildnis verselbständigt. Solche Spiegelungen bilden das Gespinst des Sichtbaren. 1 8 Was in die A u g e n fällt, schillert auf vielfältige
15 Vgl. die Beilage III in Husserls Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie (Husserliana; VI), D e n Haag 1954, 371: „Es ist die wichtige Funktion des schriftlichen, des dokumentierenden sprachlichen Ausdrucks, dass er Mitteilungen o h n e unmittelbare oder mittelbare persönliche Ansprache ermöglicht, sozusagen virtuell gewordene Mitteilung ist." 16 Vgl. dazu v o m Verf., Ferne und N ä h e in R e d e und Schrift, in: Ders., Vielstimmigkeit der R e d e . Studien zur Phänomenologie des Fremden, Bd. 4, Frankfurt am Main 1999. 17 Vgl. Merleau-Ponty 1964 a, 33 (dt. 1984, 21), sowie ders. 1964 b, passim (dt. 1986). 18 Dies im Gegensatz zur Kausalität als dem harten „ Z e m e n t des Universums" (Hume).
Spiegel, Spur und Blick. Zur Genese des Bildes
23
Weise, und gleichzeitig bilden sich Licht-Bilder, von denen die Sichtbarkeit ausstrahlt und die von Sichtbarem umlagert werden wie von einem Lichthof. Man mag noch so oft behaupten, Dinge, die sich ähneln, seien keine Bilder, das optische Flimmern, das die Ähnlichkeit dieses Beinahe-dasselbe erzeugt, lässt sich nicht einfach dingfest machen. Wenn der alte Demokrit versichert, die Luft sei „voll von Bildern", 1 9 so mag dies unter anderem daher rühren. Es gibt nicht bloß Bilder in der Welt, sondern es gibt eine Bilderwelt, die an der Schwelle von Träumen und Wachen, von Tag und Nacht angesiedelt ist, im Dämmerlicht des „nächtlichen Tages" (Politeia 521 c), das der sich seit Piaton ausbreitenden Auf-klärung, jenen lumieres der Vernunft, beharrlich widersteht. Bilder bedeuten, dass es nie ganz Tag wird. Doch dies ist nicht alles. Bilder rücken in eine weitere Dimension ein, die in der Abwesenheit und Ferne eine Tiefe erreicht, die von der Oberflächlichkeit der Spiegelungen deutlich absticht. Was in der visuellen Erfahrung auftritt, sieht nicht nur aus wie anderes, dem es sich mehr oder weniger angleicht, es tritt auch mit anderem auf. Die alte Assoziationslehre spricht von einer zeit-räumlichen Kontiguität, die in der neueren Phänomenologie und Hermeneutik durch Sinnhorizonte ersetzt wird. Etwas tritt nicht nur als etwas auf, sondern in einem Z u sammenhang, der mit darüber entscheidet, als was das Einzelne erscheint. Gestalttheoretisch betrachtet gibt es kein Sehen ohne Gesichtsfeld. Hinter den Spiegelungen der Ähnlichkeit wird ein Ganzes sichtbar. Während die klassische Assoziationslehre einem Atomismus zuneigt, kündigt sich hier ein Holismus an, der allerdings eigene Probleme erwarten lässt. Das sprachliche Pendant dieser Mit-gegebenheit und Mit-meinung bildet die Metonymie, die laut Jakobson eine Kontextbildung bewirkt. 2 0 Doch was hat dies alles mit dem Bild zu tun? Im Hintergrund des Erfahrungsfeldes und speziell des Gesichtsfeldes, in dem etwas hier und jetzt sichtbar wird, tun sich Abgründe der Ferne auf. Wie der Geist, so Augustinus, zu eng ist, u m sich selbst zu umfassen, so ist das Erfahrungsfeld zu eng, u m sich selbst zu u m greifen. Was hier und jetzt auftritt, verweist auf anderes, das anderswo und anderswann zu finden ist, dort und nicht hier, einstmals oder dereinst und nicht jetzt. Die Rolle, die das Bild an dieser Stelle übernimmt, besteht nicht darin, Kontraste zu überbrücken, sondern Ferne in Nähe zu verwandeln und zu vergegenwärtigen, was nicht gegenwärtig ist. Die spezifische ikonische Fiktion, kraft derer x aussieht wie y, wird ersetzt durch eine repräsentative Funktion: x erinnert an y. Diese Dimension raumzeitlicher Ferne fehlt auch bei Piaton nicht. In seiner Anamnesislehre ist es die Leier, die an den Knaben erinnert, und im Austritt aus
19
Zitiert nach Brandt 1999, 117. Vgl. R.Jakobson, Die zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen, in: Ders., Aufsätze zur Linguistik und Poetik, hrsg. von W. Raible, M ü n c h e n 1974. 20
24
Bernhard Waldenfels
der Höhle, im Aufstieg zum Licht, in der Flucht „von hier nach dort" (Theaitet 176 a) spielt die Staffelung von Nähe und Ferne eine entscheidende Rolle. Auch die Vergegenwärtigung kann auf natürliche Vorformen zurückgreifen. Während die Verähnlichung durch Spiegelungen initiiert wird, lässt sich die Vergegenwärtigung von Spuren leiten. Der genuinen Bildlichkeit der Dinge entspricht eine ebenso genuine Zeichenhaftigkeit der Dinge, die der Herstellung von Zeichendingen vorausgeht. Was sich zeigt, zeigt auf anderes. Spuren sind komplexe Gebilde; sie weisen symptomatische Aspekte auf, die mit KausalefFekten zusammenhängen, aber auch spezifisch ikonische Aspekte, so etwa im Falle von Fingerabdrücken oder Fußspuren, die zur Identifizierung eines Täters fuhren können. 21 Entscheidend ist jedoch, dass Spuren hinterlassen werden, dass sie sich in die Materie einritzen, eingravieren; selbst eine Spur im Sand verweilt, solange nicht der Wind darüberfährt. Die Spur ist also weniger flüchtig als die Spiegelund Schattenspiele, die von einer bestimmten Beleuchtung abhängen. Während diese den photo- und kinematographischen Künsten nahestehen, nähert sich die Spur der Graphik und natürlich auch der Schrift. Auch diese Versuche, im Bild Spurenelemente aufzuweisen, stoßen auf Einwände. Diese betreffen zunächst den Zeichencharakter von Spuren. So wenig ein Zwilling Bild des anderen Zwillings ist, so wenig ist eine physische Veränderung im Sand, auf dem Fußboden oder am Himmel mit einer Spur gleichzusetzen. Spuren gibt es offensichtlich nur, wenn etwas als Hinweis auf Fernliegendes interpretiert und damit als Erinnerungs- oder Vorzeichen benutzt wird. Von Natur aus gäbe es demnach weder Spiegel- noch Erinnerungsbilder. Weiterhin scheint dies zu besagen, dass Spuren - ähnlich wie funktional verwendete Bilder — etwas Sekundäres sind, angesichts eines Primats der Gegenwart, in der unser Wirklichkeitsglaube sich bewährt. Das Zeichending, das real gegenwärtig ist, verweist auf etwas, das möglicherweise ebenfalls real, jedoch durch keine leibhaftige Gegenwart beglaubigt ist. Die Spur als Zeichen wäre also fundiert in der zeichenfreien Realität des physischen Zeigdinges. Doch damit sind die Einwände noch nicht erschöpft. Generell wird man zugeben, dass die Repräsentation ikonische Züge annehmen kann, doch man wird bestreiten, dass sie auf solche Züge angewiesen ist. Das Bezeichnende, das für das Bezeichnete steht (gemäß der alten Formel: aliquid stat pro aliquo), braucht diesem nicht zu ähneln. Der Bezug kann auch kausal oder konventionell zustande kommen, wie im Falle von chemischen Spurenelementen oder von Zahlzeichen und Eigennamen. Mit diesem Argument läuft die funktionale Semiotik der Ikonik, die wir hier im Auge haben, den Rang ab. Doch macht man sich die Sache mit diesen Einwänden nicht zu einfach?
21 Vgl. schon Theaitet 193 b - c und insgesamt zum Motiv der Spur: Waldenfels 1994, 545-552.
Spiegel, Spur und Blick. Zur Genese des Bildes
25
D e n w u n d e n P u n k t bildet der angebliche Primat der Gegenwart. Ist die Ferne wirklich ein Derivat der Nähe, beginnt die Ferne nicht in der Gegenwart, in der leibhaftigen u n d leiblichen Nähe, die nie ganz Gegenwart ist? Ahnlich wie im Falle der Selbstverdoppelung u n d Selbstvervielfältigung des Bildes in Urbild u n d Nachbilder müssen wir im Falle der Spur mit einer raumzeitlichen Selbstperschiebung rechnen, die dazu fuhrt, dass jedes Nachbild Z ü g e eines Fernbildes 22
annimmt. Ein reines, differenzloses Jetzt wäre ein Etwas, das nicht als etwas, wie anderes u n d mit anderem erschiene. Es wäre ein Gedankending, ein idealer Grenzwert 2 3 oder aber ein Empfmdungsblitz, der n u r als Grenzerfahrung u n d also im Kontrast zu normalen Erfahrungen fassbar ist. Ein reines Jetzt wäre nicht etwas, also buchstäblich nichts. Dies bedeutet, dass die Gegenwart selbst schon Spur eines anderen ist, eine Urspur (Derrida), die allen sekundären Erinnungszeichen vorausgeht. Jede Geburt verweist auf eine Urvergangenheit, die nie G e g e n wart war u n d sich als solche in die Gegenwart einzeichnet. 2 4 In dieser Urspur berühren sich Vergangenheit u n d Z u k u n f t , Nachzeichen u n d Vorzeichen; d e n n eine Vergangenheit, die nie Gegenwart war, bleibt zukunftsträchtig in F o r m eines zweiten Futurs, das nicht auf unsere gegenwärtigen Möglichkeiten zu reduzieren ist. Dies alles überträgt sich auf Bildnisse, die Fernes vergegenwärtigen. Ein Foto ist kein Fernbild, weil es einen Abwesenden darstellt, sondern weil es j e m a n d e n — u n d sei es mich selbst, der ich in den Spiegel schaue, u n d sei es dich selbst, der du vor mir stehst — als abwesend darstellt. Ahnliches gilt für Kultbilder, die den abwesenden Gott oder den abwesenden Herrscher vergegenwärtigen, oder f ü r A h n e n - u n d Totenbilder, die Abgeschiedene anwesend sein lassen. 25 Die U n nahbarkeit ist eine Unnahbarkeit aus der Nähe. Sie gehört einer „architektoni-
22
Eine entsprechende Verschränkung von Nähe und Ferne findet sich im Bereich der Sprache; vgl. meinen in Anm. 16 zitierten Aufsatz. 23 Vgl. dazu Husserls Zeitanalysen in: Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (Husserliana; X), Den Haag 1966, 40, sowie Derridas dekonstruktive Lektüre dieser Texte in: La voix et le phénomène, Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl, Paris 1967 (dt. Die Stimme und das Phänomen. Ein Essay über das Problem des Zeichens in der Philosophie Husserls, Frankfurt am Main 1979). 24 So Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris 1945, 280 (dt. Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966, 283) und Levinas 1974, 31 (dt. 1992, 68). Beide Autoren radikalisieren auf diese Weise Husserls und Heideggers Zeitlehre. 25 Vgl. hierzu die grundlegenden bildhistorischen Untersuchungen in H. Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 1990. Die Verwandlung des mittelalterlichen Kultbildes ins Kunstwerk der Neuzeit scheint durchaus mitverantwortlich dafür, dass das Zusammenspiel von An- und Abwesenheit gegenüber Fragen fiktiver Darstellung in der Bildreflexion und Bildpraxis zurückgetreten ist; mit der Säkularisierung der Bilderwelt wurde auch die Dimension des Anderen geschwächt, die heute unter veränderten Bedingungen wiederkehrt. Zum philosophischen Hintergrund einer Abwesenheit im Bild vgl. I. Därmann, Tod und Bild. Eine phänomenologische Mediengeschichte, München 1995.
26
Bernhard Waldenfels
sehen Vergangenheit" an, 2 6 die besagt, dass die Vergangenheit des Lebens o d e r des Bewusstseins uns affiziert, bevor sie e i n e m Bewusstsein der Vergangenheit, einer Erinnerungsarbeit oder Traditionspflege ü b e r a n t w o r t e t wird. D i e Spuren des Gedächtnisses reichen tiefer u n d weiter als die B e m ü h u n g e n der E r i n n e r u n g . Sie weisen zurück auf die D u n k e l z o n e eines ursprünglichen Vergessens, auch dies ein zentrales platonisches Motiv. Als leibliche Wesen haben w i r aus d e m Fluss Lethe g e t r u n k e n , so dass die Urbilder, die wir geschaut haben, i m m e r schon d e m Vergessen a n h e i m g e g e b e n sind. D i e Verähnlichung im N a c h b i l d wird durch die Vergegenwärtigung i m F e r n bild also nicht n u r ergänzt, s o n d e r n vertieft. Dies r ü h r t nicht zuletzt daher, dass Ferne als Ferne nicht zu erfahren ist o h n e ein Begehren, das m i c h anderswo sein lässt, w o ich nicht bin. In d e m schon e r w ä h n t e n Beispiel geht Piaton nicht bloß von e i n e m K n a b e n u n d seiner Leier aus, s o n d e r n von e i n e m geliebten K n a b e n , dessen Anwesenheit der Liebhaber vermisst. D i e Assoziation ist kein b l o ß e r M e chanismus, s o n d e r n w i e in Freuds T r a u m d e u t u n g ist sie aus d e m Stoff der A f fekte gewirkt. R e d u z i e r t m a n Bilder auf kognitive Schemata, so k a n n auch ein C o m p u t e r mit solchen Bildern u m g e h e n . D o c h Fernbilder, die nicht n u r E n t ferntes repräsentieren, speichern, reproduzieren, s o n d e r n Ferne als Ferne nah sein lassen, sind eine andere Sache, so w i e es einen Unterschied macht, o b etwas nicht an einer b e s t i m m t e n Stelle in R a u m u n d Zeit v o r k o m m t oder o b es nicht an d e m Platz ist, w o wir es suchen. Fernbilder stellen nicht n u r B e z ü g e her im Bereich des Sichtbaren, w i e U r b i l d e r u n d N a c h b i l d e r es t u n , s o n d e r n sie f u n g i e ren als Wunschbilder u n d Angstbilder. Vestigia terrent, diese Möglichkeit des Schreckens liegt in j e d e r Spur, die unseren A n e i g n u n g s - u n d Manipulationsversuchen zuvorkommt. M a n k ö n n t e sich fragen, wieso die Verähnlichung im Abbild, aber auch der E n t w u r f v o n modellartigen U r b i l d e r n in der Philosophie w i e in den n o m o l o g i schen Wissenschaften ein ungleich stärkeres Interesse auf sich gezogen hat als die bildliche Vergegenwärtigung dessen, was uns fern ist. Dies k ö n n t e damit zusamm e n h ä n g e n , dass der Prozess der Verähnlichung sich stärker an die Frage nach e i n e m allgemeinen Was, W o z u u n d W a r u m anlehnt, w ä h r e n d die Vergegenwärtigung es stärker mit der Frage nach d e m Dass u n d d e m faktischen W a n n u n d W o zu t u n hat, die bei d e n G r i e c h e n in d e n Bereich der iorooi« fällt. D i e Frage nach der Darstellung von F e r n e m u n d A b w e s e n d e m stellt sich auf alltägliche Weise, w e n n wir in die Fremde verschlagen w e r d e n , w e n n j e m a n d in der Ferne lebt, w e n n j e m a n d gestorben ist. Erkennungszeichen, R e i s e a n d e n k e n u n d G r a b mäler bilden einen b e s o n d e r e n Bildertresor. H i n z u k o m m e n spezielle Lebensbereiche, so etwa die Z e u g e n v e r n a h m e vor Gericht, die U n t e r s u c h u n g historischer Q u e l l e n u n d ethnischer Bräuche, schließlich der Bereich der politischen u n d
26
Vgl. Merleau-Ponty 1964 b, 296 (dt. 1986, 307).
Spiegel, Spur und Blick. Z u r Genese des Bildes
27
religiösen Repräsentation: diese Galerie von Herrscher-, Götter- und Kultbildern, die eine besondere Fernwirkung ausstrahlen. Der Blick in die Ferne ist natürlich auf vielfache Weise mit Fragen der bildlichen Darstellung verquickt, doch erschöpft er sich darin keineswegs. Es geht auch nicht an, diesen Umgang mit Ferne und Abwesenheit damit abzutun, dass die Kunst einem fremden Zweck unterworfen würde. So kann man nur reden, wenn man glaubt, Ferne, Tod, Zeugnis, kulturelle Fremdheit, politische Macht und eine sakrale Aura u n abhängig von ihrer Verbildlichung fassen zu können. Haben wir es hier nicht mit Bildern zu tun, die sich mit der unmöglichen Aufgabe abmühen, etwas ins Bild zu bringen, was jeden Bildrahmen sprengt? U n d gilt dies nicht gewissermaßen für jedes Bild, auch für das angeblich so autonome Tafelbild im Museum?
4. Fluchtbild und Entzug Die Bedenken gegenüber einer allzu einseitigen und allzu hochstufigen Bildauffassung steigern sich noch, wenn wir uns mit einer letzten Dimension befassen, die sich mit den beiden anderen Dimensionen kreuzt. Sie entspringt einer Verdoppelung des Sehens in Sehen und Gesehenes bzw. in eine Verdoppelung des Bildens in Bildwerdung und Gebilde, eine Verdoppelung, die der Zweiheit von Sagen und Gesagtem im Bereich der R e d e entspricht. 27 Sehen bedeutet hier das Ereignis des Sichtbarwerdens, das Zum-Vorschein-kommen und speziell das InsBild-treten, das in jeder Beschreibung sichtbarer Gestalten und Sachlagen enthalten ist. Man wird nicht sagen können, dass dieses M o m e n t in den Prozessen der Verähnlichung und Vergegenwärtigung fehlt, aber es taucht dort nur in zweideutiger Form auf und wird vielfach in seiner Eigengewichtigkeit verkannt. Es besteht die Tendenz, der natürlichen Blickrichtung zu folgen und das Sehen im Gesehenen, das Bildwerden im Gebilde aufgehen zu lassen. N e h m e n wir n o c h mals die Differenz von Abbildendem und Abgebildetem. Diese Relation bleibt im Bereich des Sichtbaren, also im Bereich dessen, was schon gesehen wurde und was noch zu sehen ist. Sofern das Bild sich dem bloßen Abbild nähert, steigert sich die Sichtbarkeit nicht, sie breitet sich lediglich aus. N u n wird im Laufe der Bildgeschichte immer wieder darauf hingewiesen, dass ein vollkommenes, vollständiges Abbild die ikonische Differenz, ohne die es kein Bild gäbe, aufheben würde. Pygmalion wird sowohl in der Kunsttheorie wie in der Kunstpraxis immer wieder herbeizitiert als eine paradoxe Figur, die es darauf anlegt, die Grenzen der Fiktion aufzuheben. Doch worin besteht diese Aufhebung? Sie besteht keineswegs darin, dass das Standbild sein Vorbild vollkommen wiedergibt, es in allen Stücken sichtbar macht. Die Pointe liegt nicht in der vollständi-
27
Ausführlicher dazu: Waldenfels 1994, II. Teil, Kap. 2 und 3. 4.
28
Bernhard Waidenfels
gen Ansicht, sondern im lebendigen Bild, das bei Daumier vom Sockel herabsteigt - ein zweiter Kratylos gleichsam (Kratylos 431 c), doch zugleich ein „bezaubernd schönes Bild", das zum Leben erwacht. Das Standbild wandelt sich in ein Gehbild wie schon die Geräte des Dädalus. Schon oft wurde bemerkt, das der Maler im Griechischen ^¿»ypacpot; heißt, also jemand, der Lebendiges darstellt. Nimmt man dies ernst, so würde damit das Reich der Sichtbarkeit nicht etwa vollendet, sondern überschritten; denn lebendig, sich selbst bewegend ist das Sichtbare im Blick, der uns trifft, nicht in einer vollkommenen Ansicht. Hier deutet sich also bereits jener Uberschuss an, auf den unsere Überlegungen abzielen. Dieser Uberschuss gerät ebenfalls aus dem Blick, wenn das, was zur Abbildung kommt, als Urbild, als löset gefaßt wird, also als eine geschaute Gestalt, als ein geschautes Gebilde, das einer höheren, sublimierten Form der Sichtbarkeit zugehört. So schwach unsere menschlichen Augen auch sein mögen, sie würden partizipieren an der Allsichtigkeit eines Panoramas, das alles umfasst, und an einer Panikonik, in der das Sein sich als sich selbst zeigt. In der Idee schließt sich der Spalt zwischen Sein und Erscheinung. Das .Gleiche selbst' oder das ,Schöne selbst' bildet sich gleichsam durch sich selbst ab, es steht einzig für sich selbst. Wenn in der Neuzeit die Schranken fallen, die das vollendete Urbild unserem Machen entrücken, wenn Künstler, Techniker im alten und neuen Sinne sich daran machen, Urbilder eigenmächtig vor- und herzustellen, so breitet sich ein Reich künstlicher Sichtbarkeit aus. Die Höhlenbewohner proben den Aufstand, indem sie eine künstliche Beleuchtung einrichten und die nächtliche Höhle in einen „nächtlichen Tag" verwandeln, der das natürliche Sonnenlicht entbehrlich macht. Dies wäre kein Piatonismus für das Volk, sondern ein Piatonismus für Sehexperten. Bei Piaton selbst fällt das Licht allerdings weder in den Bereich des Sichtbaren, noch steht es den Sehenden zur Verfügung. Er fasst es als jenes Dritte zwischen Sehen und Gesehenem, von dem das „sonnenhafte Auge", auch das „Auge des Geistes", seine Sehkraft empfängt. Das Auge ist das sonnenhaftigste, sonnenartigste f)AioEi8EGTa.TÖv unter den Sinnesorganen (Politeia VI, 508 b). Wenn aber alles im Lichte der Sonne gesehen wird, kann es dann noch einmal eine Idee der Sonne, des Lichtes geben, wie es bei Piaton eine Idee des Guten gibt, oder führt die Bewegung, die „über das Sein hinaus" (eitExsiva xfjq ouaiaq) führt, auch über das Reich der Sichtbarkeit hinaus? 28 Doch ein Licht, das nicht nochmals in einem höheren Licht erstrahlt, zeigt ,Sonnenflecken', die sich im .blinden Fleck' des Sehens wiederholen. Auf radikalere Weise wird das Regime des Sichtbaren durchbrochen, wenn das Urbild als Urbildung, als Urstiftung der Sichtbarkeit in eine Geschichte des Sehens eintritt. Das Urbild verwandelt sich in einen Ursprung, der das Sehen ini-
2 8 Eine Koinzidenz von öqoktk; und öjjaxöv wie im Falle des Plotinschen Nus (s. Enneades V, 3, 8) wäre damit ausgeschlossen.
Spiegel, Spur u n d Blick. Z u r Genese des Bildes
29
tiiert. Dieser Ursprung, der n u r nachträglich, der n u r rückblickend ver-gegenwärtigt u n d re-präsentiert werden kann, konfrontiert uns mit einer Unsichtbarkeit im Sichtbaren, die j e d e Allsichtigkeit z u m Phantasma werden lässt. W i r bewegen uns in H o r i z o n t e n des Sichtbaren, die der Sichtbarkeit Grenzen auferlegen u n d j e d e m Bild, das etwas sichtbar macht, die Z ü g e eines Fernbildes aufprägen. D o c h i m m e r n o c h sind die Zweideutigkeiten nicht beseitigt. So lange die Ferne an einer U r n ä h e , die Abwesenheit an einer ursprünglichen Anwesenheit, die Vergegenwärtigung an einer lebendigen Gegenwart als d e m O r t der Sichtbarkeit bemessen wird, erscheint alles Unsichtbare als faktisch Unsichtbares, das nicht m e h r oder n o c h nicht sichtbar ist, aber e i n e m „Universalfeld" der Sichtbarkeit zugehört. Die Allsichtigkeit dauert fort, n u r eben als potentielle Allsichtigkeit. Weltgeschichtliche Vereinnahmungen u n d E i n o r d n u n g e n der Kunst finden hier ihre Nahrung. Ein radikaler Ausbruch aus einer kosmischen oder geschichtlichen E i n o r d n u n g des Seh- u n d Bildgeschehens findet sich an anderer Stelle, nämlich dort, w o das Sehereignis selbst ins Auge fällt u n d ins Bild eindringt. D e r Prototyp der Sichtbarkeit des Unsichtbaren ist nicht m e h r der Spiegel, der eines d e m anderen ä h n lich macht, nicht die Spur, die uns an Fernliegendes erinnert, sondern der Blick, der uns trifft als fremder Blick. Sofern auch der eigene Blick anderswo beginnt, an einem „ N i c h t - O r t " , 2 9 an d e m ich nicht sein kann, haftet d e m Blick als solc h e m etwas Fremdes an. So wie laut Michail Bachtin jedes Wort ein „halbfremdes W o r t " ist, 30 ist auch j e d e r Blick ein halbfremder Blick. Die abbildliche Verdoppelung des Sichtbaren u n d die zeitlich-räumliche Selbstverschiebung kulminiert in der Verdoppelung des Blicks, in einem Selbstentzug, in d e m das Sehen sich selbst entgleitet u n d ein unendliches Sehbegehren auslöst, das in keiner Augenlust Befriedigung findet. Sofern Spiegelbild u n d Spur an diesem G e schehen teilhaben, erreichen sie ebenfalls eine Tiefendimension, wie sie in Lacans D e u t u n g des Spiegelstadiums oder bei Levinas in der Spur des Anderen zum Vorschein k o m m t . W i e Merleau-Ponty in Le visible et l'invisible zeigt, öffnet sich im Prozess der Angleichung ein Spalt der Andersheit u n d der Fremdheit: Sehendes u n d Gesehenes unterliegen einer Koinzidenz in der Nicht-Koinzidenz. Sie decken sich u n d decken sich nicht. Die Tendenz zur Vergegenwärtigung u n d Selbstvergegenwärtigung wird aufgehalten durch eine Art Entgegenwärtigung, in der das Gegenwärtige sich entzieht. Die Fremdheit zeigt sich als Fremdheit in einer F o r m der leibhaftigen Abwesenheit. 3 1
29 30
Vgl. Levinas 1974, 58 (dt. 1992, 110), sowie die sokratische Atopie. M . M . Bachtin, Die Ästhetik des Wortes, hrsg. von R . Grübel, Frankfurt am Main 1979,
185. 31 Vgl. Husserls Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale P h ä n o m e nologie (Husserliana; VI), D e n Haag 1954, 189. Husserl parallelisiert an dieser Stelle „EntGegenwärtigung" mit „ E n t - F r e m d u n g " .
30
Bernhard Waldenfels
A m E n d e fragt sich, w i e ein Sehen ins Bild gebracht w e r d e n k a n n , das sich der Sichtbarkeit u n d damit auch der bildlichen Darstellung entzieht. O f f e n s i c h t lich k a n n dies n u r auf indirekte Weise geschehen, in F o r m einer „indirekten M a l e r e i " , 3 2 die in der A b w e i c h u n g von den O r d n u n g e n des Sichtbaren sichtbar macht, was aus d e m jeweiligen S e h - u n d B i l d r a h m e n herausfällt. In diesem Z u s a m m e n h a n g spreche ich v o n e i n e m Fluchtbild, das an einen F l u c h t p u n k t p e r spektivischer Darstellung erinnert, mit d e m Unterschied, dass der Fluchtort der Fremdheit die Linien u n d B a h n e n des Sehens nicht verlängert, s o n d e r n sie abb r e c h e n lässt, sei es, dass der Blick in der A b g r ü n d i g k e i t des Sichtbaren versinkt, sei es, dass er gegen eine Blickmauer prallt. Das Fluchtbild besteht nicht darin, dass etwas wie anderes aussieht o d e r an anderes erinnert, s o n d e r n es lässt sich in die Formel fassen: x fordert auf zu y. W e n n es u m das S e h - u n d Blickgeschehen als solches geht, haben wir es nicht n u r mit d e m Produzentenblick dessen zu tun, der etwas ins Bild setzt, auch nicht mit d e m Rezipientenblick dessen, der etwas d e m Bild e n t n i m m t , s o n d e r n mit e i n e m Anblick, der der Anrede, d e m Appell vergleichbar ist, der unseren a n t w o r t e n d e n Blick herausfordert. Dieser Blick ist n u r als Seitenblick möglich, als Blick, der sich nicht frontal auf etwas heftet, das er ins A u g e fasst u n d das i h m vor A u g e n steht, s o n d e r n ein Blick, der von d o r t h e r k o m m t , w o etwas uns b e u n r u h i g t u n d uns hinterrücks i m E i g e n e n heimsucht.33 D i e Beschäftigung der Bildverfertigung w i e auch die Beschäftigung von Literatur u n d D i c h t u n g mit sich selbst, hat w i e so vieles, was uns auf d e m W e g dieser B e t r a c h t u n g b e g e g n e t ist, etwas Zweideutiges. Es k a n n b e d e u t e n , dass das, was m a n in unserer neuzeitlichen, ästhetisch gefärbten Tradition ,Kunst' n e n n t , einen w a c h s e n d e n Weltverlust auf narzisstische Weise w e t t m a c h t , in F o r m einer Reflexionskunst, die in mancherlei Hinsicht der sogenannten Reflexionsphilosophie gleicht. Es k ö n n t e aber auch sein, dass die Kunst in sich selbst eine Z o n e der Blindheit entdeckt, die d e m Schweigen gleicht u n d sie mit ihrer eigenen Fremdheit konfrontiert, mit e i n e m herrenlosen regard sauvage, der nie G e g e n w a r t war u n d nie G e g e n w a r t sein wird. 3 4 Dies w ü r d e b e d e u t e n , dass die ikonische Differenz zwischen d e m , was sichtbar, u n d d e m w o r i n etwas sichtbar wird, sich nicht in einer F o r m a l - o d e r Materialästhetik o d e r in einer reflexiv g e w o r d e n e n Kunst verliert, s o n d e r n dass sich hinter dieser unverzichtbaren Differenz ein w e i -
32
Merleau-Ponty 1964 a, 75 (dt. 1984, 37). Die Lévi-Strauss nacheifernde Forderung von Hans Belting (1995, 178 und 193), man möge die Kunst der eigenen Kultur mit dem Blick eines Ethnologen betrachten, u m auf die Fiktionen der geschriebenen Kunstgeschichte aufmerksam zu werden, findet ihren Anhalt in einem Blick, der anderswoher k o m m t . 34 Vgl. dazu M . Merleau-Ponty, La prose du monde, Paris 1969, 185f. (dt. Die Prosa der Welt, M ü n c h e n 1984, 149): D e r Andere begegnet uns niemals völlig frontal, sondern stets lateral, marginal, indem er überraschend in unserem Gesichtsfeld auftaucht. 33
Spiegel, Spur und Blick. Z u r Genese des Bildes
31
terer Spalt öffnet, nämlich eine „responsive Differenz" zwischen dem, was in der Bildverfertigung erfunden wird, und dem, worauf diese antwortet. Piaton setzt dem bloßen Augenschein eine Flucht in die „Logoi", eine Flucht in gedankenvolles Reden entgegen (Phaidon 99 e). Heute eine „Flucht in die Bilder" zu fordern, erscheint als überflüssig; eine „Flucht aus den Bildern" zu verkünden wäre reichlich hoffnungslos, und dies nicht nur wegen der zunehmenden Bilderflut, sondern auch deswegen, weil es unserer leiblichen und sinnlichen Existenz zuwiderliefe. Doch bedenkenswert bleibt der Gedanke einer Bildlosigkeit inmitten der Welt der Bilder, ein blinder Fleck, der das Rätsel der Sichtbarkeit wachhält.
Abgekürzt zitierte Literatur Belting 1995
H . Belting, Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren, M ü n c h e n 1995. B o e h m 1994 G. B o e h m (Hrsg.), Was ist ein Bild?, M ü n c h e n 1994. Brandt 1999 R . Brandt, Die Wirklichkeit des Bildes. Sehen und Erkennen - Vom Spiegel zum Kunstwerk, M ü n c h e n 1999. Levinas 1974 E. Levinas, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, D e n Haag 1974 (dt. Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, übersetzt von T h . Wiemer, Freiburg und M ü n c h e n 1992). Merleau-Ponty 1964 a M . Merleau-Ponty, L'œil et l'esprit, Paris 1964 (dt. Das Auge und der Geist, übersetzt von H . W. Arndt, H a m b u r g 1984). Merleau-Ponty 1964 b M . Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, Paris 1964 (dt. Das Sichtbare und das Unsichtbare, übersetzt von R . Giuliani und B. Waldenfels, M ü n c h e n 1986). Waidenfels 1990 Waidenfels 1994 Waldenfels 1999
B. Waldenfels, Der Stachel des B. Waldenfels, Antwortregister, B. Waldenfels, Sinnesschwellen. den, Bd. 3. Frankfurt am Main
Fremden, Frankfurt am Main 1990. Frankfurt am Main 1994. Studien zur Phänomenologie des Frem1999.
ARBOGAST SCHMITT
Der Philosoph als Maler - der Maler als
Philosoph
Zur Relevanz der platonischen Kunsttheorie
A n einer zentralen Stelle der Politeia, an der Piaton entwirft, wie der philosophische Staatsgründer bei der politischen D u r c h f u h r u n g seiner T h e o r i e vorzugehen hat, vergleicht er die damit gestellte Aufgabe mit der Aufgabe, die ein Maler zu bewältigen hat, w e n n sein Ziel die höchste Schönheit der Darstellung ist. Die Verfahrensweise des politisch tätigen Philosophen sei eben die, die ein Maler bei der Erarbeitung der „schönsten Z e i c h n u n g " anwende. Bei der Herstellung eines solchen Bildes müsse er häufig abwechselnd nach zwei Seiten hin blicken, bald auf das von N a t u r Schöne (usw.), bald darauf, wie dieses von N a t u r Schöne sich bei den einzelnen Menschen, die er darstellt, ausnimmt. U n d so werde er einiges (von dem, was er am einzelnen vorfindet) auslöschen, anderes werde er einzeichnen, d.h. ergänzen, verbessern, u n d sich dabei auf das stützen, was H o m e r schon das Göttliche oder Gottähnliche unter den Menschen genannt habe (Politeia 501 b 1 - c 3).' In einer Weise, die b e r ü h m t e Formulierungen Aristoteles' u n d Plotins v o r w e g n i m m t (richtiger: begründet), beschreibt Piaton das schönste Bild auch als ein Bild, das zeigt, wie der schönste Mensch wäre, d.h. wie er in konkreter Erscheinung aussehen würde, w e n n alle Bedingungen der Schönheit von i h m erfüllt wären — im Unterschied zu einer Darstellungsweise, die einfach wiedergibt, was sie in empirischer Kontingenz als verwirklichte Schönheit vorfindet. 2 Diese h o c h b e r ü h m t e Schilderung des künstlerischen Schaffensprozesses lieferte, wie von Erwin Panofsky zu R e c h t festgestellt wurde, einen theoretischen R a h m e n , an d e m sich die E n t w i c k l u n g der Kunst in Europa fast
1 Z u Piatons Kunsttheorie in der Politeia vgl. zuletzt M . Kardaun, Der MimesisbegrifF in der griechischen Antike, A m s t e r d a m / N e w Y o r k / O x f o r d / T o k y o 1993; P. Murray, Plato o n Poetry, Cambridge 1996; S. Halliwell, T h e R e p u b l i c s Two Critiques of Poetry, in: O. Höffe (Hrsg.), Piaton, Politeia, Berlin 1997, 3 1 3 - 3 3 2 ; Kersting 1999. Eine sorgfältige und umfassende Abwägung des Verhältnisses der positiven u n d negativen Äußerungen zur Kunst bei Piaton gibt jetzt Büttner 2000. D o r t auch eine ausfuhrliche Diskussion der älteren u n d neueren Sekundärliteratur zum T h e m a . 2 Siehe Piaton, Politeia 472 d 5 - 9 ; vgl. damit Aristoteles, Poetik, Kap. 9, 1451 a 3 6 - 1 4 5 1 b 11 (siehe dazu unten 45fF.) und Plotin, Enneades, V, 8, 1, 3 2 - 4 0 .
Der Philosoph als Maler - der Maler als Philosoph
33
zweitausend Jahre orientiert hat. 3 Sie wirft aber zugleich eine Fülle von Problemen auf, und zwar sowohl, weil ihre genaue Deutung umstritten ist, als auch deshalb, weil es schwierig, j a fast unmöglich scheint, sie mit dem kritischen U r teil über Kunst und Literatur in Einklang zu bringen, das Piaton an vielen Stellen, mit besonderer Schärfe aber im zehnten Buch der Politeia äußert. Beide Problemkomplexe hängen natürlich aufs engste zusammen. Denn die Frage, ob sich das positive Urteil über die Kunst an dieser Stelle mit den negativen Äußerungen anderer Stellen vereinbaren lässt, setzt zuerst eine korrekte D e u tung dieser Stelle selbst voraus. Die bis heute maßgebliche und im wesentlichen kaum in Frage gestellte D e u tung hat bereits die Renaissance geliefert. Robortello z.B., der erste Kommentator der Aristotelischen Poetik in der Renaisssance, unterscheidet die dichterische Darstellung von einer bloßen Faktenwiedergabe in Prosa daran, dass der Dichter nicht auf den individuellen Charakter hinsieht, den er fingiert und nachahmt, sondern auf die Natur selbst und auf das vollkommene Exemplar dieses Charakters. Er beruft sich für diese sich schon im Wortlaut eng an Horaz anlehnende Deutung ausdrücklich auf Piaton: Piaton habe von den Malern verlangt, sie müssten immer auf die Idee hinsehen und alles schöner darstellen, als es ist. Diese ideale Darstellung erreicht der Maler oder Dichter in der Platon-Deutung Robortellos, wenn er bei der künstlerischen Gestaltung einer Person auf etwas Allgemeines und Gemeinsames seinen Blick richte. Wenn ein Künstler z.B. den klugen Odysseus darstellen wolle, dann dürfe er sich nicht auf die konkreten, individuellen Eigenschaften dieses Odysseus konzentrieren, sondern müsse zum Allgemeinen übergehen und ein Bild entwerfen, wie der Kluge überhaupt sei. Robortello macht den Künstler geradezu selbst zum Philosophen: Er müsse alle äußeren und individuellen Umstände unberücksichtigt lassen und ein rein fiktives Bild davon schaffen, wie der Kluge in seiner Absolutheit von den Philosophen beschrieben werde. 4 Robortello konstruiert also einen scharfen Gegensatz zwischen der konkret anschaulichen Individualität, die es in der Realität gibt, und der abstrakten Idealität, die die Kunst herstellt. Diese Idealität verlangt eine Abstraktion, ein Absehen von der sinnlichen Materialität 5 und einen Rückgang auf die Idee im Sinn
3 Siehe E. Panofsky, Idea. Ein Beitrag zur BegrifFsgeschichte der älteren Kunsttheorie, B e r lin 7 1 9 9 3 (1924; 2 1 9 5 9 ) , l f . 4 Siehe Francesco Robortelli, Utinensis Explicationes in librum Aristotelis, qui inscribitur D e Poetica, Florenz 1548 ( N D München 1968), v. a. 8 7 - 9 1 . Siehe dazu Schmitt 1998, 1 7 - 5 4 . 3 Die Auffassung, dass das Abstrahieren auf das vielen Gemeinsame notwendig zu einer Reinigung der Form von allem Sinnlich-Materiellen fuhrt, ist aber im Sinne Piatons eher fraglich: denn das, was man in einem Begriff als das zusammenfasse was z.B. j e d e m , der zornig ist, zukommt, enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade besonders viele M o m e n t e , die mit dem materiellen Sein der einzelnen Instanzen eines solchen Charaktertyps zu tun haben: zum Beispiel ein rot angelaufenes Gesicht, eine verfinsterte M i e n e o. ä.
34
Arbogast S c h m i t t
der inneren Regelgesetzlichkeit, von der die Materie geprägt ist und von der sie gleichsam ihre Gestalt erhalten hat. D e n Ermöglichungsgrund eines solchen Rückgangs von der kontingenten Mannigfaltigkeit der materiellen Erscheinungsformen auf die innere Form sieht beispielsweise Ficino in seinem Kommentar zu Plotins Enneade Über das Schöne darin, dass die Idee genau das ist, was übrig bliebe, wenn man von einem Körper seine Materie wegnehmen könnte: D i e F o r m in e i n e m s c h ö n e n K ö r p e r ist ihrer Idee in derselben Weise ähnlich, w i e die Gestalt eines G e b ä u d e s in d e r M a t e r i e d e m Vorbild i m Geist des Baumeisters ähnlich ist. ( . . .) W e n n m a n d a h e r e i n e n M e n s c h e n d e r M a t e r i e e n t k l e i d e t , die F o r m aber zurücklässt, d a n n ist e b e n die F o r m , die z u r ü c k b l e i b t , j e n e Idee, n a c h d e r d e r M e n s c h gebildet w u r d e . 6
Diese angeblich platonische Auslegung des Wesens der Schönheit unterscheidet sich von den Aussagen der Politeia bereits dadurch, dass sie die Transzendenz der Idee zwar nicht bestreitet, sie aber gleichsam in eine immanente Transzendenz verwandelt. Piaton setzt eine ausdrückliche Differenz zwischen dem Schönen von Natur oder als Idee und dem Schönen, wie es in die einzelnen Menschen hineingebildet ist, 7 und verlangt vom Künstler, er solle die Schönheit des einzelnen Menschen vom Blick auf das Schöne selbst her ergänzen und dadurch verbessern. Von Ficinos Position her kann es eine Verbesserung der im einzelnen realisierten Natur in einer strikten Auslegung seiner Argumentation gar nicht mehr geben. Wer einen Menschen seiner Materie .entkleidet' hat, d.h. in Abstraktion von der sinnlichen Mannigfaltigkeit seiner materiellen Erscheinungsweisen auf die diese Erscheinungsvielfalt formende Idee zurückgegangen ist, hat nicht nur ein individuelles, mehr oder weniger konzises Formgesetz gerade dieses Körpers vor sich, sondern in ihm zugleich die Idee, nach der oder, wie Ficino auch formuliert, auf die hin dieser Mensch gebildet wurde. So nimmt es nicht wunder, dass maßgebliche Künstler der Renaissance, o b wohl sie dasselbe Verständnis der Idee als eines Abstrakt-Allgemeinen haben wie Robortello und andere Kunsttheoretiker der Renaissance, zur Intention, die N a tur verbessern zu wollen, eine eher kritische Distanz einnehmen. Den Satz aus Sapientia 11, 21, Gott habe alles nach Maß, Zahl und Gewicht geschaffen, 8 hat
6 Siehe Ficinos K o m m e n t a r zu Plotins E n n e a d e I, 6, Über das Schöne, in: O p e r a o m n i a , I I / 2 , Basel 1 5 7 6 ( N D T u r i n 1959). 7 Siehe z.B. Piaton, Politeia 501 b 2 - b 4; a u c h e b e n d a , 4 0 2 a 7—b 9, w o P i a t o n z w i s c h e n d e n T u g e n d e n f ü r sich, d e n k o n k r e t e n T u g e n d e n des E i n z e l n e n u n d d e n w a h r n e h m b a r e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n dieser T u g e n d e n (ihren .Bildern') u n t e r s c h e i d e t . 8 Sapientia 11, 21 ist a u c h g r u n d l e g e n d f ü r die (im Vergleich m i t d e n R e n a i s s a n c e - T h e o retikern ganz andere) augustinische KunstaufFassung. Vgl. Verf., Z a h l u n d S c h ö n h e i t in A u g u s tinus' D e Musica VI, in: W ü r z b u r g e r J a h r b ü c h e r f ü r die Altertumswissenschaft, N . F. 16 (1990), 2 2 1 - 2 3 7 . Z u r g e n u i n p l a t o n i s c h e n B e d e u t u n g dieses Satzes siehe die w i c h t i g e u n d g r u n d l e g e n d e Analyse bei W. Beierwaltes, Augustins I n t e r p r e t a t i o n v o n Sapientia 11, 2 1 , in: R e v u e des E t u d e s A u g u s t i n i e n n e s , 15 (1969), 5 1 - 6 1 .
D e r Philosoph als Maler - der Maler als Philosoph
35
Ficino bereits so ausgelegt, als seien Maß und Zahl nicht das Vorbild im Geiste Gottes, nach dem in größerer oder geringerer Annäherung die Natur gestaltet sei, sondern als seien sie die immanente Strukturgesetzlichkeit der Welt selbst. Im Sinn dieser Uberzeugung ist die Natur „in ihren Maßen so vollständig vom Gesetz bestimmt, dass man im Einzelteil das Ganze (ex ungue leonem) zu erken« 9
nen vermag . Aus diesem Geist heraus betont z.B. Leonardo da Vinci nachdrücklich, nur j e n e Malerei sei lobenswert, die in völliger Konformität mit der dargestellten Sache ganz der Wahrheit der Natur verpflichtet sei. 1 0 Der Unterschied zwischen einer Nachahmung der empirisch kontingenten Natur, wie sie Gegenstand der Historie, nicht der Kunst im Sinne der Poetikauslegung Robortellos ist, und der idealen oder schönen Natur als dem eigentlichen Gegenstand des Künstlers ist in dieser Konzeption eingeebnet: Die Natur ist in ihr selbst schöne Natur und bedarf keiner Rückführung auf eine Idee. Die Überlastung der empirisch endlichen Natur, die im Sinn dieser Auslegung von sich her und durchgängig schöne Natur sein muss, 11 hat eine Problemsitua-
9 Siehe G. Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori . . . nelle redazioni del 1550 e 1568, I, Text, ed. R . Bettarini, Florenz 1967, 111. 1 0 Siehe z.B. Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, Parte terza, Nr. 4 0 5 (QuaF pittura e più laudabile). Leonardo fordert deshalb vom Künstler ausdrücklich genau das, was Piaton der schärfsten Kritik unterwirft: er solle die Welt draußen abbilden, und möglichst so, wie ein Spiegel es tut; und er verwahrt sich gegen diejenigen Theoretiker, die die anschauliche Natur verbessern wollen. Siehe v. a. Leonoardo da Vinci, Frammenti letterari e filosofici, hrsg. von E. Solmi, Florenz 1899, 102 (siehe dort L X X X V I - L X X X I X : der Künstler als Spiegel). 11 Die Tendenz, Natur grundsätzlich als schöne und vollkommene Natur zu begreifen, prägt die Kunsttheorie mindestens bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Ganz entschieden ist etwa Gottsched in seinem Versuch einer critischen Dichtkunst: „Die Schönheit eines künstlichen Werkes beruht nicht auf leerem Dünkel; sondern sie hat ihren festen Grund in der Natur der Dinge. Gott hat alles nach M a ß , Zahl und Gewicht geschaffen. Die natürlichen Dinge sind an sich selber schön ( . . .) Das genaue Verhältnis, die Ordnung und richtige Abmessung aller Teile, daraus ein Ding besteht, ist die Quelle aller Schönheit. D i e Nachahmung der vollkommenen Natur kann also einem künstlichen Werke Vollkommenheit geben, ( . . .) und die Abweichung von ihrem Muster wird allemal etwas ungestaltes und abgeschmacktes zuwege bringen" (Ausgewählte Werke, hrsg. von J . Birke und B. Birke, VI, 1, Berlin und N e w York 1973, 183f.). W i e man sieht, ist es für Gottsched austauschbar dasselbe, ob er von natürlichen Dingen, von der Natur der Dinge oder von der vollkommenen Natur spricht. Zur sachlichen Problematik und zur historischen Genese dieser Ambivalenz siehe Verf., Klassische und platonische S c h ö n heit. Anmerkungen zu Ausgangsform und wirkungsgeschichtlichem Wandel des Kanons klassischer Schönheit, in: W. Voßkamp (Hrsg.), Klassik im Vergleich, Stuttgart und Weimar 1993, 4 0 3 - 4 2 8 . Dass gerade in diesem Hinausspielen der kontingenten, dunklen, fragmentarischen Seiten der Natur die innere Sprengkraft lag, die schließlich zur Auflösung des (spezifisch neuzeitlichen) Nachahmungskonzepts überhaupt führte, zeigt gut H. Blumenberg, „Nachahmung der Natur". Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen, in: ders., Wirklichkeiten in denen wir leben, Stuttgart 1981, 5 5 - 1 0 3 (zuerst in: Studium generale, 10, (1957), 2 6 0 283).
36
Arbogast Schmitt
tion geschaffen, mit der die Kunst der Neuzeit lange gerungen hat. Sie ist aber keineswegs platonisch, ebensowenig wie die radikale Kluft zwischen einer konkret sinnlichen und vielfältigen Anschauung und einem abstrakt leeren Denken in Allgemeinheiten und Gemeinsamkeiten, von der bereits die Kunsttheorie der Renaissance - wenn auch nicht immer bereits mit ausdrücklicher Bewusstheit — geprägt ist. Für Piaton entsteht, wie ich noch zeigen möchte, die Idee nicht einfach aus der Abstraktion von der sinnlichen Materialität. Wenn man sich aber einmal, wie etwa Robortello oder Ficino, auf diese Position eingelassen hat, dann ist die Kritik, die schließlich zur Konzeption der Ästhetik im 18. Jahrhundert geführt hat, kaum mehr zu vermeiden. Denn die distinkte Klarheit der Idee ist dann erkauft durch den Verlust des Reichtums und der Bedeutungsprägnanz der Anschauung. W i e wenig Piaton von dieser Kritik mitbetroffen ist, kann gerade sein vielgescholtenes Urteil über die Maler und Dichter im zehnten Buch der Politeia deutlich machen, um derentwillen Piaton von Nietzsche als „Kunstmörder" 1 2 oder als „der größte Kunstfeind, den Europa bisher hervorgebracht hat" 1 3 , bezichtigt worden ist. Denn die rationalistisch spekulative Kunstkonzeption der Renaissance, die von der Ästhetik des 18. Jahrhunderts endgültig destruiert wird, ist an einen strikten Nachahmungsbegriff gebunden, der, wie wir von Leonardo gehört haben, höchste Konformität mit der nachgeahmten Sache fordert. Gerade ein zu enger Nachahmungsbegriff aber ist es, der Piaton veranlasst, eine Kunstform, die sich ihm verschrieben hat, nicht in sein Staatskonzept aufzunehmen. Denn Piaton schließt keineswegs, so oft diese Fehlbehauptung auch wiederholt wird, jede Form von Kunst und Dichtung aus demjenigen Staat aus, der ein möglichst gutes und glückliches Leben seiner Bürger anstrebt, sondern, wie er ausdrücklich betont, nur diejenige Kunst, die nachahmend ist. Das Prinzip der Nachahmung, oder, wie man gleich genauer sagen sollte, eine falsche Form der Nachahmung führt nach Piaton also zu einer defizienten Form der Kunst und damit zugleich zu einer Gefährdung ihrer wichtigen musisch-erzieherischen Aufgabe im Staat. 1 4 Piatons Kritik an einem mimetischen Kunstverständnis kann daher nicht nur einen Zugang zum Verständnis dessen, was für Piaton Kunst im besten Sinn ist,
Siehe Nietzsche Werke III, 11 (Die Geburt der Tragödie), 96. Siehe Nietzsche Werke VI, 2, 4 2 0 . 1 4 D e n Begriff der Nachahmung hatte Pia ton in den ersten Büchern der Politeia schon mehrfach und in mehreren Bedeutungen gebraucht. An dieser Stelle (und zwar gleich mit Beginn seiner erneuten Diskussion der R o l l e der Kunst im Staat: Politeia 595 a 5 ff.) aber definiert und erläutert er ausfuhrlich, was er meint, wenn er von einer nachahmenden Kunst spricht. Es sollte klar sein, dass im zehnten B u c h der Politeia nicht j e d e r mögliche Gebrauch von Nachahmung bei Piaton in Frage kommt, sondern nur der hier ausdrücklich beschriebene. Zu den verschiedenen Verwendungen von Mimesis bei Piaton vgl. jetzt Büttner 2 0 0 0 , 131-143, 162-166, 170-215. 12 13
D e r P h i l o s o p h als M a l e r - der M a l e r als P h i l o s o p h
37
öffnen, sie kann zugleich auf ein erheblich differenzierteres und anderes Verhältnis von Anschauung und Begriff aufmerksam machen, als es die schablonenhafte Unterscheidung zwischen der konkreten Anschaulichkeit des Einzelnen und der abstrakten Allgemeinheit des Denkens nahelegt. Piaton beginnt seine Argumentation mit der „gewohnten Methode" (Politeia 596 a 6), d.h. damit, bei jeder Vielheit von Einzeldingen, denen wir dasselbe Prädikat zuordnen, ein ,eidos' vorauszusetzen. So gebe es z.B. viele Betten und Tische, aber jeweils nur eine Idee des Bettes oder des Tisches. Diese Einleitung erweckt in der Tat den Verdacht, als ob Piaton - und schon Aristoteles scheint ihn manchmal so missverstanden zu haben - überzeugt gewesen sei, man verstehe die Einzeldinge dadurch, dass man sie einer Idee zuordne oder einem Begriff unterordne. Dieser Verdacht ist aber nur halbrichtig, 15 und wie vieles Halbrichtige besonders irreführend, weil es dazu verleitet, wichtige Differenzen zu unterschlagen. Natürlich ist Piaton überzeugt, dass man die vielen immer wieder anderen Einzeldinge der Erfahrung von etwas her verstehen muss, das identisch und gleich bleibt, das genau und nur dieses bestimmte Etwas ist, da man sonst gar nichts erkennen könnte. Aber dieses Identische ist nicht das, was wir unter einem abstrakten Begriff zu denken gewohnt sind, jedenfalls dann nicht, wenn Begriff eine Abstraktion der Form von der Materie meint, wie sie Ficino beschrieben hat, oder wie sie von Kant charakterisiert wird, etwa wenn er den Begriff, z.B. den Begriff eines Hundes „als eine Regel" beschreibt, „nach welcher meine Einbildungskraft die Gestalt eines vierfüßigen Tieres allgemein verzeichnen kann, ohne auf irgendeine einzige besondere Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet (...) eingeschränkt zu sein" 16 . Wäre diese Begriffsbildungstheorie richtig, nach der wir Begriffe aus einem auf die allgemeinsten Merkmale reduzierten Schema gewinnen, verfügten Kinder, die jedes vierfußige Lebewesen „Wauwau" nennen, bereits über ein entfaltetes Begriffsvermögen.
15 In b e s o n d e r s negativer Weise w i r d ein k o r r e k t e s P l a t o n - U r t e i l bis h e u t e b e e i n t r ä c h t i g t d u r c h die U b e r z e u g u n g , I d e e n seien f ü r Piaton „vergegenständlichte P r ä d i k a t e " , „ A l l g e m e i n g e g e n s t ä n d e " (So w i e d e r Kersting 1999, 306.). D a n n müsste m a n , w i e a u c h Kersting b e h a u p tet, I d e e n ü b e r Prädikate identifizieren k ö n n e n , es g ä b e g e n a u so viele I d e e n , w i e es P r ä d i k a t e gibt. Dass dies n i c h t Platonische L e h r m e i n u n g ist, ist a b e r vielfach belegbar, a m deutlichsten d e m o n s t r i e r t dies der d e r erste Teil des Parmenides. D e r W i d e r s i n n , der sich aus d e r T h e s e ergibt, zu j e d e m m ö g l i c h e n Prädikat müsse es a u c h eine Idee g e b e n , ist so o f f e n k u n d i g , dass es fast erstaunlich ist, w i e viele I n t e r p r e t e n ü b e r z e u g t sind, P i a t o n h a b e i h n n o c h gar n i c h t b e m e r k t . D i e k o m p l e x e Frage, die s c h o n in der p l a t o n i s c h e n A k a d e m i e intensiv diskutiert w u r d e , w o v o n es tatsächlich I d e e n gibt, u n d w o v o n nicht, k a n n hier n i c h t b e h a n d e l t w e r d e n , eine zentrale Voraussetzung f ü r ein angemesseneres Ideenverständnis, die Tatsache n ä m l i c h , dass I d e e n f ü r P i a t o n ü b e r h a u p t keine, a u c h k e i n e idealen, G e g e n s t ä n d e sind, s o n d e r n sachliche I n b e griffe m ö g l i c h e r F u n k t i o n e n , spezifischer L e i s t u n g e n v o n etwas, soll aber i m F o l g e n d e n w e n i g stens v o n e i n i g e n A s p e k t e n m i t u n t e r s u c h t w e r d e n . 16
Siehe I. Kant, Kritik d e r reinen V e r n u n f t . A 141 (Weischedel 1983, II).
38
Arbogast Schmitt
G e r a d e der Text aber, in d e m Piaton d e n n a c h a h m e n d e n Künsten die dritte Stelle nach der Wahrheit zuweist, m a c h t unmissverständlich deutlich, dass Piaton die Identität des Begriffs ü b e r h a u p t nicht in irgendeiner Gemeinsamkeit von Vorstellungsmerkmalen sucht, in e i n e m Schema oder, w i e etwa Wittgenstein a n n i m m t , in einer Familienähnlichkeit o d e r dergleichen. Das Konstante u n d Identische bei einer Vielzahl von Einzeldingen o d e r auch einzelnen H a n d l u n g e n findet m a n nach Piaton n u r durch einen Dimensionswechsel, der die D i m e n s i o n der Vorstellungen, der abstrakten genauso w i e der k o n k r e t e n , übersteigt. N i c h t irgendein ideales Gegenstandsmuster muss dafür in d e n Blick g e n o m m e n w e r den, sondern, w i e Piaton sagt, das ,Werk', die spezifische Leistung o d e r F u n k tion einer Sache. 1 7 U m diese Art des Dimensionswechsels leicht verständlich u n d anschaulich z u gänglich zu m a c h e n , wählt Piaton i m m e r w i e d e r Beispiele aus d e m Bereich des H a n d w e r k s . I m z e h n t e n B u c h der Politeia sind es das Bett u n d der Tisch, i m ersten B u c h war es vor allem das Sichelmesser, im Kratylos sind es die Schere u n d die Weberlade, an deren Herstellung er exemplifiziert, was er m e i n t , w e n n er von e i n e m Hinblicken auf die Idee spricht. W e n n ein H a n d w e r k e r einen Tisch herstellen m ö c h t e , m a c h t e es in der Tat w e n i g Sinn, w e n n er sich dazu an i r g e n d e i n e m ,Allgemeingegenstand', an e i n e m von k o n k r e t e n T i s c h f o r m e n abgezogenen Schema ,Tisch' orientieren wollte. Ein solches Schema k ö n n t e es nicht einmal geben. D e n n ein Tisch k a n n quadratisch, r u n d , oval, viereckig usw. sein, er k a n n einen Fuß, drei, vier Füße usw. haben, so dass auch ein u n b e s t i m m t allgemeines Schema, etwa ,viereckig mit vier F ü ß e n ' eine Fülle von Tischmöglichkeiten unerfasst ließe. Dasselbe gilt von d e n Materialien. Ein Tisch k a n n aus H o l z so gut w i e aus M a r m o r , Glas usw. sein. A u ß e r d e m garantiert d e m Schreiner w e d e r eines n o c h eine K o m b i n a t i o n dieser M e r k m a l e , dass er einen Tisch hergestellt hat, w e n n er ein Gebilde g e m a c h t hat,
17 Im Sinn der zitierten Begriffsbildungstheorie ist es für den gegenüber Piaton so kritischen Kant dagegen selbstverständlich, dass der Begriff immer noch eine Art Vorstellung ist, w e n n auch eine allgemeine. Siehe z.B. Anthropologie 1. Teil, 1. Buch, § 7 (Weischedel 1983, VI): D e r Begriff ist „das Bewusstsein der Tätigkeit in Zusammenstellung des Mannigfaltigen der Vorstellung nach einer Regel der Einheit desselben". Logik § 1 (Weischedel 1983, III): D e r Begriff ist „eine allgemeine (repraesentatio per notas communes) oder reflektierte Vorstellung"; ebda: D e r Begriff ist „eine allgemeine Vorstellung dessen, was mehreren O b j e k t e n gemein ist". Z u r H e r k u n f t dieser Identifizierung des Begriffs mit einer Sonderform der Vorstellung, die in der Antike bereits die hellenistischen Philosophenschulen der Stoa, des Epikureismus und der Skepsis gemacht hatten, aus der spätmittelalterlichen Aristotelesinterpretation, die damit zugleich den Boden für die intensive Neurezeption dieser hellenistischen Philosophien in der Renaissance vorbereitet hatte, siehe Verf., Anschauung und D e n k e n bei Duns Scotus. U b e r eine für die neuzeitliche Erkenntnistheorie folgenreiche Akzentverlagerung in der spätmittelalterlichen Aristoteles-Deutung, in: E. R u d o l p h (Hrsg.), Die Renaissance und ihre Antike. Die Renaissance als erste Aufklärung, I, Tübingen 1998, 7 - 3 4 .
Der Philosoph als Maler - der Maler als Philosoph
39
das tatsächlich unter einen Begriff mit diesen Merkmalen fällt. Ein viereckiges Gebilde aus Holz mit vier Füßen z.B. kann ebensogut ein Fußschemel sein wie ein Tisch. An all dem orientiert man sich nach Piaton auch gar nicht, wenn man einen Tisch herstellen will, sondern man orientiert sich an einer bestimmten Leistung, die man erzielen will, etwa, dass man etwas braucht, worauf man etwas legen und an das man sich setzen kann. Im Kratylos betont Piaton darüber hinaus, dass diese Orientierung sogar noch spezifiziert werden muss. Bei der Weberlade z. B. gilt allgemein: Die Funktion, Kette und Einschlag zu trennen, ist dasjenige Identische, das jede Weberlade zu einer Weberlade macht. Zur Herstellung einer bestimmten Weberlade aber muss man zusätzlich wissen, ob sie diese Aufgabe an feinem oder grobem, leinenem oder wollenem Zeug erfüllen muss, usw. (Kratylos 389 b 8—c 1). Ich weise darauf hin, dass Piaton diese Spezifizierung für notwendig hält, um zu belegen, dass der Blick auf die Funktion zwar auf etwas Identisches führt, nicht aber auf etwas abstrakt Schematisches. Nicht nur Farbe und Form lassen viele Konkretisationen zu, auch die Funktion lässt sich vielfältig differenzieren. Bevor ich versuche, etwas genauer zu klären, was eine Funktion im Sinne Piatons ist, und wie sie erkannt wird, möchte ich zeigen, dass bereits die Grundunterscheidung, wie wir sie bisher nachgezeichnet haben, ausreicht, um die platonische Kritik an den nur nachahmenden Künsten in einem ganz anderen als dem gewohnten Licht erscheinen zu lassen. Piaton unterscheidet die Idee selbst von ihrer Realisation in einer bestimmten Form und in einem bestimmten Material durch den Handwerker. Das, was der Handwerker zustandebringt, ist nicht die Sache Tisch selbst, nicht die Funktion als solche, sondern, wie Sokrates formuliert, etwas, das nur so ist, wie die Sache, an dem die Sachbestimmtheit also nur ein qualitativer Aspekt ist. In gewissem Sinn ist daher auch das Tun des Handwerkers für Piaton eine Form des Nachahmens: Er realisiert eine bestimmte Möglichkeit in einer bestimmten Form und in einem bestimmten Material. Dieses Nachahmen ist aber kein bloßes Nachahmen, kein Kopieren eines anderen Einzelnen, es versucht nicht, ein Gegebenes mit den eigenen Mitteln einfach zu wiederholen, sondern es sucht in schöpferischer Weise nach den geeigneten Materialien und den geeigneten Formen, 1 8 die eine angestrebte Funktion erfüllen können. Wer z.B. etwas vom Lautenton als dem ,Werk' der Laute, der spezifischen Leistung, die die Laute zur Laute macht, versteht, der ist es, der auch das richtige Holz und seine Bearbeitung entweder
1 8 Im Sinn dieser platonischen Differenzierung ist es ein konfuser Sprachgebrauch, Idee mit Form zu übersetzen. Die Idee ist nicht die (äußere) Form, in die irgendein Material gebracht worden ist, sondern die in sich selbst genau bestimmte Möglichkeit, die in verschiedenen Materialien und Formen realisiert werden kann - aber eben nur in solchen Formen und Materien, die zur Realisation gerade dieser Möglichkeiten geeignet sind.
40
Arbogast Schmitt
selbst ermitteln oder einen anderen, der wiederum davon etwas versteht, anleiten kann, etwas produktiv herzustellen, in dem der gesuchte Lautenton realisiert werden kann. In diesem Sinn ist das Tun des Handwerkers kein bloßes Nachahmen, sondern etwas Schöpferisches. D e r Schreiner z.B., der eine zerbrochene Weberlade vor sich hat, setzt nicht die alte Weberlade wieder irgendwie zusammen und versucht dann, eine exakte Kopie davon zu machen, sondern er orientiert sich wieder an dem, was eine Weberlade ist, d.h. an ihrer Funktion (Kratylos 3 8 9 b 1 - 6 ) , und schafft so eine neue Lade, keine Wiederholung der alten. Genau dies aber macht nach Piaton der nur nachahmende Künstler, paradigmatisch der mimetische Maler. Er glaubt, sich nicht um das kümmern zu müssen, was eine Sache ist, d.h. was ihre spezifische Leistung ausmacht, sondern er ist überzeugt, alles darstellen zu können, wenn er nur dessen optische Erscheinung kopiert. Piatons Kritik an diesem Maler, er sei um nichts besser als jemand, der mit einem Spiegel herumlaufe und sich einbilde, er könne auf diese Weise Pflanzen, Tiere, Menschen, Erde und Himmel hervorbringen, ist bekannt genug, genauso wie Piatons Schlussfolgerung, ein solcher Maler binde sich völlig an die jeweilige Perspektive, in der sich etwas darstellt, sein Produkt sei deshalb vielfaltigen Verzerrungen und Täuschungen ausgesetzt und nur ein drittes nach der Wahrheit. 1 9 Man wird, wenn man Piatons Unterscheidung zwischen der spezifischen Leistung, dem Akt einer Sache, an dem man erkennt, was etwas ist, und der Weise, w i e ein solcher Akt in einem so oder so geformten Material realisiert ist, im Auge behält, dieses Urteil kaum für abwegig halten. Selbst ein guter Photograph spiegelt nicht einfach das Gegebene wider, wie er es gerade vorfindet, sondern
19 Das Problem, das Piaton mit dem Maler als dem dritten nach der Wahrheit hat, ist daher nicht, wie Kersting 1999, 3 0 8 f. wieder vorträgt, dass er aus Unfähigkeit, selbst etwas, z.B. einen Stuhl, herzustellen, zur Farbe greift und sich einen Stuhl abmalt - Maler würde dann nur der, dem das Zeug zum Handwerker fehlt - sondern dass es Maler gibt, die meinen, man brauche für ein gutes Bild gar nichts von der dargestellten Sache zu verstehen, es genüge, einfach die Farben und Formen wiederzugeben, in denen sie erscheinen (Politeia 6 0 0 e— 601 a). Diese bloß mimetischen Maler möchte Piaton aus seinem Staat ausgeschlossen wissen, nicht den Maler überhaupt. Analoges gilt von den Dichtern. Ein Dichter, der meint, er brauche nicht zu wissen, nach welchen Handlungsprinzipien sich ein gerechter Charakter richtet, es genüge, wenn er die beobachtbaren Handlungen beschreibe, die Leute, die als gerecht gelten, an den Tag legen, nur ein solcher Dichter ist ein dritter nach der Wahrheit und nur er ist den perspektivischen Täuschungen der Wahrnehmung ausgesetzt, etwa wenn er beobachtet, wie gerechte Menschen fremdes Eigentum zurückgeben, und deshalb meint, er müsse solche Handlungen darstellen, um zu zeigen, was einen gerechten Charakter ausmacht. Ein wirklich gerechter Mensch würde aber zum Beispiel einem Mörder das geschuldete Mordinstrument nicht zurück geben, und das heißt, wenn man zeigen will, wie ein gerechter Mensch handelt, darf man nicht einfach einzelne gerechte Handlungen nachahmen, sondern muss sie als Ausfluss der Gesinnung zeigen, von der her sie allein die Qualifikation ,gerecht' oder ,nicht gerecht' haben.
Der Philosoph als Maler - der Maler als Philosoph
41
er sucht durch die Wahl der Position, der Lichtführung, der Konturierung usw. das Charakteristische, Signifikante, Prägnante o.ä. darzustellen. Ein Bild, das nichts dergleichen enthält, würden auch wir als unwahr bezeichnen können. Dass die platonische Kritik nichts mit dem hoffnungslosen Unverständnis eines Philosophen für die Kunst zu tun hat, wird aber erst genauer deutlich, wenn man verfolgt, wie sie im einzelnen von Piaton durchgeführt ist. Dabei kann sichtbar werden, dass Piaton mit der Charakterisierung des Vorgehens des Handwerkers, des Demiurgen, eine wichtige Analogie zum künstlerischen Schaffensprozess aufgedeckt hat, und zugleich, dass seine Kritik an der Mimesis des Faktischen sich überhaupt nicht an der abstrakten Rationalität orientiert, von der her die Kunsttheorie der Renaissance die Aufgaben der Kunst zu bestimmen versucht hatte. Da es uns hier nicht nur um Piatons Stellung zur Kunst im Allgemeinen, sondern zur Malerei im besonderen geht, muss zusätzlich geklärt werden, wie man nach Piaton in der Dimension des Sichtbaren mit den Mitteln von Farbe und Form Gegenstände, Charaktere, Gefühle usw. darstellen kann. 20 Ich konzentriere mich der Deutlichkeit halber zunächst auf das Problem der Gegenstandsdarstellung. Gegenständliche Malerei ist heute in besonderem Maß dem Verdacht ausgesetzt, einem veralteten Nachahmungskonzept verhaftet zu sein. Dieser kritische Vorbehalt würde aus platonischer Sicht nur den Kopisten treffen, der sich von der Täuschung durch das sinnliche Meinen und den gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht freimachen konnte. Denn in einem korrekten Sachverständnis kann man nach Piaton die Gegenständlichkeit von Gegenständen überhaupt nicht sichtbar machen. Auch Aristoteles betont, dass das Sichtbare niemals ein Abbild eines Gegenstandes sein kann, sondern immer nur ein Symbol, ein Zeichen von ihm (Politik 1340 a 27-40). Obwohl Piaton und Aristoteles mit dieser Auffassung eine wichtige Grundüberzeugung des Poststrukturalismus teilen, weichen die Begründung und der Inhalt ihrer Auffassung erheblich von der des Poststrukturalismus ab, und zwar vor allem deshalb, weil sie von einer anderen erkenntnistheoretischen Position ausgehen und deshalb auch der Wahrnehmung eine andere Funktion zuweisen, als es der Poststrukturalismus im Gefolge einer langen neuzeitlichen Tradition tut. Piaton und Aristoteles unterscheiden sich von dieser Tradition v.a. dadurch, dass sie kritisch darauf reflektieren, was eine Wahrnehmung überhaupt als Wahrnehmung, d.h. sofern sie nichts als einen reinen Wahrnehmungsakt tätigt, leistet, und davon strikt getrennt halten, was in einen konkreten Erkenntnisakt, bei dem
20 Dass für Piaton das eigentliche Darstellungsziel der Malerei die Darstellung von Charakteren und seelischen Zuständen ist, belegen Stellen wie Politeia 4 0 1 a l f f . oder N o m o i 654 e 9 - 6 5 7 c 2. Für die Gegenstände der Literatur siehe das Folgende und dazu Politeia 399 a 5 - c 4; 603 c 5 - c 10; N o m o i 798 d 7 - e 3.
42
Arbogast Schmitt
m a n nicht n u r etwas w a h r n i m m t , s o n d e r n etwas als etwas auffasst, an zusätzlicher Erkenntnisleistung einfließt. 2 1 Das, was m a n sieht, ist nach Piaton u n d Aristoteles ausschließlich Farbe u n d F o r m . G e n a u s o h ö r t m a n n u r T o n e u n d kein Cello, riecht G e r ü c h e u n d nicht ein P a r f ü m usw. Dass unsere D e n k - u n d Sprachgewohnheit, die so tut, als n e h m e m a n Gegenstände wahr, oberflächlich ist, k a n n besonders gut Piatons Beispiel von der Weberlade klarmachen. Es d ü r f t e h e u t e w o h l n u r n o c h w e n i g e geben, die tatsächlich eine Weberlade ,sehen', w e n n m a n i h n e n eine Weberlade zeigt. W i r sehen vielmehr, was m a n sieht: ein farbiges Gebilde in b e s t i m m t e r F o r m . Dass dieses Gebilde eine Weberlade ist, begreifen wir, w e n n uns j e m a n d seine F u n k t i o n erklärt. W e r meint, eine Weberlade w a h r z u n e h m e n , überlastet daher die W a h r n e h m u n g , er spricht ihr eine Leistung zu, die wir gar nicht e r b r i n g e n , sofern wir w a h r n e h m e n , s o n d e r n die wir lediglich (fast) zugleich mit der W a h r n e h m u n g vollziehen. W e n n m a n d e n Vorgang einer solchen überlasteten , W a h r n e h m u n g ' auseinanderlegt, sieht m a n , dass sehr viel u n d Verschiedenes in i h m zusammenlaufen kann. Bei der Weberlade etwa ist es die durch die Farbe u m g r e n z t e F o r m , die m a n sieht, ihre B e w e g u n g im Webstuhl kann m a n zugleich sehen, tasten, hören, aber es sollte kein Zweifel sein, dass auch diese von Aristoteles sogenannte W a h r n e h m u n g des (sc. m e h r e r e n W a h r n e h m u n g e n ) G e m e i n s a m e n n o c h kein Begreifen ist. M a n k a n n j a stundenlang einer solchen B e w e g u n g zusehen u n d d o c h die Aufgabe nicht durchschauen, die sie im Webvorgang erfüllt. D a m i t dies möglich ist, muss m a n den Vorgang des Webens, w i e er grundsätzlich u n d allgemein abläuft, verstanden h a b e n u n d muss bei der B e o b a c h t u n g des b e w e g t e n Gebildes begreifen, dass die B e w e g u n g gerade dieses Gebildes genau diesem Vorgang e n t spricht. Dies letztere ist bereits ein Schluss, dessen erste Prämisse das Wissen e n t hält, dass die Weberlade Kette u n d Einschlag trennt, dessen zweite Prämisse aus der B e o b a c h t u n g , dass dieses Gebilde Kette u n d Einschlag trennt, stammt, u n d dessen Conclusio aus der V e r b i n d u n g der k o n k r e t e n E i n z e l b e o b a c h t u n g mit d e m allgemeinen Wissen d e n Schluss zieht, dieses Gebilde ist eine Weberlade. Dies alles t u n wir bei d e n meisten G e g e n s t a n d s w a h r n e h m u n g e n schnell u n d leicht u n d vor allem o h n e bewusste R e f l e x i o n auf die spezifischen Erkenntnisleistungen, die w i r dabei vollziehen, so dass wir den E i n d r u c k einer einzigen G e s a m t w a h r n e h m u n g haben, o b w o h l es sich dabei gar nicht u m eine G e s a m t w a h r n e h m u n g , s o n d e r n u m eine Gesamterkenntnis aus vielen Einzelleistungen: Sehen, V e r b i n d u n g m e h r e r e r W a h r n e h m u n g e n , Gedächtnis, Urteil, Schluss usw. handelt.
21 Für eine konzise Erklärung der Aristotelischen Wahrnehmungstheorie siehe W. Bernard, Rezeptivität und Spontaneität der W a h r n e h m u n g bei Aristoteles (Saecula Spiritalia; 19), Baden-Baden 1988.
D e r Philosoph als Maler - der Maler als Philosoph
43
Wenn man diese - hier nur grob skizzierte — Analyse des sogenannten Wahrnehmungsvorgangs in Rechnung stellt, wird verständlich, dass es bei Piaton keine ,Geschichte des Sehens', keine These von der sogenannten Kulturabhängigkeit des Wahrnehmens gibt. Was wir für eine Geschichte des Sehens ausgeben, ist in Wahrheit eine Geschichte der unterschiedlichen Deutungen des Gesehenen, j a man könnte im Sinn Piatons sagen, dass die Behauptung der Geschichtlichkeit des Sehens die Ungeschichtlichkeit des Gesehenen voraussetzt. Wenn wir etwa mit Nelson Goodman und vielen anderen darauf verweisen, dass die Wahrnehmung eines Blau flir den mittelalterlichen Besucher einer Kathedrale eine ganz andere war, als sie etwa der Betrachter eines modernen m o nochromen Bildes hat, dann beruht die Erkenntnis der Verschiedenheit dieser sogenannten Wahrnehmungen darauf, dass wir überzeugt sind, dass der mittelalterliche und der moderne Betrachter dasselbe Blau sehen, 2 2 das sie lediglich anders empfinden. Wäre das Blau, das sie sehen, verschieden, müssten wir davon ausgehen, dass der Unterschied der Empfindungen aus der Verschiedenheit des Blau resultiere, so wie etwa grün mit anderer Wirkung wahrgenommen wird als gelb. Einen Beweis dafür, dass blau in verschiedenen Epochen oder Kulturen verschieden wahrgenommen werde, haben wir nur, wenn wir im Blick auf dasselbe Blau feststellen, dass es von den einen so, von den anderen anders empfunden wird. Diese Identität des Wahrgenommenen im Unterschied zu den vielfach nur subjektiven Gefühlen, Vorstellungen, Meinungen, mit denen wir das Wahrgenommene verbinden, ist für Piaton einer der Gründe, derentwegen er der unmittelbaren Wahrnehmung den Rang einer Episteme, eines sicheren Wissens gibt. 2 3 Diesen R a n g hat sie aber nur in ihrem j e eigenen, eigentümlichen B e reich, beim Sehen des Blau, Hören des a, beim Schmecken des Süßen oder Bitteren usw. Wer mehr von der Wahrnehmung erwartet und glaubt, sie zeige auch, was das gesehene Blau ist, für den leistet die Wahrnehmung, wie Piaton formuliert, .nichts Gesundes'. 2 4 Die Mittel des Malers sind aber nun einmal Farbe und Form. Wie kann Piaton dann sagen, dass der Maler des schönsten Bildes statt nur blaue und rote Gebilde zu erzeugen, sogar darstellt, wie sich das Schöne, Gerechte, Besonnene, Tapfere selbst in den verschiedenen Charakteren der Menschen ausnimmt? Die grundsätzliche Antwort ergibt sich aus der Analogie zum Schaffensprozess des Handwerkers. Der Demiurg ist ja deshalb kein bloßer Nachbildner der sinnlichen Eigenschaften seines Gegenstandes, weil er unter den Eigenschaften mit
2 2 Siehe R . Brandt, Die Wirklichkeit des Bildes. Sehen und Erkennen Vom Spiegel zum Kunstbild, M ü n c h e n und Wien 1999, 181 ff. 2 3 Siehe Piaton, Theaitet 163 b 8 - c 5. 2 4 Zur Formulierung siehe Piaton, Politeia 5 2 3 b 3 - b 5.
44
Arbogast Schmitt
Blick auf die Leistung, die sein Gegenstand erbringen soll, auswählt, und zwar eben diejenigen Eigenschaften, die in genau bestimmter Kombination bewirken, dass das hergestellte Gebilde die gesuchte Leistung hat. Durch diese Auswahl erhebt sich der Handwerker über das empirisch Faktische, z.B. über die Abhängigkeit von einer ihm schon vorliegenden Weberlade. Er braucht sie nicht in ihrer Ganzheit mit all ihren passenden und unpassenden Eigenschaften zu kopieren, sondern er reinigt durch die Orientierung an der Funktion im Allgemeinen — und allgemein ist natürlich auch eine spezifizierte Funktion gegenüber dem einzelnen Material, das sie erfüllen soll — das ihm vorliegende konfuse Ganze, indem er nur das übernimmt, was an ihm zur Sache Weberlade gehört, während er anderes, Sachfremdes, Störendes weglässt, dafür aber anderes, das die Funktion im Allgemeinen oder im Besonderen verbessert, hinzufügt. Er macht damit eine Lade, die nicht so ist, wie irgendwelche beliebigen vorhandenen Laden, sondern eine Lade, die so ist, wie eine Lade in einem bestimmten Material als Lade verwirklicht werden kann. 25 Wer in Analogie zu diesem Vorgehen des Handwerkers eine Lade als Lade und nicht nur etwa als verziertes Ornament — in Farbe und Form darstellen will, darf nicht einfach irgendeine Lade in irgendeinem Zustand abzeichnen, sondern muss sie gleichsam in Aktion zeigen, und zwar in der für gerade diese Lade spezifischen Aktion. Erst dann hat er nicht nur ein braunes Gebilde, sondern eine bestimmte Lade gezeichnet. Die Tatsache, dass man das Vorgehen des Handwerkers mit Piaton so beschreiben kann, wie er an anderen Stellen den Schaffensprozess des Künstlers beschreibt, gibt bereits wichtige Hinweise zum Verständnis, es bleiben aber auch noch viele Fragen offen, Fragen, die nicht nur den Unterschied zwischen den künstlerischen und den handwerklichen Gegenständen betreffen, sondern die sich zuvor auf den Begriff der spezifischen Leistung und sein Verhältnis zu dem, was Piaton Idee nennt, richten. Hat man, wenn man die Funktion einer Sache begriffen hat, ihre Idee erkannt? Gibt es also eine Idee der Weberlade, und nicht nur der Weberlade im Allgemeinen, sondern auch einer Weberlade, die Wolle, einer Weberlade, die Leinen sondert, usw.? Und wenn es von jeder Sache eine Idee gibt, gibt es dann auch Ideen von Kot, Müll und dergleichen? Über diese Fragen gibt es bei Piaton selbst und innerhalb der Akademie eine breite Diskussion. 26 Wir können hier nur einige grundsätzliche Aspekte berüh-
25 Aristoteles hat von Piaton nicht nur die Formulierung, dass Kunst darstellen solle, wie etwas sein kann, u n d nicht einfach, wie es in zufälliger Realisierung gerade ist, ü b e r n o m m e n , er verbindet mit dieser Formulierung (siehe A n m . 2) auch ein analoges Kunstkonzept, das strikt von dem Nachahmungsbegriff der Renaissance unterschieden werden muss. Siehe Schmitt 1998. 26 Die später kanonisch gewordenen Lösungen dieses Problems findet man etwa im Parmem'des-Kommentar des Proklos: P r o d i Philosophi Platonici opera inedita pars tertia continens
Der Philosoph als Maler - der Maler als Philosoph
45
ren, immerhin fuhrt aber die Frage nach dem spezifischen Gegenstand der Kunst gleich ins Zentrum der Problematik. Grundsätzlich gilt nach Piaton, dass etwas dann eine bestimmte Leistung hat, wenn es etwas Bestimmtes kann, ein bestimmtes Vermögen zu etwas Bestimmtem hat. Eine Schere ist dadurch eine Schere, dass sie schneiden kann. O b die Schere dieses Vermögen tatsächlich hat, kann man natürlich nur dadurch feststellen, dass man sich wieder ihrer Leistung zuwendet und prüft, ob sie tatsächlich schneidet. Weder an Farbe noch Gestalt nämlich, so betont Piaton, erkennt man ein Vermögen, sondern ausschließlich, indem man auf das hinblickt, worauf es sich bezieht und was es bewirkt (Politeia 477 c 1 - d 5). Diese Frage ist aber nicht identisch mit der Frage nach der Bestimmtheit des Vermögens selbst, d.h. wenn man fragt, „was ist denn das Schneidenkönnen als solches, welche Bedingungen müssen in welcher Weise zusammenkommen, damit ein Vermögen zu schneiden entsteht?" Hier geht es also um Bedingungen, die dem Schneidenkönnen noch vorausliegen, z.B. darum, dass es in der Ebene so etwas wie spitzwinklige Dreiecke, im Körperlichen Keile und Bewegung der Keile gegeneinander geben muss, außerdem muss es Materie geben, die hart ist, bei der also — aus platonischer Perspektive — die Elementardreiecke in bestimmter Form angeordnet sind usw. Diese Bedingungen sind nicht selbst materiell, sondern es sind begreifbare Möglichkeiten, nach denen Materien geordnet werden können. Diese Analyse können und müssen wir nicht zu Ende führen, denn das nach Piaton und Aristoteles eigentlich interessante Thema der Kunst — und sie folgen damit einer offenkundigen Tendenz der griechischen Künstler - sind nicht Produkte der Technik, aber auch nicht Naturgegenstände, sondern es ist der menschliche Charakter und das durch ihn bestimmte Handeln. Dieses vom Charakter bestimmte Handeln bildet gegenüber den einzelnen Handlungen eines Menschen ein Allgemeines. In ihm sind die generellen Neigungen und Abneigungen eines Menschen umfasst, die bei diesem durch eine bestimmte Ausbildung seiner psychischen Vermögen zu einem festen Habitus geworden sind. Bei einem Menschen, der sich einen festen charakterlichen Habitus erworben hat, muss man nicht ständig mit allem rechnen, sondern hat die Möglichkeit, die einzelne Handlung aus ihrem Bezug zum Allgemeinen des Charakters zu verstehen. Ein Künstler, der diese Bezüge durchschaut, gewinnt dadurch die Fähigkeit, die verschiedenen Handlungen eines Menschen in ihrer einheitlichen Zusam-
Procli commentarium in Piatonis Parmenidem, ed. V. Cousin, Paris 1864 (ND Hildesheim 1961), 809ff. und besonders 823, 16ff. und 834, 3 7 f f , im Metaphysik-Kommentar Syrians: Syriani in metaphysica commentaria, in: Commentaria in Aristotelem Graeca, VI, 1, ed. W. Kroll, Berlin 1902, 1 0 7 , 8 - 3 8 oder etwa im P/iys/fe-Kommentar des Simplikios: Simplicii in Aristotelis physicorum libros quattuor priores commentaria, in: Commentaria in Aristotelem Graeaca, IX, ed. H. Diels, Berlin 1882, 296,32ff.
46
Arbogast Schmitt
m e n g e h ö r i g k e i t u n d in ihrer Stellung u n d ihrem G e w i c h t u n t e r e i n a n d e r u n d z u m G a n z e n des dargestellten Charakters v o r z u f u h r e n . 2 7 Dieses charakterbedingte H a n d e l n ist nach Piaton nicht n u r der zentrale G e genstand der Kunst, seine Darstellung ist zugleich das, was Kunst zur Kunst macht, d.h. was die ästhetische u n d formale Qualität der Kunst hervorbringt. Im dritten B u c h der Politeia lässt Piaton Sokrates sogar b e h a u p t e n , die Volle n d u n g der F o r m der Darstellung sei unmittelbare Folge der V o l l k o m m e n h e i t des dargestellten Charakters: W i e aber - der Stil der Darstellung u n d die sprachliche Form, folgen die nicht dem Charakter der Seele? - D e m Stil der Darstellung aber folgt das Übrige? Die schöne Form der R e d e also, das klare Maß, die Durchgestaltetheit und die gelungene R h y t h m i sierung, alles folgt dem durchgebildet guten Charakter.. ." 2 8
Das m o d e r n e B e f r e m d e n ü b e r diese Moralisierung der Kunst ist oft g e n u g ausged r ü c k t w o r d e n , oft g e n u g aber auch, o h n e dass der g e n a u e Sinn des v o n Piaton G e m e i n t e n sorgfältig ermittelt w o r d e n wäre. Z u o f f e n k u n d i g sind die Missverständnisse, die Piaton zu unterlaufen scheinen. W i r d nicht ein schlechter Maler auch v o m besten Charakter ein schlechtes Bild malen, w ä h r e n d der gute auch einen schlechten M e n s c h e n großartig darstellen kann? U n d k a n n m a n nicht ein lächerliches G e d i c h t auf einen großartigen Gegenstand u n d ein großartiges auf einen lächerlichen m a c h e n ? Vielleicht sollte m a n sich angesichts eines so o f f e n k u n d i g e n Widerstreits mit d e n P h ä n o m e n e n aber d o c h fragen, o b es eine sinnvolle Voraussetzung ist, a n z u n e h m e n , ein K o p f w i e Piaton habe nicht b e m e r k t , was d o c h j e d e m halbwegs gebildeten K u n s t k e n n e r o h n e langes N a c h d e n k e n in d e n Sinn k o m m t . Bevor ich versuche, aus d e n bisher skizzierten Voraussetzungen d e n platonischen Skopos etwas schärfer zu treffen, m ö c h t e ich wenigstens darauf hinweisen, dass Aristoteles, der in Kunstfragen j a oft als antiplatonisch gilt, in nahezu allen g e n a n n t e n P u n k t e n genauso w i e Piaton denkt. A u c h er verlangt v o m Dichter, Maler, Bildhauer, Musiker, sie sollten charaktervolle Darstellungen m a c h e n , u n d rät j u n g e n M e n s c h e n , sie sollten nicht Bilder von Pauson, s o n d e r n von Polygnot anschauen, da in dessen Bildern die Eigentümlichkeit der Charaktere herausgearbeitet sei. 2 9 In der Poetik l e h n t er es bekanntlich ab, formalästhetische Aspekte als
27 Siehe dazu ausfuhrlicher Verf., Teleologie u n d Geschichte bei Aristoteles, oder: W i e k o m m e n nach Aristoteles Anfang, Mitte und Ende in die Geschichte?, in: Das Ende. Figuren einer D e n k f o r m , hrsg. von K. Stierle und R . Warning, M ü n c h e n 1996, 5 2 8 - 5 6 3 . 2S Siehe Politeia 400 d 6ff.; siehe auch Phaidros 264 b 3—c 5, w o festgehalten wird, dass die optimale Disposition jeder R e d e aus der hinreichenden Erkenntnis der darzustellenden Sache hervorgeht. In seiner Analyse der R e d e des Lysias macht Sokrates auch an einem Gegenbeispiel deutlich, dass es gerade das ungenügende Sicheinlassen auf die Sache ist, die zugleich für die künstlerische U n f o r m dieser R e d e verantwortlich ist. 29 Siehe Aristoteles, Politik 1340 a 2 8 - 3 8 .
Der Philosoph als Maler - der Maler als Philosoph
47
konstitutiv für Dichtung anzusehen und behauptet, auch wenn man den ganzen Herodot in Verse bringe, werde daraus nicht Literatur. Zur Literatur werde etwas erst, wenn gezeigt werde, wie das Handeln eines Menschen Folge des genau für ihn eigentümlichen Charakters sei.30 Die Aufgabe, die dem Dichter und dem Künstler überhaupt damit gestellt ist, ist nicht einfach die, sich einen charaktervollen Menschen zum Vorwurf zu nehmen, sondern Handlungen so auszuwählen und darzustellen, dass sie in Wort oder Bild nicht als eine beliebige Ereignisansammlung erscheinen, sondern als direkter Ausfluß und Ausdruck eines Charakters. Einen Charakter hat ein Künstler aber noch weniger vor sich als ein Handwerker ein Bett oder eine Weberlade. Das, was er empirisch vor sich hat, sind konkrete Handlungen, noch genauer, wenn man wirklich exakt das sinnlich Gegebene benennt: bewegte Figuren in Farbe und Form. Wenn man diese Erkenntnisanalyse ernst nimmt, wird man kaum noch behaupten können, auch ein schlechter Maler könne einen guten Charakter, wenn auch ästhetisch misslungen, darstellen. Solange er nicht weiß, was einen bestimmten Charakter ausmacht, in welchen Handlungen er sich ausdrückt und in welchen Bewegungen und Formen er deshalb in Erscheinung tritt, kann er überhaupt keinen Charakter darstellen, geschweige denn einen guten. Wenn er diese Zusammenhänge aber durchschaut, dann hat er nach Platonischem Urteil alles, was er über die bloß handwerklich einzuübenden Fertigkeiten hinaus braucht, um aus einer technisch vollendeten eine künstlerisch vollendete Darstellung zu machen. Am CharakterbegrifF hängt also tatsächlich sehr viel, wenn es um ein korrektes Verständnis der platonischen Kunsttheorie geht. Leider weicht auch der Begriff von Charakter, den Piaton und Aristoteles entwickelt haben, erheblich von uns gewohnten Traditionen ab, so dass ich versuchen muss, wenigstens eine grobe Abgrenzung zu geben. Für Hegel etwa ist der individuelle Charakter bestimmt von der Weise, wie ein Einzelner von seiner Idee, die gleichsam die „unermessliche Abbreviatur gegen die Einzelheit der Dinge" ist, vollständig durchdrungen ist.31 In ähnlichem Sinn liegt auch für Schleiermacher oder Humboldt der individuelle Charakter einer Person in der unnachahmlich einmaligen Weise, wie alle Empfindungen, Gedanken, Handlungen eines Menschen von seiner ganz besonderen Art, Welt zu erleben, durchdrungen sind, so dass alles, die Art, wie jemand lacht, geht, isst, genauso zu seinem Charakter gehört, wie etwa seine sittlichen Lebensprinzipien oder auch seine Abweichungen davon. Die Möglichkeit zu
30
Siehe Aristoteles, Poetik, Kap. 9, 1451 a 3 6 - b 11. Siehe dazu Schmitt 1998. Siehe G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, hrsg. von G. Lasson, H a m b u r g (Meiner, Philos. Bibl.; 56), I, 18; II, 408, 428f., 484. 31
1963
48
Arbogast Schmitt
einem solchen ,Charakter' existiert nach platonischen Kategorien bestenfalls im Sinn einer materiell-existentiellen Individualität, d.h. dass alles, was jemand denkt, empfindet, tut, in den realen Vollzugsbedingungen seiner Existenz strikt einmalig ist. Dass diese Einmaligkeit aber ein einheitlich zusammenstimmendes Weltverhalten sei, das ein Individuum gegen alle anderen abgrenzt, so dass es in seinem gesamten Verhalten von einem Charakter bestimmt ist, dafür reicht diese existentielle Singularität nicht aus, da sie aus vielen disparaten Elementen gebildet sein kann, die gar nicht zu etwas Einem werden können. Diese Einmaligkeit enthält sozusagen eine Menge jeweiliger Einmaligkeiten, keine im Ganzen der Person wirksame Selbigkeit. An einen Charakter, der die Haltungen eines M e n schen vollständig prägt, kann man nach Piaton etwa beim homerischen Odysseus oder bei Sokrates denken. Wenn es bei Sokrates ein gemeinsames Identisches für alle seine Handlungen gibt, dann nicht weil er — wie alle anderen auch - letztlich in seiner Einzelheit ineffabel ist, sondern weil er seine menschlichen Vermögen so gebildet hat, dass sie zu einem einheitlich bestimmten Ganzen von Neigungen und Abneigungen zusammenstimmen. Charakter ist in diesem Sinn nichts einfach Gegebenes, mit dem man dann in unterschiedlicher Weise umgehen kann, sondern eine Aufgabe, die man - mehr oder weniger - bewältigen und auch verfehlen kann. Hier liegt in der Tat die substantielle Differenz zwischen Piaton und vielen modernen Ansätzen, dass bei Piaton Charakter nicht auf irgendeine inkommensurable Innerlichkeit gegründet wird, die als solche am Ende auch noch von Natur aus oder genetisch einfach gegeben ist, sondern auf der Durchbildung der menschlichen Vermögen (und nur von ihnen kann man sagen, dass sie dem Menschen gegeben sind). Auch was der Mensch als Mensch ist, bestimmt sich bei Piaton vom ,Werk' des Menschen her, d.h. von der Art, wie er seine Vermögen betätigt. Anders als bei der Frage nach dem Werk der Weberlade oder gar nach dem Werk eines Baumes, eines Pferdes usw. hat der Mensch zu seinen eigenen Leistungen einen direkteren, unvermittelteren Zugang. Es gehört zwar zu den besonders hartnäckigen Vorurteilen der nachcartesianischen Moderne, der Antike und auch Piaton vorzuhalten, sie hätten noch nicht auf die eigenen Akte, insbesondere die Akte des Denkens, durch die der Mensch seine Welt überhaupt erst konstituiert, reflektiert; dieses Vorurteil hat seinen Grund aber darin, dass Piaton diese Reflexion auf eine gänzlich andere, uns unvertraute Weise vollzogen hat. Für Piaton liegt der zentrale Unterschied zwischen einer naiven und einer aufgeklärt kritischen Lebensform nicht bereits in der Herstellung einer reflexiven Bewusstheit der eigenen Akte — dass man sich bewusst ist, einen Akt zu vollziehen, garantiert in keiner Weise, dass dieses Bewusstsein aus einem korrekten Wissen von der Natur dieses Aktes hervorgegangen ist - aufgeklärt ist eben erst, wer seine Akte aus einem Wissen um ihre Natur, d.h. über die Vermögen, die die Leistungen dieser Akte bestimmen, vollzieht.
Der Philosoph als Maler - der Maler als Philosoph
49
Das Grundvermögen, in dem alle anderen Vermögen des Menschen, seine theoretischen wie seine praktischen, ihren Ursprung haben, ist nach Piaton das Unterscheidungsvermögen. Da ich an anderen Stellen schon viel über dieses Thema gesagt habe, 3 2 rekapituliere ich nur das Wichtigste: Das Unterscheiden geht dem Bewusstsein voraus, denn es könnte überhaupt kein Bewusstsein von irgendetwas geben, wenn man zuvor nicht etwas unterschieden hätte, und zwar sowohl in dem Sinn, dass man überhaupt einen Unterschied gemacht haben muss, als auch im Sinn der Frage, was man unterschieden hat. Wer einen Baum als Menschen .gesehen' hat, ist sich eines Menschen bewusst, d.h. genau des Unterschieds, den er tatsächlich gemacht hat. Von einem Unterscheidungsakt hängen aber nicht nur Akte des bewussten Denkens ab, man könnte auch keine Wahrnehmung machen und sich ihrer bewusst werden, wenn man nicht Rotes von Grünem, Bitteres von Salzigem unterscheiden könnte. Dasselbe gilt für das, was wir Gefühle und Willensakte nennen. Der Idiot hat keine Angst, d.h.: ohne Unterscheidung des Bedrohlichen vom Nichtbedrohlichen empfindet niemand Angst, und ohne Unterscheidung der Geschmacksqualitäten des Weins entsteht kein Wille, Wein zu trinken. Der Unterschied zwischen Wahrnehmen, Fühlen, Wollen und Denken besteht daher nicht darin, dass das Denken eine Unterscheidungsleistung wäre, während die anderen seelischen Akte ohne erkennende Unterscheidungsleistung zustande kämen. Der Unterschied liegt aber auch nicht darin, dass nur das Denken sich seiner selbst bewusst wäre, es gibt ja auch ein Bewusstsein von Wahrnehmungen und Gefühlen. Der Unterschied liegt nach Piaton in der unterschiedlichen Weise, in der die verschiedenen psychischen Akte über das Unterscheidenkönnen verfügen. Wer sein Unterscheidungsvermögen über das Auge betätigt, bindet es auch an die Möglichkeiten des Auges, d.h. er unterscheidet nur Farben und Formen, keine Tone, keine Geschmäcke, aber auch keine Gegenstände. Wer seine Empfindung von Lust und Unlust aus der Unterscheidungskompetenz der Zunge bezieht, bindet sich auch an die Grenzen dieser Kompetenz, usw. In all diesen Fällen unterscheidet man, hat aber kein reflexiv kritisches Wissen darüber, was Unterscheiden ist und nach welchen Kriterien man dabei verfährt. Erst wer sich darüber Rechenschaft abgelegt hat, denkt nach Piaton im strengen Sinn des Wortes. Die Kriterien des Unterscheidens werden nach Piaton in einer gemeinsamen mathematischen Wissenschaft' untersucht, die für alle Künste und Wissensdisziplinen grundlegend ist. Hier geht es um Begriffe wie Einheit, Vielheit, Ganzheit, Teil, Identität, Verschiedenheit, Gleichheit, Ruhe, Bewegung
Siehe v. a. Verf., Erkenntnistheorie bei Piaton und Descartes, in: Antike und Abendland, 35 (1989), 5 4 - 8 2 ; ders., Das Bewusste und das Unbewusste in der Deutung durch die griechische Philosophie (Piaton, Aristoteles, Plotin), in: Antike und Abendland, 40 (1994), 5 9 - 8 5 .
50
Arbogast Schmitt
usw., aus deren Kombination sich nach Piaton zuerst ein Wissen von den Zahlen, dann der geometrischen Figuren, dann der Tone und Harmonien, schließlich der regelmäßig bewegten Körper ableiten lässt. Aus der Kombination der in diesen Wissenschaften unterschiedenen Grundmöglichkeiten des Seins ergibt sich dann auch die Möglichkeit, konkretere Funktionen wie etwa die Funktion der Schere zu begreifen. 33
33 Erst die Kenntnis dieser Zusammenhänge, wie aus den obersten, mit j e d e m Sein verbundenen rein intelligiblen Begriffen in methodischer Kombination immer konkretere Sachgehalte erschließbar werden, macht ein genaueres Verständnis, wovon es Ideen gibt und wovon es keine Ideen oder nur Derivate von Ideen gibt, möglich. Ich möchte wenigstens die R i c h t u n g der platonischen Argumentation skizzieren: W e n n es etwa u m die ,Erfindung' des Rads geht, u n d die Frage gestellt wird, ob Piaton an eine Idee des Rads schon vor seiner Erfindung geglaubt habe, dann wäre die Antwort zu differenzieren. Grundsätzlich kann niemand jemals so etwas wie das R a d erfinden, wenn es nicht das, was ein R a d möglich macht, bereits gibt. Z u diesen Möglichkeitsbedingungen des Rads gehören zuerst die Begriffsbedingungen des Kreises. Diese sind rein begrifflich und in keiner Weise anschaulicher Natur. Z u ihnen gehören Begriffe wie Einheit, Vielheit, Ganzheit, Teil, Verschiedenheit, Identität usw. Eine Ganzheit, die strikt als Einheit ihrer Teile gedacht wird, kann nur so gedacht werden, dass alle Teile Teile eines Selben sind u n d sich in derselben Weise zu diesem Selben verhalten. Dieser nur einsehbare Sachverhalt ist die Idee des Kreises. Davon zu unterscheiden ist bereits die geometrische Vorstellung eines Kreises. Sie ist bereits eine Instanz des begrifflichen Sachverhalts ,Kreis', denn sie ist nur möglich, wenn das selbige Verhalten aller Teile eines Selben zu i m m e r dem Selben in dem Verhältnis von P u n k t u n d Linie realisiert ist. O b w o h l nach Piaton Punkt und Linie aus den obersten Begriffen ableitbar sind, gehören sie daher bereits einer synthetisierten D i m e n sion an, die einerseits in ihrer begrifflichen Struktur konstant ist, die diese Struktur aber auf viele Instanzen verteilt. Auch der ideale geometrische Kreis ist nach Piaton daher keine Idee mehr, aber eine o h n e sachverändernde Zwischenschritte aus der Idee abgeleitete Instanz der Idee. Sachfremde Zusätze k o m m e n aber hinzu, w e n n j e m a n d so etwas wie ein R a d .erfindet'. Dies kann er zwar nicht, ohne eine ,Idee' v o m Kreis zu haben, er benötigt dazu aber noch die Kenntnis einer R e i h e anderer Sachverhalte, etwa dass Holz hart ist und deshalb belastbar, u n d dass Holz formbar ist und deshalb in die Form des Kreises gebracht werden kann. Dass man auch die Eigenschaften ,hart' und .formbar' letzten Endes aus Ideen begreift, kann ich hier nur behaupten, es ist aber unschwer nachweisbar. Auf j e d e n Fall müssen diese Erkenntnisse zur Erkenntnis des Kreises u n d seiner Möglichkeiten h i n z u k o m m e n und auf ihre Verbindbarkeit geprüft werden, wenn so etwas wie ein R a d erfunden werden soll. O b w o h l es daher keine Idee ,Rad' gibt, jedes R a d besteht ja immer aus mehreren Ideen und deren Derivaten, o h n e den begreifbaren Sachgehalt ,Kreis' und ohne die Verbindbarkeit dieses Sachgehalts mit den Sachmöglichkeiten etwa des Holzes gäbe es kein R a d , und das heißt als eine erkennbare M ö g lichkeit existiert das R a d bereits vor der Erfindung des Rads.
N o c h ein letztes Wort zu der für Piaton angeblich so ruinösen Folge aus seiner Ideenlehre, dass es auch Ideen von Müll, Kot usw. geben müsse, wenn wir die Einzeldinge aus ihrem Verhältnis zur Idee begreifen. Allein die Tatsache, dass Piaton selbst diese Probleme aufgeworfen und dennoch an seiner Ideenlehre festgehalten hat, zeigt schon, dass er dieses Argument nicht für destruktiv gehalten hat. Natürlich gibt es keine eigene Idee für Müll nach Piaton, aber es gilt dennoch, dass man alles, was man von der Sache ,Müll' begreift, nur von Ideen her begreifen kann. D e n n ,Müll' ist nur ein Ausdruck dafür, dass etwas sich in einem privativen Verhältnis zu der Ideenkombination befindet, von der her seine Sachbestimmtheit k o m m t . Wer
Der Philosoph als Maler - der Maler als Philosoph
51
O b w o h l die Verfolgung dieser Z u s a m m e n h ä n g e auch f ü r die Kunsttheorie von höchster R e l e v a n z ist, z. B. weil sich aus i h n e n eine T h e o r i e des S c h ö p f e r i schen bei Piaton herleiten lässt, müssen wir uns hier auf das Verhältnis von C h a rakter u n d Stil beschränken, u n d auch da auf eine grobe Skizze. Piaton k o m m t i m z e h n t e n B u c h der Politeia n o c h einmal auf die schon in d e n B ü c h e r n zwei u n d drei behandelte Frage zurück, o b er D i c h t e r in seinen Staat a u f n e h m e n wolle. G r u n d f ü r diese N e u a u f n a h m e des T h e m a s sei, dass erst jetzt, n a c h d e m die verschiedenen V e r m ö g e n der Seele unterschieden u n d ihre verschiedenen Aufgaben beschrieben seien, endgültige Klarheit darüber erzielt sei, dass die mimetischen D i c h t e r u n d die mimetischen Künstler ü b e r h a u p t nicht in einen g u t e n Staat g e h ö r t e n . D e r G r u n d dafür ist, dass die mimetischen Künstler zu der G r u p p e von M e n s c h e n im Staat gehören, die die Tendenz haben, ständig ihre K o m p e t e n z e n zu überschreiten u n d dadurch zu schlechten Charakteren u n d unglücklichen M e n s c h e n w e r d e n bzw. durch ihr künstlerisches T u n die Entsteh u n g schlechter Charaktere b e f ö r d e r n . Als die elementarste seelische K o m p e t e n z war in der Analyse der menschlichen Psyche durch Sokrates das W a h r n e h m u n g s v e r m ö g e n b e s t i m m t w o r d e n . W e r sein U n t e r s c h e i d u n g s v e r m ö g e n auf dieses V e r m ö g e n konzentriert, u n t e r scheidet W a h r n e h m b a r e s , hat Lust an W a h r n e h m b a r e m u n d will, b e g e h r t W a h r nehmbares. Darin sieht Piaton, w e n n auch oft aus oberflächlicher oder voreing e n o m m e n e r Lektüre das Gegenteil b e h a u p t e t wird, kein Problem. Das b e d e u t e t , dass auch der D i c h t e r o d e r Maler, der korrekt die w a h r n e h m b a r e G e stalt der E r s c h e i n u n g e n wiedergibt, nicht der Kritik Piatons unterliegt. D i e Kritik b e g i n n t erst dort, w o sie nicht n u r die erscheinende Gestalt darzustellen beanspruchen, s o n d e r n unmittelbar in ihr Gegenstände, M e n s c h e n , ihr gutes o d e r schlechtes Verhalten usw. Das k a n n m a n nach Piaton, w i e wir geseh e n haben, eigentlich gar nicht. Dass uns das d e n n o c h irgendwie gelingt, liegt daran, dass wir dann, w e n n wir m e i n e n , einen M e n s c h e n zu sehen oder ihn mit rein optischen Mitteln darstellen zu k ö n n e n , u n v e r m e r k t m e h r tun, als uns n u r auf das Optische zu stützen. W i r e r k e n n e n einen Gegenstand an seiner F u n k t i o n u n d menschliches H a n d e l n an den seelischen Akten, die sich in i h m ä u ß e r n . Die Tatsache, dass wir dies oft u n v e r m e r k t tun, hat nach Piaton - u n d die G r ü n d e , die er dafür hat, sind nicht leicht von der H a n d zu weisen — fatale Folgen. D e n n der Sorgfalt, mit der wir die w a h r n e h m b a r e n E r s c h e i n u n g e n b e o b a c h t e n oder
etwa an eine Halde k o m m t , auf der er viele nicht mehr gebrauchsfähige Gegenstände findet, z.B. defekte Tische, kann den defizienten Zustand, der diese Gegenstände zum Müll macht, nur feststellen, wenn er den jetzigen Zustand mit dem früheren noch funktionsfähigen Z u stand vergleicht. An der Bestimmtheit der Sache erkennt man auch ihre Abweichungen. Wenn eine Abweichung auch nicht mehr als Abweichung von etwas Bestimmtem erkennbar ist, kann man gar nichts mehr unterscheiden, d.h., man würde dann auch nicht glauben, vor einer Müllhalde zu stehen, sondern befände sich vor einer undefinierbaren Masse.
52
Arbogast Schmitt
darstellen, entspricht bei einem solchen Vorgehen eine völlige Sorglosigkeit in der Ermittlung der spezifischen Leistung. Wenn Piaton recht hat, dass Denken Unterscheiden ist, hat er auch recht, wenn er diese Art der Ermittlung für ein unspezifisches, undifferenziertes Unterscheiden ausgibt. In vielen Frühdialogen und in allgemeiner Analyse im Euthydemos hat Piaton demonstriert, 3 4 dass dieses undifferenzierte Unterscheiden ein generalisierendes, verallgemeinerndes, abstraktes und zugleich ein konfuses Unterscheiden ist. Es ist konfus, weil es die Funktion nicht von dem Medium, in dem sie sich vollzieht, trennt. Wer einen H u n d zu sehen meint, glaubt ihn ja an seiner vierfüßigen Gestalt zu erkennen, obwohl er ihn de facto an den Äußerungen der spezifischen Vermögen erkennt, die ihn zu einem bestimmten Lebewesen machen, und die äußere Gestalt lediglich als Identifikationskriterium Bedeutung haben kann. Es ist abstrakt, weil ein noch nicht differenzierter Unterschied vielem gemeinsam sein kann. Eine vierfüßige Gestalt hat nicht nur dieser H u n d , sondern alle Hunde, ja viele andere Lebewesen auch. In Bezug auf menschliches Verhalten bewirkt diese abstrakt-konfuse Erkenntnisweise, dass die konkrete Äußerungsweise eines Verhaltens für dieses Verhalten selbst g e n o m m e n und als es dargestellt wird: „Wer rot wird, schämt sich; wer schreit, ist unbeherrscht; wer Geschuldetes zurückgibt, ist gerecht; wer im Kampf standhält, ist tapfer; wer bedächtig ist, ist besonnen;" usw. Bei jeder Lektüre v.a. der sog. sokratischen Dialoge 3 5 wird man mit Beispielen überhäuft, die d e m o n strieren, dass jede derartige Äußerungsform auch Zeichen des gegenteiligen Verhaltens sein kann. Nicht nur, wer bedächtig ist, ist besonnen, es kann auch einmal besonnen sein, schnell und unbedächtig zu reagieren. Wer sich an die konkreten Erscheinungsformen hält, trifft gar nicht auf das, was ein bestimmtes Verhalten wirklich ist, sondern lediglich auf etwas, das häufig, typischerweise, nach der Meinung der Leute, oder vielleicht auch nur einmal akzidentell damit verbunden ist. Gegen diese Akzidentialität hat sich die Kunsttheorie der Renaissance durch die Reduktion auf das Typische, Exemplarische, allgemein Geltende zu schützen versucht. D e m Problem, das Piaton hier beschreibt, kann man dadurch nicht entkommen. Im Gegenteil, diese Reduktion auf das abstrakt Allgemeine, auf das Regelmäßige gegenüber der Unregelmäßigkeit der konkreten Erscheinungen, bringt die Kunst u m ihre Sinnfulle. Die Wege, die dann bleiben, u m diese Sinnfülle irgendwie zurückzugewinnen, sind entweder die Rückkehr zur beliebigen
34 Für eine genauere Analyse des Euthydemos siehe Verf., Die B e d e u t u n g der sophistischen Logik für die mittlere Dialektik Piatons, Diss. Würzburg 1974. 33 Dass die außergewöhnliche Form der Argumentationsstruktur der platonischen Dialoge ihren G r u n d in der Absicht Piatons hat, diese Konfusion des gewöhnlichen Meinens zu überwinden, versuche ich genauer zu begründen, in: Verf., Sokratisches Fragen im Platonischen Dialog, in: K. Pestalozzi (Hrsg.), Der fragende Sokrates (Colloquium rauricum; 6), Stuttgart u n d Leipzig 1999, 3 0 - 4 9 .
Der Philosoph als Maler - der Maler als Philosoph
53
Pluralität des sinnlich i m m e r w i e d e r A n d e r e n o d e r die B e t o n u n g der u n b e stimmten O f f e n h e i t des R e d u z i e r t e n . Das abstrakte Schema einer vierfüßigen Gestalt k a n n ja a u ß e r H u n d n o c h u n e n d l i c h vieles anderes sein. D i e Sinnfulle, die auf diese Weise g e w o n n e n wird, ist allerdings nicht die Fülle der S i n n m ö g lichkeiten einer dargestellten Sache, sie k o m m t vielmehr daher, dass das D a r g e stellte w e g e n seiner U n b e s t i m m t h e i t mit gleichem R e c h t R e p r ä s e n t a n t vieler Sachen sein kann. Diese Fülle der Möglichkeiten, i m m e r wieder anders o d e r anderes zu sein, ist ein Darstellungsziel, das mit Piatons Kunstheorie, die auch die Kunst von ihrer spezifischen Unterscheidungsleistung her beurteilt, unvereinbar ist. Das heißt aber e b e n nicht, Piaton habe einer kunstfeindlichen abstrakten Eindeutigkeit des B e griffs d e n Vorzug vor der prägnanten, vielsagenden Darstellungsweise der Kunst gegeben. A u c h Piaton sucht eine Darstellung der Sinnfulle, aber nicht die Sinnfülle dessen, was irgendwie alles sein kann, s o n d e r n die Sinnfulle der in einer Sache enthaltenen Möglichkeiten. E r glaubt in der Tat, dass die Fülle dieser Möglichkeiten n u r g e f u n d e n u n d dargestellt w e r d e n kann, w e n n der Künstler sich von der O b e r f l ä c h e der ä u ß e r e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n u n d damit von einer b l o ß e n N a c h a h m u n g löst u n d auf die Idee zurückgeht, in der diese Erschein u n g s f o r m e n d e n G r u n d ihrer Möglichkeit haben. Diese Idee aber ist nicht der zu e i n e m transzendenten Gegenstand hypostasierte abstrakte Begriff, s o n d e r n es sind die von sich selbst h e r b e s t i m m t e n Möglichkeiten, die in verschiedenen M e d i e n verschieden realisiert w e r d e n k ö n n e n . B e i m M e n s c h e n geht es dabei u m die allgemeinen V e r m ö g e n , die er als M e n s c h ü b e r h a u p t hat, die in seinem U n t e r s c h e i d u n g s v e r m ö g e n impliziert sind, u n d u m die j e spezifische Ausbildung dieser V e r m ö g e n zu e i n e m b e s t i m m t e n Charakter. W e n n Piaton davon spricht, der M a l e r des schönsten Bildes blicke auf die N a t u r selbst des B e s o n n e n e n u n d des G e r e c h t e n usw., d a n n ist nicht ein jenseitiges Schaubild der B e s o n n e n h e i t o d e r Gerechtigkeit gemeint. B e s o n n e n heit ist nach d e n klaren A u s f u h r u n g e n der Politeia der Zustand der menschlichen Psyche, in d e m die W a h r n e h m u n g s v e r m ö g e n u n d die von i h n e n abhängigen G e f ü h l e u n d Begierden ihre K o m p e t e n z von sich aus nicht überschreiten. G e rechtigkeit heißt, dass alle V e r m ö g e n genau das Ihre t u n . Gerechtigkeit ist f ü r Piaton zugleich das Indiz, dass alle V e r m ö g e n sich optimal aktualisieren. So wie eine Laute n u r dadurch Laute ist, dass sie den L a u t e n t o n optimal wiedergibt u n d nicht w i e ein Blecheimer klingt, so artikulieren sich die menschlichen V e r m ö g e n n u r d a n n als sie selbst, w e n n sie dies optimal t u n , platonisch: w e n n sie es i m Sinn ihrer Arete t u n . Das ist der G r u n d , w a r u m Piaton b e h a u p t e t , n u r gute Charaktere k ö n n t e n gut dargestellt w e r d e n . N u r ein V e r m ö g e n , das sich optimal verwirklicht, vollzieht sich ü b e r h a u p t als ein bestimmtes V e r m ö g e n , u n d n u r die V e r m ö g e n , die optimal z u s a m m e n w i r k e n , bilden gemeinsam die Einheit einer F u n k t i o n . Von ihrer inneren Differenziertheit hängt die Art der H a n d l u n g u n d deren äußere Durchgestaltung ab.
54
Arbogast Schmitt
Der Maler oder Dichter, der diese Zusammenhänge durchschaut, der also weiß, dass dieses Vermögen diese Leistung hat, dass dieses Vermögen wiederum in Zusammenwirken mit diesem diese Leistung hat, und dass diese Leistungen in der oder der Gestalt und unter diesen Umständen in Erscheinung treten, das ist der gute Maler oder Dichter, der wegen eben dieser von ihm verlangten Erkenntnisleistung ein philosophischer Künstler ist. 36
Abgekürzt zitierte Literatur Büttner 2000 Kersting 1999 Nietzsche Werke Schmitt 1998
Weischedel 1983
S. Büttner, Die Literaturtheorie bei Piaton und ihre anthropologische Begründung, Tübingen und Basel 2000. W. Kersting, Piatons Staat, Darmstadt 1999. F. Nietzsche, Werke, Kritische Studienausgabe hrsg. von G. Colli und M . Montinari, M ü n c h e n / B e r l i n und N e w York 1988. A. Schmitt, Mimesis bei Aristoteles und in den Poetikkommentaren der Renaissance. Z u m Wandel des Gedankens von der N a c h a h m u n g der N a t u r in der frühen Neuzeit, in: A. Kablitz und G. N e u m a n n (Hrsg.), Mimesis und Simulation, Freiburg i. Br. 1998, 1 7 - 5 4 . W. Weischedel (Hrsg.), Immanuel Kant. Werke in sechs Bänden, Darmstadt 1983.
36 Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Piaton selbst sich für einen solchen philosophischen Künstler gehalten hat, wie Konrad Gaiser mit guten G r ü n d e n gezeigt hat. Siehe K. Gaiser, Platone come scrittore filosofico, Neapel 1984. Z u r Deutung, wie Piaton sich selbst als Künstler eingeschätzt hat, siehe jetzt v. a. Büttner 2000, 1 5 9 - 1 7 0 , 224f., 254, 376f.
II
J E A N - M A R I E LE T E N S O R E R
Ein Bild vor dem Bild? Die ältesten menschlichen Artefakte und die Frage des Bildes M I T TAFELN
V - X I
1. E i n f ü h r u n g W i e hat im Laufe der immensen D a u e r der urgeschichtlichen Zeit das symbolische D e n k e n zur Produktion von Bildern u n d schließlich zur künstlerischen H e r v o r b r i n g u n g führen können? U b e r den zwei oder drei Millionen Jahre u m fassenden Zeitraum des Abenteuers Mensch stecken gewisse grundlegende Schritte die Geschichte seiner intellektuellen Entwicklung ab. Das Auftreten von Merkmalen, die mit der W a h r n e h m u n g des Wirklichen oder Imaginären u n d deren Darstellung oder Ü b e r t r a g u n g in eine konkrete H e r v o r b r i n g u n g in Z u sammenhang stehen, scheint uns eng mit der Herausbildung eines symbolischen Denkens verbunden zu sein. Es stellt sich mithin die Frage, ob vielleicht die besondere M o r p h o l o g i e gewisser Werkzeuge der Altsteinzeit, speziell die der Faustkeile, mit den Ursprüngen der künstlerischen H e r v o r b r i n g u n g in Verbind u n g gebracht werden kann. Die Versuchung, darauf zu antworten, ist groß, doch ist es ebenso ratsam, die Gefahren einer solchen Versuchung genau zu erwägen: wir befinden uns in einem Bereich mit sehr ungewissem Kenntnisstand, an einer Art von unscharfer Schnittstelle zwischen den objektiven G e g e b e n h e i ten der urgeschichtlichen Gegenstände einerseits, ihrer Technologie, Typologie, M o r p h o l o g i e oder Funktion, u n d andererseits der D e u t u n g , die wir von unseren Systemen des m o d e r n e n Denkens her daraus abzuleiten suchen. Selbst w e n n sich die Kunst, wie es die abendländische Zivilisation bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts verlangte, auf das aristotelische Konzept der mimesis, d.h. auf die N a c h a h m u n g einer persönlichen Sicht des Künstlers auf das Wirkliche oder Imaginäre, einschränkt, scheint das A u f k o m m e n der künstlerischen Kreativität der H e r a u f kunft des m o d e r n e n Menschen gar nicht oder n u r ganz wenig vorausgegangen zu sein. A. Leroi-Gourhan vertritt den Standpunkt, dass die Fähigkeit, das D e n ken an stofflichen Symbolen festzumachen, mit d e m Homo sapiens auftrat. 1 In
1
Leroi-Gourhan 1964, I, 261 (dt. 1988, 237).
58
J e a n - M a r i e Le Tensorer
seiner hervorragenden Analyse des Schaffens dieses bedeutenden Fachmanns für altsteinzeitliche Kunst, schreibt M . Groenen: M i t d e n letzten N e a n d e r t a l e r n k o m m t es allmählich zur E n t w i c k l u n g des R i e c h h i r n s d e m Z e n t r u m d e r G e f ü h l e - u n d der G r o ß h i r n r i n d e - d e m Z e n t r u m des „scharfen Verstands". D i e s e r d o p p e l t e Z u w a c h s an zerebralen B e r e i c h e n stellt ( . . . ) e i n e erstrangige E r r u n g e n s c h a f t dar, da der M e n s c h n u n n i c h t m e h r u n t e r d e r biologischen F u c h t e l steht u n d sich i h m d a m i t u n b e s c h r ä n k t e M ö g l i c h k e i t e n an t e c h n i s c h e n H e r v o r b r i n g u n g e n u n d i m H i n b l i c k auf die Welt d e r S y m b o l e e r ö f f n e n .
Die Vorstellung einer progressiven Enthebung des Menschen aus seinen natürlichen Einschränkungen stellt einen der wesentlichsten Aspekte in Bezug auf die Entstehung der Menschheit dar. Schon oft haben Philosophen dieses zum Ausdruck gebracht. Dabei geht es nicht allein um die klassische Opposition N a t u r Kultur; eine dritte, subtilere Stimme metaphysischen Zuschnitts ist außerdem im Spiel. D e n n nach und nach befreite sich der Mensch aus der Welt, von der er sich umgeben sah, um sich ein inneres Universum, das seines Geistes, zu schaffen. Das Auftreten dieser spirituellen Komponente bringt ihn dann dazu, zweckfreie Gedanken auszubilden, die man als außer-natürlich oder trans-natural einstufen könnte. So betrachtet ist das, was wir mit unserer Kultur des „ m o d e r n e n " Menschen bei der Untersuchung und im Studium der frühesten Werkzeuge u n serer Vorfahren wahrnehmen, eben diese undefinierbare transzendente K o m p o nente, die dem bearbeiteten Objekt mitgegeben ist. Diese Komponente ist menschlich und charakterisiert den Menschen. Sie schafft eine „symbolische Verständigung" zwischen uns und unseren Vorfahren. Wollen wir die Kunst als Ausdruck dieser „symbolischen Verständigung" bestimmen, dann war auch der altsteinzeitliche Handwerker ein Künstler.
2. Die Anfänge Wann nun lassen sich im Laufe des schon drei Millionen Jahre währenden Abenteuers Mensch die Anfänge dieser „symbolischen Verständigung" feststellen? U n serer Ansicht nach schon sehr früh, und zwar nach Maßgabe dessen, dass bereits gewisse, von den archaischsten 3 Vertretern des Homo erectus hergestellte Werkzeuge nicht nur nach typologischen oder technisch-funktionellen Kriterien, sondern
2 G r o e n e n 1996, 157: „Avec les d e r n i e r s n é a n d e r t a l i e n s v o n t progressivement se d é v e l o p p e r le r h i n e n c é p h a l e - c e n t r e des é m o t i o n s - et le n é o - c o r t e x — centre d e la .conscience lucide'. C e d o u b l e e n r i c h i s s e m e n t des territoires c é r é b r a u x c o n s t i t u e (. . . ) u n acquis m a j e u r puisqu'il va libérer l ' h o m m e d e la férule d u b i o l o g i q u e et lui o u v r i r les possibilités infinies d e la création t e c h n i q u e et d u m o n d e des s y m b o l e s . " 3 I m weitesten S i n n e des A u s d r u c k s , H. ergaster, H. antecessor, etc., m i t e i n b e z o g e n zu verstehen.
Ein Bild vor dem Bild?
59
auch unter stilistischen Aspekten, einschließlich einer augenscheinlich zweckfrei „ästhetischen", also womöglich symbolischen Komponente, bestimmt werden können. Im anthropologischen Sinne meint Kultur die Gesamtheit des Tuns und Lassens eines menschlichen Verbandes zu einem gegebenen Zeitpunkt. Man pflegt die materiellen Aktivitäten, die den Lebensraum, den Werkzeuggebrauch, Jagd, Kleidung, Schmuck, Ernährung udgl. betreffen, zu unterscheiden von den intellektuellen Aktivitäten, die die Sprache, die familiäre und gesellschaftliche Organisation, Kunst, religiöse Einrichtungen, Traditionen udgl. betreffen. Diese U n terscheidung ist natürlich arbiträr, da die materiellen und intellektuellen Bereiche in Wahrheit fortwährend interferieren und so, unter anderem, die Stile schaffen. Die treffliche Definition Malraux': „Kunst ist, wodurch die Formen zu Stil werden" 4 , macht auch für Epochen Sinn, die so weit zurückliegen wie die Altsteinzeit. Da uns der Homo erectus — von einigen sehr seltenen feinen Knochenritzungen, deren intentionaler Charakter aber keineswegs feststeht, einmal abgesehen 5 — keine künstlerischen Zeugnisse hinterlassen hat, die unmittelbar als solche evident sind, bleibt sein Gebrauch des Steinwerkzeugs unsere wichtigste Informationsquelle, wenn wir die intellektuelle Entwicklung oder die Ausdrucksfähigkeit des altsteinzeitlichen Menschen nachvollziehbar machen wollen. Die Fragen nach dem Ursprung der künstlerischen Hervorbringung lassen sich damit in der einfachen Frage zusammenfassen, ob (nämlich) die Werkzeuge oder gewisse Werkzeuge der Altsteinzeit als Träger von symbolischen Botschaften aufgefasst werden können? 6 Somit wäre das Artefakt nicht nur ein Werkzeug, sondern auch ein Zeichen, dessen Attribute den symbolischen Gehalt und dessen Ausdruck zugleich umfassten. Ein solches Objekt wird damit gleich auf zwei Ebenen, der technisch-funktionellen und der kulturell-symbolischen, signifikant und kommunikativ. Neben dem von Menschenhand behauenen oder zugeschnittenen Arbeitsgerät findet man in altsteinzeitlichen Grablegen bisweilen merkwürdige natürliche Gegenstände, die wahrscheinlich ihres fremden Aussehens, ihrer Form, ihrer Textur oder Farbe wegen aufgesammelt wurden: Bergkristalle, Fossilien, Muscheln, Minerale, verschiedene Steine, natürliche Farbstoffe; alles Elemente, die nicht mit funktionellen Objekten in Verbindung zu bringen sind. Sie
4 A. Malraux, Les voix du silence, Paris 1951, 2 7 0 : „Qu'est-ce que l'art? (. ..) C e par quoi les formes deviennent style." 5 Siehe hierzu A. Marshack, T h e neandertals and the human capacity for symbolic thought: cognitive and problem-solving aspects o f mousterian symbol, in: M . Otte (Hrsg.), L'homme de Néandertal, La pensée, Liège 1989, 5 7 - 9 2 . 6 Für A. Leroi-Gourhan „sind die Menschenartigen (anthropiens) Säuger mit Handwerkzeugen, ein Umstand, den man mit etwas gutem Willen als Vorläuferstatus für einen Zugang zum symbolisierenden Denken auffassen kann", siehe A. Leroi-Gourhan, Sur les formes primaires de l'outil, in: Festschrift Alfred Bühler, hrsg. von C. A. Schmitz und R . Wildhaber, Basel 1965, 2 5 7 - 2 6 2 , hier 2 5 9 .
60
Jean-Marie Le Tensorer
bilden eine besondere Kategorie, die die Anziehungskraft, vielleicht sogar die Faszination oder die Wunderkraft belegen mag, die flir den Homo erectus von j e n e n P r o d u k t e n ausgegangen sein muss, u n d von d e n e n Michel Lorblanchet schreibt, dass diesen ,,[d]ie Frage nach ihrem U r h e b e r zweifelsohne in die Bereiche des Glaubens, der M y t h e n u n d der Symbole einführte" 7 . Mit der eingangs gestellten Frage liegt es n u n m e h r auf der H a n d , den Bedingungen nachzugehen, unter d e n e n b e i m Menschen das Bewusstsein für ein außer-natürliches 8 , von seinen alltäglichen W a h r n e h m u n g e n klar unterschiedenes Universum entstehen konnte.
3. Die Unterscheidung des Natürlichen v o m A u ß e r - N a t ü r l i c h e n als U r s p r u n g künstlerischer Hervorbringung? D e r Kunst entsprechen ästhetische, metaphysische, spirituelle Erwägungen. Aber alle diese Konzepte gehören z u m M e n s c h e n in seiner Zeit. H e u t e unterscheiden wir das Natürliche v o m Ubernatürlichen aufgrund der rationalen Erklärbarkeit von Tatsachen im Z u g e der Entstehung der Wissenschaft; wie aber k o n n t e der altsteinzeitliche Mensch reale u n d imaginäre, erklärbare u n d unerklärliche, physische u n d metaphysische Feststellungen fassen? W i r wissen es nicht; aber wir k ö n n e n uns das H e r v o r g e h e n des Ubernatürlichen aus d e m menschlichen D e n k e n nur vorstellen als von d e m M o m e n t ausgehend, in d e m das Individuum fähig wird, eine gewisse Anzahl von P h ä n o m e nen zu verstehen u n d zu erklären. Die Unterscheidung natürlich/übernatürlich macht keinen Sinn, w e n n m a n von nichts etwas versteht u n d sich nichts erklären kann. Es gibt sie auch dann nicht, w e n n alle „Geheimnisse der N a t u r " wissenschaftlich aufgeklärt werden k ö n n e n . Im Z u g e ihrer Entstehung hat die Menschheit mehrere Intelligenzschwellen überschritten (Abb. 1). A m A n f a n g steht das Auftreten des bearbeiteten W e r k zeugs u n d damit das konzeptuelle D e n k e n . Diese Phase setzt mit d e m Homo habilis ein. Das erste bearbeitete Werkzeug ist gleichsam ein einschneidender Riss, der den M e n s c h e n dazu bringt, sich hinsichtlich der N a t u r in einer einzigartigen Situation wiederzufinden. D e r Akt bewusster u n d überlegter H e r v o r b r i n gung, der, von einem rohen Stück Materie ausgehend, ein einer bestimmten Vorstellung entsprechendes Artefakt produziert, war in der Entstehung des Le-
7 M . Lorblanchet, La naissance de l'art. Genèse de l'art préhistorique dans le monde, Paris 1999, 93: „La question de l'Auteur les introduisaient sans doute dans le domaine des croyances, des mythes et des symboles". 8 Ein Ausdruck, den wir hier d e m Begriff .übernatürlich' vorziehen, der eine seinsenthobene Ordnungsstruktur voraussetzt.
Ein Bild vor dem Bild?
61
bens vor den ersten Menschen noch nie da gewesen. Dieser ersten Phase entspricht die klassische Trennung Natur/Kultur. Die zweite, entscheidende, Etappe, die aber viel schwieriger evident zu machen ist, fuhrt zum Auftreten des symbolischen Denkens. Sie eröffnet dem menschlichen Bewusstsein neue und unauslotbare Horizonte und vollzieht sich im Laufe der langsamen Entstehung des Homo erectus. Der Mensch ist grundsätzlich ein Räuber, er nimmt sich aus der weiten Natur, was er benötigt, um sein materielles Wohlbefinden sicherzustellen; der Mensch ist aber auch ein spirituelles Wesen, das aus seinem inneren Universum unablässig eine Unzahl von selbstgeschaffenen Konzepten, Feststellungen und immateriellen Hilfestellungen herausholt, die für sein Uberleben ebenso unabdingbar sind wie die Befriedigung der materiellen Bedürfnisse. Im Laufe dieser zweiten Etappe ist der Mensch ein Räuber neuer Art geworden, der nun die endlosen Landstriche des symbolischen Denkens auszubeuten beginnt. Dieser zweiten Phase entspricht eine neue, zwischen materieller und spiritueller Kultur unterscheidende Trennung. Die dritte Etappe ist gegen Ende der Altpaläolithikums anzusiedeln, als vor ungefähr 4 0 0 0 0 0 Jahren mit der Zähmung des Feuers eine Schwelle überschritten wird. Diese .Erfindung' ist dann ausschlaggebend für das Aufkommen von neuen Produktionstechniken in der Herstellung von Steinwerkzeug, was wiederum mit der Anlage einer echten menschlichen Gesellschaft einhergeht. Der Lebensraum gewinnt an Struktur und die Unterscheidung in einen häuslichen Innenraum und einen Außenraum geht wahrscheinlich auf eine sozio-kulturelle Evolution zurück. Von da an sehen wir eine zügige Zunahme des Gehirnvolumens, das im Aufkommen der Mythen und in der Spiritualität zu seiner (vorläufigen) Vollendung gelangt, und beim Homo sapiens am deutlichsten zum Ausdruck kommt: in den ersten Bestattungen, dann in der raschen Entwicklung der tragbaren Kunst und in der Felsmalerei. Dieser dritten Phase entpricht die H e rausbildung der menschlichen Gesellschaft in ihrer ganzen Komplexität. Die Beherrschung des Steinbehauens und die Werkzeugherstellung waren darum eines der ersten großen Mittel der Einflussnahme des Menschen auf die Natur. Von Anfang an nutzt der technisch begabte Mensch — der Handwerker und Jäger, dessen Uberleben von den Fertigkeiten abhängt, die er sich aneignet, um den Unterhalt zu sichern — die Intelligenz dazu, seine Verrichtungen zu optimieren. Die Verbesserung der Lebensbedingungen ist denn auch das Hauptmotiv seines Fortschrittsdenkens. Da gibt es aber noch viel mehr. Von einem bestimmten Entwicklungsstadium an gewinnt der Mensch ein Bewusstsein für Vergangenheit und Zukunft. Wir legen diese Periode noch vor Einsetzen der beschleunigten Zunahme des Gehirnvolumens an. Der Mensch verortet sich damit in einem Universum, das er zu gewissen Teilen kontrolliert, von dem er aber grundsätzlich abhängig ist. Eingetaucht in dieses immense Naturgefüge, wovon es mal Geschöpf, mal Schöpfer ist, lebt das Individuum nicht isoliert. Im Schutze der primitiven Gesellschaft stellen sich Zusammenhänge ein, die einem schon
62
Jean-Marie Le Tensorer
bald durch die Sprache gelenkten Nachdenken N a h r u n g geben, aus dem heraus dann das Bedürfnis, die Welt zu verstehen, entsteht. Individuelles und kollektives Gedächtnis müssen bei der Herausbildung des nachdenklichen, schließlich symbolischen Denkens eine vorrangige Rolle gespielt haben. Das Problem besteht nun darin, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem die menschliche Spezies im Laufe ihrer gemächlichen intellektuellen Entfaltung eine neue Schwelle zu überschreiten vermochte, indem der Mensch die Natur jetzt als etwas zu denken beginnt, dem gegenüber er sich auf einer verschiedenen, darüberliegenden Ebene angesiedelt begreift. Der Mensch gewinnt ein Bewusstsein von Macht über die Natur, gleichzeitig aber ein noch größeres Bewusstsein von seiner eigenen Abhängigkeit und Schwäche im Hinblick auf das Universum, in dem er lebt. Die Spiritualität oder die Vorstellung eines Ubernatürlichen ist offenbar nur ein Schritt mehr zur Erkenntnis einer übergeordneten bzw. als solche angenommenen Macht, die es dem Menschen damit erlaubt, sich u m einen weiteren Grad von der Wirklichkeit zu distanzieren und so, konsequenterweise, seine Macht über den Verlauf der Naturereignisse zu stärken. Auf der Suche nach einer Erklärung der sichtbaren Welt vergünstigt sich der Mensch sein Schicksal; durch die Einrichtung einer Verständigung mit der unsichtbaren Welt gewinnt er Hoffnung, sein Schicksal bestimmen zu können. Er gibt sich der Versuchung hin, eine Wahl zu haben. So gesehen scheint uns die Definition der Kunst, die der Bildhauer Jean Pierre Lihou gibt, sehr interessant: Die Kunst ist eigentlich ein Zusammenspiel von Verhaltensweisen, die verschieden von und komplementär zu den wissenschaftlichen u n d philosophischen Verhaltensweisen sind, und durch das eine Gesellschaft auf ihrem Weg in die Menschlichkeit ihr Verständnis von der Welt und deren D e u t u n g e n , aufgrund dessen sie sie zu beherrschen vermeint, b e schreibt, ausdrückt, mitteilt und darum laufend b e r e i c h e r t /
Diese zeitgenössische Auffassung lässt sich besser als jede andere auf die ersten Zeitalter der Menschheit beziehen.
4. Die Fakten: ästhetische und symbolische Komponenten der frühesten Werkzeuge - der Fall des Faustkeils Die ältesten Werkzeuge des Menschen überraschen durch ihre subtile Kombination von Organisation und Ästhetik. Zunächst ist das Werkzeug nach Regeln hergestellt, die einem funktionalen Zweck entsprechen: schneiden, durchbohren,
9 Z u finden auf seiner homepage: www.art-creation.com/f/fgene/ftext/ftext06.html: „L'Art est un ensemble de conduites, différentes et complémentaires des conduites scientifiques et philosophiques, par lesquelles une société en marche vers son humanité décrit, exprime, c o m m u n i q u e puis enrichit sa compréhension du m o n d e et ses interprétations à travers lesquelles elle tente de le maîtriser".
Ein Bild vor dem Bild?
63
reiben . . . , gleichzeitig schließt es aber eine stilistische Komponente mit ein - als unbewusstes Aufscheinen des Handwerkers im Material. Ursprünglich dürfte das Werkzeug rein funktional gewesen sein: ein Stein, aufgelesen, um eine Nuss damit zu knacken, ein Stecken, u m nach etwas Unerreichbarem zu langen, wie es die am weitesten entwickelten Affen heute noch tun. Dann allerdings haben die ersten Menschen angefangen, am aufgelesenen Stein Veränderungen vorzunehmen — u m seine Wirksamkeit zu erhöhen. Eine solche Veränderung erreicht man beispielsweise, indem man mit einem Stein auf einen anderen schlägt. Damit k o m m t nun eine grundlegende Unterscheidung ins Spiel zwischen dem — unbeweglichen - Objekt, das geschlagen wird, und dem - beweglichen - , mit dem man schlägt. Eine Hand hält den Stein, die andere schlägt darauf ein. Also ist eine grundsätzliche funktionelle Dissymmetrie geboren, die, endlos wiederholt, eigentlich mit der Herausbildung einer fundamentalen Dissymetrie des menschlichen Gehirns und der unterschiedlichen Funktionen der linken und rechten Hand in Zusammenhang stehen muss. U b e r solches Tun, und das ist ja das eigentliche Wunder der Menschheit, kommt der Mensch dazu, die Materie solange zu bearbeiten, bis er ihr eine zureichende Form gegeben hat. Von Anfang an wird dieser Form eine starke Neigung zur Symmetrie angelegen sein, die aber für die Funktion des Werkzeugs eigentlich unnötig ist. Es handelt sich dabei u m eine ästhetische Zugabe. Besonders deutlich ist diese Symmetrie am Faustkeil ersichtlich, einem Mehrzweckwerkzeug, das mit dem Homo erectus in Afrika vor mehr als einer Million Jahre auf- und noch im Moustérien der französischen Tradition des Acheuléen am Ende des Mittelpaläolithikums vorkommt. Im übrigen macht dieses Objekt in Afrika und vor allem im Vorderen Orient eine enorme Entwicklung durch, in geringerem Masse hingegen in Europa, Indien und Java. Der Faustkeil gehört zu jenen urgeschichtlichen Werkzeugen, die die Forscher stets am meisten faszinierten. 10 Er spielte schon bei der Würdigung der „vorsintflutlichen" Menschheit eine entscheidende Rolle. Lange bevor die Urgeschichte überhaupt als solche Anerkennung fand, wurde er bereits als eindeutig von Menschenhand geschaffenes Produkt identifiziert. Dies trifft auch auf den Faustkeil zu, der im Jahre 1700 von John Conyers in Gray's Inn Lane ausgegraben und 1860 von J. Evans publiziert 11 , heute als die erste bekannt gewordene Axt aus dem Acheuléen gilt 12 . Seit dieser alten Entdeckung haben die Spezialis-
1(1
Siehe hierzu z.B. G. M. Lopez Junquera, Aspekte des Faustkeils. Versuch einer synthetischen Betrachtungsweise des Faustkeilphänomens, Diss. Tübingen 1982. ' ' J. Evans, O n the Occurrence of Flint Implements in the Undisturbed Beds of Gravels, Sand and Clay, in: Archaeologia: or Miscellaneous Tracts Relating to the Antiquity, XXXVIII (1860), XVI; zit. nach M. Groenen, Pour une histoire de la préhistoire, Grenoble 1994, 37. 12 L. Capitain, La première hache acheuléenne connue, in: Revue de l'École d'Anthropologie de Pans, 11 (1901), 2 1 9 - 2 2 6 .
64
Jean-Marie Le Tensorer
ten nicht geruht, sich mit diesem bemerkenswerten Werkzeug auseinanderzusetzen. Fast alle, die Faustkeile studiert haben, legen Wert auf die Feststellung ihrer ausgesprochen gleichmäßigen Morphologie - und das über sehr sehr lange Zeiträume hinweg und auf einem riesigen Verbreitungsgebiet. Schon viele haben ihre „Schönheit" hervorgehoben, selbst dann noch, wenn sie glaubten, diesen Aspekt zugunsten der Funktionalität sogleich wieder herunterspielen zu müssen. So schreibt doch V. Commont 1907 tatsächlich in einer Studie über Faustkeile aus dem Acheuléen: Was hat der Hersteller dieser Werkzeuge mit ihrer Fabrikation wohl bezweckt? N u n , es ist anzunehmen, dass nicht allein die Schönheit des Gegenstandes, den er im Auge hatte, ausschlaggebend war und sein ästhetisches Empfinden überhaupt noch eher wenig entwickelt war. Es ist deshalb vernünftiger, zu denken, dass ihm die Herstellung eines Werkzeugs vorschwebte, dessen Form auf ein bestimmtes Bedürfnis abgestimmt sein sollte. 13
F. Bordes, ein hervorragender Kenner des behauenen Steins, versichert uns zwar, dass „die Menschen des Acheuléen die Faustkeile bestimmt nicht zu ihrem Vergnügen hergestellt hätten, sondern um an ihnen die Formen zu erhalten, die sie benötigten", 14 gleichzeitig bricht er aber immer wieder ob der gelungenen Form oder Schönheit dieses oder jenes Faustkeils in offene Bewunderung aus. Einige zögern nicht, den befreienden Schritt zu machen. So bestätigen uns G. Clark und S. Piggot: „Es wäre abwegig, die ausgefeiltesten Faustkeile allein aufgrund ihrer Funktion zu bewerten. Der Kult um höchstmögliche Qualität, die Entschlossenheit, in der Herstellung von Dingen äußerste Perfektion zu erreichen, reicht bis in diese Zeit in der Menschheitsgeschichte zurück". 15 Und G. Smolla stellt in seinem Handbuch hinsichtlich der Faustkeile die Frage: „Ist es erlaubt, hier schon von frühesten Kunstwerken zu sprechen, oder soll man sich mit der Formulierung .Vorahnung der Kunst' begnügen?". 16 Man sieht, die Hypothese vom Faustkeil als Kunstwerk ist nicht neu, aber die Entdeckung von mehr als 11000 Faustkeilen in einem einzigen Grab aus der
13 V. C o m m o n t , Contribution à l'étude des silex taillés de Saint-Acheul et de Montières, in: Bulletin de la Société Linéenne du N o r d de la France, 3 6 / 3 3 7 (1907), 3 3 7 - 3 6 9 , hier 352: „ Q u e l était le but de l'ouvrier en fabriquant ces outils? Il est vraisemblable de croire que ce n'était pas exclusivement la beauté de la pièce qu'il envisageait et que le sentiment esthétique était peu dévelopée chez lui. Il est plus raisonnable de penser qu'il avait en vue la production d ' u n outil de forme déterminée répondant à u n besoin particulier". 14 F. Bordes, Typologie et statistiques. Observations sur la note de Mlles Alimen et Vignal, in: Bulletin de la Société Préhistorique Française, 50, fasc. 1 - 2 (1953), 7 4 - 8 1 , hier 77: „Les Acheuléens ne fabriquaient certainement pas les bifaces pour s'amuser, mais fabriquaient les formes dont ils avaient besoin". 15 C. Clark u n d S. Piggot, Prehistoric Societies, L o n d o n 1965, 51: „It would be perverse to account for the finest hand-axes in terms of their fonction alone. T h e cuit of excellence, the détermination to make things as perfect as they could be made, is something which began thus early in the history of m a n " . 16 G. Smolla, Epochen der menschlichen Frühzeit, Freiburg i. Br. und M ü n c h e n 1967.
Ein Bild vor d e m Bild?
65
Kulturstufe des Acheuleen in Nadaouiyeh Am Askar (Syrien), sodann das nahezu vollständige Fehlen an anderen Werkzeugen, sowie schließlich die augenscheinlich widersinnige Entwicklung, wonach in den älteren Schichten gefundene O b jekte weitaus feiner augearbeitet sind als solche aus den jüngeren Schichten, fuhrt uns dazu, die Frage nach der Bedeutung dieser Objekte neu zu stellen. 17 Das Altpaläolithikum von Nadaouiyeh 18 ist in mindestens sieben Stadien des Acheuleen über gut und gerne dreißig archäologische Schichten verteilt nachweisbar. Dazu kommen noch die Ubergangskulturen zwischen dem Alt- und dem Mittelpaläolithikum, das Yabroudien und das Hummalien. U m Verwirrung angesichts der bereits bestehenden Benennungen für die verschiedenen Perioden des Acheuleen im Vorderen Orient zu vermeiden, 1; haben wir für die hiesige Abfolge ein eigenes System entworfen. Aufsteigend von der ältesten zur jüngsten Schicht wurden die Stadien des Acheuleen von Nadaouiyeh provisorisch als Acheuleen Fazies G bis Acheuleen Fazies A benannt. Diese Unterteilung enthält ein Aussagepotential, das den lokalen Rahmen sicher überschreitet und so als Referenz dazu dienen kann, die Entwicklung des Acheuleen über die Grenzen der syrischen Wüste hinaus zu charakterisieren. 20 Schematisch gesehen ist die Entstehung der steinzeitlichen Traditionen von Nadaouiyeh folgendermaßen zusammenzufassen: Die Frühphase des Acheuleen zeichnet sich aus durch ausgesprochen sorgfältigen Behau der Faustkeile und eine hohe Gleichmäßigkeit in deren Form (Abb. 2 und 3). Diese Phase lässt sich in mehrere klar unterscheidbare Fazies unterteilen (Nad-A bis Nad-D). Im Oktober 1996 wurde das Scheitelbein eines Homo erectus21 in einer der Nad-D (Lage 8) zuordenbaren Schicht gefunden. Im Vergleich zu dessen älteren Schichten sind
17 J . - M . Le Tensorer, Les prémices de la créativité artistique chez Homo erectus, in: Mille Fiori. Festschrift fur L u d w i g Berger. Forschungen in Augst, 25, Augst 1998, 3 2 7 - 3 3 5 , u n d J . - M . Le Tensorer, S. M u h e s e n , R . Jagher, P. Morel, J. Renault-Miskovsky, P. Schmid, Les premiers h o m m e s du désert syrien. Fouille syrio-suisse à N a d a o u i y e h Aïn Askar (Ausst. Kat. M u s é e de l ' H o m m e Paris), Paris 1997. 18 Seit 1989 wird diese Grabungsstelle, mit Fördermitteln des Schweizerischen N a t i o n a l fonds f u r Wissenschaftliche Forschung, u n t e r der Leitung des Verfassers u n d des A b g e o r d n e t e n der Generaldirektion der A l t e r t ü m e r u n d M u s e e n Syriens, d e m an dieser Stelle ausdrücklich D a n k ausgesprochen sei f u r seine U n t e r s t ü t z u n g u n d Hilfe bei d e n U n t e r s u c h u n g e n , v o m L a b o r a t o r i u m fur Urgeschichte an der Universität Basel betreut. 19 Siehe hierzu z.B. S. M u h e s e n , Le Paléolithique inférieur de Syrie, in: L'Anthropologie, 9 2 / 3 (1988), 8 6 2 - 8 8 2 . 20 R . Jagher, N a d a o u i y e h Aïn Askar. E n t w i c k l u n g der Faustkeiltraditionen u n d der Stratigraphie an einer Q u e l l e in der syrischen Wüstensteppe, 3 Bde, Diss. Basel 2000. 21 R . Jagher, J . - M . Le Tensorer, P. M o r e l , S. M u h e s e n , J. Renault-Miskovsky, P. R e n t z e l , P. Schmid, D é c o u v e r t e s de restes h u m a i n dans les niveaux acheuléens de N a d a o u i y e h Aïn Askar (El K o w m , Syrie centrale), in: Paléorient, 2 3 / 1 (1997), 8 7 - 9 3 , u n d P. S c h m i d u n d J . - M . Le Tensorer, L ' H o m o erectus au P r o c h e O r i e n t , in: Les premiers habitants de l'Europe. R é s u m é des c o m m u n i c a t i o n s , C o l l o q u e de Tautavel, 1 0 . - 1 5 . April 2000, 84.
66
Jean-Marie Le Tensorer
die jüngeren Schichten des Acheuleen (Nad-C/B) durch wesentlich sorgloser behauene Steine ausgezeichnet (Abb. 5). Diese sind besonders schmal und weitaus weniger gleichmäßig. Ausserdem kann man im Verlauf dieser Periode eine besonders starke Zunahme an leichtem Arbeitsgerät feststellen, das in Form von winzigen Faustkeilen (Mikrofaustkeile) und von Werkzeug in Verbindung mit kleinen Blöcken (Hackwerkzeug) auftritt. Eine systematische Herstellung von Abschlag ist hingegen nicht feststellbar. Abschlagsgeräte sind sehr selten. Durch eine stratigraphische Unterbrechung abgesetzt, wird diese Periode des Acheuleen von Belegungen gefolgt, die dem Yabroudien und dem Hummalien zugewiesen werden können. Am oberen Ende von deren Schichtverlauf kann man eine Wende zur Tradition des Acheuleen (Nad-A) erkennen. Diese Periode des Acheuleen ist durch vergleichsweise leichte Faustkeile und einige wenige Abschlagsgeräte ausgezeichnet. W i r stellen also fest, dass in den ältesten Schichten, deren Alter auf 5 0 0 0 0 0 bis 4 0 0 0 0 0 Jahre geschätzt wird, die Faustkeile außergewöhnliche Perfektion erreichen, wobei ihr Hersteller als eher archaischer Homo erectus einzustufen ist. Seine Faustkeile sind bemerkenswert gleichmäßig, weisen vollkommen symmetrische und sehr reine Formen auf (Abb. 3), deren Verarbeitung ausgesprochen sorgfältig ist. Nun muss ein Gegenstand, um nützlich zu sein, j a nicht unbedingt „schön" sein. In diese Objekte ist aber ganz unbestreitbar ein ästhetisches Anliegen eingegangen. Der funktionellen Komponente schließt sich wahrscheinlich eine spirituelle Komponente an, und zwar in dem Sinne, dass der Handwerker den Stoff bearbeitet, um ihm die ideale Form zu geben, die er, wiewohl sie ihm keinen funktionellen Vorteil einträgt, für notwenig hält. Was nun vor allen Dingen überrascht, ist das Fehlen von anderen Werkzeugformen. Abschlagsgeräte, die in allen europäischen und afrikanischen Perioden des Acheuleen weit verbreitet, außerdem viel leichter herzustellen und bei den alltäglichen Verrichtungen ebenso wirkungsvoll sind wie die Faustkeile, fehlen gänzlich. Demach gibt es einen ausdrücklichen Willen, nur faustkeilartige Werkzeuge herzustellen, und das zudem in großer Zahl. Diese Ausschließlichkeit überrascht und deutet auf den gewollten Ausschluß anderer sonst gewöhnlich hergestellter Werkzeugtypen. Die Eigentümlichkeit verstärkt den Eindruck, dass dieser Produktionsmodus einer vollständig definierten Gesellschaft zuzurechnen ist, die damit auf stark ausgearbeitete Kriterien und Regeln antwortet, welche die Herstellung von unkodifiziertem Werkzeug schlichtweg nicht zulässt. Auf dieser Ebene glauben wir nun die Herausbildung des Symbols im Werkzeug erkennen zu können. M . Groenen zufolge ist das Symbol für die Mitglieder einer Gesellschaft ein Wert an sich. Die gemeinsame Haftung unter einem Verbund von Symbolen garantiert diesen überhaupt erst ihre Gültigkeit für eine bestimmte Gruppe. 22 Mehr noch, das
22
Groenen 1996, 165.
Ein Bild vor d e m Bild?
67
Symbol impliziert eine Vorstellung von Zugehörigkeit. Wie G. Gurvitch sagte, „das Symbol schließt sowohl ein als auch aus". „Diese Zugehörigkeit (...) b e zeichnet die kulturelle Tragweite". 2 3 Die doppelte Eigenschaft des Symbols scheint uns im Faustkeil schon ganz präsent. Das ist es auch, was wir weiter oben mit Inhalt und Ausdruck der symbolischen Botschaft meinten. Freilich, der Inhalt entzieht sich uns gänzlich. Allerdings erinnert uns die ausgeprägte Symmetrie des Faustkeils und seine charakteristische Länglichkeit zwangläufig an die Gestalt des Menschen selbst. Haben wir es also tatsächlich mit einer Art Anthropomorphisation des Stoffes zu tun? Sollte der Mensch wirklich, bewusst oder unbewusst, sein Bild und sein Ich in das Werkzeug hineingewirkt haben, das mithin eine Art Bindeglied zwischen ihm und der Natur sein würde; könnte es u m eine Machtübertragung auf den Menschen kraft seines Werkzeugs gehen? Sind die Anfänge der symbolischen Verständigung und damit der künstlerischen Hervorbringung ein Ansinnen zur Vermenschlichung des Unbelebten, hat der Mensch das Werkzeug nach seinem Ebenbild geschaffen? Trifft diese Hypothese zu, stieße man hier wenigstens teilweise auf die grundlegende Idee der mimesis, was uns wieder zur Idee des Aristoteles bringt, der bekanntlich darauf setzt, dass sich der Mensch durch seinen Nachahmungstrieb von den Tieren unterscheidet und folglich annimmt, dass die Phänomene der Nachahmung an die Ursprünge der Menschheit zurückreichen müssen. 24 Die Fähigkeit, unser Ebenbild und die Wirkungsweisen unseres Tuns in die konkreten Formen der äußeren Erscheinungswelt hinein zu projizieren, bildet das Fundament aller künstlerischen H e r vorbringung: 2 5 „Der Mensch trachtet nur danach, sich in seinen Werken wiederzufinden, sein Werk ist ihm sein Spiegel." 26 Das zweite Problem, das sich mit den in Nadaouiyeh gemachten Beobachtungen stellt, ist das der augenscheinlich widersinnigen Entwicklung der Faustkeile,
23 Zit. nach G r o e n e n 1996, 166: „Le Symbole inclut et exclut. C e t t e appartenance ( . . .) m a r q u e la dimension culturelle". 24 Das Mimesiskonzept w u r d e in der griechischen Philosophie m e h r f a c h behandelt. Piatons Ü b e r l e g u n g e n in Das Staatswesen (Politeia) werfen aber auf ganz besondere Weise ein Licht auf den G e d a n k e n des Faustkeils als Darstellung o d e r N a c h a h m u n g der menschlichen Gestalt. B e kanntlich steht für Piaton der N a c h a h m e r als Schöpfer von Bildern in Gegensatz z u m H e r v o r bringer der Wirklichkeit. Weshalb die künstlerische N a c h a h m u n g eine d o p p e l t e T a u s c h u n g ist. Die sichtbaren u n d greifbaren D i n g e sind n u r der W i d e r s c h e i n der wirklichen D i n g e (der D i n g e an sich) der Ideenwelt; D i e Darstellung dieses Widerscheins durch den Künstler bringt also n u r die N a c h a h m u n g einer N a c h a h m u n g hervor. D i e Kunst e n t f e r n t sich daher v o n der Wahrheit u n d belügt die M e n s c h e n , i n d e m sie Trugbilder der Wirklichkeit hervorbringt. D a r ü b e r hinaus ist sie auch in moralischer Hinsicht verdächtig: In ihrer n a c h a h m e n d e n F u n k t i o n b r i n g e n die Künstler u n v o l l k o m m e n e Beispiele hervor, die in ästhetisch a n z i e h e n d e F o r m e n gekleidet, sich ungünstig auf die menschlichen H a n d l u n g e n auswirken k ö n n e n . 23 Vgl. M . Borissalievitch, La science de l ' h a r m o n i e architecturale, Paris 1925, in: V a n d e n h e e d e 1997, 85. 26 W i e A n m . 25: „ L ' h o m m e n e fait q u e s'imiter dans son ceuvre, son ceuvre est son miroir."
68
Jean-Marie Le Tensorer
die, prächtig gebildet in den unteren Schichten, mit der Zeit immer unregelmäßiger und gröber werden. Müssen wir darin eine zu Gunsten seiner funktionalen Wirksamkeit gehende Verarmung der symbolischen Funktion des Werkzeugs sehen? Die Frage scheint uns berechtigt. Nur, wenn das tatsächlich der Fall ist, sind wir Zeugen einer Art von „Entweihung" des Werkzeugs. Hinsichtlich der Unabdingbarkeit der symbolischen Botschaft für den Zusammenhalt der Gruppe wäre demnach anzunehmen, dass diese auf andere Träger übergegangen ist und jetzt in anderen Trägern ausdrücklich wird, die nicht versteinern können, in der Geste, im Wort, im Ritus.
5. Ein Goldene Zahl der Altsteinzeit? Können wir in der „ästhetischen" Analyse des Faustkeils noch weiter gehen? Seine besondere Morphologie und seine Symmetrie fuhren uns notwendig zum Studium der Proportionen dieses Werkzeugs. Die von Menschenhand hervorgebrachten Formen weisen proportionale Beziehungen und eine das Werk durchwaltende Einheit auf. Ästhetisches Vergnügen und Harmoniewahrnehmung resultieren aus den Relationen, die sich zwischen den Formen des Objekts und dem günstigen Eindruck einstellen, die seine Betrachtung hervorruft. Das Auge sucht und bevorzugt gewisse Perspektiven, gewisse Regelmäßigkeiten und stößt dabei vor allen Dingen auf die Symmetrie. Diese Operation ist natürlich zerebraler Natur und hängt von physiologischen, psychologischen und sozio-kulturellen Phänomenen ab. Die Absolute oder Goldene Zahl ist nichts weiter als die Einforderung einer Harmonie. Bei der Hervorbringung eines konkreten Objekts dient der menschliche Körper, das vollkommenste Beispiel für Symmetrie und Harmonie in der Natur, als Modell, als Reflex eines Ideals. In diesem Zusammenhang betont Marc Crunelle zurecht dass „unseren inneren Symmetrien diejenigen entsprechen, die wir in unsere Dinge legen". 27 Also haben die Griechen eine arithmetische Regel entworfen, die auf dem Zusammenhang des Fußes eines Idealmenschen mit seiner Körpergröße beruht, das Modell der dorischen Säule. Der Goldene Schnitt leitet sich von der mathematischen Theorie der Harmonie her, deren metaphysisches und kosmologisches Äquivalent zwischen dem menschlichen Körper, der menschlichen „Seele" und der „Seele" der Welt eine Korrespondenz herstellt. Die Harmonie des menschlichen Körpers ist nichts anderes als die Verstofflichung seiner „Seele". Für die Griechen hängt die Schönheit, diese höchste Erstrebung des Künstlers, von „der Symmetrie aller Körperteile, dem Zusammenhang dieser Teile untereinander und jedes einzelnen mit
27 M . Crunelle, L'architecture et nos sens, Bruxelles 1996: „À nos symétries intérieures répondent celles que nous mettons dans les choses".
Ein Bild vor dem Bild?
69
dem Ganzen" ab. Die proportionalen Beziehungen sind der Ausgangspunkt aller Harmonie. 28 Der Goldenen Zahl der Griechen entspricht ungefähr das HöhenLängen-Verhältnis von 1, 62. Die Vermessung von mehreren tausend Faustkeilen aus Nadaouiyeh verdeutlicht eine Tendenz zur Standardisierung und zur Wiedergabe eines bestimmten Verhältnisses von Länge zu Höhe, wobei jeder Fazies ein etwas anderes Verhältnis entspricht. Dieses Verhältnis hängt von der jeweiligen Längung der Faustkeile ab. In den alten Schichten liegt es nahe bei 1, 4. Könnte diese Zahl nicht einer Art von harmonischem Verhältnis für den Homo erectus entsprechen? Diesbezüglich sind unsere Studien noch nicht über das Versuchsstadium hinaus gediehen. Und doch will uns schon scheinen, dass die ersten Menschen in solche Artefakte wie die Faustkeile, deren Morphologie durch den Vorgang des Behauens bestimmt ist, eine harmonische Komponente hineingewirkt haben, die der „göttlichen Proportion" der Goldenen Zahl der Antike durchaus vergleichbar ist.
6. Das Auftreten des Bildes oder Wann die Träume stofflich werden Die Morphologie des Faustkeils drückt vermutlich eine Kunstform aus - die allerdings unbewusst bleibt. Eine neue Stufe ist erst erklommen, als der Mensch seine innere Wirklichkeit in Zeichnung übersetzt. Die ersten graphischen Zeichen sind feine, im Allgemeinen wenig koordinierte Knochenritzungen. In Bilzingsleben (Kreis Artern, Thüringen) hat D. Mama 29 aus ungefähr 300000-jährigen altsteinzeitlichen Schichten mehrere geritzte Gebeine ans Tageslicht geholt, die teils nebeneinander gesetzte Rillen (Abb. 6), teils schwer deutbare Motive aufweisen, in denen der Ausgräber die Bilder einer Raubkatze und verschiedener Affen sehen will (Abb. 7). Wiewohl uns diese Deutung gewagt erscheint, zeigen die Fundstücke doch, dass der Mensch bereits in einer sehr weit zurückliegenden Epoche über die Zeichnung, mithin die materialisierte Geste, gewisse Eindrücke, gewisse Konzepte auszudrücken verstand. Die Kunst, das geht aus den angeführten Beispielen hervor, nimmt ihren Anfang im Setzen graphischer Zeichen; und zwar nicht in der eher unbeholfenen Darstellung des Wirklichen, sondern des Abstrakten. Die Verstofflichung eines Gedankens durch das Ziehen eines Strichs ist der Schrift verwandt. Sie ist ein Verfahren zur Verständigung und Bewahrung der Idee. Uber all die 250000 Jahre, die diese ersten Kunstwerke vom Entstehen der figürlichen Kunst im europäischen Jungpaläolithikum trennt, ist keine nennenswerte Entwicklung feststellbar. Geritzte Objekte bleiben äußerst rar und die 28
Siehe Vandenheede 1997, 87. D. Mania, Kultur, Umwelt und Lebensweise des Homo erectus von Bilzingsleben, in: J. Herrmann und H. Ullrich (Hrsg.), Menschwerdung, Berlin 1991, 2 7 2 - 2 9 6 . 29
70
Jean-Marie Le Tensorer
Darstellungen immer ungegenständlich. Im Mittelpaläolithikum, dem Zeitalter des Neandertalers, findet man manchmal Spuren einer Verwendung von natürlichen Farbstoffen. Dienten sie vielleicht der Körperbemalung oder der Bemalung von Trägern, die heute verschwunden sind? W i r werden es leider nie erfahren. Die außergewöhnliche Kunstentwicklung im Jungpaläolithikum entspricht d e m nach einer veritablen intellektuellen Wandlung des Menschen, kurz, dem Auftret e n d e s Homo
sapiens.
7. Ecce H o m o pictor Die Heraufkunft des modernen Menschen in Afrika und im Vorderen Orient, seine anschließende Verbreitung bis ins europäische Abendland, stellt seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine der großen Fragen vorgeschichtlicher Forschung dar. Inzwischen ist das chronologische Raster der letzten 100000 Jahre der Menschheitsgeschichte, die Lebensweise der Jäger, recht gut erforscht. Hingegen sind die spirituelle Komponente unserer fernen Vorfahren, die Beweggründe für die große Ausbreitung des Homo sapiens noch immer nur hypothetisch erfasst. Die künstlerischen Bekundungen, die er hinterlassen hat, sind ein möglicher Schlüssel, der uns vielleicht erlaubt, die Existenz eines bereits weitgehend strukturierten metaphysischen Denkens seit der frühesten Epoche des Jungpaläolithikums evident werden zu lassen. Die Entdeckung neuer ausgeschmückter Höhlen in Frankreich (insbesondere der Höhlen von Cosquer bei Marseille und Chauvet in Vallon Pont-d'Arc) werden eines schönen Tages, mit jüngeren Beobachtungen in den Donauländern und im Rheinland in Verbindung gebracht, unsere Vorstellungen über die Ankunft des Homo sapiens in Europa und die spirituelle Aktivität des Cro-magnon-Menschen erhellen. Die Felsmalerei ist eine allgemein auf Europa beschränkte Erscheinung, die im frankokantabrischen R a u m zu ihrer zweifellos spektakulärsten Ausprägung gefunden hat. Wie A. Leroi-Gourhan sagte, scheint diese Kunst „sich . . . von einer wirklichen Schrift loszulösen und einen Weg einzuschlagen, auf dem sie, ausgehend vom Abstrakten, Schritt für Schritt die Darstellungsweisen von Form und Bewegung herausarbeitet, u m am Ende der Kurve zum Realismus zu finden und schließlich zu verlöschen". 3 0 Gesamthaft gesehen lassen sich mehrere Motivgruppen unterscheiden, die wiederum in figürliche und symbolische Kunstformen auseinandergehalten werden können. Die figürliche Kunst ist hauptsächlich auf Tiere beschränkt, wobei die Pflanzenfresser, mehrhheitlich Pferde und Rindtiere wie Auerochs und Bison, dominieren. Die übrigen figürlichen Darstellungen 30 Leroi-Gourhan 1964, 268: „se détacher d'une véritable écriture et suivre une trajectoire qui d'un départ dans l'abstrait dégage progressivement des conventions de formes et de mouvement pour atteindre le réalisme." (dt. Leroi-Gourhan 1988, 243).
Ein Bild vor dem Bild?
71
zeigen menschliche Wesen, entweder als Statuetten, die fast immer weiblich gestaltet sind, oder, variantenreicher, in der Felsmalerei. Nicht-figürliche Motive gibt es unzählige. Man gruppiert sie seit den Arbeiten von A. Laming-Emperaire und A. Leroi-Gourhan unter dem Begriff des Zeichens. Man kennt (mit Ausnahme einiger Zeichen, deren D e u t u n g aber nicht unumstritten ist) keine oder nur sehr wenige Pflanzendarstellungen, ebenfalls sind keine Elemente landschaftlicher Darstellung bekannt. Eines wird an diesem großen Aufschwung der altsteinzeitlichen Kunst besonders deutlich sichtbar: dass der altsteinzeitliche Mensch, nachdem er einmal die einfachsten magischen Praktiken überwunden hat, ein System des symbolischen Denkens in Gang bringt, das auf das Religiöse abzielt. Handelt es sich u m eine Mythologie oder u m eine Religion, wie sie sie die letzten Jägerund-Sammler-Völker auf unserer Erde kennen? Zweifellos tut es das. Aber handelt es sich u m Magie, Schamanismus, Totemismus oder ein noch ganz anderes religiöses Prinzip? Diese Frage, die die Forscher seit über einem Jahrhundert beschäftigt, können wir noch nicht mit Gewissheit beantworten. Sicher besitzt diese Bildkunst ihre eigene ausgesprochen ästhetische Komponente, die auf ihre Art weder von der klassischen noch von der modernen Kunst j e übertroffen worden ist. Die Kunst des Jungpaläolithikums zeigt, dass sich der Homo sapiens sapiens seit seinen Ursprüngen intellektuell gleich geblieben ist. Diese Kunst ist über einen Zeitraum von wenigstens 25000 Jahren bekannt. Bei einer derart langen Dauer möchte man ein wahres Wuchern an Stilen und Motiven erwarten; anders gesagt, eine Variation in den Glaubensüberzeugungen von einer Gruppe zur nächsten, von einer Epoche zur anderen. Doch nichts davon. Die dargestellten T h e m e n bleiben auffallend unverändert. Die Kunst des Jungpaläolithikums erscheint im europäischen Abendland trotz einer gewissen Entwicklung in Stil und T h e m e n und etwaigen geringfügigen regionalen U n t e r schieden erstaunlich homogen. Vom Aurignac-Menschen bis zum Menschen des Magdalénien bleibt sich das Raster gleich: eine große Jägerreligion aus dem Renne-Zeitalter. Auf diesem Raster können sich tausend lokale Praktiken abund überlagern, der Gründungsmythos bleibt jedoch derselbe, weil er sich in den selben Grundelementen weitertradiert. Die Entdeckung der Höhle von Chauvet in Vallon Pont-d'Arc (Ardèche) bestätigt diesen Eindruck (Abb. 8). Ihre mit über 400 gemalten und eingeritzten Figurationen außerordentlich weit fortgeschrittene Kunst ist mit den Felsmalereien in den größten bekannten H ö h l e n reservaten (insbesondere mit denen von Lascaux) vergleichbar. Überdies ergab die Anwendung des C 14-Verfahrens mit einer Entstehungszeit von u m 30000 Jahren vor Christus eine der frühesten Datierungen! Dies ist ein neuer Beleg für die außergewöhnliche Konstanz in der altsteinzeitlichen Kunst. Ein weiterer Gegenstand des Erstaunens ist es, dass man in den Gegenden der oberen D o n a u - und Rheinläufe prächtige Tier-und Menschenstatuetten gefunden hat, die überdies sehr alt sind (ca. 35000 Jahre). Die wichtigsten Kunstwerke stammen aus den Vogelherdhöhlen (Abb. 9), dem Geißenklösterle und aus H ö h -
72
Jean-Marie Le Tensorer
lenstein-Stadel (Baden-Württemberg). Diese Fundstücke, die aufgrund der zahlreichen Studien, die ihnen schon gewidmet wurden, 31 inzwischen Klassiker sind, haben viele Fragen aufgeworfen und zur Formulierung von Hypothesen gefuhrt, die seit einem Jahrzehnt unsere Vorstellungen von der Entstehung der Kunst in Europa völlig erneuern. Die wahre Fülle an Skulpturen von bemerkenswerter technischer und ästhetischer Qualität und außerordentlicher stilistischer Reife, die man dort fand, beweist dass die ersten Vertreter des Homo sapiens, die in den Regionen der oberen Donau- und Rheinläufe vor mindestens 3 5 0 0 0 Jahren eingetroffen sein müssen, bereits über eine vollkommene Meisterschaft in der Bearbeitung von tierischen Stoffen verfugten. Bei Anbruch des Jungpaläolithikums erscheint die Kunst, ohne erkennbare Vorlaufsphase, schon voll ausgebildet. Tatsächlich ist aus dem Mittelpaläolithikum kein einziges Beispiel für figürliche Kunst bekannt. Allerdings muss die Phase der vor-künstlerischen Reifung, entsprechend einer Phase der mentalen Entstehung des Vor-symbolischen, doch irgendwie existiert haben. Eine solche Vorlaufsphase hat eben in anderen, wahrscheinlich orientalischeren Gegenden stattgefunden, dort, wo man die Wiege der modernen Menschheit situiert. Im süddeutschen R a u m haben wir es dagegen mit der Ankunft eines aus der Expansion hervorgegangenen oder durch Wanderung hier eingetroffenen Volkes zu tun, das schon im Vollbesitz dieser Techniken und einer neuen Symbolik ist. Neben figürlichen Themen begegnet man einer Vielzahl von Zeichen und Spuren, deren Bedeutung uns verborgen bleibt. Einige sind komplex und wurden schon oft mit Hilfe von ethnographischen Vergleichen als Hütten, Wildschweinfallen, Waffen etc. figürlich interpretiert. Andere beschränken sich auf Punkte, Linien und einfache geometrische Zeichen. Indem sie miteinander kombiniert werden, können diese einfachen Zeichen komplexer strukturierte Verbände bilden. Zu all dem gesellt sich noch eine Vielzahl von formlosen oder abgebrochenen Spuren, die eine Art von zusammenhangslosem Graffiti bilden. In seinen zu Klassikern gewordenen Studien hat A. Leroi-Gourhan diesen Zeichen eine besondere Bedeutung gegeben, indem er zeigen konnte, dass sie an der Strukturierung des ausgeschmückten Raumes partizipieren. Er hat, auf die Darstellungen in den Felsmalereien der Höhlen und Unterschlupfe abgestützt, eine neue Deutung der altsteinzeitlichen Kunst vorgeschlagen, da, so LeroiGourhan, diese Darstellungen, im Unterschied zur tragbaren Kunst, noch die vom vorgeschichtlichen Menschen dafür ausgesuchten Stellen bezeichneten. Das erlaubt eine topographische Analyse der Werke und das Studium möglicher B e ziehungen zwischen den figürlichen Darstellungen und den zahllosen Zeichen.
31 Siehe hierzu z.B. den schönen Katalog, der anlässlich einer Ausstellung in Tübingen realisiert wurde: G. Albrecht, H. Engelhardt, J . Han, H. Müller-Beck (Hrsg.), Die Anfange der ^Kunst vor 3 0 0 0 0 Jahren, Stuttgart 1987.
Ein Bild vor dem Bild?
73
Also werden von einer Stätte zur anderen die Konstanten offenbar, was wiederum belegt, dass die Ausschmückung der Höhlen nach festen, ganz offenkundig metaphysischen Kriterien vor sich ging. Die Bedeutung dieser Darstellungen bleibt freilich dennoch weitgehend rätselhaft. Für A. Leroi-Gourhan beruht das ihnen zugrundeliegende Denksystem auf einem dualistischen Prinzip, das er als m ä n n lich und weiblich einstuft, das aber ebensogut die Existenz einer Spiritualität bezeichnen kann, die etwa auf dem Gegensatz von Leben und Tod, Ja und Nein, Tag und Nacht, Gut und Böse etc. beruhen mag. Wahrscheinlich besitzt jedes Zeichen einen symbolischen Gehalt, was ja überhaupt nicht heißen muss, dass es nicht auch einen einfachen figürlichen Gehalt einbeschließen kann. Alles hängt davon ab, wie ein Beobachter das Zeichen nach dem Grad seiner Vertrautheit mit dessen Funktion liest. N e h m e n wir ein einfaches aktuelles Beispiel: erstens kann ein S-förmiges Zeichen den Buchstaben S, mithin ein alphabetisches Zeichen bedeuten. Zweitens kann es außerdem der Darstellung einer Schlange entsprechen oder einer gefährlichen Kurve, wenn es sich u m ein Verkehrsschild handelt. In diesem Fall enthält das Zeichen eine präzise Bedeutung, eine konkrete Idee, ist es Ideogramm oder Symbol. Wir können aber noch weiter gehen: Drittens geben wir dem Zeichen S einen metaphysischen Gehalt, zum Beispiel die Bedeutung für Böse. Unser Zeichen wird nun zum Symbol des Bösen. Es besitzt eine mythische oder geheiligte Komponente. W i r haben den Maßstab völlig verändert. Es ist wahrscheinlich, dass die vorgeschichtlichen Zeichen, j e nach Lektüreebene, über mehrere Bedeutungen verfügten. Wenn man den Schlüssel zur D e u t u n g nicht besitzt, ist es unmöglich, die verborgene oder an Initiationsriten gebundene Bedeutung eines jedweden Zeichens zu verstehen. Wegen dieses kryptologischen Aspektes der Zeichen sind die Chancen sehr gering, dass wir ihre exakte Bedeutung jemals werden lüften können. Hingegen können wir annehmen, dass alle diese Zeichen, gleichgültig ob sie nun einen figürlichen, ideologischen, symbolischen oder geheiligten Gehalt haben, immer diese eine Funktion hatten: etwas mitzuteilen, zu verständigen. Was immer der metaphysische Gehalt der Zeichen ist, sie partizipieren an einer Sprache und verfassen eine Botschaft. Man kann sich vorstellen, dass es sich u m eine symbolische Schrift handelt.
8. Schlussfolgerungen Die Ursprünge des Bildes, sodann der Kunst, verlieren sich im Dunkel der Zeit. In unserer vorläufigen Untersuchung haben wir versucht zu zeigen, wie sich die Entstehung der Menschheit auf ihrem langen Weg in ein nach und nach größer werdendes Abstandnehmen von der natürlichen Umgebung, vom genetischen Erbgut und von den instinktiven Beschränkungen übersetzen lässt. Schrittweise hat sich der Mensch der Welt, die ihn umgibt, enthoben, u m sich ein inneres Universum, das seines Geistes, zu schaffen. D e m Autor von Hand und Wort
74
Jean-Marie Le Tensorer
gefiel es, seinem Werk als M o t t o die Meinung voranzustellen, die Gregor von Nyssa gegen Ende des 4. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung in seinem Traktat Uber die Ausstattung des Menschen (Peri kataskeues anthropou) zum Ausdruck brachte: Indem also auf solche Art der Geist durch diese organische Einrichtung in uns die Sprache musikmeistert, sind wir redende Wesen, während wir, wie ich glaube, die Gabe der Sprache nicht hätten, wenn wir die Last und M ü h e des Nahrungserwerbes für das Bedürfnis des Leibes mit den Lippen besorgen müssten. N u n aber haben die Hände diese Leistung auf sich genommen und so geeignet für den Dienst des Wortes den M u n d gelassen. 32
Diese naive und allzu mechanistische Formulierung räumt indes das grundlegende Konzept der Befreiung des Geistes ein; die Heraufkunft des überlegten D e n kens, das aus seinem bio-animalischen Grund hervorsprießt, u m sich bis zu den Gipfeln des Bewusstseins zu erheben. Das Auftreten dieser spirituellen K o m p o nente hat zur Hervorbringung zweckfreier Gedanken gefuhrt, die man als außernatürlich einstufen könnte. Die Kunst ist eines dieser künstlichen Konzepte. Das Hervorsprießen des menschlichen Intellekts, dieser universalen Sprache, spannt ein Band von den Menschen zu den Gemeinschaften, den Kulturen und E p o chen. Kunst ist symbolische Verständigung. Der Faustkeil war schon eine Skulptur, die, zweifellos unbewusst, das Bild des Menschen, dieses aufrechten und symmetrischen Tiers, in sich beschloss. Für uns ist das unbestrittenermaßen eine Kunstform, aber diese Kunst, der noch kein klarer metaphysischer Ausdruck eigen ist, ist vermutlich nur die unbewusste Projektion einer ästhetischen, harmonischen und symbolischen Notwendigkeit in das gestaltete Objekt. Eine neue Schwelle wurde überschritten, als der Mensch damit begann, seine innere Wirklichkeit mit Hilfe graphischer Mittel zu übersetzen. Die Verstofflichung eines Gedankens durch das Ziehen eines Strichs ist der Schrift verwandt. Es ist dies ein Verfahren der Verständigung und Bewahrung der Idee. O h n e das Niveau zu erreichen, das erst mit dem Homo sapiens wirklich werden sollte, vermochten die ersten Menschen seit dem Altpaläolithikum doch, durch die Einfuhrung der Symmetrie und des Harmoniegefuhls in ihre Werkzeuge, den Stoff mitteilsam zu
32 Leroi-Gourhan 1964, I, 40 (dt. 1988, 42). Dt. nach: Unseres heiligen Vaters Gregor, Bischofs von Nyssa, Abhandlung über die Ausstattung des Menschen, nach dem Urtexte übersetzt von H. Hayd, in: Ausgewählte Schriften des heiligen Gregorius . . ., Erster Band, Kempten 1874, 231. Für den griechischen Urtext und die maßgebliche lateinische Ubersetzung siehe S. Gregorii Nysseni De hominis opificio, in: S. P. N. Gregorii episcopi Nysseni opera quae reperiri poturant omnia (Ed. Morell 1638) (Patrologiae cursus completus series graeca; 44 [Migne PG 44], Paris 1863, Sp. 123ff. hier Sp. 151/152: Hoc igitur pacto mente per opificium organicum sermonem in nobis quasi modulante, loquendi facultatem adepti sumus: quo insigni dono carituri eramus, si grave molestumque comparandi hmano corpori pastus negotium labris datum fuisset. N u n c cum id officii manibus obtigerit, nulla ex alia re os occupari necesse est, nisi ut sermonem quam aptissime effingat.
Ein Bild vor dem Bild?
75
machen. Es ist dies eine grundlegende und entscheidende Etappe in der Entstehung der Menschheit. Aus dem Französischen übertragen von Stephan E. Hauser
Abgekürzt zitierte Literatur Groenen 1996 Leroi-Gourhan 1964
Vandenheede 1997
M . Groenen, Leroi-Gourhan. Essence et contingence dans la destinée humaine, Paris und Brüssel 1996. A. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, I: Technique et langage, Paris 1964 (dt. Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst, Frankfurt a. M . 1988). L. Vandenheede, L'art et le corps: Le Module d'or, in: Art & Fact, 16 (1997), 8 5 - 8 8 .
Bildlegenden Abb. 1: Die Entstehung des Menschen, dargestellt nach dem Verhältnis zwischen der Zunahme des Gehirnvolumens (Abszisse = Gehirnvolumen in cm 3 ) und der soziokulturellen Entwicklung (Ordinate = Zeitachse). Man kann im Besonderen feststellen, dass das Volumen des Zerebrums nicht regelmäßig zunimmt, sondern genau auf die Phase, für die wir ein Heranreifen des symbolischen Denkens annehmen, eine merkbare B e schleunigung erfährt (Die Kurve entspricht dem Mittelwert der aus der Vermessung von rund sechzig aus Afrika, Asien und Europa stammenden Schädeln erhobenen Daten, auf der Arbeitsgrundlage mehrerer Autoren, wovon hauptsächlich E. Aguirre, C. Arambourg, L. de Bonis, Y. Coppens, F. C. Clark, Howell, R . E. Leakey, H. de Lumley, J. Piveteau, G. P. Rightmare und P. V. Tobias zu nennen sind). Abb. 2: Faustkeile aus Nadaouiyeh A'in Askar (alte Phase), oben: zwei herzförmige Faustkeile aus der Fazies N a d - E , unten: zwei in eiförmige Scheiben geschlagene Faustkeile aus der Fazies N a d - D (nach Zeichnungen von J . - M . Le Tensorer). Abb. 3: Faustkeile aus Nadaouiyeh Aïn Askar (Fazies N a d - E , Gesamtlänge der Faustkeile: 13,5 cm für die lanzettförmigen, 12,3 cm fur die herzförmigen. Photos Erwin Jagher, Laboratorium für Urgeschichte Basel). Abb. 4: Faustkeile aus Nadaouiyeh Aïn Askar (jüngere darunterliegende Phase), Ubergangsfazies (Lage 7), 1 : gelängt halsmandelförmiger Faustkeil, 2: lanzettförmiger Faustkeil (nach Zeichnungen von J . - M . Le Tensorer). Abb. 5: Faustkeile aus Nadaouiyeh Aïn Askar (junge Phase), Fazies N a d - B (nach Zeichnungen von J . - M . Le Tensorer). Abb. 6: Bilzingsleben. Aus dem Splitter des Schienbeinknochens eines Elefanten gefertigtes Gerät mit parallel geritzten Rillen. Altpaläolithikum (nach D. Mania 1991, Abb. 107). Abb. 7: Bilzingsleben. Geritzter Knochen (nach D. Mania 1991, Abb. 109). Abb. 8: Höhle von Chauvet, Vallon-Pont d'Arc (Ardèche), Abfolge von Nashorn- und Löwendarstellungen (etwa 3 0 0 0 0 Jahre alt). Photos Jean Glottes, Ministère de la Culture et de la Francophonie. Abb. 9: Vogelherdhöhlen (Stetten, Deutschland), Pferdestatuette aus Mammut-Elfenbein (Länge: 4,8 cm). Photo: Laboratorium für Urgeschichte Basel.
ERIK H O R N U N G
„Hieroglyphisch
denken"
Bild und Schrift im alten Ägypten M I T TAFELN
XII-XVIII
Erst vor wenigen Monaten sind die Funde aus einem archaischen Königsgrab auf dem Friedhof U in Abydos in Mittelägypten endlich veröffentlicht worden, nachdem sie schon seit Jahren in den Medien ungewöhnliche Beachtung fanden. 1 Es handelt sich um eine Grabanlage, die in zwölf Kammern unterteilt und mit Ziegeln ausgemauert ist. In den Kammern fand sich eine Fülle von Keramik, wobei die Gefäße zum Teil mit Aufschriften versehen sind. Verschiedene Tiere (darunter Elefant, Skorpion und Falke), Pflanzen und Schiffe, in denen der Ausgräber Günter Dreyer Hinweise auf königliche Verwaltungeinheiten sieht; er glaubt auch schon rein phonetische Zeichen (Schlange für d) zu erkennen, was mir jedoch nicht so sicher scheint. In jedem Fall erhalten wir hier einen Einblick in die Werkstatt des Schrifterfinders, in die Entstehungsphase der ägyptischen Schrift, die sich wohl über die gesamte Naqada HI-Periode am Ausgang der Vorgeschichte erstreckt und zeitlich die letzten Jahrhunderte des 4. Jahrtausends v. Chr. umfasst. Es handelt sich noch nicht um ein entwickeltes Schriftsystem, denn für den gewünschten Zweck, die Herkunft von Wirtschaftsgütern zu kennzeichnen, genügen knappe Symbole: ein Löwe für den König „Löwe", ein Skorpion für den König „Skorpion", eine Pflanze für „Plantage", ein Reiher für den Ort „Buto", usw. Daneben stehen auch schon abstrakte Symbole, so Himmel mit Blitz für „Dunkelheit" und sehr wahrscheinlich für „Westen", wo die Sonne untergeht, während der glänzende Schopfibis den Osten vertritt. Es sind demnach Bilder, die über sich hinausweisen auf eine weitere, symbolische Ebene der Bedeutung. Daneben aber stand man vor der Frage, etwa bei Fremdnamen oder Götternamen, auch das Nichtdarstellbare durch bildhafte Zeichen lesbar zu machen. Das konnte durch eine rein alphabetische Schreibung geschehen, wie sie bei Götternamen immer wieder gebraucht wurde, also z. B. Ptah durch die drei 1 G. Dreyer, U m m el-Qaab I. Das prädynastische Königsgrab U - j und seine frühen Schriftzeugnisse, Mainz 1998. Z u r Chronologie ist zu berücksichtigen, dass Dreyer König Aha und den Beginn der 1. Dynastie sehr früh ansetzt, u m 3150 v. Chr.
„Hieroglyphisch denken"
77
Konsonanten seines Namens p-t-h (Vokale werden in Ägypten ja nicht geschrieben); nach dem gleichen Prinzip ersetzte Echnaton, als er die Tiergestalt der Gottheiten verfemte, im Namen des Horas das Bildzeichen des Falken durch die beiden Konsonanten h und r. Die Hieroglyphenschrift bot von Anfang an die Möglichkeit, auch rein phonetisch zu schreiben, Bild- und Lautzeichen ergänzen sich, und ein solches „gemischtes" System liegt offenbar auch der Schrift der Maya in Mittelamerika zugrunde. Die Funde aus dem frühen Königsfriedhof in Abydos („Dynastie 0", da diese Könige noch vor der 1. Dynastie regierten) haben die alte Frage wieder aufleben lassen, ob die Schrift zuerst in Ägypten oder in Mesopotamien „erfunden" wurde. Diese Frage lohnt eigentlich keinen Streit, denn wir sehen, wie man im späten 4. Jahrtausend in beiden Bereichen mit einer Mehrzahl von Zeichensystemen experimentiert und dabei immer neue Möglichkeiten der Anwendung entdeckt. Die Entstehung der ältesten Hochkulturen ist aufs engste mit der Erfindung von Zeichensystemen und mit der Schaffung von verbindlichen Konventionen für die bildende Kunst (Standlinie, Bedeutungsmaßstab, Proportionskanon) verbunden. Beides gehört zu einem Ordnungs- und Regelsystem, das diesen frühen Kulturen den tragfähigen Unterbau verschafft. Parallel zu den Zeichen, die man als Schrift einstufen kann und die in Mesopotamien auch als Artefakte erscheinen, werden Topfermarken und Steinbruchmarken geschaffen; 2 dazu treten noch die frühen Gauzeichen und die Darstellung der Götter als „Mischwesen" aus Menschenleib und Tierkopf, auch sie ein eigenes Zeichensystem, eine Bildersprache über das Wesen der Gottheiten. 3 In Ägypten gestattet uns die Fülle von Zeugnissen, die wir besitzen, die Entstehung und allmähliche Ausweitung dieser Zeichensysteme besonders klar zu verfolgen (Abb. 1). Entscheidend ist dabei, dass ein Bedürfnis besteht oder aufkommt nach Informationen, welche die bildende Kunst nicht vermitteln kann. Das sind in erster Linie Namen—Namen von Personen, von Gebäuden oder Wirtschaftseinheiten, von Orten und Produkten; es sind Zahlen und Titel und bald auch Jahresnamen zur Einteilung der Zeit. Damit kann der wachsende Strom der Wirtschaftsgüter gelenkt und kontrolliert werden, damit kann aber auch der Name von Königen und Beamten „für die Ewigkeit" des Jenseits konserviert, können Ereignisse in Raum und Zeit eingeordnet werden.
2
W. Helck, Thinitische Topfmarken, Wiesbaden 1990; dazu noch E. C. M van den Drink, C o r p u s and Numerical Evaluation of the „Thinite" Potmarks, in: R . Friedman/B. Adams (Hrsg.), T h e Followers of Horus. Studies dedicated to Michael Allen H o f f m a n , O x f o r d 1992, 2 6 5 - 2 9 6 , u n d E . - M . Engel, Z u den Ritzmarken der 1. Dynastie, in: Lingua Aegyptia, Journal of Egyptian Language, 5 (1997), 1 3 - 2 7 . 3 E. H o r n u n g , Der Eine und die Vielen. Ägyptische Gottesvorstellungen, Darmstadt (1971) 5 1993, 1 0 1 - 1 1 4 .
78
Erik Hornung
Die symbolische Szene vom „Niederschlagen der Feinde", welche den Triumph des Herrschers über alle Feinde anschaulich macht, findet sich bereits in schriftlosem Kontext, wie auch andere Symbole und vor allem Chiffren für das Uberleben jenseits des Todes, mit denen schon vorgeschichtliche Keramik verziert ist. Erst jetzt aber tritt die Dimension der Zeit hinzu. Das reine Bild ist zeitlos, Sprache und Schrift aber sind der Zeit verhaftet. Auf der Grabstele des Königs „Schlange" (1. Dynastie) im Louvre (Abb. 2) gibt eine einzige Hieroglyphe den zeitlichen R a h m e n für dieses Denkmal; und sie lässt den Namen des verstorbenen Königs, in Stein gemeißelt, in die fernste Zukunft hinein dauern. So entsteht Gedächtnis aus Bild und Schrift zugleich. Die Frühzeit, welche die beiden ersten historischen Dynastien umfasst, verfugt bereits über ein Inventar von mehr als 800 Zeichen. 4 Aber ihre Verwendung ist noch äußerst sparsam, sie begegnen nur als kurze Beischrift zu dargestellten Personen oder Bildern, oder als stichwortartige Kennzeichnung von Produkten und Regierungsjahren. Dabei ist jedoch entscheidend, dass von nun an praktisch jedes Bild in der ägyptischen Kunst mit einer Beischrift versehen wird. Neben jeder Darstellung eines Gottes, Königs oder Beamten steht jetzt sein Name — für uns überaus hilfreich, weil wir so die vielen gleich oder sehr ähnlich dargestellten Gottheiten mühelos unterscheiden können. So können Isis und Hathor beide mit Kuhgehörn und Sonnenscheibe auftreten, aber der beigeschriebene Name sagt klar, wer gemeint ist. Und wenn eine solche Darstellung keine Beischrift hat, dürfen wir davon ausgehen, dass sie selber als Schriftzeichen zu „lesen" ist. Der Charakter als Beischrift bestimmt auch die Richtung der Schrift. Während die Kursivschrift auf eine feste Richtung (von rechts nach links) festgelegt ist, kommt es für die Hieroglyphen auf den Kontext an, in den sie gehören, also vorwiegend auf das Bild, dessen Beischrift sie formen. Dabei folgen sie der Anordnung des Bildes, so dass man bei einer Gruppe (etwa der König beim Opfer vor einer Gottheit) mühelos unterscheiden kann, was zu welcher Person gehört (Abb. 3). Man schreibt zunächst nur, was unbedingt notwendig ist; verzichtet wird auf Endungen, auf Präfixe, auf Determinative und auch auf vollständige Sätze. Erst am Ende der Frühzeit ist man soweit, dass man zu ganzen Sätzen und zu fortlaufenden Texten übergeht, die jetzt in Zeilen angeordnet werden (während man Bilder auf eine Standlinie stellt). Einen starken Impuls bildeten dabei die steigenden Ansprüche der Verwaltung und der staatlichen Wirtschaft; Imhotep, der Bauleiter der ersten Pyramide (Stufenpyramide des Djoser in Saqqara), ist auch der erste Schriftsteller, den wir kennen, als angeblicher Verfasser einer Lebenslehre, die nicht erhalten ist.
4 J . Kahl, Das System der ägyptischen Hieroglyphenschrift in der 0 . - 3 . Dynastie, Wiesbaden 1994.
„Hieroglyphisch d e n k e n "
79
Das Alte Reich bringt eine Schriftkultur, die in den Pyramidentexten ihren H ö h e p u n k t findet - ganze Wände in den Pyramiden der späten 5. und der 6. Dynastie werden vollständig mit Texten bedeckt, mit religiösen Sprüchen, die dem Fortleben des verstorbenen Königs dienen sollen. Man bemüht sich geradezu ängstlich, so ausführlich als möglich zu schreiben, eine Konsonantenfolge (etwa n—w) unmissverständlich gleich dreifach zu kodieren und dazu noch reichlich Determinative (dazu gleich) zu setzen, um jeden Zweifel auszuschließen. In der Bilder- und Zeichenfulle, wie sie die Beamtengräber dieser Zeit bieten, k o m m t die Lesbarkeit der Welt auf einen ersten Höhepunkt. In den beschrifteten Pyramiden dominiert die Schrift über das Bild, wie ein zweites Mal in der 26. Dynastie (664—525 v. Chr.), in der noch einmal die bereits uralten Pyramidentexte hervorgeholt werden. Dazwischen aber erfolgt ein Umschlag zurück zum Bild, und ein solcher Paradigmawechsel hat sich mehrfach in der ägyptischen Geschichte ereignet. Schon in den Sargtexten des Mittleren Reiches, welche die Pyramidentexte fortsetzen, finden wir einige beigefügte Illustrationen, und in den Unterweltsbüchern des N e u e n Reiches bilden Text und Bild eine feste Einheit. 5 U m 1000 v. Chr. begegnen dann Papyri, die praktisch nur aus Bildern bestehen, und das Textelement tritt auch auf den Särgen dieser Zeit (21. Dynastie) sehr zurück, bis hin zu bloßen „Scheintexten", die nur noch dekorativ wirken sollen. M a n entdeckt aufs neue, welche Möglichkeiten das Bild gegenüber dem Schriftzeichen bietet. Jetzt fallen auch ästhetische Bedenken, die man früher gegen die Vermischung verschiedener Bildelemente, gegen hybride und geradezu monströse Gestaltungen gehabt hat; man scheut sich nicht länger, Gottheiten mit mehreren Köpfen oder mit Gegenständen (auch mit Hieroglyphen!) an Stelle des Kopfes darzustellen 6 (Abb. 4). Das alte Schlagwort „Vom Bilde zum Buchstaben", mit dem man die E n t wicklung der ägyptischen Schrift kennzeichnen wollte, 7 lässt sich daher in dieser Form nicht halten. D e n n gerade am Anfang dominiert eher das phonetische Element, die genaue Kodierung einer Lautfolge als Ergänzung zum Bild, während später die symbolhaften Möglichkeiten des Bildes und der bildhaften Zeichen stärker genutzt werden. Ein Beispiel gibt der Gottesname Ptah, den man in der älteren Zeit rein phonetisch schreibt (vgl. oben), während die ptolemäische und römische Zeit Zeichen wählen, die zusätzlich symbolische Sinndimensionen
5 Genaueres in E. H o r n u n g , Altägyptische Jenseitsbücher. Ein einführender Überblick, Darmstadt 1997 (engl. T h e Ancient Egyptian Books of the Afterlife, Ithaca und L o n d o n 1999). 6 Z u dieser Entwicklung vgl. meinen Beitrag, Komposite Gottheiten in der ägyptischen Ikonographie, in: C. Uehlinger (ed.), Images as media (Orbis Biblicus et Orientalis; 175), Freiburg/Schweiz und Göttingen 2000, 1 - 2 0 . ' Titel einer postum erschienenen Abhandlung von K. Sethe, Vom Bilde zum Buchstaben. Die Entstehungsgeschichte der Schrift, Leipzig 1939.
80
Erik H o r n u n g
erschließen und Ptah als Schöpfer ansprechen, wenn sie seinen Namen mit Himmel für p, Erde für t und dem sie trennenden Heh-Gott schreiben. 8 Das ägyptische Schriftsystem selber ist darauf angelegt, die Grenze zum Bild immer neu zu relativieren. Es ist keine Bilderschrift im eigentlichen Sinne, aber eine Schrift in Bildern, und kann jederzeit Bilder neu mit einer Lesung versehen und dadurch in Zeichen umwandeln. Einen Extremfall hat Ramses VI. auf Pfeilern seines Grabes verwirklicht. 9 Über den üblichen Götterszenen ist dort ein Fries von Gottheiten angebracht, die auf „normalen", lesbaren Hieroglyphen stehen; dass diese Götterfiguren keine beigeschriebenen Namen haben (wie sonst üblich), deutet daraufhin, dass sie selber zu „lesen" sind. Teils stehen sie direkt für ihren Namen (Amun, Re, Maat usw.), teils auch in übertragener Bedeutung, so der Kriegsgott Month für „stark" oder „siegreich", Onuris oder Schu für „Sohn des Re". So „gelesen", ergeben sie die beiden Kartuschen-Namen des Königs mit ihren Titeln (Abb. 5). Indem man den Namen des Königs mit lauter Götterbildern „schreibt", unterstützt man die erstrebte Vergöttlichung Pharaos - er ist nun auch in seinem Namen ganz und gar ein Gott! Hier werden Bilder neu zu Schriftzeichen, aber jederzeit kann sich auch der umgekehrte Fall ereignen, dass Schriftzeichen zu handelnden und belebten Bildern werden, dass sie z.B. einen schützenden Wedel über Pharao halten oder Opfertiere schlachten; 10 in einigen Fällen geht man so weit, sie wie Menschen mit Schurzen zu bekleiden oder sie mit einem menschlichen Gesicht zu personifizieren (Abb. 6). 11 Deshalb kann man Schriftzeichen als Amulett gebrauchen, wobei das Lebenszeichen Anch auch heute noch gern getragen wird. Ganz allgemein bleibt jede sorgfältig ausgeführte Hieroglyphe im-
s
S. Sauneron, Les prêtres de l'ancienne Egypte, Paris ~1988, 138. E Abitz, Baugeschichte und Dekoration des Grabes Ramses' VI. (Orbis Biblicus et O r i e n talis; 89) Freiburg/Schweiz und Göttingen 1989, 9 1 - 9 4 . Bereits Ramses II. hat in Abu Simbel und Luxor seine Titulatur mit Götterfiguren „schreiben" lassen: E. Drioton, Recueil de cryptographie monumentale, in: Annales du service des antiquités d'Egypte, 40 (1940), 3 0 2 - 3 2 7 , hier: 3 1 5 - 3 2 8 , u n d ders., Les protocols ornamentaux d'Abydos, in: R e v u e d'Egyptologie, 2 (1936), 1 - 2 0 , zu Sethos I. in Abydos. 111 Anch mit Wedel: Baines 1985, flg. 28 (Abydos). Schlachtszene mit den Zeichen Anch, Djed und Uas: W. M . F. Petrie, Antaeopolis. T h e Tombs of Q a u , London 1930, pl. 28. Die Schriftzeichen Anch und Djed bringen mit ihren A r m e n O p f e r zur Scheintür: N . de Garis Davies, Five T h e b a n Tombs, London 1913, pis. III und V. Ein jubelndes Uas bei Baines 1985, fig. 14 (Djoser). 11 Bekleidete Anch, Djed und Uas mit Standarten: Baines 1985, fig. 19 (Abydos). Ein Anch mit menschlichem Gesicht z.B. bei H . H . Nelson, T h e Wall Reliefs, ed. by W. J. Murnane, T h e Great Hypostyle Hall at Karnak, I, 1, Chicago 1981, pl. 65. Ein rundplastisches Uas mit Armen, auf Amenophis II. datiert, befindet sich im Victoria and Albert M u s e u m in London, Inv. 437. 1895, abgebildet bei R . Parkinson, Cracking Codes. T h e Rosetta Stone and Decip h e r m e n t , London 1999, pl. 24. 9
„Hieroglyphisch d e n k e n "
81
mer auch ein Kunstwerk, auf das der Künstler nicht weniger Sorgfalt verwendet als auf die bildliche Darstellung. In älteren Totentexten werden Zeichen in Mensch- oder Tiergestalt häufig verstümmelt, damit sie dem Verstorbenen keinen Schaden zufügen; der Schlangenleib des Sonnenfeindes Apophis wird auch in der Schrift durch aufgesetzte Messer zerstückelt. Es gibt überdies Szenen, in denen Bildmotive durch Schriftzeichen ersetzt sind. So begegnet als vereinzelte Variante zu der häufigen Szene, die den Balsamierungsgott Anubis neben dem einbalsamierten Leichnam zeigt, statt der Mumie ein riesiger Fisch auf der Bahre (Grab des Chabechnet, Theben Nr. 2); dabei ist der Fisch das Schriftzeichen für „Leichnam" 12 . Analog ist der Ersatz der Mumie durch ein Schriftzeichen (Tragsessel), mit dem der Name des Osiris geschrieben wird, auf einem Papyrus in Kairo; 13 hier geht es um die Auferweckung des Osiris durch die Strahlen der Sonne, die von oben auf seine daliegende Mumie fallen. Einen besonderen Reiz der Hieroglyphen bildet ihre Farbigkeit. 14 Kein anderes Schriftsystem orientiert sich so konsequent an der bunten Wirklichkeit um uns und macht von der Möglichkeit Gebrauch, Zeichen allein durch die Farbe zu differenzieren. Das ist z.B. bei den vielen kreisrunden Zeichen der Fall: ein roter Kreis ist die Sonne, ein grüner ein Sieb aus Pflanzenfasern, ein gelber eine Tenne oder ein Brot, ein schwarzer bezeichnet eine Höhle bzw. Loch oder das Nichtsein. Dabei hat sich ein fester Farbkanon herausgebildet, der allerdings von der Farbe des Hintergrundes beeinflusst wird. Bei der Schrifterfindung bemühte man sich um eine möglichst klare Form der bildhaften Zeichen; deswegen werden Auge und Mund in Vorderansicht, Kopf, Arme und Beine in Seitenansicht als Zeichen verwendet, Eidechse und Käfer in Draufsicht. Das konnte zu extremer Stilisierung fuhren, wenn man z.B. dem Hasen überlange Ohren gibt oder bei der Frau im Gegensatz zum Mann die Arme fortlässt. Aus der Fülle an Formen und Möglichkeiten, welche die Natur anbietet, wurde bei der Schrifterfindung eine strenge Auswahl getroffen, wobei klare Erkennbarkeit ein wichtiges Kriterium bildete. Auffällig sind jedoch die vielen Vogelzeichen (etwa hundert), die verwendet werden und in ihrer Ähnlichkeit bereits für ägyptische Schreiber oft schwer zu unterscheiden waren; die arabischen Autoren nennen die Hieroglyphen geradezu „Vogelschrift".
12 Abgebildet z.B. bei I. Gamer-Wallert, Fische und Fischkulte im Alten Ägypten, Wiesbaden 1970, Taf. XVI, 1. Die Szene spricht dafür, dass es sich bei der üblichen Wiedergabe tatsächlich u m die M u m i e und nicht u m einen anthropoiden Sarg handelt. 13 A. Niwinski, Studies on the Illustrated T h e b a n Funerary Papyri of the 11 th and 10 th Centuries B. C. (Orbis Biblicus et Orientalis; 86), Freiburg/Schweiz und Göttingen 1989, 196 Fig. 69; die Szene in der „normalen" Form ibid., Fig. 68. 14 Dazu E. Staehelin, Z u den Farben der Hieroglyphen, in: E. H o r n u n g , Zwei ramessidische Königsgräber: Ramses IV! und Ramses VII., Mainz 1990, 1 0 1 - 1 1 9 .
82
Erik H o r n u n g
A m Beispiel des in Ä g y p t e n i m m e r fünfzackigen Sternes seien die verschieden e n Möglichkeiten aufgezeigt, die es f ü r die V e r w e n d u n g eines Z e i c h e n s gibt. 1 3 Z u n ä c h s t lässt sich der Stern als der dargestellte Gegenstand lesen, also als seba „Stern"; wir sprechen d a n n v o n e i n e m I d e o g r a m m (neuerdings häufig auch L o g o g r a m m ) . M a n k a n n aber auch das V e r b u m seba „lehren, u n t e r r i c h t e n " mit d e m Stern schreiben, der hier z u m Lautzeichen, z u m P h o n o g r a m m wird. Fügt m a n ihn zur alphabetischen Schreibung von seba hinzu, d a n n spricht m a n von e i n e m „phonetischen D e t e r m i n a t i v " , d e n n das „ e c h t e " D e t e r m i n a t i v des Wortes ist der „schlagende A r m " o d e r „schlagende M a n n " . D i e B e z e i c h n u n g D e t e r m i nativ geht auf C h a m p o l l i o n zurück u n d m e i n t Z e i c h e n , die nicht gelesen w e r den, s o n d e r n die Bedeutungsklasse eines Wortes angeben. In dieser V e r w e n d u n g steht der Stern im N a m e n von Sternbildern o d e r einzelnen Sternen w i e d e m Sirius, aber auch in S t u n d e n n a m e n . M i t Hilfe dieser s t u m m e n Z e i c h e n , die i m m e r a m W o r t e n d e stehen, k ö n n e n die vielen W ö r t e r mit gleichem K o n s o n a n tenbestand v o n e i n a n d e r unterschieden w e r d e n . In der ptolemäischen Zeit wird der Stern zu e i n e m der vielen m ö g l i c h e n Z e i c h e n für netjer „ G o t t " , da die G ö t t e r j a w i e die Sterne B e w o h n e r des H i m mels sind; in diesem Falle k ö n n t e m a n von e i n e m S y m b o l o g r a m m sprechen, w i e es ähnlich das Ei als Z e i c h e n f ü r „ i n n e n , befindlich i n " darstellt, o d e r ein leerer R a u m f ü r „ v e r b o r g e n " . Z w e i Sterne n e b e n e i n a n d e r f o r d e r n d e n Scharfsinn des Lesers heraus, d e n n sie sind, mit den beiden möglichen Lesungen des Zeichens, als dua netjer „ G o t t verehren, b e t e n " zu verstehen. U n d schließlich ließe sich der Stern n o c h in verschlüsselter Schreibung verwenden, als K r y p t o g r a m m f ü r d e n K o n s o n a n t e n s. Einzig als Kalligramm ist er nicht belegt, u m z.B. einen u n s c h ö n e n freien R a u m auszufüllen, o h n e irgendeine praktische B e d e u t u n g o d e r L e sung; dazu v e r w e n d e t m a n d e n Füllstrich oder einen Strick. A u f j e d e n Fall sollte damit deutlich sein, welch eine Vielzahl von Aussagen der Ägypter mit e i n e m einzelnen Z e i c h e n verbinden k o n n t e . D i e Fülle der Z e i c h e n stellt uns vor die Aufgabe, sie möglichst übersichtlich zu o r d n e n . Seit Z o e g a (1797, also n o c h vor C h a m p o l l i o n s Entzifferung) teilt m a n sie in S a c h g r u p p e n ein, also M ä n n e r , Frauen, G o t t h e i t e n , Körperteile, Säugetiere, Vögel, usw. D i e e c h t e n Zeichenlisten w u r d e n j e d o c h seit 1832 durch Verzeichnisse v o n D r u c k t y p e n verdrängt, d e n e n h e u t e Verzeichnisse v o n c o m p u tergenerierten Hieroglyphen gefolgt sind. 1 6 Ein Inventar der Z e i c h e n aus v o r p t o lemäischer Zeit ist ü b e r viele Jahre h i n w e g in Basel erarbeitet w o r d e n u n d prak-
1:1 Z u den einzelnen Kategorien von Zeichen vgl. auch L. Depuydt, O n the Nature of the Hieroglyphic Script, in: Zeitschrift fur ägyptische Sprache und Altertumskunde, 121 (1994), 17-36. 16 Z u r Geschichte der Zeichenlisten: J. M . A. Janssen, Remarques sur les listes des signes hiéroglyphiques, in: Chronique d'Egypte, 27 (1952), 8 8 - 9 7 ; E. Winter, Das hieroglyphische
„Hieroglyphisch denken"
83
tisch abgeschlossen. Es umfasst über 1700 distinkte Zeichen mit ihren Formund Färb-Varianten. W i e die bildende Kunst, ist auch die Schrift der Ägypter vom Streben nach Variation und nach neuen Lösungen bestimmt. Deshalb werden bei einer Dreifachsetzung von Determinativen, die den Plural angibt, die Zeichen häufig graphisch oder farblich differenziert, etwa drei ganz verschiedene Fische, Körperteile, Statuen oder Kronen gesetzt. Im gleichen Text kann ein Wort in unterschiedlicher Orthographie auftreten, denn der Schreiber möchte sich möglichst wenig wiederholen. Im Tempel von Esna aus römischer Zeit lassen sich 143 verschiedene Schreibungen für den Namen des dortigen Hauptgottes Chnum nachweisen. 17 Und bis in die jüngsten Phasen der Schrift können jederzeit neue Zeichen geschaffen oder bestehende Formen abgewandelt werden; sogar die römische Quadriga fand noch Eingang in die Hieroglyphenschrift. Aus diesem Willen zur Variation erwächst die Kryptographie, die geradezu eine zweite Schrifterfindung darstellt, 1500 Jahre nach der ersten. Hier werden nur begrenzt neue Zeichen geschaffen, vielmehr vor allem Möglichkeiten verwirklicht, die man bei der ersten Schrifterfindung verworfen hatte. So konnte man den Konsonanten m mit der Katze (miu) oder dem Löwen (mat) schreiben, hatte sich aber für die Eule entschieden (im, der „Klagevogel"); das Adjektiv äa „groß" schrieb man mit der Holzsäule, jetzt aber auch mit dem Esel (iâa), usw. So wirken kryptographische Texte schon äußerlich verfremdet gegenüber den „normalen" Passagen und ziehen dadurch die Aufmerksamkeit auf sich. Bewusste Vieldeutigkeit erschwert die Lesbarkeit, wenn z. B. alle Vogel- oder alle Pflanzen-Zeichen miteinander ausgetauscht werden können. Das steht in bewusstem Gegensatz zu der Eindeutigkeit, die bei der frühen Schrifterfmdung angestrebt wurde, als jedes Zeichen nur eine einzige Lesung erhielt. Die Kryptographie macht dazu von den Möglichkeiten einer symbolischen Ausdeutung konsequenten Gebrauch und nimmt so die Schriftsymbolik der ptolemäisch-römischen Zeit vorweg. Noch bis zu Hadrian und seinem Obelisken zu Ehren des Antinous entwarf man korrekte Hieroglyphen-Inschriften, und die Kenntnis dieser Schrift hielt sich bis über den Sieg des Christentums hinaus. Der alexandrinische Philosoph Horapollon verfasst im 5. Jahrhundert ein Werk über die Hieroglyphen, das immer noch viele korrekte Kenntnisse im Detail verrät, aber überlagert ist von der symbolischen „Erklärung" der Zeichen. 1 8 Ansätze dazu finden sich schon in der
Schriftsystem vor allem der Spätzeit. Stand und Aufgabe, in: Göttinger Miszellen, 14 (1974), 9 f . hat die älteste Liste nachgetragen, die Alexander Gordon bereits 1 7 3 8 aus ägyptischen Denkmälern in England zusammenstellte. 17 S. Sauneron, L'écriture figurative dans les textes d'Esna (Esna; 8), Kairo 1982, S. 59ff. IK Horapollo, Zwei Bücher über die Hieroglyphen, in der lat. Übersetzung von Jean M e r cier nach der Ausgabe Paris 1548, bearb., mit einer deutschen Ubersetzung versehen und
84
Erik Hornung
mythologischen Deutung von Zeichen in der ptolemäisch-römischen Zeit 19 und im Schriftsystem der späten Tempel. Die antiken Autoren geben uns nur Beschreibungen und Erklärungen von Bildzeichen, und diese werden dann in der Renaissance wieder in sichtbare Symbole umgesetzt; es sind, etwa in der berühmten Hypnerotomachia Poliphili, Phantasie-Hieroglyphen, die mit der altägyptischen Schrift nichts zu tun haben (Abb. 7). In der Definition von Alberti sind es signa, nicht literae. Sie dienen auch nur dazu, Ideen und Sentenzen auszudrücken, für wirkliche Inschriften sind sie ungeeignet. Höhepunkt ist das zweibändige Hieroglyphenwerk von Pierio Valeriano, 1556 in Basel erschienen, das nicht eine einzige altägyptische Hieroglyphe enthält, obwohl es die gesamte Hieroglyphenkenntnis zusammenfassen möchte und gerade damals die in R o m noch sichtbaren Inschriften auf ägyptischen Obelisken neue Beachtung fanden. 20 Das Interesse an Hieroglyphen wird jetzt auch von den neuentdeckten Bilderschriften Mexikos und den Berichten der Missionare über die chinesische Schrift gespeist. Aber noch im 17. Jahrhundert werden die phantastischen Neuschöpfungen der Renaissance als vermeintlich echt ägyptische Symbolzeichen weiter kopiert, und der gelehrte Jesuitenpater Athanasius Kircher (1602-1680) bemüht sich nicht nur um Originalinschriften, sondern erfindet ad hoc weiterhin neue „Hieroglyphen". Im 18. Jahrhundert gelten die Hieroglyphen immer noch als Zeugen einer philosophischen Ur- und Universalsprache, deren Erfinder man in Hermes Trismegistos sieht. Hier schien sich ein Weg zu öffnen, vor die Sprachverwirrung am Turm zu Babel zurückzugelangen zu der Sprache, die im Paradies gesprochen wurde und die man im Mittelalter häufig mit dem Hebräischen gleichgesetzt hatte. Jetzt sieht man in den Hieroglyphen Zeugen einer Universalsprache, die allen Völkern gemeinsam ist.21 Durch sie konnten die Ägypter mit den Göt-
kommentiert von H. Weingärtner, Erlangen 1997; vgl. auch H.-J. Thissen, Vom Bild zum Buchstaben - vom Buchstaben zum Bild. Von der Arbeit an Horapollons Hieroglyphika, Akad. der Wiss. und der Liter. Mainz (Abh. der Geistes- und Sozialwiss. Kl.; 3), Stuttgart 1998. 19 E. Iversen, Papyrus Carlsberg Nr. VII. Fragments of a Hieroglyphic Dictionary, Kopenhagen 1958 (1. Jahrh. n. Chr.). 20 Dazu werden auch im Palazzo Te in Mantua (zwischen 1524 und 1535 errichtet und ausgeschmückt) in der Loggia delle Muse „echte" Hieroglyphen verwendet, kopiert von einer beschrifteten Sphinx des Königs Nepherites I.; siehe dazu B. Jaeger, L'Egitto antico alla corte dei Gonzaga (La Loggia delle Muse al Palazzo Te ed altre testimonianze), in: C. M. Govi et al. (Hrsg.), L'Egitto fuori dell'Egitto. Dalla ricoperta all'Egittologia, Bologna 1991, 233-246, und Ders., La Loggia delle Muse nel Palazzo Te e la revivescenza dell'Egitto antico nel Rinascimento, in: Mantova e l'antico Egitto da Giulio Romano a Giuseppe Acerbi, Florenz 1994, 2 1 - 3 9 . 21 Vgl. U. Eco, Die Suche nach der vollkommenen Sprache, München 1994 und den Sammelband The Language of Adam/Die Sprache Adams (Wolfenbütteler Forschungen; 84), hrsg. von A. P. Coudert, Wiesbaden 1999, auf den mich Moshe Idei hinwies.
„Hieroglyphisch denken"
85
tern sprechen (G. Bruno, De Magia), und bei Giambattista Vico (Scienza Nuova Seconda, 1744) ist die erste Sprache hieroglyphisch, die zweite symbolisch, die dritte epistolär. Mit „Hieroglyphisch denken" greife ich ein Stichwort der Romantiker auf, das allerdings letztlich auf Formulierungen bei Plotin zurückgeht (Enneades V 8,5f.). Die Romantiker meinen damit, im „Buch der Natur" zu lesen, das Gott selber verfasst hat; denn, wie Runge in einem Brief von 1802 sagt: „In der Natur offenbart sich hieroglyphenhaft die Handschrift Gottes." Daher ist „die erste Kunst Hieroglyphistik" (Novalis). Die Dinge „sprechen hieroglyphisch" zum Dichter, Kräuter und Blumen sind „Hieroglyphen der Liebe und U n schuld" (Brentano, Godwi), und für Goethe sind Runges Bilder „wahre Hieroglyphen". In der Bibel besitzen wir die verbale Offenbarung Gottes, in der Natur aber eine zweite, unmittelbare Offenbarung, deren Zeichen die Dinge selbst sind. Das war die Meinung, die schon Paracelsus, die Rosenkreuzer und viele Alchemisten vertreten haben und die in der Romantik zu neuer Blüte kommt. Eichendorff hat in seinem Roman Ahnung und Gegenwart (Kap. 3) „das Leben", also die Natur definiert als ein unübersetzbares weitläufiges Hieroglyphenbuch von einer unbekannten, lange untergegangenen Ursprache .. . Da sitzen von Ewigkeit zu Ewigkeit die redseligsten, gutmütigsten Weltnarren, die Dichter, und lesen und lesen. Aber die alten, wunderbaren Worte der Zeichen sind unbekannt.
Ihre Entzifferung (1822 durch Champollion) hat die Hieroglyphen entzaubert und ganz prosaisch lesbar gemacht, aber trotzdem geht noch heute eine ungebrochene Faszination von ihnen aus. Das hieroglyphische Denken feiert eine gewisse Auferstehung in den modernen Verkehrszeichen, die an keine bestimmte Sprache gebunden sind, sondern als echte Bildzeichen für alle Menschen verständlich sein wollen und den Bedürfnissen der modernen Gesellschaft entspringen. Auch dieses neue Zeichensystem wird, wie die Hieroglyphen der Vorgeschichte und der Renaissance, nur für kurze Anweisungen und Sentenzen benutzt, nicht für fortlaufende Texte. Hier hat der Homo Pictor ein neues Kapitel seiner langen Geschichte aufgeschlagen.
Abgekürzt zitierte Literatur Baines 1985
J. Baines, Fecundity Figures, Chicago und Warminster 1985.
86
Erik H o r n u n g
Bildlegenden A b b . 1: G ö t t e r r e i h e v o n e i n e m Schrein T u t a n c h a m u n s . A. P i a n k o f f , T h e Shrines o f T u t A n k h - A m o n , N e w York 1955, Fig. 4 1 (Ausschnitt). A b b . 2: Grabstele des Königs „ S c h l a n g e " , u m 2 9 0 0 v. C h r . B. J. K e m p , A n c i e n t E g y p t . A n a t o m y o f a civilization, L o n d o n 1989, Fig. 10. Abb. 3: „ Z i e r i n s c h r i f t " K ö n i g A m e n e m h a t s III., u m 1800 v. C h r . , m i t n a h e z u s y m m e t r i s c h a n g e o r d n e t e n H i e r o g l y p h e n . Z e i c h n u n g A. B r o d b e c k n a c h H . B r u n n e r , H i e r o g l y p h i sche C h r e s t o m a t h i e , W i e s b a d e n 1965, Taf. 12. A b b . 4: H y b r i d e Gottesgestalt ( A m u n - R e ) aus d e r ägyptischen Spätzeit. N . Shiah, in: Annales d u Service des A n t i q u i t é s d e l ' E g y p t e 41 (1942), 196. A b b . 5: „ S c h r e i b u n g " d e r T i t u l a t u r R a m s e s ' VI. in s e i n e m Grab, u m 1140 v. C h r . F. Abitz, B a u g e s c h i c h t e u n d D e k o r a t i o n des Grabes R a m s e s ' VI., F r e i b u r g / S c h w e i z u n d G ö t t i n g e n 1989, 92. A b b . 6: Personifizierte H i e r o g l y p h e n . T e m p e l S e t h o s ' I. in Abydos, nach: J. Baines, F e c u n d i t y Figures, W a r m i n s t e r 1985, fig. 19. A b b . 7: R e n a i s s a n c e - H i e r o g l y p h e n aus d e r Hypnerotomachia Poliphili, nach: E . Iversen, T h e M y t h o f E g y p t a n d its H i e r o g l y p h s in E u r o p e a n Tradition, K o p e n h a g e n 1961, pl. X I , 3.
H A N N A PHILIPP
Z u r Genese des ,, Bildes " in geometrischer und archaischer Zeit MIT TAFELN X I X - X X I I I
1. Einleitung und zu Massys' Bild „Der Geldwechsler und seine Frau" Trotz aller neuen Möglichkeiten und Aspekte, natürlich auch Verwirrungen und Verführungen durch die sogenannten Medien erfreuen sich Ausstellungen herkömmlicher Art mit an der Wand hängenden Bildern immer noch erstaunlich großer Beliebtheit. Das muss an der Faszination des Einzelbildes liegen, das offenbar auch dem unkundigen Betrachter eine unmittelbare Botschaft bieten kann. Solche Bilder gehörten zur Ausstattung von Kirchen (vor allem Altarbilder), sie hingen in den Räumen der Adelswelt und dann, häufig genug orientiert an eben dieser Adelswelt oder in bewusster Abgrenzung zu dieser, in bürgerlicher Umgebung (z.B. Privathaus, Rathaus, dann Museum usw.). Diese Bilder sind gerahmt, d. h. von der Umgebung ausgegrenzt, haben einen eigenen Bildträger (z.B. Holzpaneel/Leinwand) und geben einen Inhalt wieder, der sich unmittelbar auf seine Umgebung und seinen Auftraggeber beziehen kann (z.B. Kirche); häufig stehen sie aber in einer uns nur mittelbar verständlichen Beziehung zum Auftraggeber, wie er jedoch bis zum 19. Jahrhundert für die meisten Arbeiten anzunehmen ist. Hierher gehört im Grunde auch die Wandmalerei, sofern sie mehr ist als bloße Dekoration (,Tapete'). Sie hat eben die Wand selbst zum Bildträger und Rahmung sowie Format können von der Architektur unmittelbar vorgegeben sein. Natürlich gibt es Bilder, die z.B. ganz vordergründig nur der Repräsentation dienen, deren Inhalte und Darstellungsweisen konventionell sind oder auch besonders beliebte Sujets wiederholen. Auch kann ein Heiligenbildchen als solches auf einen Betrachter eine ganz unmittelbare Wirkung haben, ohne dass es dabei ein Kunstwerk sein muss. Damit sind diese Bilder für die Forschung hochinteressant und u.U. eine wichtige Quelle für unser Verständnis eines bestimmten Zeitabschnittes. Hier soll aber die Rede sein vom Bild als Kunstwerk, vom Bild, das über sich hinaus weist, das eine ihm als Bild immanente eigene Aussage hat, auch wenn genauere Kenntnisse inhaltlicher Details und geschichtlicher Hintergründe das Verständnis in jedem Fall zusätzlich vertiefen würden. Durch die Art seiner gan-
88
Hanna Philipp
zen Gestaltung kann es mehr sein als ein handwerklich gelungenes Artefakt, auch mehr als eine Ansammlung ikonographisch wichtiger ,lesbarer' Details. Für ein solches Bild ist seine Ausgrenzung aus seiner Umgebung bzw. seine Eigenständigkeit, seine Rahmung also, eine wichtige Voraussetzung.1 Ein derartiges eigenständiges Bild ist Quentin Massys' „Der Geldwechsler mit seiner Frau" (Abb. 1). Es beeindruckt zunächst durch die eigenartige Darstellung des Paares.2 Mit dem Rücken parallel zu dem horizontal unterteilten Hintergrund sitzt ein nach vorne gerichtetes Paar, das im Bildaufbau zwei Vertikalen bildet; gleichzeitig entsteht durch die Armhaltung des Mannes ein sich nach vorn öffnender Halbkreis, bei der Frau ein geschlossener Kreis. Überschneidungen finden sich nicht, nur die Stoffmassen der Ärmel überschneiden sich etwas, jenseits der vertikalen Mittelachse. Beide Figuren sitzen also streng getrennt, obwohl sie sich mit den Köpfen stark einander zuneigen. 3 Auch die Blicke des Paares treffen sich nicht, nur die Blickrichtungen durchkreuzen sich im linken unteren Bildfeld: Die Blickrichtung des Mannes, der konzentriert senkrecht nach unten schaut, ist durch die beiden Haltebänder der Waagschalen vor ihm angegeben. Die sehr viel längeren Blickbahnen der Frau fuhren von rechts oben nach links unten zu dem jenseits des Geldhaufens und außerhalb des vom Geldwechsler gebildeten Halbkreises liegenden Dreieck aus wertvollen Ringen, einem kostbaren Glasgefäß und schimmernden Perlen. Dabei wird die Blickrichtung des Mannes durchkreuzt, und zwar ziemlich genau im Angelpunkt der Waage. In dem nach vorne geöffneten Halbkreis der Arme des Mannes liegen zahlreiche Münzen, und in diesen Halbkreis wird auch die Außenwelt (nicht etwa die kostbaren Dinge, auf die die Frau blickt) hineingespiegelt durch einen kleinen runden Spiegel, der seinerseits zumindest formal mit dem schwarzen Stoff (? Leder?), auf dem die Perlen liegen, als eine Art Schmuckstück des Mannes korrespondiert. - Durch die Armhaltung der Frau liegt das Buch vor ihr sozusagen außerhalb ihrer Gestalt, und auch ihr Blick gilt nicht diesem Gegenstand, sondern wie beschrieben den weiter entfernt liegenden Kostbarkeiten in der Bildecke. Die große Spannung dieses an sich stillen Bildes liegt in dem Gegensatz zwischen der im Bild erscheinenden Zu-Neigung der beiden, die doch nur eine äußerliche ist, und dem Nebeneinander zweier Gedankenwelten, das durch die Blickachsen und die weitere Anordnung der beiden Personen im Bild, sprich Komposition, deutlich wird.
1
Selbstverständlich kann hier nicht den Theorien zu der einfachen, aber vielleicht nie erschöpfend zu beantwortenden Frage, was denn ein Bild, was denn ein Kunstwerk sei, nachgegangen werden. 2 Vgl. A. de Bosque, Quentin Metsys, Brüssel 1975, 190f„ Abb. 62. 3 Auch die Haltung der Hände ist jeweils ähnlich, durch die Armfiihrung dennoch deutlich geschieden.
Zur Genese des „Bildes" in geometrischer und archaischer Zeit
89
Für alle über diese Andeutungen hinausfuhrenden Interpretationen - von der farblichen Komposition sowie der Modellierung und Gestaltung des Paares wie der Gegenstände wurde noch gar nicht gesprochen — wäre es natürlich wichtig, mehr zu wissen über die tiefere Bedeutung der Motive - etwa der gesellschaftlichen Einordnung des Geldwechslers, die Konnotationen beim Anblick des Buches, wohl eines Gebetbuches oder Evangeliums, vor der Frau - ihr rotes Gewand .spiegelt' sich bzw. wiederholt sich im roten Mantel der Madonna im Bild vor ihr. Des weiteren wäre es wichtig zu wissen, ob die Tracht der beiden der zeitgenössischen entspricht 4 oder nicht, welcher Schmuck, welche Kleidung standesgemäß war usw. In diesen und anderen Details stecken noch viele, dem Zeitgenossen oder dem Kenner der Zeit verständliche, zusätzliche Botschaften (z.B. die der Inschrift). Derartige in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzende Inhalte machen ein Bild aber noch nicht zu einem Kunstwerk, auch wenn die jeweilige Ausführung der Darstellung von hoher Vorzüglichkeit ist. Ein Kunstwerk mit einer eigenen Botschaft, das also mehr ist als eine Ansammlung von Details welcher Art auch immer, wird diese Darstellung u.a. erst durch die geschilderte eigenartige Komposition mit ihrer Grundaussage über dieses Paar, und in diese Komposition sind die Gestaltung der beiden Personen und der Gegenstände, die farbliche Anlage des Ganzen, sind alle Details und Botschaften eingebettet. Auch die dem heutigen Betrachter unmittelbar zugängliche Aussage des Bildes durch seine formale Komposition wäre in einer weiteren Studie natürlich in Zusammenhang zu bringen mit dem kunstgeschichtlichen sowie allgemeingeschichtlichen Umfeld des Bildes. Dasselbe gälte für die farbliche Komposition. Die Untersuchung ikonographischer Details und komplexer Fragen wie die nach der Wahrnehmung oder nach den Beziehungen zwischen Kunstwerk, Künstler und Betrachter stehen heute meist im Mittelpunkt der Forschung, was wissenschaftsgeschichtlich gesehen verständlich ist, und die Beantwortung bisher nicht gestellter Fragen trägt natürlich zum Verständnis eines Werkes und seiner Epoche neue Einsichten bei. Allerdings droht gerade auch in der Klassischen Archäologie die Vielfalt der neuen Aspekte den Blick auf das Kunstwerk als solches zu verstellen, auch dies eine komplexe und wissenschaftsgeschichtlich ebenso verständliche Entwicklung, nicht nur im Hinblick auf das ,Bild' als Kunstwerk; - unter den vielen erhaltenen Artefakten ragen immerhin einige als Kunstwerke heraus, wenn denn diese umgangssprachliche Trennung der Begriffe noch gestattet ist. Es handelt sich hier offensichtlich um Spätfolgen des Historismus. Zusätzlich hat Mißbrauch der Kunst im .Dritten Humanismus' und im Nationalsozialismus mißtrauisch gemacht gegen eine Identifizierung von edler Form mit angeblich innewohnender Ethik. Schließlich fehlt — im Gegensatz zu
4
H. Belting/C. Kruse, Die Erfindung des Gemäldes: Das erste Jahrhundert der niederländischen Malerei, München 1994, 157.
90
Hanna Philipp
früher — ein allgemeiner Konsens im U m g a n g mit der Kunst der eigenen Zeit, die eigentlich in ganz besonderer Weise zur Auseinandersetzung mit Form und Komposition herausfordern sollte. - Jede Epoche beschäftigt sich mit für sie relevanten Aspekten der Geschichte, und es ist wohl niemandem möglich, alle Aspekte gleichmäßig zu beachten. Dies gilt natürlich auch für die Klassische Archäologie, selbst wenn man sie als alles umfassende Kulturgeschichte versteht. Daher wird immer wieder auch zu prüfen sein, welche Aspekte inzwischen verloren gegangen sind; Ausschließlichkeit kann verhängnisvoll sein. 5 Dennoch ist uns - jedenfalls vorläufig - der Umgang mit dem besonderen, gerahmten, in der Aussage über sich hinausweisenden Bild vertraut. Solche Bilder hat es jedoch nicht immer gegeben. Meyer Schapiro 6 hat darauf hingewiesen, dass es keineswegs selbstverständlich ist, eine Fläche auszugrenzen und für eine Darstellung zu präparieren, wobei Grund und Figur dann eine untrennbare Einheit bilden 7 . Schapiro verweist vor allem auf die Höhlenmalerei, bei der ,natürliche', unbegrenzte Unterlagen - die Felswände — mit Figuren bemalt werden. Auch eine begrenzte Fläche kann ähnlich mit Darstellungen gefüllt sein. Erst die Anerkennung der Begrenzung und deren Integration in die Komposition der Figuren zueinander führt zu dem gesonderten Bild. Formal gesehen ist also die Begrenzung bzw. Ausgrenzung aus der U m g e b u n g ein wesentliches Element für ein Bild; inhaltlich gesehen ist der Wille oder das Bedürfnis entscheidend, etwas Bestimmtes einzeln darzustellen.
2. Die Entstehung des Bildes Aus dem Alten Orient wie aus Ägypten kennen wir Werke der Flächenkunst, Reliefs wie Wandmalereien, letztere insbesondere aus ägyptischen Grabkammern. Diese Arbeiten, als Kunstwerke eigener Art längst gewürdigt, 8 bestehen häufig
5
Hierzu auch H . Philipp, Der Große Trajanische Fries. Überlegungen zur Darstellungsweise am Großen Trajanischen Fries und am Alexandermosaik, M ü n c h e n 1991, 7—11. Z u r heutigen Erforschung der griechischen Vasenmalerei vgl. Kunisch 1996, 4. Dass viel der hier vorgelegten Betrachtungen von den Überlegungen M . Imdahls ausgeht, ist zu evident, als dass es im einzelnen belegt werden müsste. 6 Schapiro 1994, 253 ff. hat auf die Bedeutung des R a h m e n s eines Bildes und der präparierten Bildfläche, gerade auch im Gegensatz zum rahmenlosen Höhlenbild hingewiesen, ist dann aber dem U m g a n g mit dem R a h m e n u n d den „nicht-mimetischen" Elementen auf dem präparierten Bildfeld in der abendländischen Malerei nachgegangen. 7 Schapiro 1994, 255f.: Das gilt nicht zwangsläufig überall, wie die chinesische Kunst bzw. der U m g a n g mit ihr zeigen. 8 Einen Überblick gibt Czichon 1992, 11 ff. u n d 18 ff. - Z u r minoisch-mykenischen Kunst vgl. die treffenden Beobachtungen von J. B. Wohlfeil, Die Bildersprache minoisch-mykenischer Siegel, O x f o r d 1997, 144 f.
Z u r Genese des „Bildes" in geometrischer und archaischer Zeit
91
aus langen, oft in Registern übereinander angeordneten Friesen; } es können aber auch viele Szenen oder Figuren auf einer Fläche gemeinsam dargestellt sein, wobei es sich eher u m eine ,Ansammlung' solcher Darstellungen handelt als u m eine Komposition. Letztere gelingt nur gelegentlich. 10 Immerhin gibt es „Altarbilder" und Stelen, die aus den oben genannten Elementen - begrenzte Fläche, Einzeldarstellung — bestehen. Allerdings ist die Komposition der Darstellung meist nur einfach reihend oder antithetisch aufgebaut. Auch in der griechischen Kunst ist der Umgang mit dem gerahmten Bild im oben beschriebenen Sinne keineswegs von Anfang an selbstverständlich. D e n Weg zu diesem ,Bild' aufzuspüren, mag dem Thema dieses Symposions angemessen sein, auch wenn nicht eigentlich Neues vorgetragen werden wird. Es handelt sich vielmehr um eine resümierende Skizze mancher bisher geäußerter Überlegungen 1 1 und Beobachtungen. Anstößige Vereinfachungen sind im Folgenden unvermeidlich. Einige kurze und allgemeine Bemerkungen seien hier vorausgeschickt: Natürlich teilten sich auch in Griechenland die Benutzer der Kunstgegenstände in mehr oder weniger Wohlhabende, aber eine maßstabsetzende Hofkunst im strengen Sinne, die nur einer kleinen Oberschicht vorbehalten gewesen wäre, hat es, zumindest bis zum Hellenismus, nicht gegeben. So war auch im Prinzip von der Kunst des Schreibens und Lesens niemand ausgeschlossen. Außerdem waren fast alle Werke öffentlich aufgestellt und zugänglich, sei es in öffentlichen Gebäuden, in Heiligtümern oder auf Gräbern. Die Innenausstattung der Häuser war
9 Der Fries ist durch seine R e i h u n g , Fülle und Iteration der Figuren dem O r n a m e n t verwandt, ordnet aber durch eben diese R e i h u n g das Bildfeld im Vergleich zur Höhlenmalerei, wozu auch eine Registeranordnung beitragen kann. Die R e i h u n g der Figuren kann einem Ziel am Ende des Frieses gelten, kann aber auch antithetisch von rechts und links auf einen Mittelpunkt gefuhrt werden, wodurch eine in sich geschlossene Darstellung erzielt werden kann. Da ein Fries jedoch meist eine gewisse Länge hat, also nicht mit einem Blick zu ü b e r schauen ist, ist auch eine übergreifende, komplizierte Komposition schwer durchzufuhren. Eine Analyse z.B. des Nordfrieses vom Siphnierschatzhaus in Delphi (M. B. Moore, T h e Gigantomachy of the Siphinian Treasury: Reconstruction of the Three Lacunae, in: Bulletin de correspondance hellénique, Suppl. 4 (1977), 305fF. Abb. 1 fF.). oder des sog. Großen Trajanischen Frieses (vgl. Philipp s.o. Anm. 5) zeigt die Grenzen. Häufig besteht ein Fries aus Einzelszenen oder einzelnen Gruppen (vgl. in Bassai: Ch. Hofkes-Brukker, Der Bassai-Fries in der u r p r ü n g lich geplanten Anordnung, zus. mit A. Mallwitz, Z u r Architektur des Apollon-Tempels in Bassai-Phigalia, M ü n c h e n 1975), und es bedarf besonderer Geschicklichkeit, Brüche im G e samtablauf zu vermeiden. - Gerade der Vergleich mit dem Fries zeigt die besonderen M ö g lichkeiten eines einzelnen gerahmten bzw. abgegrenzten Bildes, das meist auch mit einem Blick zu überschauen ist. 10
Vgl. Czichon 1992, 186 Taf. 77. Vor allem auf die jüngsten o.a. Überlegungen von N. Kunisch (Kunisch 1996, bes. 59fF.) ist hier für alles Folgende zu verweisen. Immer noch aufschlussreich B. Schweitzer, Die Entwicklung der Bildform in der attischen Kunst von 540 bis 490, in: Jahrbuch des Deutschen archäologischen Instituts, 44 (1929), Berlin und Leipzig 1930, 1 0 4 - 1 3 1 . 11
92
Hanna Philipp
offenbar bis in die klassische Zeit relativ bescheiden, wobei man sich einen gewissen Luxus mit den für ein Symposion nötigen Geräten und Gefäßen leistete. Diese Symposien wiederum hatten einen halb öffentlichen — halb privaten Charakter. Das bedeutet, dass sich Kunstwerke, welcher Art und Qualität auch immer, im öffentlichen Alltag befanden, Teil des öffentlichen Lebens waren. Erst für die Zeit zwischen 600 und 580 v. Chr. haben wir mit dem Giebel des Artemistempels von Korfu eine gerahmte Darstellung, die auch soweit erhalten ist, dass man die Darstellung als ganze nachvollziehen kann. 1 2 Dabei erforderte der Umgang mit der vorgegebenen Dreiecksform natürlich besondere Lösungen. D e m geht nicht nur ein Stück Architekturgeschichte voraus, sondern auch die Entwicklung des gerahmten Bildes überhaupt. Die Reste und Befunde, die wir für die vier Jahrhunderte davor haben, sind äußerst disparat und spärlich. Immerhin ist deutlich, dass wir offenbar spätestens mit dem in die 1. Hälfte des 7. Jahrhunderts datierten ersten Tempel in Isthmia ein Beispiel dafür haben, dass man in dieser Zeit Cellawände großflächig mit Bildern überziehen konnte, wobei für uns in diesem Zusammenhang wichtig ist, dass eine solche Wand dafür in Tafeln, in einzelne Bildfelder also, aufgeteilt wurde; 1 3 man schuf demnach keine umlaufenden Friese, sondern Einzelbilder wie später z.B. an der berühmten Stoa poikile in Athen. 1 4 Nur die Darstellungen selbst in Isthmia kennen wir nicht. Zu erwähnen sind auch die Terrakottaplatten vor allem aus Thermos, die innerhalb eines eigenen aufgemalten Rahmens (aus Rosetten) meist eine einzelne Figur zeigen 1 5 und etwa in das 3. Viertel des 7. Jahrhunderts v.Chr. zu datieren sind (Abb. 5,3). Einzig die Vasen mit ihren Bildfeldern und Verzierungen sind zahlenmäßig so dicht und so kontinuierlich erhalten, dass sie Fragen wie die nach der Entwicklung des ,Bildes' zulassen, zumal bei vielen ihre Qualität so hoch ist, dass „dabei auch ein Uberschuss geistig-künstlerischer Kräfte am Werk gewesen sein muss: eben jener Überschuss, der Handwerk zu Kunst macht". 1 6
1 2 Vgl. G. Rodenwaldt, Die Bildwerke des Artemistempels von Korkyra, Bd. II, Berlin 1939, passim. - J . Floren, Die geometrische und archaische Plastik der Griechen ( = W. Fuchs/ J. Floren, Die griechische Plastik I, 1, Handbuch der Archäologie, München 1987), 1 9 3 f . 1 3 O. Broneer, Temple o f Poseidon (Isthmia I), Pnnceton, N . J . 1971, 3ff. 3 3 f . 1 4 Vgl. auch das Marmormodell eines Naiskos aus Sardis: G. M . A. Hanfmann/ N. H. Ramage, Sculpture from Sardis: the Finds through 1975, Cambridge und London 1978, 43ff. Nr. 7 Abb. 2 0 - 5 0 . 1 5 Hierzu vgl. H. Kahler, Das griechische Metopenbild, München 1949, 28ff. Nach dem erhaltenen Bestand sind auf zwei Platten auch j e zwei Figuren dargestellt: Zwei nebeneinander stehende Frauen bzw. Chelidon und Aedon, die sich gegenüber sitzen; zwischen ihnen, kaum zu erkennen, Itys. Hier verdichtet sich dieses „Gefuge . . . zu einer geschlossenen bildartigen Einheit" (Kahler, 35). 1 6 E. Kunze, Beinschienen (Olympische Forschungen; X X I ) , Berlin und N e w York 1991, 4.
Zur Genese des „Bildes" in geometrischer und archaischer Zeit
93
Für die hier behandelten Fragen seien vor allem zwei Gefäße in den Mittelpunkt gestellt, die im übrigen sehr bekannt und häufig diskutiert sind: die große geometrische Grabamphore 804 im Nationalmuseum von Athen und die archaische Exekiasamphora in Boulogne-sur-Mer mit der Darstellung des Aias. Das geometrische Gefäß wurde auf dem antiken Friedhof Athens im Stadtteil Kerameikos gefunden und hat wohl auf einem Grabhügel gestanden (Abb. 2). 17 Es handelt sich um eine sog. Bauchhenkelamphora mit der beachtlichen Höhe von ca. 1,55 m (max. Dm: 74 cm), die aus Ton auf der Töpferscheibe gedreht und anschließend gebrannt worden ist. Solche Gefäße sind für uns zusammen mit den bis zu drei Meter hohen Dreifüßen aus Bronze die einzigen erhaltenen Zeugen großformatiger Arbeiten geometrischer Zeit, also des 10. bis 8. Jahrhunderts v. Chr. Alles Figürliche ist dabei allerdings kleinformatig, was aber, wie die Gefäße zeigen, nicht etwa an technischem Unvermögen lag - man konnte durchaus große Formate bewältigen. Das Gefäß ist zwar unten analog zu anderen Vasen teilweise ergänzt, aber der Gesamteindruck eines asymmetrisch ovoiden, spannungsvoll ansteigenden Gefäßkörpers ist sicher richtig. Vielleicht verjüngte sich das Gefäß nach unten nicht ganz so stark wie jetzt und war dann etwas weniger hoch. Die Datierung schwankt zwischen .frühes 8. Jh. v. Chr.' und ,kurz vor der Mitte des 8. Jhs.'. 18 Größte Ausdehnung und Höhe verhalten sich in etwa wie 1:2, was auch für das Verhältnis von Hals zu eigentlichem Gefäßkörper gilt, 19 wobei der Hals in seiner ungefähr zylindrischen Form einen starken Kontrast zu der gespannten Wölbung des Gefäßes bildet, auch wenn er sich oben ein wenig erweitert. Der Gefäßaufbau ist deutlich gekennzeichnet: Der Fuß bzw. Ansatz, aus dem sich das Gefäß entwickelt, ist wohl zu Recht ganz schwarz rekonstruiert, wobei die beiden oben umlaufenden hellen Bänder die folgenden Ornamente vorbereiten. Die beiden Henkel weisen auf die stärkste Bauchung des Gefäßes gerade unter ihnen und betonen das ausgesparte Bildfeld, den Halsansatz hingegen kennzeich-
17 Arias/Hirmer 1960, 21 Abb. 4. - Vgl. Homann-Wedeking 1966, 6f. - Simon/Hirmer 1976, 30f. (breite Lit.) Abb. 4. 5 (Detail mit Totenklage). - Wiedergabe der Rückseite: R . Hampe, Die Gleichnisse Homers und die bildende Kunst seiner Zeit, Tübingen 1952, 13 ff. Taf. 1, 3. - Eine äußerst detaillierte Analyse der komplizierten Gestaltung dieses Gefäßes zusammen mit dem Versuch, den Entwurf dafür zu rekonstruieren, wurde von B. Andreae erarbeitet: B. Andreae/H. Flashar, Strukturaequivalenzen zwischen den homerischen Epen und der frühgriechischen Vasenkunst, Poetica, 9 (1977), 217fF. und B. Andreae, Zum Dekorationssystem der geometrischen Amphora 804 im Nationalmuseum Athen, in: G. Kopcke/M. B. Moore (Hrsg.), Studies in Classical Art and Archaeology, A Tribute to Peter Heinrich von Blanckenhagen, Locust Valley, N. Y. 1979, 1 - 1 6 (dort jeweils weitere Lit.). 1S Buschor 1969, 13 Abb. 12: frühes 8.Jh. v.Chr. - Homann-Wedeking 1966, 6: 770 v. Chr. - Arias/Hirmer 1960, 21 und Simon/Hirmer 1976, 30f.: um 760 v. Chr. 19 Genaue Maße sind den o. a. Arbeiten von Andreae zu entnehmen.
94
Hanna Philipp
net nur ein schwarzes Band, während der abschließende Gefaßrand hell-dunkel abgesetzt ist. Das sorgfältig ponderierte Gefäß überziehen schwarzlinige, horizontale O r n a mentbänder, deren ruhige Abfolge das allseitig gerahmte Bildfeld unterbricht. Alles ist sorgfältig aufeinander abgestimmt und nimmt aufeinander Bezug. Die Ornamentbänder selbst sind je durch drei parallel umlaufende schwarze Linien voneinander getrennt und damit ihrerseits gerahmt. Der Eindruck eines ordnenden basso continuo wird dadurch verstärkt, dass jedes zweite Ornamentband gleich schmal und mit demselben Rautenmuster versehen ist. Die anderen O r n a mentbänder variieren in Motiv und Größe voneinander, wobei der Streifen u n ter dem Bildfeld mit einem zweistufigen Mäander der breiteste ist; ihm korrespondiert ein fast ebenso hoher Mäander auf der Gefäßschulter und ein dreistufiger am Gefäßhals. Letzterer wiederum entspricht in seiner H ö h e in etwa der des ausgesparten Bildfeldes. Die hellen zweilinigen Bänder der Mäander sind alle mit kurzen Schrägstrichen schraffiert. Im übrigen ist der einstufige Mäander immer linksläufig im Gegensatz zu den übrigen, was eine rhythmisierte Bewegung in der Horizontalen bewirkt. W i r haben also ein Steigern und wieder Zurücknehmen, ohne dass durch spiegelsymmetrische Abfolgen Monotonie entstünde: so sind die beiden Tierfriese 20 am Hals und die beiden schmalen Mäanderbänder dort nicht im Schema a — b — c - b — a angeordnet, sondern als a - b — c - a - b. Das bewirkt im übrigen, dass jeder große Mäander über einem kleineren steht, wie dies zweimal am Gefäßbauch und einmal am Hals der Fall ist; außerdem begrenzen in dieser Anordnung mehrere Ornamentbänder den Gefäßhals nach oben. Die fragilen, äsenden Tiere würden, höher angebracht, zu sehr ,schweben', die gelagerten Tiere unten scheinen nun wieder auf dem Ansatz der Gefäßschulter zu ruhen. Letztere sind nach rechts gerichtet, bewegen sich aber nach links mit ihren Hälsen zurück, so den Rhythmus der vielen Mäander aufgreifend. Gleichzeitig geht die Bewegungsrichtung nach oben — zur Mitte —, und dem entspricht die nach unten - zur Mitte — weisende Haltung der äsenden Tiere darüber. Die R e i h u n g der Tiere ist gleichmäßig rhythmisiert, was die beiden Friese ganz in das System der Ornamentstreifen einbindet, sie sind also nicht selbständig. Der Darstellung der Lebewesen am Hals entspricht das Figurenbild auf dem Gefäßbauch. Es befindet sich an buchstäblich prominenter Stelle des Gefäßes, knapp über der maximalen Wölbung, und es ist an allen vier Seiten breit gerahmt und durch die seitlichen Henkel zusätzlich akzentuiert. Die dargestellte Szene gibt eine Totenklage (mit Totentanz?) wieder, womit auch die Funktion des Gefäßes — es ist für den Totenkult bestimmt — eindeutig
20
Z u den ersten Tierfriesen in der geometrischen Vasenmalerei s. Buschor 1969, 11.
Z u r Genese des „Bildes" in geometrischer u n d archaischer Zeit
95
festgelegt ist. Zur Beschreibung des Bildes seien die Stichworte, die P. E. Arias gibt, wiederholt: Auf einer Kline mit h o h e n , gedrechselten Beinen liegt der Tote ausgestreckt; sein Antlitz ist nach oben gewandt, der O b e r k ö r p e r ist frontal, Leib und Beine sind im Profil wiedergegeben; hinter dem Toten ist das Leichentuch ausgebreitet, durch dichtes Netzwerk angedeutet. U n t e r der Kline zwei am Boden kauernde Gestalten, die zum Zeichen der Trauer das Haupt mit den H ä n d e n berühren, sowie zwei weitere Figuren, die auf einem h o h e n Hocker sitzen: die erste von ihnen fuhrt nur die linke H a n d an den Kopf, w ä h rend sie mit der rechten ein Zeichen gibt. Rechts von der Kline sieht man sieben stehende Gestalten, von denen die kleinere erste die Kline mit der einen H a n d berührt, mit der anderen die übliche Trauergeste macht. Links von der Kline weitere sieben G e stalten; die beiden letzten halten ein Schwert, das an ihrer Seite hängt, mit der freien H a n d berühren sie das Haupt. Das Geschlecht ist nicht angedeutet; vielleicht sind die am Boden sitzenden Gestalten Frauen; sämtliche Figuren haben einen langen Hals; ihr frontal wiedergegebener O b e r k ö r p e r ist dreieckförmig, die Taille ist stark eingezogen, die leicht gespreizten Beine sind im Profil wiedergegeben. 2 1
Es handelt sich also um eine Reihung vor allem aufrechter Figuren, die die Vertikale betonen und von rechts und links zur gemeinsamen Mitte ausgerichtet sind, welch letztere ihrerseits mit dem Totenbett die Horizontale bestimmt. Schematisierende Spiegelsymmetrie ist hingegen vermieden. Die eigentliche Spannung erhält diese Darstellung aber erst mit ihrer Einbindung in das ganze Ornamentnetz, was ein Vergleich mit der aus ihrer Umgebung herausgelösten Szene (Abb. 4,1) sofort zeigt: Die erhobenen Arme der stehenden Gestalten gehören zur Formel der Klagedarstellung - mehr aber nicht. Im Zusammenhang mit der g a n z e n Gefäßgestaltung scheinen sie jedoch die Fläche fiir diese Szene freizustemmen, wiewohl sie sich zugleich in diese Ordnung fugen: Einerseits sind diese Figuren rhythmisch gereiht wie auch die Tiere am Gefäßhals, ganz den Ornamenten entsprechend, andererseits betonen sie die Vertikale, womit sie sich den horizontal umlaufenden, den Drehungen des Töpfers gewissermaßen folgenden Ornamentbändern widersetzen. Dabei wird die Vertikale durch den zweistufigen Mäander darunter vorbereitet und am Gefäßhals mit dem dreistufigen wiederholt. Auch die seitliche Rahmung der Szene mit den je zwei wiederum in sich gerahmten Mäanderbändern, die die horizontale Rahmung oben und unten zu überdecken scheinen, betonen diese vertikale Ausrichtung: Der so eingebrachte Gegensatz gibt der Szene eine eigene, über sie hinauswirkende Dynamik, zeigt Wucht und Vehemenz der Totenklage. Damit ist die Szene den Ornamenten nicht bloß hinzugefugt oder dient ihnen gar, sondern sie ist als selbständiger, aber dem Ganzen eingeordneter Teil zu verstehen. Wir haben eine innige Verwebung zwischen Gefäß, Ornament und szenischer Darstellung, und schon immer wurde gesehen, dass dieses Gefäß einen
21
Arias/Hirmer 1960, 21.
96
Hanna Philipp
Höhepunkt der geometrischen Vasenkunst darstellt. Nur eine Wiedergabe aller Ansichten und zahlreiche Detailaufnahmen könnten eine annähernd angemessene Würdigung ermöglichen. Es geht um mehr als um hübsche Verzierungen und gelegentlich einige menschliche Figuren. Die Ornamentbänder haben keine gegenständliche Bedeutung, aber mit ihrer wohl ausgesuchten Größe und Ausrichtung, mit ihrer sorgfältigen Plazierung auf dem Gefäß und ihrer komplizierten Korrespondenz untereinander zeigen sie eine durchdachte, komplexe Ordnung, eine Ordnung, in die sich Mensch und Tier fugen, 22 im Bild und in der Tat, denn das Grabgefäß zeigt an, dass man mit viel Aufwand der Ordnung Genüge geleistet hat: Der Tote wurde, wie es sich gehört, beklagt und bestattet und sein Grab deutlich bezeichnet; welche Bedeutung dem zukam, zeigt noch rund 300 Jahre später die Tragödie „Antigone" des Sophokles. Der Tote war vielleicht eine bedeutende Persönlichkeit, und angesichts des kostbaren Gefäßes sicher nicht unvermögend, aber er war ein Bürger der Stadt, nicht etwa ein König. Es erscheint jedoch kein individuelles Bild des Toten, keine individuelle Schmerzbezeugung ist dargestellt, sondern die Trauer und Totenklage, die jedem zusteht; auch dieser Tote ist vor den Göttern und vor den Menschen in eine allgemeine Ordnung eingefugt. Daher kann man hier auch nicht von einem einzelnen isolierten Bild im Hinblick auf die dargestellte Szene sprechen: Das G a n z e ist ein Bild der Ordnung, die darzustellen offenbar so wichtig war. Die klaren schwarzen Linien sind unverrückbar, keine Verkürzungen oder Perspektiven relativieren. Auch die Figuren sind schwarze Silhouetten — unverrückbar gegenwärtig. Im Rahmen dieses Beitrags ist es nicht möglich, auf die Darstellung des Toten und der Totenklage, die bei den Griechen immer wieder eine wichtige Rolle spielte, weiter einzugehen; auch inhaltliche Deutungen wie etwa die der erwähnten Gesten der Klagenden müssen unterbleiben ebenso wie etwa die Beantwortung der Frage, ob die Darstellung der Totenriten denen der Zeit, aus der das Gefäß stammt, genau entspricht. — Auch die dieser Amphora vorangehende Geschichte der Vasenkunst 23 kann hier nicht dargestellt werden. Sie würde zeigen, dass anfänglich die Gefäße, wie bekannt, überhaupt nur sparsam verziert waren, dass einzelne Lebewesen zunächst sporadisch wiedergegeben werden, und zwar keineswegs an bedeutender Stelle des Gefäßes. Ein gelegentlich ausgespartes Bildfeld kann dann mit konzentrischen Kreisen 24 oder einem ,Stück' Mäander 25 (Abb. 5,1), nicht etwa mit menschlichen Figuren gefüllt sein. Solche Bildfelder, gerahmt und aneinandergereiht, fuhren im weiteren Verlauf zu der raffinierten
22 23 24 23
Vgl. auch Homann-Wedeking 1966, 8. Vgl. einen Überblick bei Buschor 1969, 5 ff. - Homann-Wedeking 1966, 5 ff. Z.B. Buschor 1969, Abb. 6. Zur Bedeutung der Mäanderform vgl. Homann-Wedeking 1966, 8.
Z u r Genese des „Bildes" in geometrischer und archaischer Zeit
97
Verbindung von Fries und Bildfeld, 26 die im ,Metopen-Triglyphen-Fries' der Architektur ihre eigentliche .Karriere' haben wird. 27 Erst allmählich kommen einzelne Tierdarstellungen und anschließend auch Tierfriese auf, eingebettet in die Ornamentfriese, sowie zunehmend die Darstellung menschlicher Figuren. Dies alles ist mit großer künstlerischer Kraft bei der hier besprochenen Amphora zu einem Ganzen zusammengefugt. Das wachsende Interesse an der Wiedergabe von Lebewesen, und zwar gleich zahlreicher, fuhrt dazu, dass weiterhin die den Ornamentbändern ja verwandte Friesform häufig dem Einzelbild vorgezogen wird. Damit wird umgekehrt deutlich, wie wenig das Bildfeld der hier erörterten Amphora aus dem Gesamtzusammenhang der ganzen Gefäßgestaltung mit den friesartig umlaufenden Ornamentbändern als selbständiges Einzelbild herausgelöst werden kann, weder formal noch inhaltlich. 28 Wie der Klitiaskrater (Abb. 5,4) 29 zeigt, hat diese Gestaltung durch Friese auch im 6. Jahrhundert v. Chr. noch nicht ihre Gültigkeit verloren. Diese auf geometrischen Gefäßen gegenwärtige ,Ordnung' war aber nicht von Bestand, und vor allem im folgenden 7. Jahrhundert v. Chr. - nach unseren U n terteilungen — müssen aufwühlende Eindrücke und Veränderungen sie ins Schleudern gebracht haben, worauf u.a. auch manche Gefäßgestaltungen schließen lassen. Ein Blick auf eine attische Amphora aus Eleusis (Abb. 5,2) 30 mag dies erläutern: Hier dominieren die Figuren, die Ornamente sind zurückgedrängt, wobei aber die Anordnung der ganzen ,Verzierung' des Gefäßes auch hier dessen Aufbau folgt. Die Hauptszene mit der durch Perseus getöteten Medusa, ihren ihm nacheilenden, von Athene aber aufgehaltenen Schwestern ist als Fries angelegt, jedoch ohne weitere Gestaltung, sondern in einfacher Reihung der Figuren, was aber den Eindruck der temperamentvollen Darstellung keineswegs mindert. 31 Die weit ausholenden, in ihren Proportionen ungebändigten großen Figuren, die über das Zeichenhafte der geometrischen weit hinausgehen, bestimmen den Eindruck.
26
Vgl. Buschor 1969, Abb. 4. 6. 9. Kunisch 1996, 62 hat zu R e c h t betont, wie sehr zu dieser .Bildwerdung' auch die figürliche Verzierung z.B. von Fibelplatten oder Dreifußbeinen beigetragen habe. Allerdings ergeben sich hier vor allem bei den Fibeln Bildfelder sozusagen von selbst, u n d insofern ist wohl die ausdrückliche Freistellung eines Bildfeldes in der Vasenmalerei für die Genese des .gerahmten Bildes' von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 28 S. A n m . 42. 29 Arias/Hirmer 1960, Taf. 40. 41. 30 G. E. Mylonas, H o protoattikos amphoreus tes Eleusinos, Athen 1957. - Arias/Hirmer 1960, Abb. 12. 13. 31 Gewichtet man die Darstellung nach Vorder- und Rückseite (mit Pflanzenranken gefüllt), dann bilden die beiden von Athene aufgehaltenen Gorgonen den Mittelpunkt der D a r stellung. 27
98
Hanna Philipp
Ein gerahmtes Bild im oben beschriebenen engeren Sinne entsteht aber auch auf dem Schulterbild mit dem damals schon konventionellen 3 2 Thema des Tierkampfes nicht. Anders verhält es sich am Gefäßhals mit der Wiedergabe von Polyphems Blendung durch Odysseus und seine Gefährten. Hier bilden Gefäßrand und Henkel einen natürlichen' R a h m e n für die den ganzen Hals ausfüllende Darstellung. Es entsteht nicht der Eindruck eines Frieses bzw. eines Ausschnitts eines solchen, sondern der einer in sich geschlossenen Wiedergabe, und zwar einer ganz bestimmten Szene aus der Odyssee. Das Bemühen, eigens die Dichte des Geschehens wiederzugeben, wird deutlich im Vergleich mit derselben Szene auf dem sog. Aristonothoskrater: 3 3 Die lange R e i h e der tänzelnden Gefährten des Odysseus ist wie ein lockeres Ornamentband gestaltet. Alle weiteren Stufen, wie z. B. die bereits erwähnten Tafeln von Thermos 3 4 (Abb. 5,3) oder das Halsbild der Amphora des Nettosmalers 3 5 seien hier übergangen. Aber anhand eines jüngeren Gefäßes soll noch einmal gefragt werden, was aus der Beziehung von Gefäß, O r n a m e n t und dargestellten Figuren geworden ist. Es handelt sich um die schon genannte schwarzfigurige Bauchamphora 3 6 (Abb. 3 und 4,2). Das Gefäß ist zwar nicht signiert, aber es wird aufgrund seines Stils dem durch Signaturen bekannten Töpfer und Vasenmaler Exekias zugeschrieben und in die Zeit u m etwa 540 v. Chr. datiert, also j e nach Datierung reichlich 200 Jahre später als die zuerst besprochene Grabamphora. Das Gefäß ist mit 45 cm nur ein Drittel so hoch wie diese Grabamphora, es ist stämmig, gedrungen. Die breite Standplatte ist leicht gewölbt, die Vase verjüngt sich stark nach unten bzw. steigt von unten aus einem Strahlenkranz im Kontur zunächst in einer schrägen Geraden auf, die dann die Form einer Kurve annimmt, welche an der Stelle der Schulter nach innen schwingt und weiter zum kurzen Gefäßhals gerade aufsteigt. Der Gefäßrand ist außen nicht gerundet, sondern gerade, also klar im Kontur markiert. Einen deutlichen Absatz zwischen Gefäßkörper, Schulter und vor allem Halsansatz gibt es hingegen nicht. Allerdings ist die Schulterpartie in etwa durch die Position der Henkel bezeichnet und der eigentliche Hals beginnt am oberen Ansatz der Henkel und über dem Palmettenband. Das ganze Gefäß ist schwarz gehalten, bis auf den zur Konvention gewordenen Strahlenkranz über dem Fuß, der selbst einen hellen R a n d hat, und die Fläche für die dargestellte Szene. U b e r der Szene findet sich ein Palmetten-Lotos-Band, das in seiner Leichtigkeit mit dem lichten Strahlenkranz korres-
32
Auch wenn die Gegenüberstellung des Löwen mit einem Eber noch selten ist. Vgl. Arias/Hirmer 1960, Abb. 15. 34 S. o. Anm. 15. 35 Vgl. Arias/Hirmer 1960, Abb. 19. 36 J. D. Beazley, T h e Development of Attic Black-Figure, Berkeley/Los Angeles/London 3 1986, 103 A n m . 29 (ABV 145, Nr. 18). Trotz starker Reparaturen wird der Gesamteindruck von dem ursprünglichen nicht stark divergieren, denn die wesentlichen Partien sind unversehrt. 33
Z u r Genese des „Bildes" in geometrischer und archaischer Zeit
99
pondiert. Ganz anders als bei der geometrischen Amphora 804 fehlen weitere Ornamente. Ebenfalls im Unterschied zu dem geometrischen Gefäß nimmt die helle Fläche der Szene bei der Exekiasamphora etwa ein Drittel der gesamten Gefäßhöhe ein, ohne sich dabei im mittleren Drittel zu befinden, und bedeckt in der Breite die ganze Gefäßhälfte. Diese muss auch die Ansichtsseite sein, denn die andere Seite zeigt nur ein konventionelles Viergespann. Das oben beschriebene Ornamentband beschließt die rote Bildfläche und wird seinerseits oben und unten von je einer dünnen Linie gerahmt, geht seitlich aber nicht über die Bildfläche hinaus, 37 gehört also eigentlich noch zum Bild. Sonst gibt es keine eigene Rahmung, d.h., die schwarze Fläche des Gefäßes als Ganzem mit seinen schwarzen Henkeln bildet den Rahmen. Dabei entsprechen die kräftigen Henkel, der Hals und der breite Gefäßrand oben der schwarzen Masse des unteren Gefäßkörpers. Die Bildfläche wird aber noch in einer anderen Weise von dem Gefäß bestimmt: Die Wölbung des Gefäßes wölbt auch die dargestellten Figuren, was im Prinzip für alle gewölbten Gefäße gilt, hier aber bei der relativ großen Bildfläche deutlicher wird als z.B. bei dem geometrischen Gefäß. Diese Wölbung gibt der Darstellung eine eigene, kaum zu beschreibende und in der Abbildung nicht nachvollziehbare Bewegung. Sie wird dadurch verstärkt, dass die helle Fläche der Veijüngung des Gefäßes nach oben wie in einem Sog folgt, d.h. die konkave Einwölbung aufnimmt. Die Bildfläche selbst ist also unten zunächst konvex, dann oben konkav gewölbt. Diese räumliche Schwingung der Bildfläche wäre unangenehm unterbrochen, würde das Palmetten-Lotos-Band oben rechts und links über die Bildfläche hinausgehend etwaige seitliche Rahmen schneiden. Dargestellt ist die schwarze Masse einer am Boden kauernden menschlichen Figur, links von ihr eine Palme, rechts abgestellte Waffen und Rüstungsteile. Wir finden keine Beifiguren, also keine helfenden Gefährten, keine Götter, die Beistand leisten, keine Tiere wie etwa einen Löwen, auch kein Halsbild mit einem Tierkampf o. ä. Nur diese drei Elemente bestimmen das Ganze der e i n e n Darstellung auf dieser Gefäßseite. Die Palme links nimmt die Wölbung des Gefäßes auf und biegt sich wie bergend der vor ihr kauernden Gestalt zu. Sie zeigt die Einsamkeit der Landschaft und damit die Verlassenheit der Person, zeigt aber auch Leben an, das jedoch hinter dem Kauernden liegt. Die Waffen rechts sind zwar auch auf diesen ausgerichtet (Helm), streben aber gleichzeitig von ihm weg und ergeben ein äußerst labiles Gebilde: Der böotische Schild steht wie an den Bildrand gelehnt, 38 scheint aber wegzurutschen, das Gleiche gilt für den Helm
37 Vgl. die obere R a h m u n g des Bildfeldes auf der geometrischen Vase und schon bei den Gefäßen Buschor 1969, Abb. 9. 10. 38 S. u. Anm. 60.
100
Hanna Philipp
und auch die abgestellten Lanzen. Der Helm mit seinem hohen Busch ragt in die obere, sich verjüngende Bildzone wie auch die Krone der Palme links. Beide neigen sich nach innen, und das Ornamentband rahmt nicht eigentlich, sondern beschließt vielmehr die Szene nach oben. Der am Boden kauernde Mann würde aufgerichtet das Bildfeld, also auch die Palme, weit überragen. Seine Gestalt nimmt jetzt den unteren Bildteil an der Stelle der größten Gefäßausdehnung ein. Er hat seine Rüstung offenbar — ganz unheldenhaft — abgelegt und ist unbekleidet, wenn auch wohl frisiert. Auch seine gekrümmte Gestalt hat nichts von einem großartigen Kouros in ,idealer Nacktheit'. Die Masse seines Körpers erscheint nicht in der Mitte, sondern links im Bild, und diese ,Unwucht' wird durch die Masse der Rüstung im Bild rechts ausgeglichen, denn der Schild ist nicht im Profil, sondern in ganzer Fläche frontal gezeigt. Die Bildmitte nimmt der Kopf des Kauernden ein, vorsichtig akzentuiert, indem der Kopf mit zerfurchter Stirn in der Achse der 6. Palmette liegt, der mittleren von insgesamt elf im oberen Ornamentband. Der Mann drückt mit großer Konzentration ein Schwert vor sich in den kleinen Erdhügel. Chiastisch sind die Belastungen verteilt: Sein Körper lastet auf dem linken, ganz aufgesetzten Fuß, mit dem rechten aufgestellten balanciert er; hingegen bohrt er mit der Rechten das Schwert in den Boden, mit der freien Linken überprüft er sorgfältig dessen Standfestigkeit. Folgt im Rücken der Figur die Palme noch einer weichen Kurve, so begrenzt dieses senkrechte Schwert die Figur nach vorne: Es ist eine kurze, spitze Senkrechte, die einzige Senkrechte in diesem Bild. Danach folgen die völlig labil und schief aufgestellten Waffen, die zu nichts mehr nütze sind, ein geknicktes Tropaion. In dem Augenausschnitt des Helmes erscheint natürlich nicht das lebendige Auge des Kriegers; der Ausschnitt ist vielmehr mit Weiß gefüllt, also leer und blind. Durch die Aufstellung des Schildes ist das Gorgoneion in voller Größe zu sehen, wobei es aber nicht auf einen möglichen Gegner, sondern gegen den Schildträger selbst gekehrt zu sein scheint. Auch jemand, der den dargestellten Mythos nicht kennt, entnimmt der Darstellung ohne weitere Erläuterung, dass hier ein Selbstmord vorbereitet wird: Das Schwert begrenzt nicht nur die Figur im Bild, sondern wird auch das Leben des Dargestellten begrenzen. Die Rüstung gibt zwar zur Person an, dass es sich um einen Krieger mit kostbaren Waffen handeln muss, aber entscheidend ist, dass hier ein Mensch mit seinem unverrückbaren Entschluss zum Selbstmord und in seiner unendlichen Einsamkeit gezeigt ist. Es wird nicht der vollzogene Selbstmord wiedergegeben, sondern die Vorbereitung dazu. Aber nur dadurch können Entschlossenheit und Verlassenheit ausgedrückt werden. Sokrates konnte im Kreis seiner Freunde sterben - er hatte sich entschlossen, sich dem Spruch der Richter zu beugen, aber sein .Selbstmord' war nicht sein eigener originärer Entschluss. Anders auf diesem Vasenbild.
Z u r Genese des „Bildes" in geometrischer und archaischer Zeit
101
Der antike Betrachter wusste natürlich, dass hier der Selbstmord des Aias gemeint ist,39 dass das Schwert ein Geschenk des Hektor war; aber er konnte auch sehen, dass hier nicht ein Mythos illustriert wird, sondern dass der Mythos zum Anlass wird, etwas ganz anderes zu zeigen: Einen Menschen, der aus welchen Gründen auch immer die Konsequenz zum Selbstmord zieht. Nicht im Wahnsinn handelt er, sondern ganz klaren Sinnes — das deuten seine Konzentration und sorgfältige Vorbereitung, aber auch schon seine wohl geordnete Frisur an. Der Vasenkünstler Exekias arbeitet mit zu seiner Zeit üblichen Mitteln, d.h., er verwendet die schwarzfigurige Vasenmalerei, die die Perspektive nicht kennt, und er bedient sich des inzwischen selbstverständlich gewordenen, ausgesparten großen hellen Bildfeldes auf dem ansonsten schwarzen Gefäß. Das bedeutsam andere ist, dass er nicht wie üblich den bereits in sein Schwert gestürzten Aias darstellt, sondern den entscheidenden Moment davor. Mit diesem Motiv, und zwar in der beschriebenen Komposition, kann Exekias mehr zeigen als die Illustration eines Mythos oder einer Vorbereitung zum Selbstmord. Dargestellt ist die fürchterliche Einsamkeit und Leere, die in tragischer Weise einen Menschen umgibt, der sich mit aller Klarheit und Konsequenz zu einem solchen Tun entschlossen hat. Es handelt sich nicht um eine negativ zu bewertende Vereinsamung, sondern um eine für dies Handeln notwendige, selbstgewählte Einsamkeit. 40 Entstanden ist ein Bild, das nach Form und Inhalt selbständig ist (Abb. 4,2). 41 In der künstlerischen Gestaltung sind zwar, wie beschrieben, Bild und Gefäß aufeinander bezogen, aber Gefäß und Ornament sind letztlich als Rahmen zu verstehen, die dem Bild als Bild dienen. Daher genügt es offenbar, das Bild nur mit dem einen genannten Palmetten-Lotos-Fries zu begrenzen, während sich auf der geometrischen Amphora das Bildfeld durch breite Rahmung an allen vier Seiten mit den gleichbedeutenden Elementen aus Gefäß und dem übrigen System der Ornamentbänder auseinandersetzen muss. Bei Exekias ist das Gefäß zum Bildträger geworden und tritt als eigene Form zurück. Hingegen bilden bei der geometrischen Amphora Gefäß, Ornamente und Darstellung eine gleichgewichtige Einheit, 42 wodurch eindrucksvoll eine alle und alles umfassende vorhandene Ordnung dargestellt und festgehalten wird. In einer weiterführenden Betrachtung wäre nach der Bedeutung dieser Ordnung für die geo-
39
Vielleicht stand sein N a m e auf der jetzigen Fehlstelle der Vase über seinem Kopf. In den Aufsätzen des von A. u n d J. Assmann herausgegebenen Sammelbandes „Einsamkeit", Archäologie der literarischen Kommunikation, VI, M ü n c h e n 2000, wird zwar i m m e r wieder auf Äußerungen antiker Autoren zu diesem T h e m a eingegangen, aber das Kapitel „Einsamkeit in der Antike" wäre wohl noch zu schreiben. 41 Auf der Rückseite der Vase ist, wie gesagt, nur eine konventionelle, belanglose Wagenszene dargestellt. 42 Mit klagenden Figuren auf der Rückseite und unter den Henkeln, bestimmt dieses T h e ma ,friesartig' das ganze Gefäß, auch wenn Vorder- und Rückseite deutlich auseinander zu halten sind. 40
102
Hanna Philipp
metrische Zeit zu fragen, nach der damaligen Beurteilung nicht nur des Selbstmordes, sondern auch, wie die Möglichkeiten freier Entscheidungen eines Menschen, wie die Gestaltungsmöglichkeiten seiner eigenen Geschichte bzw. seiner fortwährenden Eingebundenheit in den Willen der Götter verstanden wurden. Rückblickend lassen sich die formalen Schritte zur Genese des ausgegrenzten Bildes erkennen: Das Freisetzen einer eigenen Bildfläche innerhalb der Gefäßverzierung, zunächst ornamental, dann mit menschlichen Gestalten oder Tieren gefüllt; das Schwinden der Ornamente zugunsten des nun alles dominierenden figürlichen Bildes, dem alles übrige untergeordnet sein kann. Für die Botschaft der geometrischen Amphora wird das ganze Gefäß benötigt, bei der Exekiasamphora nur das eine Bild. — Zwischenstufen wurden hier ausgelassen,43 aber die beiden beschriebenen Beispiele lassen erkennen, welchen Weges es bedurfte, um das einzelne, inhaltlich und formal selbständige Bild schaffen zu können. Auch die weitere, keineswegs geradlinige Entwicklung soll hier nicht dargelegt werden. Es dürfte dennoch deutlich sein, dass sich in diesem Werk des Exekias eine wichtige Weichenstellung für alles, was wir später unter dem .abendländischen Bild' verstehen, abzeichnet.
3. Literarische Quellen Literarische Quellen zu Werken der bildenden Kunst sind in dieser frühen Zeit rar, was nicht nur an der unvollständigen Uberlieferung liegt, sondern auch daran, dass es offenbar kein Bedürfnis zu Reflexionen, wie wir sie kennen, gab. Als Möglichkeiten des Gestaltens und des Ausdrucks bestanden bildende Kunst, Dichtung und auch Tanz und Musik wie selbstverständlich und ohne theoretisches Hinterfragen nebeneinander. Werke der jeweiligen Gattungen müssen sich nicht gegenseitig illustrieren, sondern können ganz Verschiedenes gestalten. So wiederholen die homerischen Gesänge zunächst einmal Geschichten aus mythischen und heroischen Zeiten, auch wenn sie Allgemeingültiges und menschlich Wirkliches, also Gegenwärtiges wiedergeben. Das Grabgefäß hingegen gehört in die Gegenwart des damaligen Betrachters und stellt Ordnung dar, eine Ordnung, die auch dem Toten, nicht einem mythischen Heros, sondern einem Zeitgenossen gilt, selbst wenn er durch den Totenkult seinerseits heroisiert sein sollte. Aber auch die homerischen Gesänge sind von einer festen Ordnung getragen: Die Figuren haben alle ihren genauen Platz, klar umrissene Eigenschaften mit immer wiederkehrenden Epitheta. Die Handlungen sind sinnvoll miteinander ver-
43
So w u r d e auch nicht auf die Veränderungen in der Kompositionsweise der frühen Bildfelder eingegangen; hierzu z.B. I. Scheibler, Die symmetrische Bildform in der frühgriechischen Flächenkunst, Kallmünz 1960.
Zur Genese des „Bildes" in geometrischer und archaischer Zeit
103
schränkt, ihre Abfolgen in einem komplizierten Bezugssystem ineinander geschachtelt. Vor allem W. Schadewaldt 44 und jetzt wieder U. Hölscher 4 5 haben sich damit auseinandergesetzt. 46 Die Schilderungen bei H o m e r wirken auf uns sehr anschaulich und lebensvoll, gerade auch im Vergleich mit den geometrischen Vasen. Diese Anschaulichkeit wird u.a. durch die berühmten homerischen Vergleiche 47 erzielt: „Aias und Hektor stürzen sich wie fleischverschlingende Löwen oder mächtige Eber aufeinander" (Ilias VII 2 5 6 - 2 5 7 ) . Genaugenommen wird der jeweilige Held mit seinem Z o r n also gar nicht beschrieben, er wird nicht bleich oder ist zorngerötet, sein Gesicht verzieht sich nicht usw. Auch die Tiere werden in ihrer Wirklichkeit nicht genauer geschildert. Aber durch die N e n n u n g der Tiere ist für den Hörer die Macht bezeichnet, mit der gekämpft wird und die bei Mensch und Tier gleich ist. So wird auch die Totenklage auf der Vase nicht weiter ausgemalt, denn für jeden, der sie sah, war mit den chifFrenartigen Figuren und den O r n a menten alles, was dazu gehört, die der O r d n u n g entsprechende Totenklage, das Aussehen der Klagenden, ihre Klagerufe, das Schweigen des Toten, benannt. Insofern wurde ein Gefäß wie die geschilderte geometrische Amphora für den Betrachter in ähnlicher Weise .anschaulich' wie für den Hörer die Gestalten des Homer. Tierkampfszenen finden sich dann auch auf jüngeren Vasen wie z.B. auf der erwähnten Amphora aus Eleusis (Abb. 5,2). Sie können u. a. auch die Bedeutung solcher Vergleiche aufnehmen: Der Tierkampf auf diesem Gefäß kann für die Wucht und die Macht der darüber auf dem Gefäß dargestellten Auseinandersetzung mit dem auch noch in seiner Trunkenheit gewaltigen Polyphem stehen. Einen direkten Bezug zu einem Werk der bildenden Kunst haben wir in der berühmten Schilderung des von Hephaistos für Achill hergestellten Schildes im XVIII. Buch der Ilias (V 468ff.). H o m e r beschreibt dort die Herstellung eines Schildes, der mit konzentrisch umlaufenden, figurengefüllten Friesen verziert wird, wie wir dies in der Tat von
44
W. Schadewaldt, Iliasstudien, Leipzig 1938. Hölscher 1989. Vgl. auch die Studien von H. Patzer, Die Formgesetze des homerischen Epos, Frankfurt 1996, m. Rez. von E . - R . Schwinge, G n o m o n , 71 (1999), 487£F. 46 Zu den Studien von Andreae und Flashar s. o. Anm. 17. 47 Zu Gleichnis, Vergleich usw. vgl. B. Snell, Die Entdeckung des Geistes: Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen, Göttingen 4 1975, 178ff. 311 m. Anm. 25 (weitere Lit.angaben). - Diese Vergleiche haben nichts mit einer etwaigen H ö h e r bewertung des Tieres oder seiner Vermenschlichung zu tun; zum Problem s. H. Rahn, Tier und Mensch in der homerischen Auffassung der Wirklichkeit, Darmstadt "1968 passim; ders., Rez.: U. Dierauer, Tier und Mensch im Denken der Antike, Amsterdam 1977 in: G n o m o n 51 (1979), 713fF. - Zur möglichen Vorgeschichte solcher .Gleichnisse' vgl. die Überlegungen von B. Borell in: B. Borell/D. Rittig, Orientalische und griechische Bronzereliefs aus Olympia (Olympische Forschungen; XXVI), Berlin 1998, 122 m. Anm. 96. 45
104
Hanna Philipp
zwei, wenn auch jüngeren Bronzeschilden des 7. Jahrhundert kennen 48 , und wie dies als Motiv vor allem auf phönikischen Schalen vorkommt, die etwa aus der Zeit Homers stammen. Von diesen könnte er sogar angeregt worden sein, sie sind für uns jedenfalls die nächsten deutbaren Vorbilder.49 Zwei Eigentümlichkeiten der homerischen Beschreibung sind in unserem Zusammenhang wichtig: Die beschriebenen Figuren rufen, reden, lachen, singen, wie dies eine verbale Schilderung beschreiben kann, nicht aber eine bildliche Darstellung. Das zweite ist, dass zwar Vorgänge - ein Streit, ein Krieg - beschrieben werden, aber ohne dass die jeweiligen Handlungen zu Ende geführt würden, 50 - gemäß der Tatsache, dass im Bild jeweils nur ein Augenblick, aber nicht der Ablauf einer Begebenheit bis zu ihrem Ende dargestellt werden kann, es sei denn, man addiert viele Szenen — zu einem Fries, zu einem Film. Der Dichter trägt also hier der Tatsache Rechnung, dass er eine bildlich geformte Darstellung beschreibt, aber bei den rufenden, redenden Figuren scheinbar nicht. Natürlich wusste auch damals ein Grieche, dass eine bildliche Darstellung ,bloß' eine Darstellung ist.51 Aber offenbar spielte das keine bestimmende Rolle für den Umgang mit Werken der bildenden Kunst. Vielmehr ist zu folgern, dass Darstellungen — für uns befremdlich - offenbar in einer Weise unmittelbar wirkten, dass man beim Betrachten z.B. auch eine Totenklage, wie oben schon angedeutet, mit-hörte. Und von daher ist Homers Beschreibung des Schildes nicht ,falsch' in unserem Sinne, sondern sie impliziert die Reaktion des respektiven Betrachters. Gerade wegen dieser Unmittelbarkeit genügen offenbar auch die knappen Formulierungen auf den geometrischen Gefäßen. Sie waren insofern für den damaligen Betrachter nicht weniger anschaulich als homerische Beschreibungen. Man könnte von einer gewissen Distanzlosigkeit von Betrachter und Darstellung sprechen. Diese Distanzlosigkeit bedeutet aber eine unmittelbare Wirkung des Dargestellten, was dann für die bildende Kunst der archaischen Zeit, für die Vasenbilder wie vor allem auch für die Plastik eine große Rolle spielt. Diese Unmittelbarkeit hat nichts mit Magie und Zauberei zu tun und ist vielleicht für uns am ehesten nachvollziehbar an der Art, wie z.B. Diktatoren die Wirkung von Bildern fürchten bzw. für sich nutzen, oder am Zögern, etwa das Photo der Großmutter zu zerreißen und wegzuwerfen. 52
48
Vgl. E. Kunze, V. Olympiabericht über die Ausgrabungen in Olympia, Winter 1941/42 und Herbst 1952, Berlin 1956, 4 6 - 5 0 . Taf. 12-14. 49 Zu dem ganzen Fragenkomplex vgl. demnächst H. Philipp, XAAKHAATA. Figürlich ausgeschnittene Bronzebleche und Schildzeichen archaischer Zeit in Olympia (Olympische Forschungen; XXX), Berlin-New York, u.a. zu Kat. Nr. 29 (im Druck). 50 Hierzu Philipp 1968, 13 ff. 51 Schon das häufig wiederholte ev 8s. . .7ioir|CTE o. ä., mit dem jeder neue Abschnitt auf dem Schild eingeleitet wird, macht deutlich, dass es sich um ein Kunstwerk handelt, dessen Herstellung beschrieben wird. 52 Gadamer 1986, 144.
Zur Genese des „Bildes" in geometrischer und archaischer Zeit
105
In der späteren 1. Hälfte des 6. Jahrhunderts wird die Beschreibung des Heraklesschildes des sog. Pseudohesiod entstanden sein, die an der homerischen orientiert ist, aber bezeichnende Abweichungen aufweist. Davon interessiert hier ein Detail: An mehreren Stellen (V. 189. 194. 209. 215. 228. 244) wird von einer beschriebenen bildlichen Darstellung auf dem Schild gesagt, sie sei ,wie lebendig'. Damit wird einerseits deutlich betont, dass es sich ,bloß' um einen bildlich existierenden Vorgang oder um eine Figur handelt. Andererseits wird gesagt, die Darstellung sei so gut, dass sie die Qualität des ,wie lebendig' habe. 53 Pseudohesiod war kein besonders bedeutender Dichter, aber gerade die Beiläufigkeit seiner Formulierung zeigt doch wohl, dass er eine schon bekannte, zu seiner Zeit schon manchem gültige Erfahrung mitteilt - dass eine Darstellung eben ,wie lebendig' wirken kann. Das heißt, dass sich eine Distanz zur Darstellung entwickelt hat, die nun ein bewusstes ,wie lebendig' zur Charakterisierung der Qualität herausfordert. Zwischen Betrachter und Objekt schiebt sich ein trennendes ,als ob'. Dies ist, wie gesagt, sicher keine Erfindung dieses mediokren Dichters, sondern war offenbar schon manchem Denker selbstverständlich und bedeutet einen wichtigen Schritt im „immer differenzierter werdenden Bildbewusstsein", wie H.-G. Gadamer es nannte 54 . Dass diese Äußerung bei Pseudohesiod keine zufällige Formulierung ist, bestätigen außerdem fragmentarisch erhaltene Betrachtungen des Heraklit und des Xenophanes. Beide Philosophen sind jünger als Pseudohesiod, 53 aber gerade das zeigt, wie langwierig solche Prozesse sind und wie sehr solche Fragen doch manche beschäftigten. Selbstverständlich muss aber die große Menge der Bevölkerung nicht sofort daran teilgenommen und gewohnten Vorstellungen entsagt haben. Heraklit (5 D) mokiert sich darüber, dass die Leute Statuen anbeten: Das sei, als ob man mit Häusern — toten Wänden — schwätze. Sie erkennen nicht, was Götter und Heroen eigentlich seien. Dahinter lauert die Frage, ob der Dargestellte der Dargestellte sein kann; ist der Kouros auf dem Grab der Verstorbene? — H. G. Niemeyer 56 hat jüngst gefragt, ob nicht in diesem Moment, da diese unmittelbare Gewissheit in Frage gestellt wird, das Porträt nötig und möglich wird. Es ist hier nicht der Ort, allen sich daran anknüpfenden Problemen wie ,Bild — Abbild', auch nicht solchen der ,Mimesis', 57 nachzugehen. Aber es ist
53
Hierzu Philipp 1968, 13 ff. S. Anm. 52. 55 Der |iaxQÖßio Die Belege bei F. Puttkammer, Q u o m o d o Graeci victimarum carnes distribuerunt, Diss. Königsberg 1912, 21 f.; mehr Graf 1985, 4 0 f .
Der Eigensinn der Götterbilder in antiken religiösen Diskursen
231
wie der Kniefall vor dem Bild, die 7tgoax Vgl. A. M . Haas, Kunst rechter Gelassenheit. T h e m e n und Schwerpunkte von Heinrich Seuses Mystik, 2. durchgesehene u n d verbesserte Auflage, Bern 1995, 204. 36 P. Florenskij, Die Ikonostase. Urbild und Grenzerlebnis im revolutionären Russland, Stuttgart 1988; ders., Die umgekehrte Perspektive. Texte zur Kunst (übers, und hrsg. von A. Sikojev), M ü n c h e n 1989. 37 J.-L. Marion, Idol und Bild, in: B. Casper (Hrsg.), Phänomenologie des Idols, Freiburg und M ü n c h e n 1981, 1 0 7 - 1 3 2 . 38 Vgl. zu den beiden das Referat von Hergenröder 1996, 3 8 5 - 4 0 9 . 34
Bildresistenz des Göttlichen
297
Die am 8. November 1453 abgeschlossene Schrift De visione Dei des Nikolaus von Kues ist aus einer Diskussion mit verschiedenen theologisch und monastisch orientierten Partnern über den Vorrang von Gefühl (affectio) oder Intellekt (;intellectio) in der theologia mystica entstanden, was in diesem Zusammenhang sowohl die mystische Vereinigungserfahrung selbst wie die über sie angestellte R e flexion meint. 3 9 Oberflächlich gesehen geht es um eine Frage der mystischen Psychologie. Wer genauer zusieht, merkt aber sehr bald, dass es dem Kusaner darum geht, an der „Grenze der Sichtbarkeit" 4 0 „auf dem Wege der Erfahrung" (experimentaliter) in „die Leichtigkeit der mystischen Theologie" und „in die allerheiligste Dunkelheit (Gottes) hineinzugeleiten". 41 Dabei benutzt der Kardinal „ein optisches Potential", 4 2 das sich allem Gesehenen, vor allem aber visuell wahrnehmbaren Artefakten als „Horizont des Unsichtbaren" 4 3 eingeschrieben findet. Mit anderen Worten: Er benutzt als Vehikel seines experimentierenden Umgangs mit der unio mystica ein Bild, das auf nahezu technisch vollkommene Weise dazu hinfuhren soll. Das Bild, das zum „Vorauskosten" des „Mahls der ewigen Seligkeit" (praegustare, 5 [1,12]) vermitteln soll, ist ein in der bildenden Kunst des 15. Jahrhunderts modisches ikonographisches Sujet, das Antlitz eines den Betrachter aus dem Bilde heraus anblickenden All-Sehenden (imago cuncta videntis), hier identifiziert mit der Vera icon des Christusantlitzes. 44 Mittels dieses Bildes will er seine Adressaten, die Mönche des Klosters Tegernsee, „auf menschliche Weise zum Göttlichen zu erheben" versuchen (5 [2,1]); er tut dies nicht, ohne entsprechende Gebrauchsanweisungen zu geben. Die an der mystischen Theologie interessierten Mönche haben sich so um die Ikone herum aufzustellen, dass jeder die mit Erstaunen zu quittierende Beobachtung machen muss, dass die Ikone zugleich alle und jeden einzelnen anblickt. D e n n die Vorstellungskraft des im Osten Stehenden fasst es keineswegs, dass der Blick der Ikone in eine andere Gegend gerichtet ist, nämlich nach Westen oder Süden. Dann mag sich der Bruder, der im Osten stand, nach Westen begeben; und er wird erfahren, dass der Blick so auf ihn im Westen gerichtet ist, wie vorher im Osten. U n d da er weiß, dass die Ikone befestigt und nicht verändert worden ist, wird er über die Veränderung des unveränderlichen Blicks staunen. U n d geht er, den Blick immer auf die Ikone heftend, von Westen nach Osten, so wird er erfahren, dass der Blick (visus) der Ikone immerzu mit ihm weitergeht. U n d
3 9 A. M . Haas, D e u m mistice videre . . . in caligine coincidencie. Z u m Verhältnis Nikolaus' von Kues zur Mystik, Basel und Frankfurt am Main 1989, 15; vgl. auch Hopkins 1985, 6.
B o e h m 1997, 2 8 7 . Nikolaus von Kues, D e visione Dei. Das Sehen Gottes. Deutsche Übersetzung von H. Pfeiffer, Trier 1985 (Nikolaus von Kues, Textauswahl in deutscher Übersetzung; 3), 5 (hinfort Seitenangabe im Text in Klammer). Den lateinischen Text gebe ich wieder nach Hopkins 1985, 1,2; 1,9f. (Textverweise hinfort in eckiger Klammer im Text). 4 2 B o e h m 1997, 2 8 6 . 4 3 B o e h m 1997, 2 8 6 . 4 4 A. Neumeyer, Der Blick aus dem Bilde, Berlin 1964; A. Stock, Die R o l l e der ,icona Dei' in der Spekulation ,De visione Dei', in; Haubst 1989, 5 0 - 6 2 . 40 41
298
Alois M. Haas kehrt er vom Osten nach Westen zurück, wird er ebenfalls ihn nicht verlassen. Er wird darüber staunen, wie er sich auf unbewegliche Weise bewegt. Auch seine Vorstellungskraft (imaginatio) wird es nicht fassen können, dass er sich ebenso mit einem anderen bewegt, der ihm in entgegengesetzter Bewegung entgegen kommt. Und wenn einer, der dies erfahren will, während er sich von Westen nach Osten begibt, einen Mitbruder unter Hinschauen auf die Ikone von Osten nach Westen gehen heißt und er den Entgegenkommenden fragt, ob der Blick der Ikone sich jeweils mit ihm umdrehe, und wenn er hört, dass er sich ebenfalls in entgegengesetzter Richtung bewegt, wird er ihm glauben müssen. Würde er ihm nämlich nicht glauben, würde er nicht fassen, dass dies möglich ist. So wird er durch die Mitteilung des ihm Berichtenden zu dem Wissen kommen, dass jenes Angesicht (fadem) keinen von allen, die in Bewegung sind, auch in entgegengesetzten Richtungen verlässt (6f. [3,7—4,10]).
Die entscheidende Erfahrung bei diesem Experiment ist die Wahrnehmung, dass der Blick des Alles-Sehenden „niemanden verlässt" u n d „so aufmerksam für einen j e d e n Sorge trägt, als ob er sich allein u m den, der erfährt, dass er angeschaut wird, u n d u m keinen anderen kümmere, und zwar so sehr, dass auch von keinem, den er anblickt, begriffen werden kann, dieser trage auch für einen anderen Sorge. Er wird auch so gesehen, dass dieser so die aufmerksamste Fürsorge gegenüber d e m geringsten Geschöpf hegt, als sei es das größte u n d das gesamte Weltall. Von einer solchen sinnlichen Erscheinung her, vielgeliebte B r ü der, habe ich vor, euch durch eine bestimmte Ü b u n g der Frömmigkeit (praxim devotionis) zur mystischen Theologie zu erheben" (7 [4,15ff.]). Die spirituelle Voraussetzung dieser Frömmigkeitsübung ist die darin mögliche Verdeutlichung der göttlichen visio absoluta45, des göttlichen Auges, d e m nichts entgeht, dessen Sehen allem menschlichen Sehen voraus ist. Meister Eckhart (f 1328) hatte einst als mystisches Gesetz seiner Erfahrung formuliert: Daz ouge, da inne ich got sihe, daz ist daz selbe ouge, da mich got sihet: min ouge und gotes ouge daz ist ein ouge und ein gesiht und ein bekennen und ein minnen.46 Diese Einsicht nimmt der Kusaner zum methodischen Prinzip seines Experiments: Das nach Gott ausschauende A u ge wird immer schon u n d tiefer von d e m göttlichen Auge angeblickt, das nicht nur schauendes Auge, sondern Leben spendendes Prinzip alles Seienden ist. Menschliches Sehen ist je schon von Gott gewirktes Sehen u n d signalisiert daher den „Sinn-Grund alles Erscheinenswerten" (13 [14,7]). In diesem ,Sehen von Angesicht zu Angesicht' geht es also u m den absoluten Seinsgrund von allem; Sehen ist Leben (spenden u n d empfangen), ist Selbstoffenbarung Gottes in seiner Seinsgnade. Die Ü b u n g besteht darin, den göttlichen Blick „immer durchdringender" (15 [19,4]) wirken zu lassen, so dass die „absolute F o r m " als in die
43 W. Beierwaltes, Visio Absoluta. Reflexion als Grundzug des göttlichen Prinzips bei Nicolaus Cusanus, Heidelberg 1978 (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wiss., Phil.-Hist. Kl. 1978, 1. Abt.), 21 ff. (der creative Aspekt dieser visio). 46 Meister Eckhart, Deutsche Werke, Predigten, I, hrsg. von J. Quint, Stuttgart und Berlin 1958, 201, 5 - 8 .
Bildresistenz des G ö t t l i c h e n
299
Unendlichkeit vermittelndes „Angesicht der Angesichte" (16 [19,12,21]) sichtbar und erfahrbar wird. Wer in dieses Angesicht sieht, erblickt darin immer schon und wieder seine eigene Wahrheit; Nikolaus behauptet sogar in Form eines von Gott selber gesprochenen Bedingungssatzes: „Sei du dein, und Ich werde dein sein!" (21 [26, 15f.]) — denkbar ist diese Formel nur im Hinblick auf deren Grundvoraussetzung: „Dein absolutes Angesicht ist das natürliche Angesicht, das die absolute Seiendheit jedes Seins ist, die Kunst und das Wissen alles Wissbaren!" (21 [26,1 ff.]). 47 Der Kusaner holt den schon bei Gregor von Nyssa angetroffenen Gedanken der letztlichen Undurchschaubarkeit Gottes in sein Konzept hinein, indem er mit Nachdruck auf die trotz aller sichtbaren Schönheit durchherrschte Rätselhaftigkeit dieses Antlitzes verweist: In allen A n g e s i c h t e n w i r d das A n g e s i c h t der A n g e s i c h t e verhüllt u n d im .Rätsel g e schaut'. E n t h ü l l t aber w i r d es n i c h t geschaut, solange m a n n i c h t ü b e r alle A n g e s i c h t e hinaus in eine A r t g e h e i m e s u n d v e r b o r g e n e s S c h w e i g e n eintritt, w o es kein Wissen (scientia) u n d k e i n e n B e g r i f f (conceptus) eines Angesichtes gibt. Das D u n k e l (caligo), d e r N e b e l , die Finsternis o d e r U n w i s s e n h e i t , in die d e r gerät, d e r D e i n A n g e s i c h t sucht, w e n n er alles W i s s e n u n d j e d e n B e g r i f f übersteigt, ist n ä m l i c h derart, dass m a n D e i n A n g e s i c h t diesseits n u r verhüllt f i n d e n k a n n . E b e n das D u n k e l aber enthüllt, dass d o r t ein A n g e s i c h t ist ü b e r aller V e r h ü l l u n g (18 [22,1 ff.]).
Es geht um einen Überstieg über alle denkbaren Vermittlungsgrößen - der Kusaner redet später sogar von einem ,Sprung' über die „Mauer der Absurdität" (35 [50,6]) — die Mauer des Paradieses48 - in die coincidentia oppositorum — und ins dionysische Paradox der ,überlichten Finsternis' Gottes, in „das unsichtbare Licht" (19 [22,20]). Man wird nicht fehlgehen, wenn man die theologia mystica im Sinne des Cusanus als experimentell über diese Bildkonstellation arrangierbare Erfahrung des paradoxen ,Ineinsfalls der Gegensätze' versteht: So erfahre ich, dass ich in die Finsternis eintreten, ü b e r j e d e s F a s s u n g s v e r m ö g e n des Verstandes hinaus d e n Ineinsfall d e r G e g e n s ä t z e z u g e s t e h e n , u n d d o r t die W a h r h e i t suc h e n muss, w o U n m ö g l i c h k e i t b e g e g n e t . U n d - jenseits dieser, a u c h ü b e r j e d e n h ö c h s t e n Aufstieg d e r Einsicht hinaus - w e n n ich gelangt sein w e r d e zu d e m , was j e d e r E i n sicht u n b e k a n n t ist u n d was j e d e Einsicht als ganz e n t f e r n t v o n der e r k e n n b a r e n W a h r h e i t b e u r t e i l t - d o r t bist D u , m e i n G o t t , der D u absolute N o t w e n d i g k e i t bist. U n d j e m e h r diese m i t D u n k e l b e d e c k t e U n m ö g l i c h k e i t als finster u n d als u n m ö g l i c h e r k a n n t wird, desto w a h r e r l e u c h t e t die N o t w e n d i g k e i t (necessitas) auf, desto w e n i g e r verhüllt ist sie g e g e n w ä r t i g u n d n ä h e r t sie sich (28 [38,1 ff.]).
47
Vgl. Biser 1970, 8 7 - 9 0 . Vgl. R . H a u b s t , D i e e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e u n d mystische B e d e u t u n g der , M a u e r der K o i n z i d e n z ' , in: H a u b s t 1989, 1 6 7 - 1 9 1 ; A. M . Haas, N i k o l a u s ' v o n K u e s A u f f a s s u n g v o n der Paradiesesmauer. K o n z e p t i o n u n d H e r k u n f t eines D e n k m o t i v s , in: S. H a r t m a n n / U . M ü l l e r (Hrsg.), J a h r b u c h der O s w a l d v o n W o l k e n s t e i n Gesellschaft, 9 ( 1 9 9 6 / 9 7 ) , 2 9 3 - 3 0 8 . 48
300
Alois M . Haas
Im selben Maße Erfahrung sich hier prädisponieren lässt, im selben Maße ist sie auch hineinzuführen in die sie übergreifende Indisposition grundsätzlicher Dunkelheit.
• Das Paradox, das den Titel unserer Überlegungen tragen sollte, ist — im Blick auf die behandelten Autoren — nicht auflösbar oder zu eliminieren: Die helldunkle Finsternis begleitet alle Versuche, die prinzipielle Nichtdarstellbarkeit Gottes zu überwinden. Jedes Paradox führt in ein neues. Alle Sichtbarkeiten und alle „hochwillkommene(n) Gleichnisse" (19 [23,5]) treten für den Kusaner in j e n e Dunkelheit ein, die „enthüllt, dass dort ein Angesicht ist über aller Verhüllung" (18 [22,7]: esse fadem super omnia velamenta). Diese Versicherung, dass U n sichtbares nur über Sichtbares, im Sichtbaren aber Unsichbares sichtbar werden kann, ist das letzte Wort einer Mystik, die um die Schwierigkeit eines endlichen Zugangs zum Unendlichen weiß. Sie stellt letztlich ein Plädoyer dar für die Produktivkraft des Gedankens, der sich von der Vorstellung nährt, dass die wahre Ikone Gottes wahrhaft Mensch geworden ist, aber von der Abbildhaftigkeit Gottes im Menschen 4 9 her es nicht wagt, schlichte Bezugslinien zum unendlichen Gott hin auszuziehen, 50 selbst wenn an sich die Menschwerdung Gottes - Christus ist „das Ebenbild Gottes" (2 Kor 4,4)! — eine solchen Bezug nahelegen würde. Gerade die ,Frommen' haben eine eigentliche Scheu, Gott über eine allzu verdinglichende Wahrnehmung festhalten zu wollen: „Ein Bild, das die Differenz zwischen sich und Gott nicht sichert, gehört zermalmt." 3 1 Es bleibt also dabei: D e m Fluss und Druck der Bilder gegenüber ist mit letzter Sicherheit resistent nur Gott als der Nicht-Definierbare und Unerkennbare. Völlige Definierbarkeit und überdeutliche Bildhaftigkeit ohne Transzendenz ins Gegenteil ist die Hölle. So jedenfalls hat Johannes Scotus Eriugena im fünften Buch von De divisione naturae im 9. Jahrhundert sie definiert: Die Hölle ist kein Ort mit konkreten Peinigungen (Feuer, Pech, etc.), sondern wir sind uns die Hölle mit unseren inneren Bildern die uns terrorisieren, malträtieren und belästigen. Wenn die m e diale Bilderwelt, welche in ihrer Big Brother-Funktion das Auge Gottes tendenziell zu ersetzen droht, 5 2 langsam aber sicher immer allgegenwärtiger wird, dann
G. Kruhöffer, Der Mensch als Bild Gottes, Göttingen 1999, 46. H. Eising, Bild Gottes ohne Gottesbild, in: W. Heinen (Hrsg.), Bild - Wort - Symbol in der Theologie, Würzburg 1969, 3 5 - 5 4 . 3 1 E. Nordhofen, Der Fromme hat kein Bild. Ikonoklasmus und Negative Theologie, Stuttgart 1990, 19. Vgl. von dems., Der Engel der Bestreitung. Ü b e r das Verhältnis von Kunst und negativer Theologie, Würzburg 1993. 3 2 C. Havelange, D e l'œil et du monde. U n e histoire du regard au seuil de la modernité, Paris 1998. 49
50
301
Bildresistenz des Göttlichen
ist die Überlegung des irischen Gelehrten aus dem 9. Jahrhundert beherzigenswert: In der Erkenntnis, dass alle Bilder menschlich und daher hinfällig sind, ist auch einsehbar, dass im Moment, wo sie uns zur Hölle werden sollten, ihre Schwäche am offensichtlichsten ist.
Abgekürzt zitierte Literatur Barasch 1 9 9 8
M . Barasch, Das Gottesbild. Studien zur Darstellung des U n s i c h t b a ren, M ü n c h e n 1 9 9 8 .
Besançon 1994
A.
Besançon,
L'image
interdite.
Une
histoire
intellectuelle
de
l'iconoclasme, Paris 1 9 9 4 . Biser 1 9 7 0
E . Biser, T h e o l o g i s c h e
Sprachtheorie
und H e r m e n e u t i k ,
München
1970. B o e h m 1997
G. B o e h m , S e h e n . H e r m e n e u t i s c h e R e f l e x i o n e n , in: R . Konersmann
B o h m 1996
T. B ö h m , T h e o r i a Unendlichkeit Aufstieg. Philosophische Implikatio-
(Hrsg.), Kritik des Sehens, Leipzig 1 9 9 7 , 2 7 2 - 2 9 8 . nen zu De vita Mosis von G r e g o r von Nyssa (Supplements to Vigiliae Christianae; 3 5 ) , Leiden 1 9 9 6 . Boespflug 1 9 9 8
F. Boespflug, Apophatisme théologique et abstinence figurative. Sur r„irreprésentabilité" de D i e u (le Père), in: R e v u e des Sciences religieuses, 7 2 ( 1 9 9 8 ) , 4 4 6 - 4 6 8 .
Finney 1 9 9 4
P. C . Finney, T h e Invisible G o d . T h e Earliest Christians on Art, N e w York und O x f o r d 1 9 9 4 .
Harder 1 9 5 6
Plotins Schriften, übersetzt von R . Harder, B d . I, H a m b u r g 1 9 5 6 .
Haubst 1 9 8 9
R . Haubst (Hrsg.), Das S e h e n Gottes nach Nikolaus von Kues. Akten des Symposions in Trier vom 2 5 . bis 2 7 . S e p t e m b e r 1 9 8 6 (Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft; 18), Trier 1 9 8 9 .
Hergenrôder 1 9 9 6
C . Hergenröder, W i r schauten seine Herrlichkeit. Das j o h a n n e i s c h e Sprechen vom S e h e n i m H o r i z o n t von Selbsterschliessung Jesu und Antwort des M e n s c h e n , Würzburg 1 9 9 6 .
Hopkins 1985
J . Hopkins, Nicholas o f Cusa's Dialectical Mysticism. Text, Translation, and Interpretative Study o f D e visione D e i , Minneapolis 1 9 8 5 .
Lange 1 9 9 9
G. Lange, Bild und Wort. D i e katechetischen Funktionen des Bildes in der griechischen T h e o l o g i e des sechsten bis n e u n t e n Jahrhunderts, Paderborn u. a. ( 1 9 6 9 )
PG 44
2
1999.
Gregoriu episkopu Nysses ta heuriskomena panta (Patrologiae cursus completus, Series Graeca; 4 4 ) , ed. J . P. M i g n e , Paris 1 8 6 3 .
P G 150
Gregoriu archiepiskopu Thessalonikes, tu Palama ta heuriskomena panta (Patrologiae cursus completus, Series Graeca; 150), ed. J. P. Migne, Paris 1 8 6 5 .
PL 38
Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi opera omnia,
tomus
quintus, pars prior (Patrologiae cursus completus, Series Latina; 3 8 ) , ed. J. P. Migne, Paris 1 8 4 1 . Tristan 1 9 9 6
F Tristan, Les premières images chrétiennes. D u symbole à l'icône, Pans 1 9 9 6 .
V
PETER BLOME
Die imagines maiorum: ein Problemfall römischer und neuzeitlicher Ästhetik MIT TAFELN X L - X L V I I
Die imagines maiorum werden im Folgenden nicht einmal mehr aus althistorischer Warte betrachtet, nur soviel: Der Begriff ius imaginum, zu Deutsch etwa „das Recht, Ahnenbilder zu besitzen", scheint als kodifizierter Rechtstitel im alten R o m so nicht existiert zu haben. Die Wendung geht nicht auf das römische Recht, sondern auf T h . Mommsen zurück, allenfalls auf Gelehrte des 16. Jahrhunderts. Berufen kann man sich höchstens auf Cicero Verres 5,14,36, der von einem ius imaginis spricht als Privileg eines curulischen Magistraten, sein Bildnis öffentlich aufzustellen. Das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage ändert freilich nichts an der Existenz der Sache selbst: Die römische Nobilität, ob patrizisch oder plebeisch, ist nicht zuletzt eben dadurch definiert, dass die zu ihr gehörenden Familien Ahnenbilder in großer Zahl besaßen. Zweite Vorbemerkung: Mit Grab und Jenseits haben die imagines maiorum nichts zu tun; sie spielten bei Zeremonien am oder im Grab nicht die geringste Rolle; es sind auch keine magischen ,survivals', wie man immer noch lesen kann. 1 Die imagines maiorum sind, auf den kürzesten Nenner gebracht, völlig rational und kalkuliert eingesetzte gentilizische Propaganda- und Legitimationsinstrumente. Sie werden deshalb bezeichnenderweise in den Atrien der vornehmen Häuser aufbewahrt und vor allem bei den großartigen Trauerkondukten der vornehmen Familien öffentlich zur Schau gestellt. Die Rechnung ist sehr einfach: Je mehr imagines ein Clan vorzeigen kann, um so größer ist seine Reputation. Die imagines sind ein wichtiger Indikator der Position einer gens im fein austarierten und äußerst sensiblen Machtpoker der republikanischen Oberschicht. Das ist alles längst bekannt und vielfach kompetent dargestellt.2 Was hier interessiert, ist vielmehr die Frage nach dem Aussehen, der bildlichen Eigenart und
Von Schlosser 1993, u.a. 5 2 f . , 6 9 f . ; vgl. auch das Nachwort von T h . Medicus, 138fF. Umfassende Bibliographie bei Flower 1996, 3 6 2 - 3 9 2 . Auswahl: T h . M o m m s e n , R ö m i sches Staatsrecht, I , Leipzig 3 1 8 8 7 , 4 4 2 - 4 4 7 ; F. Börner, Ahnenkult und Ahnenglaube im alten R o m , Leipzig 1943; Drerup 1980; G. Lahusen, Zur Funktion und R e z e p t i o n des römischen Ahnenbildes, R ö m i s c h e Mitteilungen, 9 2 (1985), 2 6 1 - 2 8 9 ; E. Flaig, Die Pompa Funebris, in: O. G. O e x l e (Hrsg.), M e m o r i a als Kultur, Göttingen 1 9 9 5 , 1 1 5 - 1 4 8 . 1
2
306
Peter Blome
der W i r k u n g der Ahnenbilder. Es geht also — d e m T h e m a des Colloquiums angemessen — u m die Ästhetik der imagines maiorum, die durchaus auch ein P r o dukt des homo pictor darstellen. Ich werde dabei ziemlich weit über die römische Antike hinausgreifen, auch dies ganz im Sinne der „Colloquia R a u r i c a " , die nicht n u r das interdisziplinäre, sondern auch das interchronologische Fragen z u m Ziel haben. Daher d e n n auch der Titel: Die imagines maiorum: ein Problemfall römischer u n d neuzeitlicher Ästhetik. Als Ausgangspunkt eignet sich am besten Plinius naturalis historia 35,2,6. 3 Als Kontrast z u m Porträtverständnis seiner eigenen, flavischen Zeit, das er scharf kritisiert, k o m m t er auf die Zustände der guten alten Zeit zu sprechen: Aliter
apud maiores in atriis haec erant, quae spectarentur;
aut marmorn:
expressi
tarentur gentilicia funera,
cera vultus semperque
singulis
disponebantur
dejuncto
aliquo
non signa externorum armariis,
ut essent
totus aderat familiae
artißcum
imagines,
nec aera
quae
eius qui umquam
comifuerat
populus.
Anders war es bei unseren Ahnen in den Vorhallen zu sehen: keine Bilder fremder Künstler und nicht Bronze oder Marmor; die aus Wachs modellierten Gesichter waren in einzelnen Schränken verteilt, u m Bilder zu haben, welche die Leichenbegängnisse edler Geschlechter begleiteten, und bei j e d e m Verstorbenen war stets die ganze Schar der Familie, so groß sie jemals gewesen war, zugegen.
Entscheidend fiir uns sind drei Begriffe, nämlich «ra/Wachs, vultus/Gesieht und imago/Bild, Abbild, Bildnis. Die A h n e n der zur römischen Nobilität gehörenden Familien w u r d e n in F o r m von wächsernen Gesichtern in den Atrien aufbewahrt u n d bei den Leichenzügen mitgeführt. U m gleich zu Beginn einer hartnäckigen Fehlinterpretation entschieden entgegenzutreten: Wächserne imagines sind keine Totenmasken u n d auch nicht sekundäre U m f o r m u n g e n von solchen, ja imagines sind überhaupt keine Masken, wie i m m e r u n d i m m e r wieder behauptet wird, leider auch in der umfassenden Monografie von Harriet Flower Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture (1996). 4 Die imagines stellen den Verstorb e n e n als Lebenden dar, als rundplastisches Porträt aus d e m Werkstoff Wachs, ja das Material Wachs ist so entscheidend, dass imagines synonym schlicht cerae genannt werden k ö n n e n . Ich kann das Wortfeld von imago nicht in extenso aufrollen, m ö c h t e aber die früheste bezeugte Verwendung in der römischen Literatur bei Plautus heranziehen, zumal Plautus das Wort in einer Zeit verwendet, in der die altrepublikanischen pompae funebres in höchster Blüte standen. In seinem Amphitruo, aufgeführt zwischen 200 u n d 190 v. Chr., verwandelt sich der Gott M e r k u r in das Ebenbild des Sklaven Sosia. Sosia steht n u n fassungslos vor seinem Doppelgänger u n d sagt 4 5 9 / 6 0 : 5
3
Übersetzung nach R . König und G. Winkler (Hrsg.), C. Plinius Secundus d. Ä., Naturkunde, Buch 35, Farben, Malerei, Plastik, München 1978. 4 Flower 1996, 32fF„ 59. 3 Ubersetzung nach Binder/Ludwig 1976.
Die imagines maiorum: ein Problemfall römischer und neuzeitlicher Ästhetik Nam quisque
hicquidem
omnem
mortuo faciet
imaginem
meam,
quae antehac fuerat,
possidet.
Vivo ßt,
quod
307 numquam
mihi.
Denn der hier besitzt meine ganze Gestalt, die sonst die meine war. Mit mir als Lebendem wird gemacht, was keiner j e mit mir nach meinem Tode machen würde.
Sosia verweist hier implizit auf die Leichenzüge der Patrizier, bei denen die nobiles in ihrem Ebenbild erscheinen, eben in ihren imagines. Die Pointe liegt natürlich darin, dass Sosia als Sklave es niemals zu einer imago nach dem Tod bringen wird, dafür paradoxerweise jetzt zu Lebzeiten. Sosia, bzw. Plautus, tut uns den Gefallen und präzisiert, was er unter „omnem imaginem meam" versteht, wenn er 441 ff. sagt: 6 Certe edepol,
quom
quem ad modum itidem
habet petasum
sura, pes, statura, malae, mentum,
illum contemplo
et formam
ego sum (saepe in speculum ac vestitum:
tonsus,
cognosco inspexi),
tarn consimilest
oculi, nasum
meam, nimi' similest
atque
mei
ego;
vel labra,
barba, collus: totus. Quid
verbis
opust?
Wahrlich, wenn ich ihn so anseh und in allem meine eigene Gestalt erkenne, die ich oft im Spiegel sah, so ist er mir auch gar zu ähnlich: H u t und R o c k trägt er ganz gleich wie ich; Fuss, Wade, Haltung, Haar, Nase, Augen, Lippen, Wangen, Kinn, Bart, Hals - ganz gleich! Was braucht's noch mehr?
Es ist evident: imago bezeichnet hier weit mehr als nur das Gesicht; gemeint ist die ganze Gestalt des Merkur, der als Spiegelbild, als Double auftritt. Realität und Fiktion sind kaum mehr auseinanderzuhalten: Sosia und seine imago sind austauschbar. Die imago ist auf Täuschung angelegt, muss in allem lebensecht wirken. Wenn wir diese imago-Bedeutung vom Lustspiel auf die Ahnenbilder übertragen, so heißt dies nichts anderes, als dass auch diese möglichst wirklichkeitsnah, lebensecht, ja zum verwechseln ähnlich ausgesehen haben müssen. U n d genau diesen Eindruck haben die imagines maiorum den Betrachtern auch vermittelt, wie uns die berühmte Polybios-Stelle anzeigt, wobei wir hier auf eine - allerdings zu lösende - Schwierigkeit stoßen. Polybios weilte von 167 bis 150 v. Chr. in R o m und hat dort prachtvolle pompae funebres mit eigenen Augen gesehen, er gibt in Buch 6,53 folgenden Bericht: 7 Wenn in R o m ein angesehener Mann stirbt, wird er im Leichenzug in seinem ganzen Schmuck nach dem Markt zu den sogenannten rostra, der Rednertribüne, geführt, meist stehend, so dass ihn alle sehen können, nur selten sitzend. Während das ganze Volk ringsh e r u m steht, betritt entweder, wenn ein erwachsener Sohn vorhanden und anwesend ist, dieser, sonst ein anderer aus dem Geschlecht die Rednertribüne und hält eine R e d e über die Tugenden des Verstorbenen und über die Taten, die er während seines Lebens voll-
6
Übersetzung nach Binder/Ludwig 1976. Ubersetzung nach H. Drexler, Polybios, Geschichte. Gesamtausgabe, 1, Zürich und Stuttgart 1961. 7
308
Peter B l o m e bracht hat. Diese R e d e weckt in der Menge, die durch sie an die Ereignisse erinnert wird und sie wieder vor Augen gestellt bekommt, und zwar nicht nur bei den Mitkämpfern, sondern auch bei den nicht unmittelbar Beteiligten, ein solches Mitgefühl, dass der Todesfall nicht als ein persönlicher Verlust für die Leidtragenden, sondern als ein Verlust für das Volk im ganzen erscheint. Wenn sie ihn dann begraben und ihm die letzten Ehren erwiesen haben, stellen sie das Bild des Verstorbenen an der Stelle des Hauses, wo es am besten zu sehen ist, in einem hölzernen Schrein auf. Das Bild ist ein prosopon, das mit erstaunlicher Treue die Bildung des Gesichts und seine Züge wiedergibt. Diese Schreine öffnen sie bei den großen Festen und schmücken die Bilder, so schön sie k ö n nen, und wenn ein angesehenes Glied der Familie stirbt, fuhren sie sie im Trauerzug mit und setzen sie Personen auf, die an Größe und Gestalt den Verstorbenen möglichst ähnlich sind. Diese tragen dann, wenn der Betreffende Konsul oder Praetor gewesen ist, Kleider mit einem Purpursaum, wenn Censor, ganz aus Purpur, wenn er aber einen Triumph gefeiert und dementsprechende Taten getan hat, goldgestickte. Sie fahren auf Wagen, denen Rutenbündel und Beile und die anderen Insignien des Amtes, j e nach der Würde und dem R a n g , den ein jeder in seinem Leben bekleidet hat, vorangetragen werden, und wenn sie zu den rostra gekommen sind, nehmen alle in einer R e i h e auf elfenbeinernen Stühlen Platz. Man kann sich nicht leicht ein großartigeres Schauspiel denken für einen Jüngling, der nach R u h m verlangt und für alles Große begeistert ist. D e n n die Bilder der wegen ihrer Taten hochgepriesenen Männer dort alle versammelt zu sehen, als wären sie noch am Leben und beseelt, wem sollte das nicht einen tiefen E i n druck machen? Was könnte es für einen schöneren Anblick geben?
Das lateinische imago ist griechisch mit eikon wiedergegeben. U n d dieses Bild bezeichnet Polybios weiter als prosopon, was die meisten Ubersetzer fast zwanghaft mit Maske übersetzen, so notorisch, dass diese Polybios-Stelle als Kronzeuge für die Gleichung imago gleich Maske herhalten muss. 8 Gewiss: Prosopon kann Maske heißen, doch keineswegs ausschließlich. Zunächst meint prosopon einfach das Gesicht, das Antlitz - erst in dritter Bedeutung ist das Wort im Liddell-Scott als Maske aufgeführt. Weitere Bedeutungen sind Büste oder Porträt. Ich würde deshalb als Ubersetzung der Polybios-Passage vorschlagen: „Dieses Bild ist ein Porträt, das sowohl hinsichtlich der Formung als auch der Bemalung auf Ähnlichkeit gearbeitet ist". Wichtig ist dabei, dass auch Polybios auf die große Ähnlichkeit der Porträts mit den dargestellten Ahnen hinweist. Im übrigen macht es Freude, die Polybios-Passage in der Ubersetzung Lessings zu lesen, sagt er doch bezüglich prosopon: „Dies Bildnis aber ist das Antlitz der Verstorbenen mit ganz vorzüglicher Ähnlichkeit gearbeitet". 9 Damit sind wir beim zentralen Punkt: Jenseits aller Semantik scheitert die Interpretation der imagines als Masken an der Eigenart des Gegenstandes Maske. Sie ist prinzipiell kein Lebendgesicht, sondern durch die leeren Augenhöhlen und die weit offene Mundkerbe a priori eine künstliche Hülle. Die Maske kann
Flower 1996, 3 6 ff. G. E. Lessing, U e b e r die Ahnenbilder der R o e m e r (1769). Diese unvollendete Arbeit wurde abgedruckt in: H. von Heintze (Hrsg.), R ö m i s c h e Porträts, Darmstadt 1974, 1 1 - 2 5 , hier 23. 8 9
Die imagines maiorum: ein Problemfall römischer und neuzeitlicher Ästhetik
309
einzelne Gesichtszüge ü b e r t r e i b e n u n d karikieren, sie k a n n e i n z e l n e T y p e n scharf herausstellen, sie k a n n e n t w e d e r fröhlich o d e r t r a u r i g sein, j u n g o d e r alt, s c h ö n o d e r hässlich etc. A b e r eines k a n n sie n i c h t u n d will sie n i c h t k ö n n e n : die G e sichtszüge eines I n d i v i d u u m s treu w i e d e r g e b e n . Dies leistet n u r ein L e b e n d g e sicht m i t n a t ü r l i c h e r A u g e n - u n d M u n d p a r t i e . G e r a d e diese t ä u s c h e n d e Ä h n l i c h k e i t d e r imagines w i r d i m m e r u n d i m m e r w i e d e r g e r ü h m t : v o n „vivida cera" spricht Martial 7 , 4 4 , v o n „locuturas mentito corpore ceras" Statius silvae 4,6,21; m a n e m p f i n d e t ihre b e d r ä n g e n d e G e g e n w a r t , so w i e e b e n Sosia i m Amphitruo seine d u p l i z i e r t e imago b e s t a u n t . A u c h die T o t e n m a s k e , w e l c h e die Gesichtszüge des g e r a d e V e r s t o r b e n e n tatsächlich treu n a c h b i l d e t , u n t e r s c h e i d e t sich v o n ein e m L e b e n d g e s i c h t d u r c h die geschlossenen A u g e n . I m Ü b r i g e n spricht einiges dafür, dass die M i t g l i e d e r d e r N o b i l i t ä t ihre imagines bereits zu L e b z e i t e n h a b e n a n f e r t i g e n lassen. F ü r die H e r l e i t u n g d e r imagines v o n T o t e n m a s k e n gibt es o h n e h i n k e i n e literarische E v i d e n z . Sie ist a u f z u g e b e n . N o c h e i n m a l : D i e W a c h s b i l d e r s u g g e r i e r e n die Präsenz des A h n e n in seiner möglichst lebensvollen D y n a m i k , n i c h t a m E n d e seiner Tage. M a n f i n d e t in d e r u m f a n g r e i c h e n Literatur zu d e n imagines u n d i n s b e s o n d e r e zur Maskendiskussion erstaunlicherweise so g u t w i e n i r g e n d s das A r g u m e n t , dass, w e n n die lateinischen A u t o r e n in d e r imago e i n e M a s k e g e s e h e n h ä t t e n , dies durch eine andere Wortwahl auch z u m Ausdruck gebracht hätten, nämlich d u r c h das W o r t persona,10 D i e P r o b e aufs E x e m p e l liefert S u e t o n Vespasianus 19,2, d e r ü b e r die pompa junebris des Kaisers Vespasian schreibt. D o r t trat tatsächlich ein Schauspieler m i t d e r M a s k e des V e r s t o r b e n e n auf, d e r A r c h i m i m u s Favor, v o n d e m es lateinisch k o r r e k t h e i ß t : „personam eius ferens". N u n b e h a u p t e t j a a u c h Polybios i m h e r a n g e z o g e n e n Zitat, dass die i m T r a u e r z u g m i t g e f ü h r t e n eikones P e r s o n e n aufgesetzt w ü r d e n , die a n G r ö ß e u n d Gestalt d e n V e r s t o r b e n e n m ö g l i c h s t ä h n l i c h seien. N a t ü r l i c h hat a u c h diese B e m e r k u n g d e r M a s k e n t h e o r i e reichlich N a h r u n g g e g e b e n , w i r d d o c h v o n Polybios suggeriert, dass die eikones v o n n i c h t n ä h e r b e z e i c h n e t e m Personal w i e M a s k e n g e t r a g e n w u r d e n . Ich w e r d e auf diesen P u n k t später z u r ü c k k o m m e n . Z u n ä c h s t j e d o c h zur Frage, was die r ö m i s c h e A n t i k e materiell zur Diskussion ü b e r das A u s s e h e n der imagines maiorum b e i t r a g e n k a n n . Es ist leider v e r s c h w i n d e n d w e n i g , da sich k e i n e einzige imago d e r r ö m i s c h e n N o b i l i t ä t e r h a l t e n hat, w o r a n in erster Linie das Material, e b e n Wachs, S c h u l d hat. D a z u k o m m t , dass die imagines n i c h t in G r ä b e r n d e p o n i e r t w u r d e n , s o n d e r n in d e n A t r i e n d e r H ä u s e r — d e r S c h u t z des G r a b e s fällt w e g . So ist es d e n n n i c h t v e r w u n d e r l i c h , dass das einzige e r h a l t e n e r ö m i s c h e W a c h s p o r t r ä t in e i n e m G r a b g e b o r g e n w e r -
10 Dazu u.a. P. Blome, Das Opfer des Phersu: ein etruskischer Sündenbock, in: Römische Mitteilungen, 93 (1986), 97ff.; S. Schlossmann, Persona und IIPOXOnON im Recht und im christlichen Dogma, Kiel 1906 (ND Darmstadt 1968).
310
Peter Blome
den konnte, und zwar schon 1852 in Cumae. Auf den drei Liegen der Grabkammer lagen stark zerfallene Skelette, anscheinend alle ohne Schädel. An Stelle des Schädels von zumindest zwei Skeletten fand man nun Wachsköpfe, was zur bis heute weitgehend akzeptierten Deutung geführt hat, es handle sich um Ersatzköpfe von enthaupteten Verbrechern. 11 Der eine Kopf zerfiel bei der Berührung, der zweite blieb glücklicherweise erhalten. Er zeigt einen unbärtigen, noch jungen Mann (Abb. 1). Die Augen sind aus Glas eingesetzt und weisen eine dunkle Iris auf. Es ist vor allem der etwas stechende Blick aus diesen Augen, der dem Gesicht eine auch im beschädigten Zustand bemerkenswerte Präsenz und Lebendigkeit verleiht. Dazu kommen der fein geschwungene, ganz leicht geöffnete Mund und die ruckartige Wendung nach rechts. Für uns wichtig ist auch die Notiz der Ausgräber, dass Reste natürlichen Haares mitgefunden wurden. Die dünne Wachshaut besteht aus zwei Schichten, wobei Stirn- und Augenzone heute einen hellen Grau-Braunton aufweisen, der nach unten zunehmend schwärzlich wird. Die Zeitstellung des Grabes ist nur sehr ungefähr zu bestimmen, der Grabtyp setzt in samnitischer Zeit ein und läuft im 2. Jh. n. Chr. aus. Auch wenn völlig klar ist, dass der Wachskopf aus Cumae topographisch, funktional und vor allem soziologisch mit den imagines maiorum nichts zu tun hat, so ist er für deren optische Rekonstruktion dennoch von größter Relevanz, weil er uns ein wächsernes Lebendgesicht zeigt, dass in seiner täuschenden Lebensnähe von einer Maske denkbar weit entfernt ist. Für mich ist klar, dass die stadtrömischen imagines nicht wesentlich anders ausgesehen haben können. Das zweite Monument, das man im Zusammenhang mit den imagines maiorum mit Recht immer wieder heranzieht, ist der sogenannte Togatus Barberini, eine frühkaiserzeitliche Togastatue im Konservatorenpalast in R o m (Abb. 2). 12 Der Kopf des Togatus ist nicht zugehörig, eine Identifizierung des Mannes daher nicht möglich. Was ihn auszeichnet, sind die beiden Porträtbüsten, die er stolz präsentiert. Man vermutet in ihnen den Vater und den Großvater des Togatus, wobei die Zuweisung an die Generationen je nach Auffassung des spätrepublikanischen Porträts schwankt. Das Entscheidende aber ist, dass der Togatus die beiden Büsten in seinen Händen hält, als wären sie federleicht. Kann man bei der linken noch behaupten, er stelle sie auf die als Statuenstütze dienende Palme, so steht die unerhörte Leichtigkeit des Tragens bei der Rechten außer Zweifel. So trägt man gewiss keine lebensgroßen Marmor- geschweige denn Bronzeköpfe. Das Fazit ist einfach: Der Mann präsentiert zwei seiner wächsernen imagines, die man glaubhaft so mühelos tragen konnte. O b es seine zwei einzigen sind und er
11
Drerup 1980, 93f. Taf. 49,1 (mit weiterer Literatur). R . Bianchi Bandinelli, Rom. Das Zentrum der Macht, München 1970, 79ff. Abb. 85-87; W. Heibig, Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom, 2, Tübingen 4 1966, Nr. 1615; J.-Ch. Balty, Porträt und Gesellschaft in der römischen Welt, in: Trierer Winckelmannsprogramm, 11 (1991), 7ff. Frontispiz und Taf. 1,1. 12
Die imagines maiorum: ein Problemfall römischer und neuzeitlicher Ästhetik
311
damit als u n b e d e u t e n d e r homo novus anzusprechen ist, wie m a n in der Literatur durchwegs lesen kann, ist eher zweitrangig. 1 3 Entscheidend ist vielmehr auch hier, dass die intendierten imagines maiorum rundplastische Lebendgesichter sind, Porträts älterer M ä n n e r mit individuellen Z ü g e n , mit Sicherheit auch hier keine Masken. Bis jetzt kreist unsere Vorstellung altrömischer imagines maiorum u m wächserne Gesichter, u m rundplastische Porträtbüsten, die m a n in d e n Schränken der A t rien a u f b e w a h r t e u n d bei d e n pompae funebres öffentlich vorführte. D e r Begriff lässt sich indessen, zumindest partiell, erweitern u n d — durchaus i m plautinischen Sinn - auf die ganze Gestalt eines h o c h r a n g i g e n Verstorbenen ausdehnen. W i c h tigen Aufschluss geben Berichte ü b e r Leichenzüge römischer Kaiser, angefangen bei Augustus bis hin zu Septimius Severus. Von diesen kaiserlichen Bestattungen fällt d a n n durchaus auch Licht auf die republikanischen pompae funebres. Z u n ä c h s t z u m Bericht ü b e r d e n T r a u e r k o n d u k t des Augustus, w i e er bei Cassius D i o 56, 34 erhalten ist: 14 Hierauf folgte die Leichenbestattung des Augustus. Die Bahre war aus Elfenbein und Gold gefertigt und mit p u r p u r n e n , golddurchwirkten Decken geschmückt. Darauf ruhte sein Leichnam, unten in einem Sarge verborgen; ein Wachsbild von i h m im T r i u m p h g e wand aber war zu sehen. Dieses w u r d e vom Palatium aus von den fürs k o m m e n d e Jahr bestimmten Amtspersonen, ein weiteres — goldenes - Bild aus der Curie getragen und noch ein drittes auf einem Triumphwagen mitgefuhrt. Dahinter kamen die Bilder seiner A h n e n und seiner bereits verstorbenen Verwandten - Caesar ausgenommen, der unter die Halbgötter zählte - sowie die der anderen irgendwie ausgezeichneten R ö m e r , und zwar unmittelbar von R o m u l u s angefangen.
D e r Text ist klar: D i e reale Leiche des Augustus lag in e i n e m geschlossenen Sarg, auf d e m P r u n k b e t t aber lag sein Scheinleib aus Wachs - eikon kerine. Dass diese imago m e h r war als eine Porträtbüste beweist der Zusatz en epinikio stole, also i m T r i u m p h g e w a n d . D a m i t nicht genug: N e b e n d e m wächsernen Scheinleib i m T r i u m p h a l o r n a t w u r d e eine goldene imago gezeigt - o b als Ganzgestalt o d e r n u r als Porträt ist hier nicht zu entscheiden; schließlich wird ein drittes Bild o h n e nähere M a t e r i a l b e z e i c h n u n g auf e i n e m Prachtwagen m i t g e f ü h r t . D a h i n t e r folgten d a n n die w o h l zahllosen imagines maiorum der iulisch-claudischen Familien, w o b e i die Grenze zwischen d e n realen u n d mythischen A h n e n hier fließend wird: auch R o m u l u s , der Stadtgründer, wird m i t g e f ü h r t . V o m w ä c h s e r n e n Scheinleib ist auch bei Pertinax die R e d e , der einige Zeit nach seinem physischen Tod in R o m mit P o m p beigesetzt w u r d e . Laut Cassius D i o 75,3 „ r u h t e auf d e m Paradebett ein wächserner Scheinleib des Pertinax, angetan mit Triumphinsignien, u n d ein anmutiger K n a b e scheuchte, als o b es
13 So z.B. Drerup 1980, 123 mit A n m . 194; vgl. auch P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, Zanker 1987, 168, Abb. 130. 14 Cassius Dio, Römische Geschichte, übers, v. O. Veh, 4, Zürich und M ü n c h e n 1986.
312
Peter B l o m e
wirklich ein Schlafender wäre, mit einem Pfauenwedel die Fliegen von ihm weg". 1 5 Die Fiktion, dass der realiter verstorbene Kaiser in seinem Scheinleib gleichsam noch am Leben sei, wird bei Septimius Severus auf die Spitze getrieben, wenn wir bei Herodian 4,2 lesen: 16 D e n n üblicherweise bestatten sie die Leiche des V e r s t o r b e n e n m i t a u f w e n d i g e r Ausstatt u n g w i e M e n s c h e n ; d a n n aber h a b e n sie ein Wachsbildnis gefertigt, das d e m V e r s t o r b e n e n völlig gleicht, legen es auf eine riesige B a h r e aus E l f e n b e i n , die h o c h e m p o r g e h o b e n wird, stellen sie a m E i n g a n g z u m Kaiserpalast auf u n d b r e i t e n g o l d d u r c h w i r k t e T e p p i c h e d a r u n t e r . Das A b b i l d aber liegt da so blass w i e ein Kranker. Beiderseits der B a h r e sitzen ü b e r e i n e n g r o ß e n Teil des Tages h i n links d e r gesamte Senat in s c h w a r z e n G e w ä n d e r n , rechts alle F r a u e n , d e n e n die h o h e Stellung ihres M a n n e s o d e r Vaters e i n e b e s o n d e r e W ü r d e verleiht; k e i n e v o n i h n e n lässt sich d o r t m i t g o l d e n e n R i n g e n o d e r Halsketten g e s c h m ü c k t s e h e n , s o n d e r n in schlichten w e i ß e n K l e i d e r n b i e t e n sie ein Bild d e r Trauer. S i e b e n Tage w i r d dies hier B e s c h r i e b e n e d u r c h g e f ü h r t ; u n d i m m e r w i e d e r t r e t e n Ärzte an die Bahre, blicken h i n u n d v e r k ü n d e n d a n n , es g e h e d e m K r a n k e n s c h o n w i e d e r etwas schlechter. W e n n er d a n n verstorben erscheint, n e h m e n die edelsten des R i t t e r s t a n des u n d ausgewählte j u n g e M ä n n e r von s e n a t o r i s c h e m R a n g die Bahre, tragen sie ü b e r die Via Sacra u n d stellen sie auf d e m alten F o r u m auf, w o die r ö m i s c h e n B e a m t e n ihren Eid b e i m N i e d e r l e g e n des A m t e s leisten.
So anekdotisch und für manche wohl geradezu grotesk solche Nachrichten tönen, sie belegen in wünschenswerter Deutlichkeit, dass der Scheinleib, diese Kombination aus wächsernem Gesicht und bekleideter Stoffpuppe, so täuschend lebensnah wie nur immer möglich gewesen sein muss, ein Double des Verstorbenen, genau wie die verdoppelte omnis imago des Sklaven Sosia auf der plautinischen Komödienbühne. Werfen wir von da noch einmal einen Blick zurück auf die republikanischen pompae funebres und bewerten im Licht der gut bezeugten imperialen Praktiken die Nachricht, dass die imago des Publius Cornelius Scipio Africanus nicht in einem privaten Atrium, sondern auf dem Kapitol in der Cella des Jupitertempels aufbewahrt worden sei. Valerius Maximus 8,15,1 sagt: Imaginem in cella lovis optimi maximi positam habet, quae, quotienscumque funus liae gentis celebrandum est, inde petitur, unique Uli instar atrii Capitolium est.
aliquod
Corne-
Sein Bild ist in d e r Cella des J u p i t e r O p t i m u s M a x i m u s aufgestellt u n d so o f t es ein B e g r ä b n i s in d e r gens der C o r n e l i e r zu f e i e r n gibt, w i r d dieses Bild von d o r t g e h o l t ; i h m als e i n z i g e m dient statt eines A t r i u m s das Kapitol.
U b e r das Aussehen dieser imago unterrichten Valerius Maximus 4,1,6 und Livius 38,56,12-13. Beide sprechen von einer „imago sua triumphali ornatu" (Livius) bzw. „imaginem
eius triumphali
ornatu indutam"
(Valerius). D i e imago w a r d e m n a c h
ganzgestaltig und zugleich transportierbar gewesen, was eine Gewandstatue aus-
15 16
1996.
Cassius D i o , R ö m i s c h e G e s c h i c h t e , übers, v. O. Veh, 5, Z ü r i c h u n d M ü n c h e n 1987. H e r o d i a n , G e s c h i c h t e des K a i s e r t u m s n a c h M a r c Aurel, hrsg. v. F. L. M ü l l e r , Stuttgart
Die imagines maiorum: ein Problemfall römischer und neuzeitlicher Ästhetik
313
schließt. W i r fassen die K l e i d e r p u p p e im T r i u m p h g e w a n d u n d mit w ä c h s e r n e m Porträtkopf. So w u r d e Scipio Africanus an d e n funera der C o r n e l i e r v o r - u n d h e r u m g e f ü h r t - von Schauspielern u n d Masken k a n n w i e d e r u m nicht die R e d e sein. G e g e n diese breit d o k u m e n t i e r t e Auffassung der imagines als künstliche Stoffp u p p e n mit Wachsporträt steht n u n Polybios, w o b e i ich schon o b e n , Lessing folgend, das griechische W o r t prosopon mit Antlitz bzw. Porträt w i e d e r g e g e b e n habe. A b e r der weitere Text des Polybios k a n n - das ist z u z u g e b e n — so verstand e n w e r d e n , dass m a n die imagines solchen aufgesetzt habe, die den jeweils Verstorbenen an G r ö ß e u n d R a n g möglichst ähnlich gewesen seien, u n d dass diese, von Polybios im ü b r i g e n keineswegs als Schauspieler bezeichneten Leute die d e m R a n g des Toten entsprechenden Kleider getragen hätten. Ich k a n n diese Textpassage nicht anders erklären, als dass Polybios auf die täuschende Lebensnähe der eikones sozusagen hereingefallen ist. 17 Bedeutsam ist jedenfalls seine Aussage, w o n a c h die eikones auf Wagen gefahren seien. M a g sein, dass durch die holprige B e w e g u n g des Fahrens o d e r durch zusätzliche M a n i p u l a t i o n e n der S t o f f p u p p e n der E i n d r u c k der Beweglichkeit zusätzlich erweckt w e r d e n k o n n t e . Z u e r i n n e r n ist in diesem Z u s a m m e n h a n g an d e n beweglichen Scheinleib des Gaius Iulius Caesar, d e n m a n bei seinem t u m u l t u ö s e n Begräbnis vorgezeigt hat. Appian bellum civile 2,147 berichtet: 1 8 Schon waren sie in dieser S t i m m u n g nahe daran Gewalt zu brauchen, als Jemand die Statue Caesars, aus Wachs geformt, über dem Lager emporhielt; denn der Leichnam war auf dem Lager so zurückgelegt, dass man ihn nicht sehen konnte. Die Statue wendete sich durch eine Vorrichtung nach allen Seiten; man sah an ihr die dreiundzwanzig W u n den, die sie ihm in wilder W u t h an allen Theilen des Körpers, sogar ins Gesicht beigebracht hatten. Dieser Anblick schien dem Volke so bejammernswürdig, dass sie ihn nicht länger ertrugen; sie seufzten laut auf, umgürteten sich und verbrannten das Rathhaus, worin Caesar ermordet worden war.
Schließlich n o c h eine sehr banale, praktische Ü b e r l e g u n g : N e h m e n wir das S t e m m a der Cornelii Scipiones u n d stellen uns vor, dass b e i m Begräbnis eines der späteren republikanischen W ü r d e n t r ä g e r des Geschlechtes, etwa Q u i n t u s Metellus Pius Scipio, Consul im Jahre 52 v. Chr., die pompa junebris z u s a m m e n gestellt w e r d e n musste. D a waren, angefangen bei Lucius C o r n e l i u s Scipio Barbatus, C o n s u l 298 v. Chr., etwa 20 gewesene C o n s u l n , dazu einige andere c u r u lische Dignitare zu berücksichtigen, inklusive der schon behandelte, im Capitol a u f b e w a h r t e Africanus. N i m m t m a n n o c h die R e i h e von imagines von Allianzgeschlechtern hinzu, so k a n n m a n bei e i n e m späten patrizischen P r u n k b e g r ä b n i s gut u n d gern von 50 u n d m e h r imagines ausgehen. Sich vorzustellen, dass ein
17 18
So auch schon Drerup 1980, l l l f . Nach der Übersetzung bei von Schlosser 1993, 21 f.
314
Peter Blome
Heer von Schauspielern sich zum Teil dreihundert Jahre alte Wachsmasken anlegen musste, grenzt ans Absurde, ganz abgesehen davon, dass derart alte Masken den dauernden Gebrauch mit Sicherheit nicht überstanden hätten. Das fuhrt mich zum letzten Aspekt: Nämlich zum Spott natürlich vor allem der Satiriker an den funera der Nobilität. In seiner achten Satire (1-5) geißelt Iuvenal das gewiss bisweilen groteske Erscheinungsbild altadliger pompae funebres: Stemmata
quid faciunt?
quid prodest,
sanguine
censeri, pictos ostendere
maiorum
et stantis in curribus
et Curios
iam dimidios
Corvinum
et Galbam
Pontice,
longo
vultus Aemilianos
umeroque
minorem
auriculis nasoque
carentem,
.. .
Ahnenregister - wozu? Was hilft's, o Ponticus, alten Blutes gerühmt sich zu sehn, die gemalten Gesichter der Väter zeigen zu können und, stehend im Wagen, die Aemiliane, Curier, welche verstümmelt bereits, Corvin u m die beiden Arme gebracht, und Galba, der Nase und Ohren entbehrend.
Wieder erfahren wir, dass die Ahnen in Wagen stehen, gewiss nicht von Schauspielern gemimt, sondern bisweilen stark lädiert mit fehlenden Gliedmaßen, abgefallenen Ohren und Nasen, wie das bei zwei-, dreihundertjährigen Scheinleibern auch gar nicht anders zu erwarten ist. Von imagines fumosae, rauchgeschwärzten Ahnenbildern, sprechen denn auch andere Autoren, unter ihnen Seneca.1"* Das Bisherige zusammengefasst: Die literarischen Quellen vermitteln uns hinlänglich brauchbare Anhaltspunkte, um von den imagines maiorum eine Vorstellung zu gewinnen. Es sind Lebendgesichter aus Wachs mit offenen, aus Glas oder anderem Material eingelegten Augen und wohl auch echtem Haar. Die wächsernen Porträtbüsten, wie sie der Togatus Barberini in den Händen hält und von denen der Wachskopf aus Cumae die beste antike Vorstellung gibt, konnten offenbar mit Scheinleibern verbunden werden, die den Verstorbenen als Stoffpuppe mit entsprechenden Kleidern und Ehrenzeichen abbildeten. Bei der Suche nach mehr tatsächlich erhaltenem Anschauungsmaterial kann uns nur eine beträchtliche Erweiterung des zeitlichen Horizontes helfen. Im Folgenden versuche ich mithilfe neuzeitlicher Parallelen, die verlorene antike Funeralplastik der Anschauung näher zu bringen. Als immer noch sehr nützliche Quellensammlung dient mir die im Jahre 1910 erschienene Abhandlung von Julius von Schlosser Die
Geschichte
der Poträtbildnerei
in Wachs.
Von der Interpretation
Schlossers,
wonach die antiken wie die neuzeitlichen Funeraleffigien als magische ,survivals' zu gelten hätten, bin ich indessen völlig unberührt. 20
19 20
Seneca, Epistulae, 14. Von Schlosser 1993, 52f., 69f.
Die imagines maiorum: ein Problemfall römischer und neuzeitlicher Ästhetik
315
Zunächst schlage ich eine Brücke von den zitierten römischen Kaiserbegräbnissen z u m offiziellen Zeremoniell am französischen Königshof zwischen d e m 14. u n d d e m 17. Jahrhundert. Genau wie für Augustus, Pertinax oder Septimius Severus w u r d e n für die verblichenen Könige u n d andere Mitglieder des H o c h adels Funeraleffigien aus Wachs hergestellt, angetan mit den P r u n k g e w ä n d e r n u n d den Insignien der Macht. 2 1 Für Ludwig XII., gestorben 1515, ist folgende A b r e c h n u n g erhalten: 2 2 Er erhält die S u m m e von 40 Pfund in Gold dafür, dass er d e m verstorbenen König die Gesichtsmaske nach dem Leben a b g e n o m m e n u n d eine Perücke hergestellt hat, gemäß der seinen, für die er 4 Pfund gezahlt hat, sowie dafür, dass er den Körper samt Armen und Beinen präpariert hat, u m so alles zusammenfugen zu können. Bezahlt wird er auch dafür, dass er geliefert u n d ausgelegt hat die Kosten fur die Schneider und Arbeiter, für Holz, Feuer und Werkzeuge, u m den Körper in festem Zustand zu bewahren und ihn des Nachts dahin zu transportieren, wo er auf die genannte Weise präpariert wurde. Die Bezahlung erstreckt sich des weiteren auf die Bekleidung mit königlichen Gewändern, die Ausstattung mit Handschuhen u n d Kragen sowie die H e r r i c h t u n g mit Nägeln, Seilen und anderen notwendigen Dingen.
Dass die Porträts aus Wachs hergestellt w u r d e n , geht aus zahllosen E r w ä h n u n g e n hervor, so wird nach d e m Ableben Franz I. im Jahre 1547 sein H o f m a l e r François C l o u e t beauftragt, „die Gesichtsmaske a b z u n e h m e n , u m so eine Effigie ihrer verstorbenen Majestät herzustellen, u n d zu diesem Behufe soll er acht P f u n d gelben Wachses k a u f e n " . 2 3 Mit W e n d u n g e n wie „le visage après du vif" ist klar, dass es sich auch am französischen H o f u m Lebendgesichter handelt, auch w e n n diesen eine Totenmaske z u g r u n d e liegt. Das Desiderat nach größtmöglicher Ähnlichkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die Quellen: „Ein Porträt, so lebensecht wie nur möglich", ein andermal: „gefertigt nach Leben u n d N a t u r z u stand", oder auch: „nach d e m Leben u n d der N a t u r gestaltet, mit gegen H i m mel gerichteten Augen u n d gefalteten H ä n d e n " . 2 4 In geradezu auffälliger Weise werden wir an die Arztvisiten b e i m Scheinleib des Septimius Severus erinnert, w e n n wir über die Obsequien Karls IX., gestorben 1574, lesen: 2 5 Es gilt zu wissen und wird hiermit kundgetan, dass während der Körper in effigie sich zur Zeit des Abendessens in j e n e m Saale befand, die Formen und Prozeduren der Bedien u n g absolut genauso beobachtet u n d weitergeführt wurden, wie dies zu Lebzeiten ihrer Majestät zu geschehen pflegte, insofern nämlich der Tisch aufgestellt wurde von den Fourrage-Offizieren u n d die Bedienung in den H ä n d e n der Edelleute lag - Vorlegern, Zuständigen fîir das Brot, Mundschenk u n d Zuschneider. Diesen schritt der Amtsdiener voran, gefolgt von denjenigen Offizieren, welche die Trinkbecher wieder entfernen und
21 22 23 24 25
Von Von Von Von Von
Schlosser Schlosser Schlosser Schlosser Schlosser
1993, 1993, 1993, 1993, 1993,
34-53. 35f.; Übersetzung ebd., 174. 36; Übersetzung ebd., 174. 37; Übersetzungen ebd., 176. 36f.; Übersetzung ebd., 175.
316
Peter B l o m e die ihrerseits den genannten Tisch mit den geziemenden Vorkehrungen und Gegenständen versehen. Sodann, nachdem das Brot von den dafür Zuständigen aufgeschnitten worden war, wurde das Fleisch vorbereitet und von einem Maitre d'Hotel gereicht, wobei die Kammeijungen, Küchengehilfen und Geschirr-Bewahrer assistierten. Dann wurde das Mundtuch von besagtem Maitre d'Hotel der würdigsten Person dargereicht, die anwesend war, damit diese die Hände ihrer Majestät abwische. Schließlich wurde der Tisch gesegnet von einigen Kardinälen oder Prälaten und die Schälchen mit Waschwasser vor dem Stuhl ihrer Majestät aufgestellt, ganz so, als ob diese lebendig wäre und darauf säße. Die drei Handreichungen am genannten Tisch setzten sich fort in den gleichen Z e r e m o nien und Formen, die auch zu Lebzeiten ihrer Majestät üblich gewesen waren, wobei man auch die Darreichung des Pokals zu dem Zeitpunkt nicht vergaß, an dem ihre Majestät bei den Mahlzeiten zu trinken pflegte.
W i e bei Septimius Severus mag man das Zeremoniell vor dem Scheinleib Karls I X . als leicht makabre Komödie empfinden, allein wir haben die Vorgänge historisch ernst zu nehmen als den Versuch, den verstorbenen Souverän für eine gewisse Zeit fiktiv als noch lebend darzustellen. Mittel dieser Fiktion ist in R o m wie in Paris eine Stoff- oder Holzpuppe mit wächsernem Lebendgesicht und wächsernen Händen, angelegt auf Täuschung, immer noch genauso wie die verdoppelte imago des Sklaven Sosia im Amphitruo. D i e Herstellung bekleideter FuneralefHgien war auch an anderen Königs- und Fürstenhöfen Europas vom späten Mittelalter bis etwa ins 17. Jahrhundert gang und gäbe, so vor allem in England. 2 6 Ich übergehe die diesbezüglichen N a c h richten und wende mich für ein besonders gutes Beispiel nach Florenz, eines der großen Zentren der Keroplastik mindestens seit dem 14. Jahrhundert. Die Florentiner ceraiuoli produzierten meist lebensgroße sogenannte boti, die als Votive in Kirchen geweiht wurden. Natürlich wurden auch die Medici in Wachs konterfeit. So ließ Lorenzo de Medici, dem Attentat der Pazzi im Jahr 1478 glücklich entronnen, drei lebensgroße Porträtfiguren beim bekannten ceraiuolo Orsino anfertigen. Eine davon zeigte Lorenzo „in dem Gewand, in dem er sich nach dem Attentat, am Halse verwundet, von seinem Fenster dem Volk gezeigt hatte". 2 7 D i e Parallele zum verwundeten Scheinleib des Iulius Cäsar ist offensichtlich. Kein geringerer als Vasari war von diesen drei boti begeistert: 2 8 Onde Orsino, fra l'altre con l'aiuto ed ordine d'Andrea, ne condusse tre di cera grandi quanto il vivo, facendo dentro l'ossatura di legname, come altrove si è detto, ed intessuta di canne spaccate, ricoperte poi di panno incerato con bellissime pieghe e tanto acconciamente, che non si può veder meglio, ne cosa più simile al naturale. Le teste poi, mani e piedi fece di cera più grossa, ma vote dentro e rittratte da! vivo e dipinte a olio con quelli ornamenti di capelli e altre cose, secondo che bisognava, naturali e tanto ben fatti, che rappresentano non più uomini di cera, ma vivissimi ...
26 27 28
Von Schlosser 1993, 41 ff. Von Schlosser 1993, 61 f. Zitiert bei von Schlosser 1993, 61 ff.; Übersetzung ebd., 178.
Die imagines maiorum: ein Problemfall römischer und neuzeitlicher Ästhetik
317
Deshalb führte Orsino, neben anderen Figuren, drei Figuren aus Wachs in Lebensgröße aus, indem er in ihrem Innern ein Knochengerüst aus Holz konstruierte, verbunden durch gespaltenes Schilfrohr, u m das er dann wachsgetränktes Tuch in herrlichen Falten so gekonnt drapierte, dass man sich nichts Besseres und Naturähnlicheres vorstellen kann. Desweiteren machte er Köpfe, H ä n d e und Füße aus dickerem Wachs, aber innen hohl und nach dem lebenden Vorbild geformt, mit Ölfarben bemalt, mit Haarschmuck u n d sonstigem Beiwerk, wie es erforderlich war, ganz natürlich und so perfekt, dass sie nicht mehr wie Wachsfiguren wirkten, sondern wie höchst lebendige Menschen . . .
Einmal m e h r sind alle E l e m e n t e beisammen, die auch f ü r die römischen imagines als typisch zu gelten haben: der Werkstoff Wachs flir K o p f u n d Extremitäten, das echte Haar, die bekleidete H o l z - bzw. S t o f f p u p p e u n d vor allem die auf T ä u schung angelegte Lebensnähe, der schrankenlose Naturalismus bis hin zu den b l u t e n d e n W u n d e n . H ä t t e die Nobilität von Florenz die republikanischen pompae funebres praktiziert, e i n e m Betrachter hätte sich das gleiche Bild w i e d e m Polybios in R o m geboten. N u n sollten wir hinreichend vorbereitet sein flir d e n Anblick einiger wirklich erhaltener Wachsporträts, v o r n e h m l i c h aus d e m habsburgischen Kaiserhaus. Als Auftakt diene die Büste Kaiser Leopolds I. (Regierungszeit: 1 6 5 8 - 1 7 0 5 ) : ein Lebendgesicht aus Wachs mit etwas glotzenden A u g e n u n d feisten Gesichtszüg e n . 2 9 B e m e r k e n s w e r t das natürliche Haar, das in gewaltiger Fülle u n t e r d e m S e i d e n k ä p p c h e n hervorquillt. In eindrücklicher Lebensnähe präsentiert sich sod a n n Kaiser Leopold II. (Regierungszeit: 1 7 9 0 - 1 7 9 2 ) : 3 0 M i t d e n Insignien seiner M a c h t reich versehen, blickt er aus g r o ß e n , von Tränensäcken u n t e r f a n g e n e n A u g e n leicht melancholisch in die Welt (Abb. 3). D e r volllippige M u n d , K i n n u n d D o p p e l k i n n , die h o h e Stirn u n d die leicht eingefallenen W a n g e n sind trefflich modelliert, das w i e d e r u m natürliche Haar ist nach hinten gestrichen, w o b e i gerade am ausgefransten Haar in der Seitenansicht die Anfälligkeit solcher Effigien sichtbar wird. Dasselbe gilt f ü r das Wachsporträt K ö n i g Ferdinands IV. von N e a p e l (1751 — 1825), bei d e m die naturalistische W i e d e r g a b e seines alternden Gesichtes gnadenlos auf die Spitze getrieben ist (Abb. 4): „Die Lebenstreue wird hier beinah zur Indiskretion". 3 1 D i e Wachseffigien sind nicht auf die Mitglieder des Adels beschränkt, s o n d e r n dienen auch b e g ü t e r t e n B ü r g e r n zur Repräsentation. Ein besonders eindrückliches Beispiel bietet die Wachsbüste des reichen G e o r g W i l h e l m von Kirchner ( 1 6 7 0 - 1 7 3 5 ) , der das A m t eines kaiserlichen H o f b u c h h a l t e r s bekleidete u n d sich als großer M ä z e n hervortat (Abb. 5). Von Schlosser charakterisiert das Werk so: „Die mit natürlicher Perücke sowie Stoffen u n d Spitzen bekleidete Büste, die ihn als älteren M a n n zeigt u n d eine der denkwürdigsten Leistungen der österrei-
29 30 31
Von Schlosser 1993, 72, Abb. S. 74f. Von Schlosser 1993, 80, Abb. S. 76 f. Von Schlosser 1993, 80, Abb. S. 78 f.
318
Peter B l o m e
chischen Barockplastik auf diesem Gebiet darstellt, passt in die ausserordentliche Umgebung, in der dieser Mann sich bewegt hat". 3 2 Tatsächlich ist man frappiert von der fast beängstigenden Präsenz dieser Erscheinung und man denkt wieder an die Worte Vasaris über die Effigien des Lorenzo de Medici: „naturali e tanto ben fatti, che rappresentano non piü uomini di cera, ma vivissimi". Genau dasselbe gilt von der Büste des französischen Staatsmannes und Gesetzgebers d'Aguesseau ( 1 6 6 8 - 1 7 5 1 ) . Der Frack ist längst den Motten zum Opfer gefallen, das Frackhemd der Auflösung nahe (Abb. 6). Doch von dem Wachsporträt kann man mit von Schlosser lobend sagen: „Es ist ein technisch wie künstlerisch hervorragendes Werk, fein und sorgfältig, ohne Kleinlichkeit modelliert und trotz der Vergilbung des Materials höchst ausdrucksvoll, geradezu ein Schulbeispiel dafür, wie dergleichen Büsten, trotz ihrer natürlichen Haare und Gewänder, trotz der Glasaugen, einen künstlerisch befriedigenden Eindruck hervorzubringen imstande •
J "
33
sind . Unter den erhaltenen Effigien befinden sich nun durchaus auch ganzfigurige Arbeiten, so zum Beispiel der sitzende Friedrich I. von Preußen, gestorben 1713. In vollem fürstlichem Ornat, mit Degen und Zepter, thront er in zeitloser Starre, das Gesicht und die Hände in Wachs, auf dem Kopf der Dreispitz. 34 Für mich den Höhepunkt stellt indessen die ganzfigurige imago Friedrichs des Großen dar, geschaffen 1786 nach seinem Tod (Abb. 7). Die Uniform soll er m den schlesischen Kriegen getragen haben, der markante Kopf mit Glasaugen und Haarperücke ist nach der Totenmaske als Lebendgesicht verfertigt worden. Der alte, von Gicht geplagte König ist in der charakteristischen Haltung des zwar gebückten, aber unbeugsamen Feldherrn wiedergegeben. Er geht am Stock und der angedeutete Schritt ist schleppend. Die Uniform wirkt eher salopp und durchaus abgenutzt. Der alte Fuchs blickt indessen hellwach unter seinem breiten Dreispitz hervor, jederzeit bereit zu einer spöttischen Bemerkung. W i r erinnern uns: Den republikanischen imagines wurde attestiert, sie würden Bewegung, Haltung, Kleidung und Eigenschaften der Dargestellten imitieren. Wo sonst, wenn nicht an der Ganzfigur des alten Fritz kann sich unsere Vorstellung der verlorenen imagines maiorum entzünden? Stellen wir ihn gedanklich noch auf einen Wagen und lassen ihn von einem Dutzend oder mehr weiterer Würdenträger seines Schlages begleitet sein - so kommen wir ziemlich nah an das Schauspiel, das sich einem Polybios geboten hat. Und wenn wir die preußische Feldherrenuniform durch das römische Triumphgewand ersetzen, so können wir uns das Aussehen der im Kapitol aufbewahrten omnis imago des
32 33 34 35
Von Von Von Von
Schlosser Schlosser Schlosser Schlosser
1993, 1993, 1993, 1993,
86-89. 89 f. 81, Abb. S. 83. 81, Abb. S. 84.
Die imagines maiorum: ein Problemfall römischer und neuzeitlicher Ästhetik
319
Scipio Africanus besser als bisher vorstellen. U n d wir k ö n n e n auch besser verstehen, dass Polybios u n d sicher auch andere von der Präsenz solcher Stoffpuppen derart frappiert waren, dass sich ihnen die Grenze zwischen Fiktion u n d Realität verwischte.
• Die imagines maiorum der R ö m e r , die Wachsporträts der Habsburger, die Scheinleiber Cäsars, Lorenzo de Medicis u n d Friedrich des G r o ß e n werden von der Forschung allenfalls als historische P h ä n o m e n e w a h r g e n o m m e n , sie sind aber kein oder k a u m Gegenstand kunsthistorischer Betrachtung, geschweige d e n n Wertschätzung. Gewiss: Aus der römischen Antike sind bis auf das ominöse Wachsporträt aus C u m a e keine imagines erhalten — das erleichtert den Verzicht auf eine ästhetische Wertung. D o c h die Kunstgeschichte macht auch u m die tatsächlich erhaltene Keroplastik der Neuzeit einen großen Bogen. G e b e n wir es u n u m w u n d e n zu: Es fällt schwer, die Porträtbüsten Leopolds I. oder Ferdinands IV. als Produkte künstlerischen Schaffens ernst zu n e h m e n . W i r sehen keine Künstler am Werk, vielmehr geschickte Präparatoren, Handwerker, die mit d e m weichen Werkstoff Wachs eine Art dreidimensionale Fotografien h e r stellen, platte Kopien der Wirklichkeit, o h n e j e d e künstlerische Inspiration. Ja, Leopold I. u n d Friedrich der G r o ß e gehören ins Wachsfigurenkabinett u n d mit ihnen alle imagines maiorum bis zu R o m u l u s , dessen mythische imago im Leichenzug des Augustus mitgefuhrt wurde. Tatsächlich haben sich die Wachsfigurenkabinette im Verlauf des 18. Jahrhunderts aus der keroplastischen Porträtbildnerei der Fürstenhöfe entwickelt, u n d ein Kunsthistoriker, der die Familie Windsor bei M a d a m e Tussot einer kunsthistorischen Studie wert befände, w ü r de von der Z u n f t wohl nicht m e h r ernst g e n o m m e n . Mit anderen Worten: Die Sache ist peinlich. Aber sie ist deswegen nicht aus der Welt u n d wir müssen uns zuletzt fragen, w a r u m uns die Keroplastik so u n a n g e n e h m berührt. W i r touchieren dabei wohl einen zentralen Bereich der Ästhetik, nämlich das Problem von N a t u r u n d Kunst, von Materie u n d Form, von Idee u n d Wirklichkeit. D e r homo pictor steht seit j e in diesen Spannungsfeldern. Was soll das Bild leisten? Soll es uns, u m b e i m T h e m a zu bleiben, den Scipio Africanus oder Friedrich den G r o ß e n in ihrer unverwechselbaren, sozusagen materiellen Individualität darbieten, d e m Leben täuschend ähnlich? O d e r soll es versuchen, durch bewusste Ubersetzung der Materie in eine künstlerische F o r m das Zufällige der Erscheinung abzustreifen, u m so zu einer höheren Wirklichkeit, zur Idee im Sinne Piatons vorzustoßen? Hier hilft n u n glücklicherweise ein Text Schopenhauers weiter, der unseren Gegenstand, nämlich die Wachsplastik, in souveräner Manier abhandelt u n d zwar eben als P h ä n o m e n im skizzierten Spannungsfeld von F o r m u n d Materie, von Idee u n d Wirklichkeit.
320
Peter Blome
W i r finden den Gedankengang im Paragraphen 209 der 1851 erschienenen Parerga:36 Näher aber betrachtet, beruht die Sache darauf, dass das Werk der bildenden Kunst nicht, wie die Wirklichkeit, uns das zeigt, was nur einmal da ist und nie wieder, nämlich die Verbindung dieser Materie mit dieser Form, welche Verbindung eben das Konkrete, das eigentlich Einzelne ausmacht, sondern dass es uns die Form allein zeigt, welche schon, wenn nur vollkommen und allseitig gegeben, die Idee selbst wäre. Das Bild leitet uns mithin vom Individuum weg auf die blosse Form. Schon dieses Absondern der Form von der Materie bringt solche der Idee um vieles näher. Eine solche Absonderung aber ist jedes Bild, sei es Gemälde oder Statue. Darum gehört nun diese Absonderung, diese Trennung der Form von der Materie, zum Charakter des ästhetischen Kunstwerks: eben weil dessen Zweck ist, uns zur Erkenntnis einer (Platonischen) Idee zu bringen. Es ist also dem Kunstwerk wesentlich, die Form allein, ohne die Materie zu geben, und zwar dies offenbar und augenfällig zu tun. Hier liegt nun eigentlich der Grund, warum Wachsfiguren keinen ästhetischen Eindruck machen und daher keine Kunstwerke (im ästhetischen Sinn) sind: obgleich sie, wenn gut gemacht, hundertmal mehr Täuschung hervorbringen, als das beste Bild oder Statue es vermag, und daher, wenn täuschende Nachahmung des Wirklichen der Zweck der Kunst wäre, den ersten R a n g einnehmen müssten. Sie scheinen nämlich nicht die bloße Form sondern, mit ihr, auch die Materie zu geben; daher sie die Täuschung, dass man die Sache selbst vor sich habe, zu Wege bringen. Statt dass also das wahre Kunstwerk uns von dem, welches nur einmal und nie wieder da ist, d.i. dem Individuum, hinleitet zu dem, was stets und unendliche Male, in unendlich Vielem da ist, der bloßen Form oder Idee, gibt das Wachsbild uns scheinbar das Individuum selbst, also das, was nur einmal und nie wieder da ist, jedoch ohne das, was einer solchen vorübergehenden Existenz Wert verleiht, ohne das Leben. Darum erregt das Wachsbild Grausen, indem es wirkt wie ein starrer Leichnam.
Besser kann man Wesen und Eigenart der Wachsbilder und damit auch aller imagines maiorum von Scipio Africanus bis Friedrich den Großen nicht treffen, und klarer kann man die auf Piaton zurückgehende Uberzeugung nicht f o r m u lieren, wonach Kunst nicht die Wirklichkeit abzubilden habe, sondern durch die Absonderung der Form von der Materie etwas der Wirklichkeit überlegenes, Ideelles wiedergeben müsse. Wenn wir also die wächsernen imagines mitsamt den Scheinleibern aus dem Reich der Kunst verbannen, dann stehen wir am Ende des 20. Jahrhunderts immer noch in derselben platonischen Tradition wie Schopenhauer, ja unsere Abneigung gegen die veristische Imitation des Individuums, dem dann doch das Entscheidende, das Leben selbst nämlich, fehlt, ist seit Schopenhauer gewiss noch gewachsen, wie man an Hand weniger kunstgeschichtlicher Beispiele mühelos zeigen kann. Wenn wir etwa Bronzeplastiken von Matisse oder Picasso bewundern, die eigentlich nur durch die entsprechende Beschriftung als Porträts bestimmter Individuen definiert sind, dann bewundern wir den endgültigen Sieg der abstrakten Form über das gegenständlich Zufällige, über die
3fi
A. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften, Zürcher Ausgabe 2,2, 1977, 464f.
Die imagines maiorum: ein Problemfall römischer u n d neuzeitlicher Ästhetik
321
M a t e r i e im Sinne Schopenhauers. O d e r w e n n w i r Picassos kubistisches Porträt des Ambroise Vollard von 1910 mit R e c h t f ü r ein geniales Werk halten, d a n n beziehen wir mit diesem Urteil w i e d e r u m eine geradezu platonische Position, ist d o c h die A b s o n d e r u n g der F o r m von der Materie k a u m weiter zu treiben als in der U b e r s e t z u n g des wirklichen Ambroise Vollard in ein vielfach gebrochenes S p e k t r u m von F o r m e n u n d Farben (Abb. 8). 3 7 Das Wachsporträt des G e o r g W i l h e l m von Kirchner u n d das Porträt des A m broise Vollard verhalten sich zueinander w i e die extremsten Pole i m S p a n n u n g s feld v o n M a t e r i e u n d F o r m , von Wirklichkeit u n d Idee. W e n n w i r das eine d e m Gruselkabinett der keroplastischen imagines z u o r d n e n , das andere d e m P a n t h e o n großer Kunst, dann fällen wir ein nicht sehr mutiges, weil v o n k a u m j e m a n d e m bestrittenes Urteil. W i r akzeptieren o h n e W i d e r s p r u c h das S c h o p e n h a u e r s c h e D i c t u m , dass täuschende N a c h a h m u n g der Wirklichkeit gerade nicht der Z w e c k der Kunst ist, ansonsten e b e n die Wachsfiguren d e n ersten R a n g e i n n e h m e n müssten. W i r setzen uns damit vielleicht etwas zu selbstverständlich ü b e r alle j e n e h i n w e g , die, angefangen bei Sosia i m Amphitruo ü b e r Polybios bis Vasari die täuschende N a c h a h m u n g des W i r k l i c h e n durchaus als lohnenswertes Ziel der Kunst verstanden haben. W i r verweisen allzu g e r n e die N o t i z bei Plinius naturalis historia 35,36,65 ins R e i c h der witzigen A n e k d o t e , w o n a c h der b e r ü h m t e Zeuxis Trauben so erfolgreich gemalt habe, dass die Vögel an ihnen picken wollten. W i r sollten, w e n n auch nicht enthusiastisch, a n e r k e n n e n , dass die täuschende N a c h a h m u n g der zufälligen Wirklichkeit durchaus eine Aspiration des homo pictor sein kann. D e r homo pictor trägt in sich auch d e n homo ßctor, der das Leben durch täuschende N a c h a h m u n g überlisten will. D i e imagines maiorum u n d ihre späteren N a c h f a h r e n sind zu Z e i t e n sehr geschätzte u n d b e w u n d e r t e Manifestationen d i e ser List. A c h t e n wir sie deshalb nicht allzu gering u n d freuen uns ein letztes mal am Ausruf Vasaris: „naturali e tanto benfatti, che rappresentano non più uomini di cera, ma vivissimi... ",38
Abgekürzt zitierte Literatur: Binder/Ludwig 1976 Drerup 1980 Flower 1996
W. Binder u n d W. Ludwig, Antike Komödien, I, M ü n c h e n 1976. H . Drerup, Totenmaske und Ahnenbild bei den R ö m e r n , in: R ö m i sche Mitteilungen, 87 (1980), 8 1 - 1 2 9 . H . I. Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in R o m a n C u l ture, O x f o r d 1996.
37 C h . Zervos, Pablo Picasso, Catalogue raisonné, 2, Paris 1942, 104, Nr. 214; Cézanne und die M o d e r n e (Ausst. Kat. Fondation Beyeler Basel), Ostfildern-Ruis 1999, Abb. 70. 38 Zitiert bei von Schlosser 1993, 61 ff.; Übersetzung ebd., 178.
322
Peter B l o m e
Von Schlosser 1 9 9 3
J . von Schlosser, Tote Blicke. Geschichte der Porträtbildnerei aus Wachs. Ein Versuch, von T. Medicus mit einem Nachwort versehen neu hrsg. nach der Erstveröffentlichung im Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen W i e n , 2 9 ( 1 9 1 0 - 1 1 ) , 1 7 1 - 2 5 8 , Berlin 1993.
Bildlegenden Abb. Abb. Abb. Abb. Abb. Abb. Abb. Abb.
1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:
Wachsmaske aus Cumae. Neapel, Nationalmuseum, Inv. 8 6 . 4 9 7 . Frühkaiserzeitliche Togastatue, sog. Togatus Barberini. R o m , Konservatorenpalast. Wachsbüste Leopolds II. ( R e g . 1 7 9 0 - 9 2 ) . Wachsbüste König Ferdinands IV. von Neapel ( 1 7 5 1 - 1 8 2 5 ) . Wachsbüste des Pfarrers Georg Wilhelm von Kirchner ( 1 6 7 0 - 1 7 3 5 ) . Wachsbüste des französichen Staatsmannes d'Aguesseau (1668—1751). Wachsfigur Friedrichs des Grossen. Pablo Picasso, Porträt des Ambroise Vollard (1910). Moskau, Staatliches PuschkinMuseum für bildende Künste.
Abbildungsnachweise Abb. 1: Abb. 2: Abb. 3: Abb. 4: Abb. 5: Abb. 6: Abb. 7: Abb. 8:
Wachsmaske aus Cumae. - Nach Drerup 1980, Taf. 49, 1. Togatus Barberini. R o m , Konservatorenpalast - Nach R . Bianchi Bandinelli, R o m . Das Zentrum der Macht, München 1970, Abb. 85. Wachsbüste Leopolds II. - Nach von Schlosser 1993, Abb. S. 76. Wachsbüste König Ferdinands IV. von Neapel. - Nach von Schlosser 1993, Abb. S. 79. Wachsbüste des Pfarrers Georg Wilhelm von Kirchner. - Nach von Schlosser 1993, Abb. S. 88. Wachsbüste von d'Aguesseau. - Nach von Schlosser 1993, Abb. S. 90. Wachsfigur Friedrichs des Grossen. - Nach von Schlosser 1993, Abb. S. 84. Pablo Picasso, Porträt des Ambroise Vollard. - Nach Cézanne und die M o d e r n e (Ausst Kat. Fondation Beyeler Basel), Ostfildern-Ruis 1999, Abb. 70.
ACHATZ V O N M Ü L L E R
Der Politiker am Fenster Zur historischen Ikonographie eines „lebenden Bildes" M I T TAFELN
XLVIII-LVI
Blickfenster und Fensterblick Das Fenster öffnet den Blick auf das Innere der hochmittelalterlichen Stadthäuser. Nach außen zu blicken, kommt niemandem in den Sinn. Die Fensterordnungen des 13. und 14. Jahrhunderts halten in Mitteleuropa den Blick nach innen als Ordnungsmerkmal fest. Er bezeugt die Ehrbarkeit des Hauses. So werden Tavernen dazu angehalten, ihre Fenster zu vermauern, wie umgekehrt „ehrbaren Kaufleuten" das R e c h t eingeräumt wird, neue Fensteröffnungen an ihren Häusern zu schaffen. Es geht dabei nicht um Licht und Luft wie in den scheinbar ähnlichen Baumaßnahmen und Bauordnungen des späten 19. und 20. Jahrhunderts, sondern um — Sozialhygiene. 1 Das Fenster nämlich erscheint als Korrespondent des Auges. Spätantike sowie vor allem früh- und hochmittelalterliche Metaphorik verweist vielfach auf solche Korrespondenz. Die wichtigste Autorität ist hier in vielen Fragen auch Augustinus. Er weist den Augen die Eigenschaft zu als Fenster des Geistes — der Psyche — zu dienen: „Die Augen sind Gliedmaßen des Fleisches, aber Fenster des Geistes (fenestrae mentis). Wer durch sie blickt, befindet sich in ihm." 2 Das Zitat erhält seinen Sinn, wenn der Blick in die Augen, das will heißen: in die Fenster, vorausgesetzt wird, nicht durch die „Fenster" nach außen. Ambrosius fügt warnend hinzu: „Der Tod zieht durch die Fenster der Augen ein." Und da die Gefahren den Unbewachten am schnellsten überwältigen, rät nahezu die
1 Fensterrechte können im Spätmittelalter vor den städtischen R ä t e n angefochten werden. Solche Anfechtungen unterliegen regelhaft bei Nachweis der Rechtsausübung - also der Existenz von Fenstern - über „Jahr und Tag". Es sei denn - und damit kommt die „sozialhygienische" Funktion ins Spiel - die „Ehrbarkeit" hinter den Fenstern ist zweifelhaft. Siehe R a t s entscheidungen z.B. bei W. Ebel (Hrsg.), Lübecker Ratsurteile, II, Göttingen 1956, Nr. 57; IV, Göttingen 1967, Nr. 3 und Nr. 5. 2 Dieser und erschöpfend weitere Belege bei Schleusener-Eichholz 1985, I, 220fF. und passim.
324
Achatz von Müller
gesamte Patristik seit Sedulius (4. Jahrhundert) unisono, nicht mit offenen Augen zu schlafen. Denn „im Schlaf sind die Augenfenster geschlossen, damit niemand unbemerkt eindringe". So lässt auch Gottfried von Straßburg Tristan vor der Gewalt der Liebe warnen, die „durch die venster der äugen / in viel manice edele herze sleich und daz zouber darin streich". 3 Umgekehrt ist dementsprechend vor dem Blick nach außen zu warnen. Hrabanus Maurus (9. Jahrhundert) spricht von der „concupiscentia oculorum", der Begierde der Augen, die bereits den Blick allein mit den Gefahren der Sünde konfrontiert. Der Pfaffe Lamprecht lässt den Helden seines Alexanderromans auf dem Weg zum Seelenheil über einen Edelstein in Form eines Auges stolpern, der - wie ein Orakel dem Helden verrät - nur mit Erde und Flaumenfedern gewogen werden kann. Die Lösung ist schlicht aber ergreifend: das Auge lenkt ab — vom Heil zur Welt, und es wiegt nichts — leicht wie Flaum. 4 Gleichartige Warnungen, garniert mit der uns bereits geläufigen Drohung, der Tod ziehe durch das geöffnete Auge ein, finden sich gleich - und ähnlich lautend bei Bernhard von Clairvaux, Wilhelm von St. Viktor - der Elite hochmittelalterlicher Theologie. Auch hier wird immer wieder Augustin angeführt, der vor der „petulantia" der Augen warnt, der Lust des Auges am Umherstreifen. Je schwächer die moralische Konstitution und Festigkeit, desto mehr habe man daher auf die Zügelung des Auges zu achten. Und „man" ist hier nun deutlich „frau", denn eben deshalb sei sie besonders gefährdet und müsse daher züchtig die Augen senken: „contra petulantiam". So hat das Auge also ohnehin nicht umherzuschweifen - und schon gar nicht aus dem Fenster. Denn dieses ist das unmissverständliche Allegorem des Auges, versinnbildlicht seine Gefährdung. Und dennoch blicken wir alle wie selbstverständlich aus unseren Fenstern, genießen die Ausblicke - jeder gewiss auf seine Art und mieten oder vermeiden Häuser mit der Titulatur „Bellevue", „Bella vista" etc. Die ersten Impulse, die Blickrichtung auf und durch das Fenster zu verändern, sind zu Beginn des 14. Jahrhunderts auszumachen. Wohl nicht ganz zufällig in Italien. Denn hier sind die politischen und sozioökonomischen Bedingungen, ja Notwendigkeiten für Wahrnehmung und Kommunikation besonders intensiv. Aber um Missverständnisse zu vermeiden: Es geht dabei nicht um eine sozialdarwinistische Theorie von Challenge und Response. Kulturelle Prozesse verhalten und vollziehen sich komplex. Zudem kennen wir noch keine nur einigermaßen geglückte Anwendung der Chaos-Theorie auf kulturelle Zusammenhänge. So bleibt uns nur eine Mischung von Verfahrensweisen übrig, denen „die Wahrheit" an sich verdächtig ist, die aber Assoziationsbedingungen aufzeigen, Bedeutungszu-
3
Schleusener-Eichholz 1985, I. Lamprechts Alexander nach den drei Texten mit den Fragmenten des Alberic de Besançon und den lateinischen Quellen, hrsg. von K. Kinzel, Halle an der Saale 1884, v. 7144 ff. 4
Der Politiker am Fenster
325
sammenhänge rekonstruieren, Repräsentationsweisen des Imaginären mit E r scheinungsformen des Sozialen kombinieren. Z u r ü c k also z u m Blick durch das Fenster nach außen: D e r W e g dorthin fuhrt über Repräsentationsinteressen, N a t u r w a h r n e h m u n g u n d Aufwandsinvestitionen in den m o n e t ä r entwickelten, politisch u n d sozial mit gänzlich n e u e n G r u p p i e rungen konfrontierten Aufsteigergesellschaften Italiens - fast gleichgültig ob sie „seigneural" oder „bürgerlich" orientiert waren. Eine erste Spur zum Blickwechsel weist auf einen Text des Bologneser Juristen u n d Frühhumanisten Pietro de Crescenzi: Ruralia Commodora. Es geht u m den fragilen Blick in den Garten. B u c h 8 seines Traktates handelt von „Gärten u n d anderen Annehmlichkeiten" (de viridariis et rebus delectalibus). Hier ist n u n im Unterschied zu Gartentexten (Albertus Magnus, Jean de M e u n ) , die eine G e n e ration zuvor n o c h als m o d e r n galten, der Garten nicht nur auf seine „locus amoenus"-Qualitäten u n d die damit verbundenen Paradiesesassoziationen g e w ü r digt, sondern — u n d das ist neu (wenn auch mit Blick auf Vitruv u n d Plinius so neu auch w i e d e r u m nicht) — sein Verhältnis z u m Haus u n d vice versa behandelt. D e r Garten der Mächtigen soll - so heißt es — ein M e d i u m der M a c h t sein. Er wird gleichsam vom Palast geschaffen. Dieser spendet ihm Schatten, bevölkert ihn mit seltenen Tierarten, wie sie die Mächtigen als Zeichen ihrer Herrschaft auch über die N a t u r lieben, u n d er spendet den Wechsel der Blicke u n d behält doch zugleich den Blick über das Ganze. 5 Dieses Zusammenspiel von Haus u n d Garten als Spiel der herrschaftlichen Blicke aus d e m Hause heraus wird in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts von Leon Battista Alberti, d e m wichtigsten Theoretiker der patrizischen Lebensführ u n g der italienischen Frührenaissance, sowohl in seinem Familientrakt als auch seinen Zehn Büchern über die Baukunst wieder a u f g e n o m m e n u n d vertieft. D e r Garten konstruiert sich nach ihm als Repräsentation des Hauses durch den h e r r schaftlichen Blick aus d e m Haus. In dieser F o r m setzt sich der nach außen gewendete Blick in den Architekturtraktaten des 16. u n d 17. Jahrhunderts fest bis hin zu Sir H e n r y Wottons Elements of Architecture von 1624. Mit Evelyn u n d Brown beginnt dann j e d o c h ein ganz anderer D u k t u s die Gartenarchitektur zu prägen: die heroische Landschaft. Ein wenig davon ist j e d o c h bereits bei Erasmus von R o t t e r d a m in seinem Convivium von 1522 zu ahnen. Das ideale herrschaftliche Haus blickt hier auf Bilder, Sinnsprüche u n d piktorial geordnete Natur, u n d m a n ahnt, dass der Blick der Herrschenden durch die Herrschaft des Blicks substituiert werden könnte. 6
5 Nach d e m von W. R i c h t e r rekonstruierten Text, in: C. A. W i m m e r , Geschichte der Gartentheorie, Darmstadt 1989, 26 ff. 6 Erasmus von Rotterdam, Colloquia familiaria. Vertraute Gespräche: Convivium religiosum, in: Ausgewählte Schriften, hrsg. von W. Welzig, VI, Darmstadt 1967, 26 ff.
326
Achatz von Müller
Die Betrachtung des Hauses von außen, in dem die geöffneten Fenster den Blick auf Ehrbarkeit und sozialen Status freigeben — sich gleichsam dem kontrollierenden Blick öffnen — beginnt somit seit dem 15. Jahrhundert und konsentiv bis hin zum topischen Gebrauch im 15. und 16. Jahrhundert der herrschaftliche Blick aus dem Haus zu korrespondieren. In welcher Weise dabei die Fenster beteiligt sind, wäre noch genauer zu beleuchten. Die Trecento-Novellistik hört, erfindet, vor allem aber erzählt nämlich eine ganze Reihe von Geschichten, in denen der Blick bzw. die Wahrnehmung aus dem Fenster heraus eine pointierende Rolle spielt. Vor allem Frauen treten dabei als Akteure auf. Sie hören, riechen und blicken nun offenbar mit Lust aus dem Fenster, ohne einen Gedanken an Augustinus oder Ambrosius zu verschwenden. Wohl aber an den Ehemann. Denn oft genug verbietet er der Frau das „fensterin" — wenn es erlaubt ist, diesen Begriff für italienische Stadtgesellschaften vor über 600 Jahren zu verwenden. Die Ehemänner wenigstens kennen die Gefahren der „petulantia", - der Reize, die das umherschweifende Auge empfängt. Dass auch Nonnen davor nicht gefeit sind, weiß Boccaccio mehrfach zu berichten, so wie er weiß, dass eben dieser Umstand den Reiz seiner „novelle" ausmacht. In einer seiner berühmtesten „novelle" des Decamerone blickt eine Äbtissin aus dem Fenster — natürlich in den Garten und bewundert das Muskelspiel ihres stummen Gärtners. Alles weitere ist schnell zu denken, wie auch der Trick des Gärtners Masetto de Lamporecchio, der sich stumm stellt. Raffiniert auch die Novelle, in der eine junge Witwe einen in sie verliebten Gelehrten im winterlichen Hof halbnackt frieren lässt, während sie sich mit ihrem Geliebten auf doppelte Weise vergnügt: sie frönen der Liebe und blicken dabei auf den frierenden Gimpel aus ihrem Fenster herunter, „ohne selbst gesehen zu werden". Wir werden diesem Motiv ganz ohne novellistische Verfremdung wieder begegnen. Bei Sacchetti blickt eine französische Aristokratin (de Beucaire) mit ihrer Dienerin in den Garten. Beide Frauen beobachten Spatzen bei ihrem Frühlingsgeschäft und im Hintergrund einen Eselshengst „mit eingelegter Lanze", wie es bei Sacchetti ritterlich heißt. Und rasch sind sich beide Frauen einig, dass ein kräftiges „IA" ihnen lieber sei als hundertfaches „Piep-piep". 7 Die Botschaft dieser Novellen und vieler anderer ist recht eindeutig: Die Kirchenväter haben recht; der Blick durch das Fenster nach außen steckt voller Gefahren für die moralische Konstitution. Aber nichts kann die Frauen — und hier sind sie tatsächlich Frauen und zugleich die „geborenen" Repräsentanten des Hausinneren — abhalten, ihn zu wagen. Damit bezeugen sie die Öffnung des Blicks nach außen — ebenso wie die realen technologischen Modernisierungen der Fensterarchitektur, die nun mit einem System unterschiedlicher Klappen aus-
7
G. Boccaccio, Decamerone, VIII, 7. F. Sacchetti, Novelle, Nr. 226.
D e r Politiker am Fenster
327
gerüstet wird, die den Blick nach draußen ermöglichen, ohne den Blick nach innen freizugeben. Diese Klappen werden daher „Spione" genannt. 8 Die moralische Fragilität bleibt dem Fenster an sich ebenso eigentümlich erhalten wie seine nur scheinbar widersprüchliche Bedeutung als Zeichen der Ehrbarkeit.
Die ausdifferenzierte Repräsentation Der politische Kontext des Fensters jedoch konstituiert sich am herrschaftlichen Palast. Dabei spielen die neuen Signoriepaläste in den popolane — also von Bürgerräten dominierten - Städten Mittel- und Norditaliens eine bedeutsame Rolle. In Florenz repräsentiert der am Ende des 13. Jahrhunderts errichtete Palazzo della Signoria den politischen (nicht sozialen) Sieg des Popolo über den Adel. In den ersten drei Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts wird der Palast konsequent als Blickfang ausgebaut. Der Blick auf den Palast dominiert dabei zunächst. Turm, Wappen, Zinnen und Prachtfenster zeichnen ihn als herrschaftliches Bauwerk aus. Dazu kommen Löwenzwinger und Marzocco — eine Löwenskulptur vermeintlich antiken Ursprungs, die zum Wahrzeichen der bürgerlichen Herrschaft wurde. Im Löwenkäfig ist sie nach dem Vorbild herrschaftlicher Tiergärten als gezähmte „wilde Natur" inszeniert. Seit 1323 jedoch wendet sich der Blick um. Der Palast beginnt mit der Piazza zu kommunizieren, indem ihm eine Bühne vorgebaut wird - die Rhingiera. Auf ihr sollen fortan die politischen Rituale der Signorenwahl, ihrer Präsentation, Empfänge und öffentlichen Verlautbarungen feierlich vollzogen werden. Ein Theater der Macht und doch eine willentliche Sichtbarmachung von bis dahin weitgehend Unsichtbarem. Die Wendung nach außen, die der Palast damit vollzieht, wird 1356 durch den Beschluss zur Errichtung der Loggia dei Lanzi verstärkt. Die Loggia soll das politische Theater überdachen und ihm einen eigenen architektonisch hervorgehobenen Raum zukommen lassen, Steigerung also der herrschaftlichen Aura bewirken. Auch hier ist Florenz nur ein Beispiel für eine Reihe ähnlicher Bauvorhaben. Bedeutende kommunale Loggien finden sich im etwa gleichen Zeitraum in San Giminiano, Bologna und Siena. Vor allem aber die patrizisch-aristokratischen Familien dieser Städte beginnen für eigene Repräsentationszwecke Loggien zu errichten. Allein in Florenz werden bis zum Jahr 1470 über sechzig Adelsloggien den Palästen angegliedert, wie Leon Battista Alberti vermerkt, „zur Kühlung und um den Anblick weiser und würdiger Männer zu genießen". 9
8 A. Schiapparelli, La Casa Fiorentina e i suoi arredi nei secoli X I V e XV, Firenze 1908 ( N D a cura di M . Sframeli e L. Pagnotta, Firenze 1983, I, 130ff). 9 R . A. Goldthwaite, T h e Building of Renaissance Florence. An E c o n o m i c and Social History, Baltimore und L o n d o n 1980, 356 fi".
328
Achatz von Müller
Insofern ist eben der Bau der Loggia dei Lanzi eingebettet in einen Prozess formaler AusdifFerenzierung sozialer und politischer Repräsentationsräume, die für ein inszeniertes Wechselspiel der Blicke, Gesten und Worte zwischen städtischer Bürgerschaft einerseits und Mächtigen andererseits angelegt werden - bei den Medici übrigens deutlich nicht nur der Bürger, sondern gezielt auch der Kleinbürger und Unterschichten. Hier entsteht wohl doch nicht jene segmentierte „repräsentative Öffentlichkeit", von der Jürgen Habermas für sein Konstrukt des Strukturwandels ausgeht, sondern eher ein Interaktionsfeld, ein Machttheater, in dem Akteure und Publik u m im Wechselspiel der Aktionen und Figurationen ihre Rollen potentiell und zuweilen auch real zu tauschen vermögen. Die besondere Aufmerksamkeit bereits der Zeitgenossen für die Loggia dei Lanzi beruht also nicht auf ihrer Einmaligkeit, sondern auf dem Aufwand, der ihr zuteil wurde, konkret: den Dimensionen des Baus sowie vor allem auf dem Widerstand, den der Baubeschluss von 1356 hervorrief. Matteo Villanis bekannte polemische Pointe, die „Signori" im Palast hätten aus reiner Langeweile das Loggiaprojekt entdeckt, entwertet beinahe seinen sehr viel ernsthafteren Einwand, diese Loggia sei ein signifikantes Merkmal der Tyrannis. Die allmähliche Oligarchisierung, ja Aristokratisierung der Florentiner Politik hatte er dabei ebenso erahnt, wie er die Rolle der monumentalen politischen Zeichen in diesem Prozess begriff. 1 0 Wenn aber Villani und seine mittelständischen Parteigänger den Bau der Loggia fast 30 Jahre verzögern konnten — sie wurde erst 1382 fertiggestellt —, so war doch der mächtige soziale Transformationsprozess, der sich in formaler Ausdifferenzierung und zugleich Institutionalisierung politischer Repräsentation einen sichtbaren Ausdruck schuf, nicht wirklich aufzuhalten. — Wenn aber die Mächtigen nun bald ihre festen Bühnen besaßen, welche Rolle spielte da noch ein Fenster? — Im Repräsentationsritual war es ohne Funktion. Es blieb fragil.
Das Fenster als Bühne Tatsächlich entstand der politische Fensterauftritt eben gerade im Sog der neuen Repräsentationsrituale und ihrer architektonischen, ornamentalen und normativen Verfestigung. Wenn ich recht sehe, erfolgte der erste Fensterauftritt eines Politikers unter den Bedingungen der neuen Repräsentations- und Figurationsinteressen in R o m am 7. O k t o b e r 1354. Dabei handelt es sich vielleicht nicht zufällig u m den Auf-
K. S. Sexton, History of Renaissance Civic Loggia. From the Loggia dei Lanzi to Sansovino, Ann Arbor 1998, 24 ff.
Der Politiker am Fenster
329
tritt eines Mächtigen, der in geradezu ingeniöser Weise selbst an der Entwicklung neuer Repräsentationsfiguren beteiligt war: Cola die Rienzo. Rienzo hatte 1347 als „Tribun des römischen Volkes" die ohnehin reiche politische Repräsentationsüberlieferung der „ewigen Stadt" in eine gewaltige Urbane Maschine verwandelt, die eine Serie lebender Bilder ausspieh - alle jedoch mit ein und demselben Motiv: Cola die Rienzo als Erneuerer von Stadt, Kirche und Imperium. Aus den Briefen Rienzos geht hervor, dass er diese Bildprogramme selbst entwarf und für ihre Verankerung im politischen Ritual der Stadt ein eigenes Formelbuch anlegte. Die Erneuerung des Kapitols als politisches Forum, des Kapitolspalastes als zentraler Residenz und Stadtpalast sowie die Nutzung der von Papst Bonifaz VIII. ein halbes Jahrhundert zuvor geschaffenen politischen Bühne an und um San Giovanni in Laterano mit der von Giotto dekorierten Benediktionsloggia waren zu festen Stationen im politischen Bildprogramm Colas ausgebaut worden. Senatoreneinkleidung, Ritterbad, Tribunenkrönung, Proklamation des italischen Kaisertums, Petrarcas Dichterkrönung waren die berühmtesten dieser Bildinszenierungen, eingebettet in nahezu tägliche Auftritte und Ausritte des Tribunen, die R o m in eine überdimensionierte „Sound and Light-Show" verwandelten. Rienzos politisches Programm war, Macht in Dekoration zu verwandeln. 11 Am 1. August 1354 war es dem Tribun nach seinem Sturz Ende des Jahres 1347, nach Flucht, Gefangenschaft, Schmeichelei und Krieg doch noch gelungen, erneut als Senator nach R o m zurückzukehren. Aber diesmal benötigte er nur zwei Monate, um die Stadt gegen sich aufzubringen. Am 7. Oktober 1354 standen „Bürger und Volk von R o m " an den hölzernen Barrikaden vor dem Kapitolpalast. „Viva il popolo!" war zu hören. Aber da dieser R u f auch zu Gunsten des Senators ausgelegt werden konnte, hieß es vielfach deutlicher: „Weg mit den Steuern und dem, der sie erhebt". Offenbar nur wenig erschreckt legte Rienzo Rüstung und Helm an und trat mit der Fahne R o m s an das Mittelfenster des obersten Stockwerkes. Er hob die Hand, wollte reden. „Doch", so schreibt der Anonimus Romanus, „die Menge wusste, wenn sie ihn hörte, würde sie umgestimmt werden. So wollte sie ihn nicht hören und begann wie Schweine zu grunzen, um seine Stimme zu übertönen". Ein Pfeil durchbohrte die erhobene Hand Rienzos. Darauf entrollte er stumm die Stadtfahne mit den goldenen Buchstaben S P Q R und dem Bild der Wölfin und wies mit der zerschossenen Hand auf sie: „So stand er, stumm und beredt wie ein Bild", berichtet wieder der Anonimo, um von diesem offenbar selbst überwältigt fortzufahren: „Wäre er geblieben, wäre er gewiss gerettet worden". - Aber Cola blieb nicht, hielt das Bildprogramm, in das er den eigenen Körper verwandelt hatte, nicht aus. Plötzlich machte er kehrt, verließ das Fenster und floh zu einem an-
11
Seibt 1992, 148 ff.
330
Achatz von Müller
deren, das in den Hof des Palastes blickte. Dort ließ er sich an zusammengeknoteten Tischtüchern herab und versuchte sich mit geschwärztem Gesicht, altem Mantel und dem R u f „Oben ist noch mehr zu holen" unter die Menge zu mischen. Dass er an einem Ring erkannt wurde, nötigt uns allerlei Gedanken über den Märchenton des „Anonimo" auf, der Rienzo sogleich darauf noch einmal — jetzt aber auf den Stufen des Kapitols — zu einem Bild erstarren lässt. Uber eine Stunde habe Rienzo dort gestanden, den Blick gesenkt, das Schwert in der Hand und ihm gegenüber die ebenso erstarrte Menge - bis diese plötzlich losbrach. Den fast zerstückelten Leib ohne Kopf habe man dann jedoch zum Palast zurückgeschleift und an einem Strick aus eben jenem Fenster baumeln lassen, in dem er zum ersten Mal zum Bild erstarrt war. 12 Haben wir mit dem Auftritt Cola di Rienzos gewissermaßen den Typus des erfolglosen Politikers am Fenster vor Augen, so bietet die Florentiner Politik des 14. Jahrhunderts nur wenig später den erfolgreichen. Am 18. Juni 1378 waren die Florentiner Stadtherren - die bürgerlichen „priori" — mit einem Teil der sozialen und politischen Elite im Palazzo della Signoria versammelt. Die Stadt befand sich in einer schweren Krise. Krieg mit dem Heiligen Stuhl, Wirtschaftsblockade und Versorgungsprobleme belasteten alle Gruppierungen der Florentiner Gesellschaft. Vor dem Palast warteten in gereizter Stimmung vor allem die Wollarbeiter der Stadt. Der Zusammenbruch der Ökonomie bedrückte sie am schwersten. Im Palast aber saßen Verbündete: das Aufsteigerklientel der mächtigsten neureichen Familie der Stadt — der Medici. An ihrer Spitze Salvestro de Medici selbst, der sogar formal auch an der Spitze der Regierung stand, aber die Vertreter der Mehrheitspartei im Rat, der alten Familien oder auch des „rechten Flügels der parte Guelfa" gegen sich wusste. Es war ein Konflikt des Handelsund Industriekapitals mit den grundbsitzenden ahnen- und standesstolzen R e n tenempfängern. Die Wollarbeiter standen in dieser Lage auf Seiten des Kapitals, hatten aber, wie sich später zeigen sollte, auch eigene politische Ziele. Salvestro hatte im Palast inzwischen die Machtfrage gestellt: Umkehrung der politischen Mehrheiten zu Gunsten der Geldpartei. Die „oligarchische" Partei wies ihn zurück. Da öffnete er — nach anderen Berichten sein wichtigster Gefolgsmann, „un amico e bracchio", Benedetto Alberti — das Fenster des Sitzungssaals, stellte sich auf das Gesims und rief mit mächtiger Stimme: „Viva il popolo!" Sofort antwortete die Menge „Giustizia! Ai voti la petizione". Im großen Saal wartete der „consiglio del Popolo" entsprechend der Sitzungsordnung auf Dekrete der Prioren, über die er abzustimmen hatte. N u n erhielt er die Vorlage über das Medium des Fensters direkt von der Piazza. Mit immerhin nur drei Stimmen Mehrheit stimmte er dem Machtwechsel zu Gunsten der Geldpartei zu.
12
154f.
Seibt 1992, 209. La vita di Cola di Rienzo, a cura di A. M . Ghisalberti, Firenze 1928,
Der Politiker am Fenster
331
Der Politiker am Fenster hatte allerdings, ohne es zu wissen, nicht einer Machtverschiebung den entscheidenden Anstoß gegeben, sondern einer tiefgreifenden Revolte. Es war das Signal für den Ausbruch des berühmten Aufstandes der Ciompi gewesen, auf dessen Höhepunkt einen Monat später die Arbeiter selbst die Macht übernahmen. 1 3
Der Feind am Fenster Der hier hängt (Abb. 1), ist nicht Cola di Rienzo, sondern Giuseppe Rinaldeschi. Ein fröhlicher Tunichtgut, der eines Abends im Jahr 1501 in Florenz an der Kirche Sta. Maria de' Ricci vorbeigeht und in klassischer Säuferlaune einen Pferdeapfel auf die Verkündigungsszene im Tympanon der Tür zur Sakristei wirft. Bekanntlich haben stille, nächtliche Straßen viele Augen. Schon am nächsten Morgen wird Rinaldeschi verhaftet, recht zügig wegen Gotteslästerung und damit zugleich Hochverrats verurteilt und an einem Fenster des Bargellopalastes (Sitz der Polizei und des Kriminalgerichtes) aufgehängt. Der Klerus der geschändeten Kirche ließ auf Kosten Rinaldeschis ein Schandbild anfertigen, eines der wenigen erhaltenen. Das Aufhängen am Fenster — nicht die Schandbilder, sie waren älter — hatte die Stadt im April 1478 auf Geheiß Lorenzos de Medici eingeführt. Anlass war die berühmte Verschwörung des Clans der Pazzi gegen die Medici gewesen, die Lorenzo fast, seinem Bruder Giuliano tatsächlich das Leben kostete. Die Verschwörer und ihre Verbündeten wurden an den Fenstern im oberen Stockwerk des Palazzo della Signoria aufgehängt und starben dort langsamer und qualvoller als am Galgen. Der zu den Verschwörern zählende Erzbischof von Pisa, Francesco Salviati, der das Hochamt im Florentiner D o m zelebrierte, bei dem das Attentat geschah, wurde in vollem bischöflichem Ornat aufgehängt. — Dies war nun zwar kein lebendiges Bild, aber doch ein lebendes - nämlich eine an harter Anschaulichkeit unüberbietbare „rappresentazione politica", eine „efFigies", die den Körper des politischen Gegners nicht in Wachs modellierte oder in eine „pittura infamante" - ein Schandbild — in cotumancia verwandelte, sondern als Stoff für ein Schreckensbild benutzte.
1 3 Z u m Geschehen: N. Rodolico, I Ciompi. Una pagina di storia del proletariato operaio, Firenze 1971, 85 ff. Zur Einschätzung: Il Tumulto dei Ciompi. U n momento di storia Fiorentina ed europea ( = Atti del Convegno internazionale di studi, tenuto a Firenze, 1 6 - 1 9 settembre 1979), Firenze 1981. A. von Müller, Ständekampf oder Revolution? Die Ciompi-Bewegung in Florenz 1 3 4 3 - 1 3 7 8 , in: Ansichten einer künftigen Geschichtswissenschaft, hrsg. von I. Geiss und R . Tamchina, II: Revolution. Ein historischer Längsschnitt, München 1974 ( N D Frankfurt am Main 1980), 54 ff.
332
Achatz von Müller
Cola di Rienzo, die Pazzi-Verschwörer und selbst Giuseppe Rinaldeschi waren als Fensterfiguren zu politischen Feinden erklärt worden. Sie hatten mit ihrer Verbildlichung eine — wenn auch tödliche — politische Aura erhalten, die sie in einen zweiten Körper verwandelte — den politischen Feind schlechthin. 14 Die Etablierung des Fensters zu einer politischen Bühne, auf der die Integrität der Stadt symbolisch wiederhergestellt wird, erhebt das Fenster selbst in j e n e n Bildern, die politischen Zusammenhängen gewidmet sind oder in politischen Zusammenhängen erscheinen, zum Zeichen der O r d n u n g und Integrität. R e p r ä sentative politische Stadtbilder zeigen daher Fluchten von Fenstern, Bögen und Loggien und verleihen den Stadtbildern auf diese Weise die Signatur und die Aura antiker Würde und O r d n u n g (Abb. 2). 15 Es geht dabei aber nicht nur u m eine allgemeine politische Signatur, sondern u m die Garantie von Recht, Schutz des Handels, Sicherung des Eigentums. Die Fensterbögen, Arkaden und Loggien garantieren den „kontrollierenden Blick". Das Fenster gewinnt dabei auch im „lebenden Bild" — den großen politischen Repräsentationen - signifikante Funktion. Bei Stadtfesten, den großen „Entrées" der Fürsten, Herrscher, Könige etc. ordnen Feststatuten die Drapierung der Fenster an. Kostbare Tücher, Wappen, am Ende Fahnen verwandeln in diesen Augenblicken all jene Fenster, die in die Inszenierung des Bildes einbezogen sind - die also „am Wege liegen" - in mediale Träger der städtischen Politik. Auch hier ist ihre Botschaft auf O r d n u n g und Einheit gerichtet. 1 6
Fenstercodes In den höfisch geprägten Repräsentationen Frankreichs und vor allem Burgunds dominiert die Festschreibung des Rituals allerdings so deutlich, dass Platz fur Formen inszenierter Spontaneität, wie ihn in den K o m m u n e n Italiens das Fenster bietet, nicht eingeräumt wird. Da die Repräsentationszwänge in diesen politischen Ordnungen durch äußere Bedrohung bzw. gänzliche Neuschöpfung herrschaftlichen Zusammenhalts außergewöhnlich stark waren, reagierten die Höfe mit einer Art „Invention of Tradition". Die zu diesem Inventionsarsenal gehö-
14
S. Edgerton, Pictures and Punishment. Art and Criminal Prosecution during the Florentine Renaissance, Ithaca und L o n d o n 1985. A. von Müller, Die Erfindung des inneren Feindes. Politische Prozesse in den spätmittelalterlichen K o m m u n e n Florenz und Venedig, in: U. M a n t h e und J. von U n g e r n - S t e r n b e r g (Hrsg.), Große Prozesse der römischen Antike, M ü n c h e n 1997, 174 ff. 13 Vgl. R . Krautheimer, Le tavole di Urbino, Berlino e Baltimore rieseminate, in: Rinascim e n t o da Brunelleschi a Michelangelo: la rappresentazione dell'architettura, a cura di H . MilIon e V. Magnago Lampugnani, Milano 1994, 233 ff. 16 Ph. Helas, Lebende Bilder in der italienischen Festkultur des 15. Jahrhunderts, Berlin 1999.
Der Politiker am Fenster
333
rende politische, historische und mythologische Literatur verwandelte in ihren hochrepräsentativen Texten und Bildern, die als kostbare Schaustücke gefasst wurden, den gesamten H o f in ein Repräsentationstheater. Auf dem Widmungsbild der offiziellen höfischen Edition der Geschichte Girarts von Roussillon erscheint daher der burgundische H o f mit seinen wichtigsten Vertretern in einem höchst dekorativen Pseudorealismus (Abb. 3). Alle Personen sind individuell erkennbar und doch zugleich Teile eines großen ornamentalen Musters. Das dargebotene Werk des Historikers Wauquelin beschert dem burgundischen System das, was es am wenigsten hat: eine eigene Geschichte. Girart, Graf von Paris und Regent des Königreichs Burgund-Provence, eine reale historische Gestalt des 9. Jahrhunderts, wird von Wauquelin in einen mythologischen Helden verwandelt, der Karl den Kahlen in die Knie zwang und die Autonomie Burgunds begründete. Die Überreichung des Buches ist daher, so wie im Bild gezeigt, als Staatsakt zu begreifen. Alles wird im Bild zu Bedeutung, auch die geschlossenen Fenster. Sie nämlich fungieren als Wappenträger der Eheallianz Burgunds mit Portugal, repräsentieren also die sonst im Bild abwesende Herzogin. 1 7 Im französischen Gegenstück, den offiziellen „Grandes Chroniques de France", die ebenfalls als politische Schaustücke erstellt wurden, erscheint die wichtigste Legitimationsszene des ganzen Werkes wie zuvor als höfische Repräsentation im politischen Z e n t r u m des Reiches, dem Thronsaal (Abb. 4). Auf dem Bild ist dargestellt, wie Edward I. von England Philipp dem Schönen von Frankreich den Lehenseid leistet. Die Szene aus der Hand Jean Fouquets weist eindringlich die Ansprüche Englands auf die französische Krone zurück, das höchst expressive Fenster transportiert das Bild förmlich nach außen. Fouquet erweist sich überhaupt als ein Meister der Fensterinszenierung. Seine großen „Entrées" lassen über die dicht besetzten Fenster den Außenraum wie einen Innenraum erscheinen. Die Menschen scheinen förmlich hereinzublicken nicht heraus. Auch Perspektivwechsel werden durch Fensterblicke pointiert. Das Fenster erscheint wie ein Scharnier, u m das sich das Bild dreht. Fouquets politischer Bilderbogen bittet jedoch auch die Herrscher selbst ans Fenster (Abb. 5). Hier ist es Philipp V., der mit drei handgreiflichen Krisenfaktoren seiner R e g i e rung konfrontiert wird: Der Fehde des Grafen von Nevers, dem Z u g der Pastorellen nach Paris und den vermeintlichen Brunnenvergiftungen durch Aussätzige und Juden. Das Fensterbild zeigt den König in j e n e m Augenblick, da er die Probleme löst. Die Aussöhnung mit dem Grafen von Nevers leuchtet golden aus dem Fenster herab, in eine Landschaft, die entsprechend Lösungen für die anderen Krisenphänomene bietet: Auszug der Pastorellen aus Paris, Verbrennung der Brunnenvergifter. Erneut erscheint der Politiker am Fenster in einem fragilen Augenblick, der Entscheidung und „Wende" markiert.
17
Thoss 1989, 11 ff. und passim.
334
Achatz von Müller
Ein anderes „Fenster" präsentiert politische Fragilität par excellence: Den Tod des Königs (Abb. 6). Der Tod Ludwigs VIII. (25. 8. 1270), aufgefangen durch die Salbung des 12-jährigen Ludwigs IX. spielt am Fenster, die Rückkehr zur Ordnung in einer offenen gotischen Sakralarchitektur. Der Diskurs zwischen den Szenen im Fenster und in der Loggia „spielt" dem Betrachter die Gefährdung der Ordnung und ihre repräsentative Sicherung durch das Konzept des politischen Erbes, der Dynastie, vor. 18
Herrscherträume am Fenster Was aber sind diese „Fenster" anderes als Konstrukte — Erfindungen? Sie sind virtuelle Fenster, durch die spezifische Ereignisse oder Handlungen einen eigenen Rahmen erhalten. Der „Politiker" — Träger von Herrschaft oder Repräsentant der Macht - gewinnt im Kontext dieser Ereignisse oder Wandlungen, abgesondert im virtuellen Raum eines virtuellen Fensters, vor allem eines: Bedeutung. Das „Fenster" bildet einen Bedeutungsraum, der den Mächtigen in eine profane Mandorla hüllt. Signifikant wird dieser Bedeutungsraum im Motiv des „Träumenden Herrschers". So wird der Lösungstraum Karls des Kahlen in der erwähnten burgundischen Girart-Erzählung des Wauquelin als Bedeutungsbild in ein Fenster verlegt. Durch den Traum gewinnt Karl die Versöhnung mit Girart und verweist damit auf die reale burgundische Gegenwart der Bildstiftung. Sollte doch Philipp der Gute, der Stifter und Empfänger des Buches, auch als Stifter der Aussöhnung Burgunds mit Frankreich erscheinen (Abb. 7). 19 Einer der interessantesten politischen Träumer war Kaiser Karl IV. Denn er erzählt seine Träume in seiner Autobiographie (Geschichte der Jugend) und liefert somit selbst die Vorlagen für spätere Illustratoren. Beispiele des späten 15. Jahrhunderts seien hier kurz betrachtet (Abb. 8). Karls Buch steckt voller Träume, die deutlich Kompensationscharakter haben und libidinöse Schuldgefühle verraten. Der abgebildete Traum aber ist der Traum an sich. Der Kaiser selbst berichtet von einer Erscheinung, die er nur als Bewegung wahrnahm. Der Chronist des Kaisers, Benesch von Weitmühl, macht daraus die Erscheinung eines grauen Männchens - eines Schrats. Der Illustrator und auch der einer zweiten Handschrift der Vita entscheiden sich für den Auftritt des Schrats, obwohl ihr Text (die Vita) diesen nicht nennt. Herrscherträume haben in den älteren Gesellschaf-
18
F. Avril, M . - T h . Gousset, B. Guenée, Jean Fouquet. Die Bilder der „Grandes Chroniques de France": mit der originalen Wiedergabe aller 51 Miniaturen von Manuscrit français 6465 der Bibliothèque nationale in Paris, Graz 1987, 197f., 219f. C. Schaefer, Jean Fouquet. An der Schwelle zur Renaissance, Dresden und Basel 1994, 172 ff. 19 Thoss 1989, 171 f.
D e r Politiker am Fenster
335
ten charismatische Funktion. 2 0 Die Selbstinszenierung des Herrschers als Träumer sollte ihn als Charismatiker stilisieren. Die Illustratoren nahmen eben diese Bedeutung des träumenden Herrschers in ihre Bilder auf, indem sie den Herrscher in ein Fenster legten. Sie gaben damit einen „bedeutungsvollen" Hinweis auf die überschreitende Funktion des Traumes. Im Traum verlässt der Träumende nach mittelalterlicher Traumlehre seinen Körper und nimmt Fernes unmittelbar wahr, holt es aus der Ferne in die Nähe. Der Traum ist ein Fernrohr, keine Entrückung. 2 1 So erscheint im Bild der träumende Herrscher doppelt: als Träumer und zugleich mit seinem Begleiter als Beobachter - außerhalb des Fensters. Die Verdoppelung des königlichen Körpers wird dabei ganz real erfasst: als König mit Krone träumt Karl, als träumender Mensch ohne Krone erblickt er den Schrat. Das Fenster separiert den träumenden Herrscher, lädt ihn aber zugleich charismatisch so auf, dass er zu eben dieser Passageleistung fähig wird.
Die Repräsentation der Passage Damit aber wäre ein entscheidender Begriff angesprochen: Passage. Das Fenster mit Politiker will mir als eine jener Höhlungen, Offnungen und Durchgänge erscheinen, die Arnold von Gennep in seinen Rites de Passage als Ubergangsorte vorstellt. Funktionen von Passage mit Passageorten sind nach ihm: Trennung, Schwelle und Angliederung, unterscheidbare, aber hier miteinander zu verbindende, in Bildern virtueller Repräsentationen kontrahierte Signifikatio22
nen. Den Zusammenhang von Passage und Repräsentation erfasst Michel de M o n taigne in einem Kapitel seiner Essays (III, 6), das über das Fahren in Kutschen handelt. Die Kutsche erscheint ihm als ein fahrendes Fenster — als Repräsentation und Passage zugleich. In ihm zeigen sich die Mächtigen für einen Augenblick - als politische Flaneure — und fahren sogleich ihrer konkreten Wahrnehmung, ihrer kritischen, vielleicht widerständigen Erfassung, „Aufnahme", durch die Beherrschten, weiter davon. Das Fenster mit Politiker kommt aber an sich ohne die Kutsche aus. Es ist ein imaginärer R a u m — voller Bedeutung und zu-
2 0 J . Le Goff, D e r Traum in der Kultur und in der Kollektivsprache des Mittelalters, in: Ders., Für ein anderes Mittelalter. Zeit, Arbeit und Kultur im Europa des 5 . - 1 5 . Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1984 und Weingarten 1987, 137 fF. J . Heise, Traumdiskurse. Die Träume der Philosophie und die Psychologie des Traumes, Frankfurt am Main 1989, 129ff. A. T. Grafton, Cardanos Kosmos. Die Welten und Werke eines Renaissance-Astrologen, Berlin 1999, 3 1 5 fF. 2 1 P. Dinzelbacher, Der Traum Kaiser Karls IV., in: A. Paraviccini Bagliani und G. Stabile (Hrsg.), Träume im Mittelalter. Ikonologische Studien, Stuttgart und Zürich 1989, 161 ff". 2 2 A. von Gennep, Ubergangsriten, Frankfurt am Main und N e w York 1986, 13ff.
336
Achatz von Müller
gleich fragil, instabil, im Übergang. A m Fenster kontrahiert die sanfte Fahrt, der von O r d n u n g e n u n d Ritualen umstellten Repräsentation zu einem einzigen schnellen Augenblick. In diesem Augenblick gibt eine Art ritualistischer Spontaneität A n t w o r t auf eine Situation, die auf Entscheidung zielt. D e r Politiker am Fenster repräsentiert nur n o c h sich selbst, substituiert situative Fragilität. Die Passagensituation erfasst dabei sowohl das Fest wie die Revolte, die Krise wie den Traum, den Tod wie den Sieg. O b der Passagenmoment als Schwelle erscheint, wie in der Ciompi-Revolte, als Trennung wie bei R i e n z o oder später b e i m Fenstersturz von Prag, als „Angliederung " wie bei den Festen oder in den königlichen Träumen - das allerdings m a g u n d wird von Fall zu Fall wechseln u n d auch der W a h r n e h m u n g überlassen bleiben. Gewiss ist n u r die Aufladung u n d Fragilität des Fensters u n d der Blicke.
Die Verkehrung von A u ß e n u n d Innen Anlässlich der H i n r i c h t u n g des Attentäters auf Ludwig XV., Robert-François Damiens 1757, schildert Casanova mit amüsiertem Grauen den Blick hinter die Fenster. Er sieht dort Höflinge mit ihren D a m e n stehen u n d sich an Damiens Q u a l e n weiden. D e n n der Attentäter wird mit Inbrunst gefoltert; u n d da er stark ist, lebt er lange. Höflinge u n d D a m e n blicken herab von den Fenstern der Paläste an der Place de la Grève. Es ist die literarische Inszenierung eines politischen Publikums bei der Vernichtung des politischen Feindes — ein Fensterbild — u n d zugleich der Travestierung des Fensterbildes. D e n n Casanova erfasst mit imaginärem Blick, was dem realen Blick der „Öffentlichkeit" verborgen bleibt: was hinter d e m Fenster geschieht. Die Aristokratie kopuliert b e i m Anblick der Q u a len des „Königsmörders". Sie vollzieht obszön seinen Todeskampf als sexuellen Akt nach - Sadismus avant la lettre. Politisch aber vollzieht sich ein R o l l e n tausch: Die Mächtigen am Fenster überlassen d e m geschundenen O h n m ä c h t i g e n das politische Handlungsfeld. N u r er ist n o c h allein politischer Akteur. 2 3 Die Revolution vollzieht diesen politischen Rollentausch strukturell u n d scheinbar endgültig. Ludwig X V I . tritt tatsächlich gegen alle Etikette mehrfach ans Fenster: Als Träger der Revolutionskokarde (Abb. 9) u n d in Versailles mit d e m Versprechen, nach Paris zu ziehen. So ahmt der König am Fenster nach, was längst durch andere Prozesse entschieden ist. Tatsächlich aber hat damit der Politiker am Fenster nicht abgedankt. Schon zuvor war er in ganz anderer G e -
23 G. Casanova Chevalier de Seingalt, Geschichte meines Lebens. N a c h der Urfassung, hrsg. und eingeleitet von E. Loos, V, Berlin 1967, 81 ff. D e n Z u s a m m e n h a n g von Wollust, Grausamkeit, Spektakel und Delegitimierung analysiert O. Flake, Marquis de Sade, Berlin 1930 ( N D M ü n c h e n 1966), 11 ff.
D e r Politiker am Fenster
337
stalt am Fenster erschienen: das Volk als der n e u e Souverän hatte sich bereits beim Ballhausschwur am Fenster gezeigt (Abb. 10). Jacques Louis Davids b e rühmteste Fassung dieser Szene lässt mit d e m n e u e n Souverän in den sich b a u schenden Vorhängen den S t u r m der Geschichte ahnen — eine D r a p e r i e - M e t a pher im „Stil" Warburgs mit doppelter Bedeutung. D e n n das Volk blickt n u n zum Fenster herein, transformiert die Positionen. Die w e h e n d e n Vorhänge u n terstreichen die Blickwendung. W i e Casanova schon bei Damiens ahnte, ist der politische Akteur n u n endgültig jenseits des Fensters zu suchen. „Viva il p o p o l o " hatte das Volk in R o m anlässlich des Fensterauftritts Rienzos gerufen, „Viva il P o p o l o " war es aus d e m Fenster des Palazzo della Signoria im Juni 1378 zu hören, jetzt am 19. Juni 1789 war es das Volk selbst, das am Fenster erschien. Die Fragilität des Fensters j e d o c h bleibt den politischen Prozessen, die durch Fensterauftritte ausgelöst werden, erhalten. Scheidemanns Gründungsaufruf der Weimarer Republik, Hitlers u n d Görings Fensterauftritt am 30. Januar 1933, Mussolinis fast serienhafte Uberspielung seiner Abenteuerpolitik am Fenster des Palazzo Venezia in R o m erscheinen als politische Bildinszenierungen des 20. Jahrhunderts, die den fragilen Charakter politischer Strukturen nicht n u r im Rückblick signifikant werden lassen. Vielleicht mit einer Ausnahme: Willy Brandt war bekanntlich ein Meister der politischen Bildinszenierung. Sein Auftritt am Fenster des Erfurter Hofes mit der b e r ü h m t e n beschwichtigenden H a n d bewegung, entsprach der Fragilität der politischen Lage durchaus. D e n n o c h war es eine wirkliche Trennungspassage, die sich hier vollzog. Trennung von der alten Politik u n d der erste Schritt zur Phase der Angliederung. Aber eben n u r der erste Schritt. Zugleich ging mit diesem Bild die Ära des „Politikers am Fenster" n u n doch zu Ende. Was wäre anderes zu erwarten in Zeiten der „politics o n screen", der Bildschirmpolitik! Aber zugleich hebt die unbegrenzte K o m m u n i k a t i o n durch Bilder, die sich vor uns auftut, die vermeintliche Autorität des Bildes e n d gültig auf. D a n n wäre die Fragilität des Fensterbildes ein Hinweis auf die Fragilität des Bildes an sich. Ein Hinweis, der uns vorbereitet.
Abgekürzt zitierte Literatur Schleusener-Eichholz 1985 G. Schleusener-Eichholz, Das Auge im Mittelalter ( = Münstersche Mittelalterschriften; 35, I), M ü n c h e n 1985. Seibt 1992 G. Seibt, A n o n i m o R o m a n o . Geschichtsschreibung in R o m an der Schwelle zur Renaissance, Stuttgart 1992. Thoss 1989 D. Thoss, Das Epos des Burgunderreiches: „Girart de Roussillon": mit der Wiedergabe aller 53 Miniaturseiten des W i d m u n g s e x e m plars für Philipp den Guten, Herzog von Burgund, C o d e x 2549 der Osterreichischen Nationalbibliothek in W i e n , Graz 1989.
338
Achatz von Müller
Bildlegenden Abb. 1: Abb. 2: Abb. 3: Abb. 4: Abb. 5: Abb. 6: Abb. 7: Abb. 8a und 8b: Abb. 9: Abb. 10:
Rinaldeschi hängt am Fenster des Bargello. Anonymes Tafelbild, um 1500, Florenz. Museo Stibbert. Francesco di Giorgio Martini (?), Stadtprospekt. Urbino Galleria Nazionale. Überreichung des „Girart de Roussillon" an Herzog Philipp den Guten von Burgund. Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 2549, fol. 6r. Huldigung Philipps des Schönen durch Eduard I. Jean Fouquet, Grandes Chroniques de France, Paris, Bibl. Nat. Ms. franc. 6465, fol. 301v. Aufnahme des Grafen von Nevers; Aufstand der Pastorellen, Hinrichtung der Aussätzigen. Jean Fouquet, Grandes Chroniques, a. a. fol. 327v. Einnahme von Avignon; Tod Ludwigs VIII.; Salbung Ludwigs IX. Jean Fouquet, Grandes Chroniques, a. a. O., fol. 251v. Karls Traum während der Belagerung durch Girart. Miniatur des „Girart de Roussillon", Wien, Österr. Nationalbibl., C o d . 2549, fol. 162r. Karl IV. erblickt im Traum den Schrat. Beide: Wien, Österr. Nationalbibl., 8a: C o d . Ser. N . 2618, fol. 18v.; 8b: C o d . 581, fol. 21v. Ludwig XV. grüßt das Volk am Fenster am 17. Juli 1789, Kupferstich. Privatbesitz. Ballhausschwur, Variante nach David. Kupferstich, Privatbesitz.
VI
O S W A L D PANAGL
Bezeichnung
und
Bedeutung
Wortgeschichtliche Streifzüge im Sinnbezirk des Bildes Der Stellenwert und Aufschlussrang der Etymologie für die aktuelle W o r t b e d e u tung, für den Sprachgebrauch und definitorischen Bedarf ist im Wechsel der Epochen und im Wandel der Diskursebenen ganz verschieden beurteilt worden: Im Wellengang der Kultur- u n d Geistesgeschichte lösen die Flut der U b e r schätzung und die Ebbe der Geringachtung einander in bunter Folge ab. Dafür nur einige rasch herausgegriffene Beispiele: Für eine R i c h t u n g der antiken Grammatik und Lexikographie war die £Tij(ioÄoyia nicht bloß die G r u n d b e d e u tung, das älteste erreichbare semantische Profil eines Ausdrucks, sondern die w e senhafte, dem sprachlichen Zeichen immanente Aussage, was die lateinische Lehnübersetzung des Begriffs veriloquium1 noch deutlicher belegt. Eine stark formal orientierte Sprachbetrachtung, wie sie das Denken der J u n g grammatiker im späten 19. Jahrhundert charakterisierte, hielt sich bei der W o r t forschung an die leichter objektivierbaren Kriterien von Lautgesetz, Analogie und Stammbildung, während sie die Semantik mit ihren Imponderabilien, mit ihrer Kasuistik und Anekdotik für schwer systematisierbar hielt und damit als Fremdkörper in der Theoriebildung einstufte. 2 Im sprachlichen Strukturalismus der ersten Hälfte unseres jüngst ausgegangenen Jahrhunderts wurde das Konzept einer h o m o g e n e n sprachlichen B e d e u t u n g schier aufgegeben, es verschwand einerseits hinter enzyklopädischem Wissen über die Welt u n d ihre Gegenstände u n d mutierte auf der anderen Seite zu einem behavioristischen Schema von R e i z und R e a k t i o n . 3 Die gegenwärtige kognitive Linguistik findet ihr Heil in einer Ö f f n u n g zur Psychologie und Biologie, sucht aber auch verstärkt den Z u g a n g zu soziologi-
' Das Ü b e r s e t z u n g s k o m p o s i t u m g e h t auf C i c e r o z u r ü c k (Top. 35) u n d w i r d in d e r Institutio oratoria des Q u i n t i l i a n (1,6,28) a u f g e g r i f f e n . 2 G r u n d l e g e n d u n d aufschlussreich ist n a c h w i e v o r das so g e n a n n t e j u n g g r a m m a t i s c h e Manifest, also das V o r w o r t zu H . O s t h o f f / K . B r u g m a n ( n ) , M o r p h o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n auf d e m G e b i e t d e r i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n , I, Leipzig 1878, I I I - X V . 3 E x e m p l a r i s c h vertreten w i r d diese Position v o n L. B l o o m f i e l d , Language, N e w York 1 9 3 3 ( N D N e w York 1965).
342
Oswald Panagl
sehen Sehweisen und ethnologischen Nischen - so im Bereich von Euphemismus, Sprachtabu 4 und sprachlichen Stereotypen wie Feind- und Fremdbildern 5 . Eine seltsame, für manche befremdliche Wiederkehr der Etymologie zeigt sich in der soeben im deutschsprachigen R a u m umgesetzten Orthographiereform, die älteren Lautungen und längst verschütteten paradigmatischen Zusammenhängen wieder Geltung verschafft: einleuchtend bei überschwänglich (neben Uberschwang), mittelbar bei Stängel (zur semantisch bereits fernliegenden Stange), eher skurril bei schnäuzen, dessen Basiswort Schnauze man höchstens im Jargon auf Menschen und dann nicht auf ihre Nase bezieht. Im philosophischen Diskurs war der Rückgriff auf den Wortursprung, auf die eigentliche Bedeutung zu allen Zeiten ein beliebtes argumentatives Instrument, wobei die Grenzen zur Volksetymologie, zu nachträglich hergestellten semantischen Tangenten, nicht selten überschritten, j a schmerzlich verletzt worden sind. Notorische Beispiele finden sich allenthalben in den Schriften Martin Heideggers, dessen erkenntnistheoretische Deduktionen sich durchaus auch als wirbelnde Wortspiele und schillernde Sprachkaskaden lesen lassen.6 Ein heterogenes Bild der Etymologie also: bald ontologisch überfrachtet, dann wieder als historisierende Deckfarbe bemüht, häufig aber nur noch schöngeistige Arabeske und bildungsbeflissener Zierat für Sonntagsreden oder Festansprachen, wohlfeiler Selbstbedienungsladen in der ebenso wohl sortierten wie ungeschützten Vorratskammer der Wörterbücher. Was viele selbsternannte Herolde und eifrige Nutznießer des etymologischen Reservoirs gerne vergessen, ist die Sprachgeschichte mit ihren Weichenstellungen, Hürden und Engpässen, ist aber auch jenes Bündel aus normativen Setzungen, gezielter Auswahl und spontanem Zufall, welches kultureller Wandel, der Wechsel der politischen Systeme und gesellschaftlichen Institutionen, aber auch ein veränderter Wertekanon den Wortbiographien schnüren und zwischen U r sprung und aktuellen Gebrauch eines Ausdrucks legen. 7 Lassen Sie mich diese Aussage zur Illustration mit zwei Beispielen aus dem Lexikon der militärischen Fachsprache belegen: die Charge eines Leutnants (französisch lieutenant) lässt sich zwar eindeutig auf eine lateinische Junktur locum
4 Vgl. dazu den rezenten Ansatz von G. Lakoff, W o m e n , Fire and Dangerous Things. W h a t Categories Reveal about the Mind, Chicago und London 1987. 5 Grundsätzlich dazu und mit historisch-literarischen Daten O. Panagl, Verbale Feindbilder am Ende der Donaumonarchie und im Umfeld des Ersten Weltkriegs, in: Neohelicon: Acta Comparationis Litterarum Universarum; 2 3 / 1 (1996), 3 1 - 5 9 . 6 Dazu sprachkritisch M . Wandruszka, Wörter und Wortfelder. Aufsätze, hrsg. von H. Bertsch, Tübingen 1970, 1 0 7 - 1 2 1 . 7 Zu den verschiedenen Lesarten und Gebrauchsweisen von Etymologie sowie ihrem Verhältnis zur Wortgeschichte vgl. J . Untermann, Etymologie und Wortgeschichte, in: Linguistic Workshop, III. Arbeiten des Kölner Universalienprojektes 1974 (Structura. Schriftenreihe zur Linguistik; 9), hrsg. von H. Seiler, München 1975, 9 3 - 1 1 6 .
Bezeichnung und Bedeutung
343
tenens zurückfuhren, dennoch wäre eine synchrone Umschreibung oder gar Ersetzung durch „Platzhalter" oder „Stellvertreter" unpassend, j a sinnstörend. Die Position im neuen semantischen Feld wird strukturell wie pragmatisch definiert und hat ihre sprachgeschichtlichen Relikte abgestreift. Noch krasser ist die Situation beim Worte Marschall. Wiederum steht die Herkunft als althochdeutsches Kompositum marahscalc fest, doch eine Bezeichnung dieses hohen militärischen Würdenträgers als Pferdeknecht wäre nicht bloß anachronistisch, sondern hätte vielleicht sogar zivilrechtliche Folgen. Die Aufwertung des zunächst subalternen, aber im Zeitalter der Postwagen und Reiterheere wichtigen Berufs hat sich bekanntlich über die Einfuhrung der Amter am karolingischen Herrscherhof ereignet. Im Französischen hat sich das Lehnwort aus dem Deutschen auf zwei hierarchischen Stufen erhalten: als maréchal ferrant „Hufschmied" und maréchal des logis „Quartiermacher" auf der niedrigen Etage, als maréchal de France auf der höchsten Ebene des nationalen Heereswesens. Bedeutungswandel heißt also j e n e Instanz, die sich zwischen den Wortursprung bzw. ältere Belege und den modernen, heutigen Sprachgebrauch schiebt. Was im Einzelfall und bei oberflächlicher Betrachtung zufällig, willkürlich, ja absurd erscheinen mag, nimmt Regularität und Transparenz an, hat man erst einmal die typischen Tendenzen und dominanten Richtungen semantischer Veränderung erkannt, beschrieben und klassifiziert. Ich möchte, ehe ich auf den materiellen, themenbezogenen Teil meines R e f e rates übergehe, zur Einstimmung die wichtigsten Trends der Bedeutungsentwicklung wenigstens an jeweils einem Beispiel vorstellen, wobei ich mich wegen der vorteilhaften Kombination von philologischer Vertrautheit und zeitlicher Distanz auf lateinische Daten beschränken werde. Die ersten drei Spielarten des Bedeutungswandels bewegen sich jeweils zwischen zwei Polen, sind also konvers anwendbar. Verbalnomina und Adjektivabstrakta tendieren zur Konkretisierung, aus einer Aktion oder einer Eigenschaft werden Gegenstände oder Vorrichtungen: rogus, eigentlich „das Aufrichten", wird zum „Scheiterhaufen", liberalitas „Großzügigkeit" kann im Spätlatein auch ein „splendides Geschenk" bedeuten. Den umgekehrten Weg der semantischen Drift legen häufig Intellektualverben zurück: concipere, von konkretem capere hergeleitet, wird ebenso wie die deutschen Pendants erfassen, begreifen zum angemessenen Ausdruck fur kognitive Aneignung, legere entwickelt sich vom manuellen Sammeln zum verstehenden Lesen. Bei der Bedeutungserweiterung werden semantische Merkmale ausgelagert, wodurch ein Vokabel im gleichen Maße unspezifischer und breiter verwendbar wird: Das Verbum aedißcare trägt die ursprüngliche Einschränkung auf die Architektur in seinem Wortkörper, was eine spätere Konstruktion mit Objekten wie navem nicht verhindert. Im umgekehrten Prozess der Bedeutungsverengung werden kontextuelle Angaben zu Bedeutungsfacetten verdichtet und dem semantischen Aggregat eines Wortes einverleibt, das sich damit ebenso präziser wie rest-
344
Oswald Panagl
riktiver i m G e b r a u c h darstellt. Eine ältere Phrase orbus ab oculis, also „der A u g e n b e r a u b t " , i n k o r p o r i e r t die präpositionale A n g a b e derart, dass schon bei Apuleius bloßes orbus „blind" b e d e u t e t , was sich in italienisch orbo ebenso fortsetzt w i e u m g e k e h r t der präpositionale Ausdruck ab oculis in französisch aveugle weiterlebt. Gegensatzprofile der zunächst subjektiven, später objektiv-konventionellen B e w e r t u n g sind die Verbesserung u n d Verschlechterung der W o r t b e d e u t u n g . Meliorisierung liegt, häufig im Gefolge eines kulturellen Wandels o d e r geistesgeschichtlichen U m b r u c h s , d a n n vor, w e n n crux als „Schandholz" der Plautuskom ö d i e n in der christlichen D i c h t u n g z u m Erlösungssymbol u n d transzendentalen H o f f n u n g s t r ä g e r aufsteigt. D i e viel gängigere Pejorisierung, aus Skepsis o d e r n e gativen E r f a h r u n g e n h e r r ü h r e n d , aber auch aus U n d e r s t a t e m e n t resultierend, zeigt sich z.B. in latro, dessen R e f e r e n z radikal von altlateinisch „Mietsoldat" zu klassischem „Straßenräuber" umspringt. A u f weitere Möglichkeiten des semantischen Wechsels sei wenigstens p u n k t u ell verwiesen: so die volksetymologische N e u d e u t u n g in e i n e m Beispiel w i e curiosus, dessen g e n u i n e Basis curia durch rezenten B e z u g auf cum ersetzt wird, was eine j ü n g e r e B e d e u t u n g „sorgfältig, eifrig" anbahnt. B e d e u t u n g s w a n d e l via Ellipse liegt dann vor, w e n n ein Syntagma aus V e r b u m u n d O b j e k t o d e r eine Verb i n d u n g von Adjektiv u n d Substantiv in Fachidiomen invariant u n d damit selbstverständlich wird, so dass i m einen Fall die Ergänzung, im anderen das B e z u g s n o m e n wegfallen k a n n u n d ihr semantischer Gehalt jeweils im verbleibend e n R e s t a u f g e h o b e n ist. Aus e i n e m trivial g e w o r d e n e n navem appellere wird in der Matrosensprache ein intransitives appellere „landen"; fera o d e r ferum k a n n f ü r sich das „wilde T i e r " bezeichnen, j e n a c h d e m o b bestia o d e r animal ursprünglich vorgelegen ist bzw. später hinzugedacht w e r d e n k o n n t e . 8 Endlich k a n n sich auch eine Veränderung der Lebensumstände, der realen Verhältnisse u n d zivilisatorischen G e g e b e n h e i t e n sprachlich als semantischer W a n d e l niederschlagen: das e r klärt die spezifische B e d e u t u n g von pecunia „finanzielles V e r m ö g e n " g e g e n ü b e r d e m G r u n d w o r t pecu, das w i e d e r u m in seinen h o m o p h o n e n , n u r orthographisch geschiedenen germanischen E n t s p r e c h u n g e n englisch fee u n d deutsch Vieh n o c h das gleiche semantische Differential a u f w e i s t / E h e ich nach diesen heuristischen u n d m e t h o d i s c h e n Präliminarien auf B e i spiele aus d e m Sinnbezirk der bildlichen Darstellung eingehe, muss ich n o c h einen weiteren terminologischen Schritt setzen, eine zwar einleuchtende, aber
8
Z u diesen und weiteren Beispielen s. O. Panagl, Aspekte der Volksetymologie (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Vorträge u n d kleinere Schriften; 30), Innsbruck 1982. Näheres zu den vorgeführten Daten und den dazugehörigen Erklärungsmodellen bei O. Panagl, Implikationen und Präsuppositionen als Faktoren im lateinischen Bedeutungswandel, in: Aspects of Latin. Papers from the Seventh International Colloquium on Latin Linguistics, Jerusalem April 1993, hrsg. von H . Rosen, Innsbruck 1996, 6 1 9 - 6 3 4 .
Bezeichnung und Bedeutung
345
bisweilen vernachlässigte b e g r i f f l i c h e S c h e i d u n g e i n f u h r e n u n d b e g r ü n d e n . D i e B e d e u t u n g s l e h r e o d e r S e m a n t i k zerfällt in zwei B e t r a c h t u n g s w e i s e n o d e r B l i c k r i c h t u n g e n , die w i e die b e i d e n Seiten einer M ü n z e zwar u n t r e n n b a r a n e i n a n d e r g e b u n d e n sind, a b e r nie zugleich ins Bild k o m m e n k ö n n e n . D i e u n a u s g e s p r o c h e n ü b l i c h e Lesart v o n „ B e d e u t u n g " ist Semasiologie, also j e n e Disziplin, die d e n s e m a n t i s c h e n H o r i z o n t eines Ausdrucks, e i n e r W o r t f o r m a n g i b t u n d a b steckt. D a n e b e n ist a b e r die O n o m a s i o l o g i e n i c h t zu ü b e r s e h e n , die aussagt, w i e ein b e s t i m m t e r Inhalt sprachlich t r a n s p o r t i e r t w i r d , also ü b e r die B e n e n n u n g v o n G e g e n s t ä n d e n o d e r Sachverhalten u n d ihre M o t i v e in e i n e r b e s t i m m t e n S p r a c h e b e f i n d e t . D i e e b e n a n g e f ü h r t e U n t e r s c h e i d u n g ist n i c h t b l o ß i m wissenschaftlic h e n Diskurs erheblich, sie b e g e g n e t d u r c h a u s a u c h pragmatisch in b a n a l e n Sit u a t i o n e n des Alltags: W e r in e i n e m f r e m d e n L a n d in e i n e m R e s t a u r a n t d e n Kellner n a c h d e m Sinn e i n e r e x o t i s c h e n E i n t r a g u n g auf d e r Speisenkarte fragt, verfährt semasiologisch, gleichgültig o b i h m d e r K o n s u l t i e r t e m i t e i n e r U b e r setzung, e i n e r sachlichen E r k l ä r u n g o d e r d u r c h optische D e m o n s t r a t i o n aus d e r verbalen V e r l e g e n h e i t hilft. G e h t d e r Gast h i n g e g e n so vor, dass er auf e i n e S p e i se in d e r V i t r i n e o d e r auf d e m N a c h b a r t i s c h verweist u n d n a c h d e r e n N a m e n fragt, so b e d i e n t er sich d e r o n o m a s i o l o g i s c h e n M e t h o d e . B e g i n n e n w i r n a c h diesem a u s f ü h r l i c h e n Vorspann m i t u n s e r e r diagnostischen R u n d s c h a u auf E t y m o l o g i e u n d W o r t g e s c h i c h t e i m S i n n b e z i r k des Bildes. D a eine B e s c h r ä n k u n g des G e g e n s t a n d s b e r e i c h e s u n u m g ä n g l i c h ist, h a b e ich m i c h a u f die b e i d e n klassischen S p r a c h e n G r i e c h i s c h u n d Latein k o n z e n t r i e r t , die ich zu Vergleichszwecken u n d im H i n b l i c k auf R e z e p t i o n s e r s c h e i n u n g e n m i t D a t e n aus D e u t s c h , Englisch, Französisch u n d Russisch k o n f r o n t i e r e . Das b i e t e t m i r d e n Vorteil, dass ich n e b e n e i n e m geschlossenen D a t e n b e f u n d a u c h L e h n w o r t b e z i e h u n g e n sowie diachronische V e r ä n d e r u n g e n aller Art, v o n lautlicher A d a p t i e r u n g bis zu d e n e b e n b e s p r o c h e n e n Varianten des B e d e u t u n g s w a n d e l s h e r a n z i e h e n k a n n . Ich fasse d e n B e g r i f f des Bildes freilich etwas a l l g e m e i n e r u n d k o m p l e x e r , als dies üblicherweise i m d e u t s c h e n S p r a c h g e b r a u c h geschieht, also n i c h t in d e r strikten Lesart zweidimensionaler, f l ä c h e n h a f t e r D a r s t e l l u n g als G e m ä l d e , Z e i c h n u n g o d e r R a d i e r u n g , s o n d e r n als j e d e Variante bildlicher U m s e t z u n g bzw. d e r E v o k a t i o n v o n R e a l i t ä t o d e r v o n Vorstellungen, ich s u b s u m i e r e also a u c h Plastik, R e l i e f u n d d e r g l e i c h e n d a r u n t e r . D e r homo pictor des K o l l o q u i u m s ist d e m n a c h bei m i r a u c h ein homo fictor o d e r figulus. Das h a t seine G r ü n d e i m sprachlichen B e f u n d e b e n s o w i e i m O b j e k t b e r e i c h : d e n n bisweilen gibt es g l e i t e n d e U b e r g ä n g e i m W o r t g e b r a u c h , i n d e m e t w a ein u n d derselbe A u s d r u c k als Passepartout für zwei- wie dreidimensionale Kunstgegenstände verwendet wird, entweder d u r c h ein v o n v o r n h e r e i n breiteres K o n z e p t o d e r d u r c h n a c h t r ä g l i c h e A u s w e i t u n g d e r B e d e u t u n g bzw. R e f e r e n z . Sicher trägt zu dieser g r o ß z ü g i g e r e n , w e n i ger differenzierten B e z e i c h n u n g s w e i s e a u c h eine D i s k r e p a n z z w i s c h e n P r o d u k t i o n s - u n d R e z e p t i o n s ä s t h e t i k bei, die m a n sich a u c h als S p r a c h h i s t o r i k e r i m m e r w i e d e r bewusst m a c h e n muss: W a r e n d o c h j e n e S k u l p t u r e n u n d A r c h i t e k t u r t e i l e
346
Oswald Panagl
aus der Antike, die uns mit dem Glanz des Marmors wie die künstlerische Signatur einer Epoche erscheinen, ursprünglich bemalt gewesen, und die intendierte koloristische Vielfalt ist erst nachträglich, also gleichsam in einem destruktiven Vorgang, verblasst: ein schönes Beispiel für die sekundäre Asthetisierung eines Verfallssymptoms. Schließlich sei erwähnt - und die besprochenen Daten werden es wohl belegen dass die mimetische oder gestaltende Absicht unabhängig vom Material und technischen Verfahren in vielen Fällen das konstante Bezeichnungsmotiv abgibt. Die mehrfache Durchsicht des philologisch und lexikographisch erhobenen, danach etymologisch analysierten Wortguts hat für mich insgesamt zwölf onomasiologische Nischen ergeben (geradezu eine biblische Zahl!), die nach gelegentlichen prüfenden Blicken in andere Kulturen, wenn nicht universal gültig, so doch repräsentativ sein dürften. 10 In einer ersten Annäherung können diese semantischen Konzepte lauten: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)
„nachahmen, wetteifern" „Ähnlichkeit" mit der Natur, der Vorlage „Unterlage", „materielles Substrat" „aufstellen", „anordnen" (gleichsam als die Perspektive der Präsentation) „schneiden, schnitzen" „formen, kneten" „malen, ritzen" „Prunkstück", „freudiger Anlass" „sehen, erscheinen" „Form, Abbild" „Zeichen, Marke" „ans Licht bringen, erkennbar machen"
Wir wollen uns in kurzen Kapiteln nunmehr der Evidenz des Datenbefundes stellen, dabei aber zumindest in Andeutungen auch die etymologischen Probleme und Aporien nicht übersehen.
10
Grundlagen der folgenden Präsentation sind vor allem die nachstehenden Referenzwerke: J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, 2 Bände, Bern und München 1959 und 1969; H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, 3 Bände, Heidelberg 1954-1972; P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, 4 Bände, Paris 1968—1974; A. Walde/J. B. Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, 2 Bände, Heidelberg 3 1938-1954; A. Ernout/A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, 2 Bände, Paris 1932 (ND Paris 1979); M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, 3 Bände, Heidelberg 1950-1955 (1953-1958); Ch. T. Onions, The Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford 1966; E Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, völlig neu bearbeitet von E. Seebold, Berlin und New York 22 1989.
Bezeichnung und Bedeutung
347
1) Das Benennungsprogramm von Nachahmung und Wetteifer zeigt sich m.E. am deutlichsten an lat. imago mit seinem Bedeutungsspektrum „Bild, A b bild, Traumbild, Sehen, Gestalt, Vorstellung", in das z.B. auch der Lehneinfluss der griechischen Begriffe eixcbv und (püvrao"|iu hineinspielt. Von Ableitungen wie imaguncula „kleines Bild" oder imaginari „sich einbilden" abgesehen, sind imitari „nachahmen" und ablautendes aemulus „wetteifernd" die bekanntesten lateinischen Verwandten. Diesem klaren semantischen Profil stehen im Wortursprung und in der vergleichenden Rekonstruktion große Schwierigkeiten gegenüber, die hier nur angedeutet werden können: Sollen wir für die Grundsprache ein abstraktes *imo- „so seiend" ansetzen, uns an einer Wurzel *yem- „zusammenhalten" (altindisch yamäs „Zwilling") orientieren, oder ein Rekonstrukt *aisheranziehen, das sich als „wünschen, verfolgen" fassen lässt? Zwei Anmerkungen seien noch gestattet, die vorführen, wie sorglos, j a leichtfertig man zu Zeiten mit Lautgesetzen umgesprungen ist. Im 19. Jahrhundert haben Gelehrte wie Pott und Breal lat. imitari als Lehnwort von griechisch ni|xt|xöq hergeleitet, wobei man den m-Verlust im Anlaut ebenso akzeptiert hat wie die itazistische Aussprache des langen e. Der Ansatz eines Kompositums (*tmmago von Fay) 11 wiederum, der das Wort als „res in cera depsta" mit griech. £X|iaysiov „Wachsabdruck" vergleicht, nimmt die Vereinfachung von -mm- ohne überzeugende Parallele wortlos zur Kenntnis. 2) „Ähnlichkeit", j a angestrebte Gleichheit mit der Natur oder auch dem vorliegenden Realitätsausschnitt äußert sich als Benennungsmotiv z.B. in lat. simulacrum und griech. sixcbv. Das lateinische Substantiv ist ebenso als deverbales N o m e n zu similare gebildet wie miraculum zu mirari oder spectaculum zu spectare. Das etymologische Umfeld des Ausdrucks spannt sich von similis „ähnlich, gleich" und simultas „Eifersucht" bis zu den Adverbien semel „einmal" und simul „zugleich". G e m e i n sam mit reichen Vergleichsdaten aus vielen idg. Einzelsprachen (griech. opaZ-öq „eben, glatt", altir. samail „Gleichnis") gelangen wir letztlich zur Wurzel *sem„eins", die sich semantisch auch zu „ein und derselbe, gleich" fortentwickelt. Griechisch eixcbv „Abbild, Bild, Gleichnis" wiederum lässt sich zweifelsfrei zu dem Praeterito-Praesens soixa, dem Partizip gixdx; und den sekundären Präsensformen SKTXCÜ und sixä^CO mit dem Bedeutungshof „gleichen, ähnlich sein" stellen, zu dem aus anderen idg. Sprachen keine sichere Parallele beizubringen ist. 3) Die substantielle Unterlage, das Material, auf dem — nicht: mit dem gemalt oder gezeichnet wird, gerät zum Bezeichnungsnenner für Ausdrücke wie lat. tabula (picta) oder c(ti)arta, wobei letzteres, wie noch zu zeigen sein wird, auf verzweigten Wegen in moderne europäische Sprachen gelangt ist. Dass mit diesen Lexemen nur flächenhafte, keine plastischen Bilder benannt werden können,
11 So E. W. Fay, Composition or Suffixation?, in: Zeitschrift fiir vergleichende Sprachforschung, 45 (1913), 1 1 1 - 1 3 5 , bes. 114f.
348
Oswald Panagl
bedarf keiner weiteren Rechtfertigung. N u r ein paar Worte zum etymologischen Befund: tabula, das auch „Schreibtafel, Spielbrett, Urkunde, Landkarte, Schuldbuch" bedeutet, erinnert lautlich an Bildungen wie griech. xr|>ia „Würfelbrett" oder deutsch Diele. Es lebt in einer Vielzahl moderner europäischer Sprachen fort, während über seinen eigenen Ursprung noch unterschiedliche Ansichten kursieren, darunter auch die Entlehnung aus akkadisch tuppu „Tontafel", das seinerseits von altpers. dipi „Inschrift" und türkisch divän fortgesetzt wird. Bei carta führt der Weg über griech. xäßtrn; wohl ins Ägyptische zurück. 4) Eine Restriktion auf die Plastik, sei es ein anikonisches Standbild oder ein steinernes bzw. bronzenes Porträt, findet sich in j e n e m Bezeichnungstypus, den lat. statua vertritt. Benennungsmotiv ist hier die Aufstellung an einem besonderen O r t unter freiem Himmel oder in einem repräsentativen Bauwerk. Vom Standpunkt der lateinischen Morphologie mag man diskutieren, ob das Substantiv eine «-Erweiterung des Nominalstammes statu- darstellt oder direkt vom Verbum statuere „aufstellen" deriviert ist: die idg. Wurzel *stä- (bzw. *steh2) und damit auch das onomasiologische Programm des Bildungstypus steht außer Zweifel. Interessant ist die für das Lateinische durchwegs eingehaltene Referenzbeschränkung, die statua auf Menschenbilder, signum aber auf Götterstatuen festlegt. Die vielseitige Verwendbarkeit gerade dieses Verbums zeigt allein für das Lateinische u.a. status „(Zu)Stand", statura „Größe", statio „Posten, Standquartier". 5) Eben war von lat. signum und seiner späteren referentiellen Beschränkung auf plastische Götterbilder die Rede. Die Etymologie des Wortes weist freilich in eine andere Richtung, sie deutet auf das Schneiden bzw. Schnitzen als kunsthandwerkliches Verfahren hin. Der Wortursprung liegt wohl beim Verbum secare, dessen geläufigste umgangssprachliche Verwendung „einschneiden" sich in der wichtigsten, der unmarkierten Lesart von signum niedergeschlagen hat: denn „Zeichen, Kennzeichen" ist ja nur eine Bedeutungserweiterung von älterem „Kerbe", also einem ,Merkmal', das sich etwa ein Z i m m e r m a n n in einem Holzpfosten setzt. N e b e n dieser Verwendung dürfen wir die Lesart „Statue, Götterbild" als resultatives N o m e n , gleichsam als effiziertes Objekt der Verbsemantik „ausschneiden, schnitzen" klassifizieren. Es sei nicht verschwiegen, dass in der älteren etymologischen Literatur auch ein Anschluss an die Wurzel sek1"- „folgen" erwogen wurde, deren semantische Biegsamkeit sich ja etwa durch die Wortsippe von deutsch sehen2 erweist. Trotz des behaupteten Aufschlusswertes der etymologischen Figur signa sequi erscheint mir diese Hypothese weit weniger plausibel. 6) Eine andere Technik des künstlerischen Gestaltens bezeichnet das semantische Konzept „plastisch formen, kneten", wie es vor allem durch lat. effigies
12 D e r Bedeutungswandel von ,,(ver)folgen" zu „schauen", den die germanischen Sprachen seit den ältesten Stufen (gotisch, althochdeutsch usw.) erkennen lassen, mag nach einem Vorschlag von W. Wissmann aus der Jägersprache vom optischen Verfolgen des Wildes herrühren.
349
Bezeichnung und Bedeutung
manifestiert wird. An diesem N o m e n hat die Wortgeschichte die etymologische Beschränkung auf die Herstellung aus Ton oder Wachs überwunden: neben „Porträt" begegnen im semantischen Spektrum auch „Scheinen, Ideal", während die Grundbedeutung „Ausgestaltung" (Plin. 9, 179) opak wurde. Die alte materielle Referenz zeigt sich noch in figulus „Töpfer" und fictilis „tönern"; das Täternomen fictor spaltet sich in handwerkliches „Bäcker" und künstlerisches „Bildhauer"; figura hat sich zu „Gestalt" emanzipiert, fictio und fictura in Richtung auf verbales Bilden („Erdichtung") erweitert. Das Basisverbuni fingere, das die ganze semantische Palette von konkretem „kneten" bis zu mentalem „ausdenken" b e setzt, hat dazu noch die pejorative, vielleicht euphemistisch entstandene Nuance „lügen, heucheln" entwickelt. Die idg. Wurzel * .ua "i
ä 3
Ig
O
3
2 e? sä-Ä s5 i m B Hl .a hilil 1 Siiil3 I IS-S.P -a sii
'S o
«2
5 00
g & 13 e %
z
'Sl II g > 00
e
i" II • •os.oS
C
s
Ji 8 81|| |fl| IUI £ I
Tafel LX
ilui
t< C l f c L
¿r 6 M itOj
A«v§«| ta*jjf>3