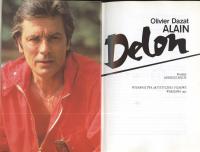Alain Resnais [1. ed.] 9783967075762, 9783967075779
253 14 9MB
German Pages 102 [107] Year 2021
Cover
Impressum
Inhalt
Sophie Rudolph — »Das Leben ist (k)ein Roman« – Filmische Reflexionen zwischen Realem und Imaginärem. Ein Vorwort
Alain Resnais im Gespräch mit Suzanne Liandrat-Guigues und Jean-Louis Leutrat — »Des reproches pleins les poches« – »Ein Haufen Vorwürfe«
Thomas Weber — Erinnern als filmischer Diskurs. Die frühen Filme von Alain Resnais
Beate Ochsner — Filmische Teilhabe oder: Das Werden des Filmes
Mirjam Schaub — »Innige Kälte« – L’Année dernière à Marienbad
Anna Magdalena Elsner — Erinnerungen an Muriel ou le temps d’un retour
Kristina Köhler — Voir et revoir. Eine Wiederbegegnung mit Je t’aime, je t’aime
Petr Mareš — »One of you must speak English«. Über Mehrsprachigkeit in den Filmen von Alain Resnais
Jörg Schweinitz — On connaît la chanson als Spiel ästhetischer Koketterie. Persönliche Reflexion und theoretischer Horizont
Stefanie Diekmann — Ritornell. Über Alain Resnais’ Vous n’avez encore rien vu
Biografie
Filmografie
Autor*innen
Anzeigen
Recommend Papers
![Alain Resnais [1. ed.]
9783967075762, 9783967075779](https://ebin.pub/img/200x200/alain-resnais-1nbsped-9783967075762-9783967075779.jpg)
- Author / Uploaded
- Kristina Köhler
- Fabienne Liptay
- Jörg Schweinitz
- Sophie Rudolph (eds.)
File loading please wait...
Citation preview
F I L M-KONZE PTE Begründet von Thomas Koebner Herausgegeben von Kristina Köhler, Fabienne Liptay und Jörg Schweinitz Heft 63 · Oktober 2021 Alain Resnais Herausgeberin: Sophie Rudolph
ISSN 1861-9622 ISBN 978-3-96707-576-2
E-ISBN 978-3-96707-577-9
E-Book-Umsetzung: Datagroup int. SRL, Timisoara Umschlaggestaltung: Thomas Scheer Umschlagabbildung: © Alain Resnais: »La vie est un roman« (1983) / mk2 éditions Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Abbildungen aus den Filmen um Screenshots.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. © edition text + kritik im Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG, München 2021 Levelingstraße 6a, 81673 München www.etk-muenchen.de Buchgestaltung: Kathrin Michel, München Druck und Buchbinder: Esser printSolutions GmbH, Westliche Gewerbestraße 6, 75015 Bretten
FILM-KONZEPTE
63 43
10 / 2021 7 / 2016
Sophie Rudolph Johannes Wende(Hg.) (Hg.)
ALAIN RESNAIS
003
Sophie Rudolph »Das Leben ist (k)ein Roman« – Filmische Reflexionen zwischen Realem und Imaginärem. Ein Vorwort
012
Alain Resnais im Gespräch mit Suzanne Liandrat-Guigues und Jean-Louis Leutrat »Des reproches pleins les poches« – »Ein Haufen Vorwürfe«
033
Thomas Weber Erinnern als filmischer Diskurs. Die frühen Filme von Alain Resnais
049
Beate Ochsner Filmische Teilhabe oder: Das Werden des Filmes
053
Mirjam Schaub »Innige Kälte« – L’Année dernière à Marienbad
067
Anna Magdalena Elsner Erinnerungen an Muriel ou le temps d’un retour
070
Kristina Köhler Voir et revoir. Eine Wiederbegegnung mit Je t’aime, je t’aime
076
Petr Mareš »One of you must speak English«. Über Mehrsprachigkeit in den Filmen von Alain Resnais
081
Jörg Schweinitz On connaît la chanson als Spiel ästhetischer Koketterie. Persönliche Reflexion und theoretischer Horizont
090
Stefanie Diekmann Ritornell. Über Alain Resnais’ Vous n’avez encore rien vu
094
Biografie
098
Filmografie
100
Autor*innen
Sophie Rudolph
»Das Leben ist (k)ein Roman« – Filmische Reflexionen zwischen Realem und Imaginärem Ein Vorwort »Bienvenu au colloque sur l’imagination de l’éducation … pardon … l’éducation de l’imagination« [Willkommen beim Kolloquium zur Fantasie der Erziehung … Entschuldigung… Erziehung der Fantasie«]. Mit diesen Worten begrüßt in La vie est un roman (Das Leben ist ein Roman, 1983) der Leiter des fiktiven Instituts »Holberg« die motivierte Lehrerin Elisabeth (Sabine Azéma). Warum dieses Zitat und warum auch das Titelbild dieses Hefts der »Film-Konzepte«, das Alain Resnais gewidmet ist, aus diesem Film? Mir scheint hier ein Schlüssel zu liegen, der direkt in das Thema hineinführt, das sich bei aller Unterschiedlichkeit der filmischen Formen wie ein roter Faden durch das sich über Jahrzehnte hinweg entfaltete Werk von Alain Resnais zieht: das Verhältnis zwischen Realem und Imaginärem und die letztliche Ununterscheidbarkeit beider Pole. Die Vermischung realer Welt und imaginärer »Spielwelt« ist in La vie est un roman auf vielfältige Weise ins Bild gesetzt worden, und schon der Filmtitel beruht auf der Aussage: »Alain, la vie n’est pas un roman!«, die der Regisseur als Kind von seinem Vater zu hören bekam.1 Was also bietet sich besser für eine (Wieder-)Entdeckung von Resnais an als dieser Film, der chronologisch in etwa die Mitte seines Werkes markiert, einen biografischen Bezug aufweist und die Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, Realem und Imaginärem auf verschiedenen Ebenen ref lektiert. Resnais’ Filme sind oft formalistisch, sie wirken artifiziell und manchmal verkopft; sie sind immer auf eine zunächst unbestimmte Weise »merk-würdig«. Bereits vor einigen Jahren habe ich eine Monografie vorgelegt,2 die dem Gedanken folgte, durch die Erkundung der Beziehung der Filme von Resnais zu anderen Kunstformen wie Fotografie, Malerei, Literatur und Theater eine Brücke zwischen verschiedenen Phasen seines Filmschaffens zu schlagen. Im Sinne einer eigenen Aussage von ihm: »Ce que j’aime bien au cinéma, c’est que c’est un art impur qui mélange de tas de choses« [Was ich am Kino liebe, ist, dass es eine unreine Kunst ist, die so viele Dinge miteinander vermischt],3 habe ich auf den
4 · Sophie Rudolph
Spuren von André Bazin den verschiedenen Inspirationsquellen eines sogenannten cinéma impur, einem »unreinen Kino«,4 nachgespürt, das trotz oder gerade wegen der Anleihen bei anderen Kunstformen seine Eigenständigkeit behauptet. Auch diesmal lässt sich schon das Titelbild als eine Anspielung auf die Arbeit des Filmemachers betrachten: Wie das Kind, das aus dem Sperrmüll der Erwachsenen etwas Neues bastelt, fügt auch Resnais vielfach vorhandenes Material neu zusammen. Was motiviert heute, sich mit den Filmen von Alain Resnais zu beschäftigen? Was macht sie aus aktueller Sicht interessant oder relevant? Resnais fragt selbst in dem hier abgedruckten Interview: »Warum haben wir dieses Gehirn und warum schaffen wir so nutzlose Dinge wie Gemälde und Filme? Niemand hat mir eine Antwort geben können«. Ganz ähnlich fragen die Texte dieses Bandes: Warum schauen wir Resnais’ Filme an und wie wirken sie auf uns? Die »nutzlosen« Filme erweisen sich dabei als alles andere als wirkungslos. Der Film Nuit et brouillard (Nacht und Nebel, 1955) wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung in den 1950er Jahren bundesweit in westdeutschen Schulen aufgeführt. Im Publikum saß auch die spätere RAF-Terroristin Gudrun Ensslin als Teenagerin. Deren Lebensgeschichte wurde später von Margarethe von Trotta in dem Spielfilm Die bleierne Zeit (1981) inszeniert – und darin wird die Vorführung der Dokumentation durch den Vater Ensslins an der Schule seiner Töchter als kritisches Momentum in der Radikalisierung des Gedankenguts einer Pfarrerstochter aus gutem Hause inszeniert. Das junge Mädchen rennt aus dem Kino, um sich auf der Toilette zu übergeben. Ins Gedächtnis brennen sich nicht allein die Leichenberge aus den alliierten Archiven ein, sondern auch der mahnende Kommentar von Jean Cayrol in der Übersetzung Paul Celans, der die Frage »wer ist schuld?« im Raum stehen lässt mit der Anklage, dass alle schuld seien, die glauben, so etwas wäre nur in einem einzigen Land zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt möglich. Bis heute bleibt die Dokumentation ein eindrückliches Zeugnis der Auseinandersetzung mit systemischer Gewalt, die das unmoralische Verhalten einzelner bürokratisch rechtfertigt und alle zu Tätern macht. Der Industriefilm Le chant du styrène (1958) folgt in konsequent umgekehrter Reihenfolge dem industriellen Fertigungsprozess der den Alltag der 1950er Jahre verzaubernden knallbunten Plastikgegenstände zurück zum Rohstoff Erdöl. Von heute aus gesehen erscheint eine Welt geradezu nostalgisch, in der die Klimakrise noch kein Thema war und Plastikprodukte im Zeichen des Fortschritts einer modernen Konsumkultur die Haushalte eroberten. An der Produktion dieses im Auftrag des
Ein Vorwort · 5
Le chant du styrène
französischen Industriekonzern Péchiney entstandenen 13-minütigen Werbefilms hat Resnais länger gearbeitet als an den Aufnahmen zu seinem ersten Spielfilm Hiroshima mon amour (1959). Der oft vernachlässigte kurze Film schafft eine bemerkenswerte dramaturgische Spannung, die auch heute noch inspirierend für eine kreative Form des Klima- und Umweltjournalismus wirken könnte. Das Beispiel Le chant du styrène zeigt, wie das konsequente Verfolgen eines Stoffes im Ökosystem einer Geschichte eine organische Dramaturgie geben kann, die sich »wie von selbst« ergibt und das komplexe Zusammenspiel industrieller Infrastrukturen sichtbar macht. ((Abb. 1)) Und obwohl es sich bei den Raffinerien Péchiney um einen sehr realen Schauplatz handelt, ist Le chant du styrène alles andere als eine Reportage. Der Film bildet nicht die Realität des Produktionsprozesses ab, sondern unterstreicht die surreale Wirklichkeit von Plastik als Kunststoff, der die natürliche Welt nachformt. Plastik als Material steht hier auch metaphorisch für den Film selbst, Abbilder der Realität werden mittels eines technischen Verfahrens auf einen chemisch hergestellten ZelluloidStreifen gebannt und können mithilfe eines Projektors immer wiedergegeben werden. Auch wenn die Apparaturen sich geändert haben, was wir sehen, ist immer eine Momentaufnahme, ein Ausschnitt, niemals ist ein filmisches Bild »real«, jedoch ebenso wenig vollständig »imaginär«. So erscheint denn der Übergang vom dokumentarischen zum fiktionalen Filmschaffen bei Resnais als ein f ließender, eine Entwicklung, die sich längst angekündigt hat und keinen markanten Bruch darstellt – von Systemen, in denen Menschen als »automatisch« handelnd dargestellt werden (der Aufseher im Konzentrationslager, der wegen des französischen képi herausgeschnitten werden musste, bevor die Zensurbehörde den Film genehmigte, der Angestellte mit Schirmmütze in den Raffinerien – halb
6 · Sophie Rudolph
Mensch, halb Roboter machen sie einfach ihren Job) wird der Fokus auf die Menschen selbst und ihre seelischen Traumata gerichtet, die untrennbar mit den historischen Katastrophen ihrer Zeit verknüpft sind. Naomi Greene hat die (frühen) Filme von Resnais als »Ghosts of History«5 bezeichnet. Tatsächlich liegt ein Schwerpunkt der Betrachtung der frühen Filme meist auf ihrer Aufarbeitung der Themen Holocaust, Atombombe, zweiter Weltkrieg und Algerienkrieg. Als ›ahistorisch‹ sticht einzig L’Année dernière à Marienbad (Letztes Jahr in Marienbad, 1961) heraus, der jedoch in seiner zeitlichen Situiertheit und im Zusammenhang mit den anderen Filmen als ein Dokument der unzuverlässigen Erinnerung vermischt mit Teilnahmslosigkeit am politischen Geschehen außerhalb des eigenen psychischen Erlebens gesehen werden kann. Auch lässt er die beteiligten Figuren nicht weniger roboterhaft erscheinen als die ihnen vorangegangenen gesichts- und namenlosen Menschen in den Dokumentationen. Als der Film 1961 in die Kinos kam, widmete die französische Tageszeitung Le Monde an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine ganze Seite den Ergebnissen einer Leser-Umfrage zu dem formal ungewöhnlichen Film. Auf die Frage »A propos d’un film difficile. Que pensez-vous de L’Année dernière à Marienbad?« reagier ten viele regelrecht angeekelt oder geradezu euphorisch. In der Ausgabe vom 3. Januar 1962 kamen zunächst die Gegner, »ceux qui sont contre«, zu Wort.6 Der verantwortliche Redakteur Jean de Baroncelli zitiert in seiner Zusammenfassung der Umfrage zunächst die wenig schmeichelhaften Etikettierungen, die er in den Zuschriften empörter Zuschauer zu lesen bekam. Immerhin haben die passionierten Gegner des Films sich blumige Formulierungen einfallen lassen. Der Film sei »une eau noire et croupie dans une bouteille de champagne« [schwarzes, verfaultes Wasser in einer Champagnerf lasche] oder »un macaroni lugubre et sans goût dans la vaisselle style baroque« [eine geschmacklose, labbrige Makkaroni in einer Barockschüssel], ein »magma d’images«, ein »monument d’ennui« [Denkmal der Langeweile] und schließlich sogar »la négation du cinéma« [die Negation des Kinos]. Ein anonymer Korrespondent war besonders radikal: »Une escroquerie … Il est impossible de se moquer davantage du public. Je m’étonne que les auteurs n’aient pas encore reçu sur la figure quelques bonnes paires de claques de leurs victimes. … Une ordure … [Eine Hochstapelei … es ist unmöglich, das Publikum derart zum Narren zu halten … Mich wundert, dass die Autoren noch nicht ein paar schallende Ohrfeigen von ihren Opfern erhalten haben … ein Miststück].7 Am Tag darauf, in der Ausgabe vom 4. Januar 1962, erschien der zweite Teil, »ceux qui sont pour«.8 Der heftigen Ablehnung der einen steht
Ein Vorwort · 7
ein schier grenzenloser Enthusiasmus der anderen gegenüber. Für diese »Fanatiker« ist der Film »une oeuvre bouleversante qui marque un renouvellement total de l’écriture et de la pensée cinématographique« [ein aufrüttelndes Werk, das eine totale Erneuerung des filmischen Schreibens und Denkens markiert]; »une création totale, le chef-d’oeuvre faisant suite à Hiroshima, celui-ci étant au coeur ce que l’autre est à l’esprit« [eine absolute Schöpfung, das auf Hiroshima folgende Meisterwerk, das eine ist für das Herz, was das andere für den Geist ist] oder sogar »une véritable oeuvre d’art, troublante de beauté et pièce unique … un des plus beaux cadeaux à l’art cinématographique, à l’art universel« [ein wahres Kunstwerk, von verstörender Schönheit und einzigartig … eins der schönsten Geschenke an die Filmkunst, an die Kunst allgemein]. Und eine andere Stimme: »Ce film m’a appris au moins une chose; qu’il fallait oublier tous – je dis bien tous – les films que j’avais pu voir précédemment … Marienbad est une révolution dans sa philosophie, dans sa vue du monde« [Dieser Film hat mich zumindest eins gelehrt; nämlich dass es alle – ich sage wirklich alle – Filme, die ich zuvor gesehen habe, zu vergessen gilt … Marienbad ist in seiner Philosophie, seiner Weltsicht eine Revolution].9 Hier zeigt sich besonders deutlich, dass die Filme von Alain Resnais, und vor allem dieser selbst, durchaus zu polarisieren vermögen. Die Kunsthalle Bremen widmete 2015/16 dem Film eine ganze Ausstellung: Marienbad – Ein Film als Kunstwerk. Er gilt in der bildenden Kunst als avantgardistisches Pionierwerk, das mit einer künstlerischen Sprache spielt und ein Kunstverständnis definierte, das bis heute aktuell und relevant ist.
L’Année dernière à Marienbad – Im Schatten
8 · Sophie Rudolph
Der »Marienbad-Look« findet sich unter anderem in künstlerischen Arbeiten von Gerhard Richter, Howard Kanovitz, Cindy Sherman, Jeff Koons, Vanessa Beecroft, aber auch in Modeschauen von Chanel.10 ((Abb. 2)) Resnais’ formalistische Experimentierfreude mag die einen erfreuen, die anderen verstören. Immer aber bleibt ein eigentümliches Gefühl der von André Bazin einmal so schön benannten »gêne exquise« zurück, was man als »angenehmes Unbehagen« übersetzen könnte, ein scheinbarer Widerspruch. Die Filme von Alain Resnais sind also keinesfalls als wirkungslos zu bezeichnen. Dieser eigentümlichen Wirksamkeit haben auch die Autorinnen und Autoren dieses ihm gewidmeten Hefts der »Film-Konzepte« nachgespürt. In den Beiträgen spiegelt sich die Lebendigkeit unterschiedlicher Erfahrungen beim Zuschauen, vielfältiger Erinnerungen und Eindrücke, die die Filme von Alain Resnais ausgelöst und hinterlassen haben. Den Beiträgen voran geht ein längeres Interview, das Suzanne LiandratGuigues und Jean-Louis Leutrat über ein Jahr hinweg, von 2005 bis 2006, in Paris mit Alain Resnais geführt haben; es wird hier erstmals in Auszügen, ins Deutsche übertragen, abgedruckt. Darin lernen wir Resnais hinter den Kulissen kennen, tauchen ein in seine Sicht auf die Welt und entdecken die Vielfalt der Inspirationsquellen, die in seine Filme eingef lossen sind. Das Interview ist assoziativ und persönlich, entbehrt der Vollständigkeit, steckt aber voller Details und entspricht daher sowohl Resnais’ Filmschaffen als auch der Konzeption dieses Bandes, der einige längere Analysen und mehrere kürzere Text-Miniaturen enthält. Ein Streifzug durch das filmische Werk, der die Leser*innen zum Verweilen einlädt. Thomas Weber betrachtet anhand des frühen Dokumentarfilmschaffens und der ersten beiden Spielfilme von Alain Resnais Erinnern als filmischen Diskurs. In den Filmen Les statues meurent aussi (Auch Statuen sterben, 1950–53), Nuit et brouillard (1955/56), Toute la mémoire du monde (Alles Gedächtnis der Welt, 1956), Hiroshima, mon amour (1958/59) und L’Année dernière à Marienbad (1961) wird die filmische Darstellung des Erinnerns von traumatischen historischen Erfahrungen in unterschiedlichen Formen erprobt. Der Aufsatz befasst sich mit dem Diskurs über filmische Darstellung von Erinnerung als Leitthema im Frühwerk von Alain Resnais, charakterisiert seine Arbeitsweise und erläutert die Position, die er als Autorenfilmemacher im französischen Kino seiner Zeit hatte. Beate Ochsner geht in ihrer kurzen Ref lexion der Frage nach, wie die Filme von Alain Resnais und speziell Letztes Jahr in Marienbad die filmische Teilhabe der Zuschauer *innen ermöglichen. Entlang einer Verschiebung der Perspektive geraten dabei die Übergänge, die Passagen
Ein Vorwort · 9
und damit die Prozesse der Filmwerdung und -vergänglichkeit selbst in den Blick. Resnais’ Filme – so Ochsner –›sind‹ nicht, sie ›werden‹ vielmehr im und durch den Schnitt, was Resnais’ Rolle als »monteur« ins rechte Licht rückt. Auf diese Weise wird nicht nur ein anderes Kino, sondern auch ein anderes Publikum erzeugt. Der Film Letztes Jahr in Marienbad steht auch im Mittelpunkt des Beitrags von Mirjam Schaub. Sie betrachtet das Spiel, das Resnais und der Drehbuchautor Robbe-Grillet mit den Zuschauer *innen des Films spielen, als zwei unvereinbare Auffassungen von Zeitlichkeit, wobei jede einzelne von ihnen »das Ganze« der Zeit ausmacht und keinerlei Ergänzung durch die andere bedarf. Daher gehe es darum, den Film für zwei einander ausschließende Interpretationen offenzuhalten. Mit Umberto Ecos Das offene Kunstwerk und Gilles Deleuzes Zeit-Bild im Gepäck kommt sie zu überraschenden Einsichten. In ihrer persönlichen Erinnerung an den Film Muriel ou le temps d’un retour (Muriel oder die Zeit der Wiederkehr, 1963) erkundet Anna Magdalena Elsner ebenfalls verschiedene Ebenen der Zeitlichkeit und bringt diese in Verbindung mit ihrer Arbeit zur Trauer bei Marcel Proust. Ihr Essay bewegt sich auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen der Figur Muriel als formlose Projektion, die weit über die Handlung des Films hinausgehen und das Filmerlebnis mit eigenen Lebenserfahrungen verknüpfen. Auch Kristina Köhler ref lektiert in ihrem Text das persönliche Filmerleben. Dabei konfrontiert sie die erste Begegnung mit dem Film Je t’aime je t’aime (Ich liebe dich, ich liebe dich, 1968) in einem Programmkino in Lyon 2003 mit dem Wiedersehen des Films 18 Jahre später auf einer DVD. Dadurch ergibt sich ein lebendiges und vielschichtiges Porträt der individuellen Filmwahrnehmung, das mit viel Liebe zum Detail die Eigenwilligkeit des Films und seiner Rezeption widerspiegelt. Petr Mareš beleuchtet in seiner Skizze über die Mehrsprachigkeit in den Filmen von Alain Resnais einen bisher wenig erforschten Aspekt in Resnais’ Filmschaffen. Er zeigt anhand der drei Spielfilme Hiroshima mon amour (1959), La guerre est finie (Der Krieg ist vorbei, 1966) und I want to go home (1989), welche Rolle der Kontakt und die Konfrontation von Sprachen sowie von Figuren, die diese Sprachen verwenden, in Resnais’ Filmen spielt. Die Äußerungen in verschiedenen Sprachen, die zu hören, aber auch in schriftlicher Form zu sehen sind, verbinden sich zugleich eng mit dem Kontakt und der Konfrontation von unterschiedlichen Ethnien und Kulturen.
10 · Sophie Rudolph
Jörg Schweinitz widmet sich dem Film On connaît la chanson (Das Leben ist ein Chanson, 1997) als Spiel ästhetischer Koketterie, wobei persönliche Ref lexion und theoretischer Horizont auch hier ineinanderf ließen: Die Begeisterung des Theoretikers, der an einer Studie über filmische Stereotype arbeitete, beeinf lusste die Wahrnehmung des Films als einen interessanten Fall, der theoretische Gedankengänge inspiriert. Der Essay zeichnet verschiedene Wege der kreativen filmischen Aneignung nach und verortet On connaît la chanson in der postmodernen Ästhetik der 1990er Jahre, in der die Filmfiguren als Stereotype in einem ewigen Spiel erscheinen. Er ref lektiert facettenreich das Oszillieren gegensätzlicher Wahrnehmungsmodi in der Rezeption und daraus resultierende Effekte, wobei sich interessante Parallelen zu Mirjam Schaubs Lesart von L’Année dernière à Marienbad ergeben. In Stefanie Diekmanns luzider Betrachtung des vorletzten Spielfilms von Alain Resnais Vous n’avez encore rien vu (Ihr werdet euch noch wundern, 2012) zeichnet sie die vielfältigen Beziehungen zum Theater auf mehreren Ebenen in Resnais’ Oeuvre nach. Exemplarisch veranschaulicht dieser Film im Besonderen die Funktionsweise der Comédie Resnais mit einem vertrauten Ensemble, das die immer wiederkehrenden Themen von Liebe, Lüge und Verrat geisterhaft repetiert. Mit dem wie eine Prophezeiung daherkommenden Titel »Ihr werdet euch noch wundern« erscheint der Film als eine Art Vermächtnis des Regisseurs Resnais, das es letztlich jedoch nicht ist, da er davon erzählt, dass auf der Bühne wie auf der Leinwand nichts geschieht, das sich nicht schon ereignet hat, nicht schon gesehen worden ist. Wie bei den anderen Filmen von Resnais handelt es sich auch hier um eine »Wiederkehr« – oder von Diekmann spielerischer formuliert: ein Ritornell. ((Abb. 3))
Vous n’avez encore rien vu
Ein Vorwort · 11
Während der Corona-Pandemie ist auf diese Weise ein mosaikartiges Panorama, eine Mischung aus längeren und kürzeren Texten, entstanden, die nicht alle Filme abdecken, dafür aber in ihrer Eigenwilligkeit auch viele verschiedene Zugänge zu diesem in sich bereits heterogenen Werk aufzeigen. Alain Resnais wäre am 3. Juni 2022 hundert Jahre alt geworden. Kurz vor seinem Tod am 1. März 2014 hat er noch im Februar seinen letzten Film Aimer, boire et chanter (2014) auf der Berlinale vorgestellt. Dabei war seine sprichwörtliche Bescheidenheit fast schon legendär. Er ist nie müde geworden, zu betonen, welche anderen Leute an seinen Filmen mitgewirkt haben. Er selbst hat sich nie als »Autorenfilmer« verstanden, er wurde als Regisseur von der Öffentlichkeit dazu gemacht. Er war ein aufmerksamer Zeuge des 20. Jahrhunderts, in seinen Filmen spiegelt sich eine eigentümliche Mischung aus kritischer Nachdenklichkeit und spielerischer Erforschung der Welt, sie eröffnen auch aus heutiger Perspektive immer noch einen anderen Blick auf das Leben. Mit den Worten des Schauspielers Pierre Arditi gesprochen, der in vielen seiner Filme mitgewirkt hat: »Il était un divin enfant« [Er war ein göttliches Kind].11 Die gleiche spielerische Freude beim (Wieder-)Sehen der Filme von Alain Resnais wirkt weiter durch die Lebendigkeit des Sprechens und Schreibens darüber. »Ein Film oder ein Theaterstück, Kunst, Fiktion, all das ermöglicht uns schnellere und herzlichere Kontakte«, so sagt Alain Resnais im Gespräch mit Suzanne Liandrat-Guigues und JeanLouis Leutrat. Das Schreiben über Filme ist und bleibt somit weder nutznoch wirkungslos.
1 Jean Grault (Interview). In: François Thomas: L’Atelier d’Alain Resnais, Paris 1989, S. 63. — 2 Sophie Rudolph, Die Filme von Alain Resnais. Reflexionen auf das Kino als unreine Kunst, München 2012 (zugl. Phil. Diss., Universität Mannheim 2010). — 3 Réal La Rochelle, ›Quand le dialogue devient chant. Entretien avec Alain Resnais‹, in: Positif 437–38 ( Juni/August 1997), S. 10–20, hier S. 10. — 4 André Bazin, ›Für ein unreines Kino. Plädoyer für die Literaturverfilmung‹, In: Ders., Was ist Film?, hg. von Robert Fischer, Berlin 2004, S. 110–138. — 5 Naomi Greene, Landscapes of Loss. The National Past in Postwar French Cinema, Princeton 1999, Kapitel II: ›Alain Resnais: The Ghosts of History‹, S. 31–63. — 6 Jean de Baroncelli, »A propos d’un film difficile. Que pensez vous de L’Année dernière á Marienbad ? I. Ceux qui sont ›contre‹«, in: Le Monde, 3. Januar 1962, S. 6 (dt., »Anlässlich eines schwierigen Films. Was denken Sie über Letztes Jahr in Marienbad? I. Die dagegen sind«). — 7 Alle Kommentare, ebd. — 8 Jean de Baroncelli, »A propos d’un film difficile. Que pensez vous de L’Année dernière á Marienbad? II. Ceux qui sont ›pour‹«, in: Le Monde, 4. Januar 1962, S. 11 (dt., »Anlässlich eines schwierigen Films. Was denken Sie über Letztes Jahr in Marienbad? II. Die dafür sind«). — 9 Alle Kommentare, ebd. — 10 Christoph Grunenberg und Eva Fischer-Hausdorf, Letztes Jahr in Marienbad. Ein Film als Kunstwerk, Bremen 2015. — 11 Anlässlich der Podiumsdiskussion Les Fidèles d’Alain Resnais im Centre Pompidou, Paris, 1. März 2008. URL: https://www.centrepompidou.fr/en/ressources/media/Jhz305E (letzter Zugriff am 3.10.2021).
Alain Resnais im Gespräch mit Suzanne Liandrat-Guigues und Jean-Louis Leutrat
»Des reproches pleins les poches« – »Ein Haufen Vorwürfe«1 Das Prinzip dieses Interviews ist es, zu vermeiden, Alain Resnais Fragen zu stellen, die ihm bereits gestellt wurden, und daher nicht zu sehr auf das zurückzugreifen, was bereits an anderer Stelle gesagt wurde. So gibt es mehrere Interviews über die Beziehung des Regisseurs zur Musik oder zur Graphic Novel, über die Entstehung der einzelnen Filme … Wir haben daher beschlossen, diese Punkte nur am Rande zu behandeln. Dieses Interview, das zwischen Februar 2005 und Februar 2006 geführt wurde, war nur durch die großzügige Verfügbarkeit von Alain Resnais möglich.
Einige vorläufige Korrekturen Gibt es falsche biografische Angaben über Sie, die in Umlauf gebracht wurden und die Sie gerne richtigstellen würden? Wie zum Beispiel die Anekdote über die Sammlung von Comics in Arradon, die von den Deutschen vernichtet wurde. Dafür müsste ich alle Texte über meine Arbeit kennen. Ich bin mir also bei meiner Antwort nicht ganz sicher. Was das von Ihnen genannte Beispiel betrifft, so glaube ich nicht, dass sich die Deutschen jemals um meine Bibliothek gekümmert haben. Was verschwunden sein mag, geschah durch Zufall. Auch der Orden der Ehrenlegion und das Abitur wurden mir zu Unrecht verliehen, aber das ist nicht wichtig (lacht). Ist die Anekdote über die Zerstörung der Harry-Dickson-Titelseiten wahr? Die Anekdote ist zutreffend. Ich kaufte Harry Dickson immer an einem Kiosk vor dem Châtelet-Theater. Meiner Erinnerung nach gab es an diesem Kiosk keine normalen Zeitschriften, sondern man sah nur HarryDickson-Cover. Für diese Titelseiten gab es mehrere Karikaturisten. Damals wusste ich noch nicht, dass es sich um die Titelseiten einer deutschen Ausgabe handelte. Es gab weder eine Unterschrift der Künstler noch eine Unterschrift der Autoren. Harry Dickson wurde übrigens auf Deutsch als Die Abenteuer von Sherlock Holmes veröffentlicht. Ich erinnere mich an ein Bild. In einem Krankenhaus konnte man den Namen Sherlock Holmes
»Ein Haufen Vorwürfe« · 13
auf dem Blatt mit der Fieberkurve am Fußende des Bettes sehen, das hat mich fasziniert. Als ich das in meinem zwölften Lebensjahr las, fielen mir einige der Bücher aus den Händen, ich konnte sie kaum zu Ende lesen, während mich andere begeisterten und aufregten. Das Lustige daran ist, dass die Letzteren, wie ich später merkte, den von Jean Ray geschriebenen Abenteuern entsprachen, während die anderen von ihm übersetzt wurden, denn die Geschichte geht so: Er übersetzte etwa 70 davon, ich glaube aus dem Deutschen, und sagte zu Hip Janssens, seinem Verleger in Gent: »Hören Sie, es ist so schlecht, was Sie mich übersetzen lassen, es würde schneller gehen, wenn ich sie [die Geschichten, SR] direkt schreiben würde.« Jannsens antwortete: »Ja, aber ich habe 114 Druckbögen gekauft.« »Das spielt keine Rolle. Sie geben mir das Cover und ich werde es irgendwann in die Geschichte einbauen.« Jean Ray sagte mir: »Mit viel Wacholder oder ein wenig Wacholder, ich weiß nicht, konnte ich die Geschichte in der Nacht schreiben. Ich habe nur eine Nacht gebraucht. Aber ich muss zugeben«, fügte er hinzu, »dass mir dieser Harry Dickson ans Herz gewachsen war und dass ich manchmal dazu neigte, mich zu fragen, zu ihm zu sagen: Was würdest du in diesem Fall tun, usw.« Er driftete in eine Art Metaphysik von Harry Dickson ab, die sehr sympathisch und berührend war. Ich habe Jean Ray allerdings nur einen Tag lang gesehen, mehr nicht. Die Cover von Nick Carter haben mich nicht beeindruckt; bei einigen Covern von Harry Dickson hatte ich ein ungutes Gefühl, beim Text hingegen nicht. Also habe ich den Text behalten und die Titelseiten abgeschnitten. Dann hat sich mein Geschmack weiterentwickelt, und mit 16, 17 Jahren fand ich die Cover natürlich ziemlich faszinierend. […]
Das Imaginäre und das Leben Harry Dickson spielte für Sie eine große Rolle, und Sie fuhren nach London, um »auf den Spuren von Harry Dickson« zu fotografieren. Der Untertitel der HarryDickson-Bücher lautet »der amerikanische Sherlock Holmes«, obwohl sich alles in London oder England abspielt … Ja, ich hatte welche auf Italienisch gekauft. Dickson hieß dort Petrosino und war der amerikanische Detektiv, der gekommen war, um Italien von der Schwarzen Hand zu befreien. Die Titelseiten wurden von Scarpelli, einem berühmten Karikaturisten, gestaltet, und dieses Cover war signiert. Ich habe nicht verstanden, warum das Bild das gleiche war, übermalt, neu gemacht, italianisiert, während der italienische Text von Petro-
14 · Alain Resnais im Gespräch
sino überhaupt nicht mit dem Text von Jean Ray übereinstimmte. Es gab keine Verbindung. Die Italiener mussten von der deutschen Ausgabe von 1905 oder 1910 ausgegangen sein. Seitdem sind exakte Übersetzungen der deutschen Ausgabe erschienen, aber ich habe das Gefühl, dass es uninteressant ist, wenn es nicht Jean Ray ist. Die Verwendung des Namens Sherlock Holmes war von den Erben der Sherlock Holmes Foundation verboten worden, die dagegen geklagt hatten. Aus diesem Grund wurden die Texte später unter anderen Namen veröffentlicht. Aber die Bilder sind erhalten geblieben. Für den oder die deutschen Karikaturisten war es Sherlock Holmes. Die Figur des Dickson ist ein Freund von Sherlock Holmes, denn sie wohnen in der gleichen Straße, nur eine Hausnummer weiter. Aber sie haben nicht die gleiche Herangehensweise bei der Ermittlung. Harry Dickson ist eher instinktiv (lacht). Er denkt nicht viel nach. Was eine Verfilmung außerdem sehr schwierig machte, war, dass der Anfang der Geschichten gut war, aber wenn man zum Schluss kam, war es nicht mehr spannend. Ich wollte die Zuschauer hypnotisieren, und dazu brauchte ich viele Mittel. Deshalb wurde der Film nicht gedreht, weil die Kosten jedes Mal so enorm waren. Und um gegen das Fernsehen zu kämpfen, musste man damals dreistündige Filme machen. Der Auftrag von Anatole Dauman lautete also: »Machen Sie einen dreistündigen Film.« Dann kam Lawrence von Arabien (David Lean, 1962) heraus und brachte nicht genug Geld ein. Die Gegenanweisung lautete also: »Nein, Sie dürfen nicht mehr als eineinhalb Stunden brauchen.« Von dem Moment an, als wir versuchten, eine anderthalbstündige Fassung zu machen, brach der Film zusammen. Pierre Kast hat sich der Sache angenommen.2 Frédéric de Torwanicki, der mit Anatole Dauman befreundet und ein Fan von Harry Dickson war, wurde Drehbuchautor für Harry Dickson.3 Es hat Korrekturen und Anpassungen gegeben. Vanessa Redgrave wurde durch den Film Blow Up (Michelangelo Antonioni, 1966) berühmt. Plötzlich waren die Produzenten interessiert. Sie sagte zu mir: »Du bist in meine Garderobe gekommen, als ich Die Möwe gespielt habe und ich praktisch unbekannt war, ich habe zugestimmt, Harry Dickson zu spielen, ich werde meine Preise nicht ändern, nur weil es jetzt Blow Up gibt und Metro Goldwyn interessiert ist.«4 Sie war perfekt, aber es reichte nicht, um den Film wieder in Gang zu bringen. Hätten Sie diesen Titelseiten einen Platz in Ihrem Film eingeräumt? Die Sets sollten eine Mischung sein. Paul Delvaux hatte mir sein Einverständnis gegeben, die vorbereitenden Skizzen anzufertigen, René Allio
»Ein Haufen Vorwürfe« · 15
sollte sie bauen, und Saulnier war für die Architektur zuständig. Kurz gesagt, es waren drei von ihnen an dem Projekt beteiligt. Natürlich waren Delvaux die Titelseiten bekannt. Ich wollte eine Mischung aus Belgien, Amerika und England. Ich träumte von einer Straße, die an jeder Ecke das Land wechselte, ohne dass man es bemerkte. Wie in P ROVIDENCE … Ja (lacht), natürlich. Es gibt Teile von nicht gedrehten Filmen, die man in den realisierten Filmen wiederfindet. Ja, es gibt Bilder von Dickson in La vie est un roman (Das Leben ist ein Roman, 1983). Aber wenn Sie mit mir über vorgefertigte Ideen sprechen, die man richtigstellen kann, dann war es insofern nicht ich, der Harry Dickson drehen wollte, sondern Braunberger, und dann Anatole Dauman, für mich war es nie der Film meines Lebens. Da ich mich immer gegen die Idee gewehrt habe, einen Roman zu adaptieren, und Harry Dickson war ein bisschen ein Roman, war mir vielleicht nicht ganz wohl dabei. Es stimmt also nicht: »30 Jahre lang träumte er davon …«. Ein Film, der nicht in demselben Jahr gedreht wird, in dem er geschrieben wurde, langweilt mich sehr schnell. Wenn Harry Dickson für Sie den Roman repräsentiert, was würde ihn dann heute ersetzen? Wie Chris Marker bin ich weiß Gott ein Fan bestimmter amerikanischer Fernsehserien geworden. Meine neueste Leidenschaft ist Lance Henriksen in der Staffel von Millenium. Es ist ein Hyper-Claude Rains. Die Art und Weise, wie er es schafft, fast seine gesamte Rolle zu f lüstern – er ist immer im Schatten der anderen –, ist ziemlich erstaunlich. Millennium wurde von Chris Carter entwickelt, der auch für die X-Files verantwortlich war. Es hat alles, und die fesselnde Kraft der 54 Episoden, die ich kenne, ist da. Auch wenn es nicht gut ist. Mark Snow hat es wirklich geschafft, eine teuf lische Titelmusik im dämonischen Sinne zu schaffen, die mich sehr fasziniert. Das ist wirklich gruselige Musik. Mir macht das jedenfalls Angst. Den Kameramann, Robert McLachlan, kenne ich nicht. Alle Darsteller, ihr Schauspiel, der technische Schnitt, die Beleuchtung, das ist beeindruckend. Wie schaffen die es nur, in so kurzer Zeit so gut gemachte, durchdachte und ausdrucksstarke Filme zu machen, wenn sie 22 Episoden pro Jahr produzieren müssen? In der Episode mit den Hunden und dem ganzen Dorf, das sich ab fünf Uhr, wenn die Nacht hereinbricht, einschließt, habe ich ein echtes Angstgefühl gespürt. Henriksen sagte in einem kleinen Interview, das ich gesehen habe, dass es in der zweiten Staffel verrückt wurde und dass sie in der dritten
16 · Alain Resnais im Gespräch
Staffel auf hören mussten, weil es so wahnsinnig wurde. Er hat nicht Unrecht. Es ist der Wahnsinn. Die Folge, die ich letzte Woche gesehen habe, wirft eine Reihe von Fragen auf, die sich der Zuschauer stellen muss, der in apokalyptische Bahnen gelenkt wird, da sich die Geschichten immer wieder um die Apokalypse drehen. Der Film endet, und die einzige Antwort des Helden ist: »Ich weiß nicht, ich weiß nicht«. Gleichzeitig ist es großartig, uns 44 Minuten lang in Ereignisse hineinzuziehen, für die wir keine Lösung finden werden. Sie basiert auf den Mysterien der Welt. Der Held ist ein pensionierter FBI-Mann, der sich ein Haus eingerichtet hat, in dem er vor all den Schrecken geschützt ist, mit denen er täglich zu kämpfen hatte. Er wird von einer Gruppe namens Millennium aufgesucht, die an schwierigen Ermittlungen arbeitet. Und dieser Frank Black, das sieht man schon an der Einfachheit des Namens, hat eine Superkraft, die sehr comic-artig ist. Wenn er sich nach einem Verbrechen bestimmte Details ansieht, hat er kurzzeitig Visionen, aus denen er sich ein Bild des Mörders machen kann. Es scheint, als ob die Autoren aufgrund der Wahrnehmungsgabe der Figur nicht in der Lage wären, eine dramatische Handlung aufzubauen. Aber er muss diese Visionen, die meist aus 20 bis 50 verschiedenen, unterbewussten Bildern bestehen, interpretieren. Ich denke, wenn ich sie mir genau ansehe, kann ich Details erkennen, die mir eine Interpretation ermöglichen. Ich weigere mich jedoch, etwas zu dekonstruieren, das amüsant ist. Welche anderen Serien würden Sie uns empfehlen? Natürlich gibt es 24 Hours, die Sopranos, The Shield, die erste Staffel von Law and Order mit einigen großartigen Schauspielern, Mr. Moriarty in einem Clint-Eastwood-Streifen. Die ersten beiden Staffeln von Sex and the City waren gar nicht so schlecht. Danach wird es langweilig. Es gibt auch NYPD Blue: Ich spreche hier nur von den ersten beiden Staffeln. Die sind sehr, sehr gut. Sehen Sie sich das nicht im Fernsehen an, sondern auf DVD. Im Fernsehen ist es auf Französisch und man kann nicht folgen. Denn sie spielen viel mit den Nebenhandlungen, die alle Episoden miteinander verbinden. Man muss akzeptieren, dass man süchtig wird, man muss sie wirklich sehen und sich darauf einlassen. Wenn man sechs Monate auf die nächste Staffel gewartet hat und die Figuren wieder auftauchen, ist das großartig. Ich habe in letzter Zeit zwei oder drei französische Filme gesehen, die eindeutig von den ersten Staffeln amerikanischer Serien wie New York Police Blues5 oder Law and Order oder auch 24 Hours inspiriert sind, und mir fällt auf, dass die Qualität der französischen Dialoge im
»Ein Haufen Vorwürfe« · 17
Vergleich zu den amerikanischen sehr schwach ist. Man hat den Eindruck, dass die Franzosen sich damit begnügen, das zu sagen, was für die Handlung nützlich sein könnte, um einer Figur ein bisschen Charakterisierung zu geben, aber es gibt kein Bemühen um den Wortklang des Dialogs, den Rhythmus der Zeilen, die Art und Weise, wie er mit den Bildmontagen harmoniert. Die Amerikaner arbeiten, wie die Italiener, in Gruppen. Es ist wie bei den ersten Fernsehsendungen, die mit Radiosendungen gekoppelt waren; sechs Drehbuchautoren mussten es schaffen, in einer Woche eine bis anderthalb Stunden Fernsehen zu machen und so einen Dialog zu schreiben. In Neil Simons Stück Laughter on the 26th Floor geht es genau darum: Er zeigt die Arbeit von sechs Autoren für Sid Caesar (er nennt ihn nicht), der am kommenden Samstag anderthalb Stunden live im Fernsehen auftritt. Und es gibt einige sehr gute Leute darin, wie Woody Allen, der einer der Autoren war, Carl Reiner, der ein Autor war, und Neil Simon, der eine der Rollen spielte … Es gibt diesen Satz von Woody Allen: »Als ich mein Drehbuch für Sid Caesar schrieb, fühlte ich mich, als würde ich etwas so Uninteressantes wie einen Brief an meine Mutter verfassen, aber als Sid Caesar wütend hereinkam, mein getipptes Blatt nahm und es laut las, wurde es magisch.« Die Idee, dass der Text durch den Schauspieler zum Leben erweckt wird, gefällt mir sehr gut, das ist wirklich interessant. Die französischen Filme, von denen ich spreche, sind sehr gut gespielt, sie sind sogar sehr gut gefilmt, aber die Sprache ist schlecht. Was den Comic angeht, so hatten wir den Eindruck, dass die Initialen Ihres Namens die gleichen sind wie die von Alex Raymond 6 (lacht) und dass Ihre Unterschrift … (lacht) Ja, ja, das ist wahr (lacht) Das A und das R sind ähnlich … Aber nicht ganz. Auch jetzt noch amüsiere ich mich manchmal, wenn ich einen Vertrag oder etwas anderes unterschreibe und dabei das A R von Alex Raymond genau nachbilde. Die Unterschrift ist nicht bewusst, aber das Unbewusste hat gewirkt, das steht fest. Andererseits ist es kein Zufall, dass mein erstes Pseudonym, als ich versuchte zu schreiben (ich hatte keinen Erfolg, aber ich versuchte es), Alex Réval war. Es klang sehr populär. Und dann: Alex Réval, Alex Raymond … Zwischen Alex und Alain gibt es mehr Gemeinsamkeiten, als es den Anschein hat (lacht), und auch zwischen Ray-mond und Res-nais. Das A, das Sie schreiben,
18 · Alain Resnais im Gespräch
ist dem von Alex Raymond sehr ähnlich, das R unterscheidet sich ein wenig in der Art, wie es nach unten führt. Aber diese Unterschrift stammt nicht aus der Zeit meines zwölften Lebensjahres. Es muss also danach passiert sein. Ich erröte, dass ich so viel Wert darauf lege … Wir sind es, die auf dieses Detail Wert legen! Es stimmt, die Entdeckung der amerikanischen Comics, die sich so sehr von den französischen Bildergeschichten unterschieden, war ein großer Schock … Das erste Terry-and-the-Pirates-Comic, das ich sah!7 … und als ich die echten Flash Gordon in Originalgröße aus dem New York Journal und dem American in die Hände bekam, war ich so beeindruckt, atemberaubend. Ich werde überhaupt nicht rot. Ich war sehr bewegt, als ich in Umberto Ecos neuestem Roman La misteriosa fiamma della regina Loana (Die geheimnisvolle Flamme der Königin Loana) entdeckte, dass er oft für die gleichen Dinge empfänglich war wie ich, für die gleichen Details. Ich hätte ihm beinahe geschrieben. »Le Paysan de Paris« (»Der Pariser Bauer«) von Aragon hat Ihnen sehr gut gefallen. Der zweite Teil dieses Buches dreht sich um den Parc Buttes-Chaumont und die Pont des suicides. Die geführte Tour von ON CONNAÎT LA CHANSON führt über diese Brücke. Ja … Das war das Ergebnis von Gesprächen mit den Drehbuchautoren. Ich wollte in meinem Film eine Stadtführung einbauen. Das amüsierte JeanLouis Bacri, und so wurde aus der Figur eine Touristenführerin. Als Kind, aus der Bretagne stammend, war ich mit vier oder fünf Jahren im ButtesChaumont-Park – mein Großvater war Apotheker in Bolivar – und ging acht Tage lang jeden Tag dorthin, und das machte mir Angst. Ich war in der Tat sehr beeindruckt: die Höhlen, die Abgründe, wenn man sechs Jahre alt ist, ist das sehr beeindruckend. Als ich viel später entdeckte, dass Breton, Aragon und ihre Bande nachts dorthin pilgerten und Paris zu Fuß durchquerten – wir denken heute nicht mehr an nächtliche Wanderungen durch Paris –, wurde mir bewusst, dass wir gemeinsame Vorlieben haben könnten. Daher war es klar, dass die Tour dort entlangführte. Erinnern Sie sich an »L’inconnue de la Seine«, die Maske einer ertrunkenen jungen Frau, die die Surrealisten faszinierte? Sabine Azéma wird am Ende von M ÉLO zu einer unbekannten Frau an der Seine. Aber ja, natürlich. Ich muss Bilder von ihr gesehen haben. Ich denke oft darüber nach. Ich habe viele Artikel oder Bücher gelesen, in denen sie
»Ein Haufen Vorwürfe« · 19
erwähnt wird. Habe ich während Mélo daran gedacht? Ich bin Bernstein gefolgt. Damals gab es ein Lied von Kurt Weill, das mich auf dieses Thema zurückbrachte, es ist eines der wenigen französischen Lieder, für das er die Musik komponiert hat. Es heißt Complainte de la Seine. Der Text von Maurice Magre erzählt von allem, was man auf dem Grund der Seine finden kann. Ein schönes Lied, das Kurt Weill komponierte, als er in den 1930er Jahren durch das damalige Paris reiste. In Ihrem Werk gibt es viele Ertrunkene oder Selbstmörder. Ja, darüber habe ich nachgedacht. Ich bestehe darauf, dass dies noch nie von einem Drehbuchautor bewusst und freiwillig verlangt wurde. So ist es nun einmal. Ich würde sagen, das ist die conditio humana. Wie kann man sein Leben beenden? Ich bewundere Julliard vom Observateur, der sagt: »Ich habe überhaupt keine Angst vor dem Tod. Alles, was ich will, ist zu Hause zu sterben.« Wie schafft man es, ruhig zu Hause zu sterben, ohne zu leiden, wie erreicht man seinen Tod? (lacht) Sind Sie ein Mann der Flut oder der Ebbe? Das ist eine sehr schwierige Frage. Zumindest wurde ich das noch nie gefragt (lacht). Meine Antwort ist natürlich eine doppelte. Bretonische oder normannische Antwort? Nein, nicht ganz. Ich bin ein Mann der Ebbe, ja, wenn die Ebbe das ganze Gras freilegt, den Wald unter dem Meer. Ich mag es sehr, wenn die
Mon oncle d’Amérique – Großvater mit Kind am Meer
20 · Alain Resnais im Gespräch
Flut steigt, denn dann kommen die Krabben heraus und laufen herum – vielleicht ist das jetzt mit der Umweltverschmutzung vorbei – und man kann sie mit der Hand fangen, was ich früher auch gemacht habe. ((Abb. 1)) Und Sie haben sie gegrillt, wie es Ihr Großvater tat. Ja. Wenn die Ebbe herrscht, wie man so schön sagt, sind auch alle Tiere weg. Wenn das Wasser steigt, kommen sie zurück. Damals konnte ich noch Krabben fangen und so Sachen. Es ist sehr lebendig. Aber gleichzeitig hängt es natürlich auch von der Region ab. Jedenfalls ist es in der Bretagne so, wenn Ebbe ist. Und ich laufe viel lieber auf nassem Sand als auf trockenem Sand. Spaziergänge bei Ebbe sind also viel romantischer. Und ich bin sicher, dass Michel Le Bris das Gleiche sagen würde. Es gibt Inseln, die man bei Ebbe erreichen kann, wo man bei Flut nicht hinkommt, jedenfalls gibt es welche. Und die Schätze am Strand. Genau, ja. Oder wie zu Beginn von MON ONCLE D’A MÉRIQUE (M EIN ONKEL AUS A MERIKA, 1980), wo man sich plötzlich in eine etwas andere geologische Epoche versetzt fühlt. Bei Ebbe befinden wir uns in der geologischen Tiefe. Wir Menschen, die wir im Vergleich zu den großen Zyklen von Bäumen und Felsen ein so flüchtiges Leben haben, tauchen plötzlich in eine Tiefe ein, die wir mit der Flut vielleicht nicht haben. Ja … Es stimmt, dass ich mich am Ufer des Mittelmeers, wo der Meeresspiegel immer hoch ist, ein wenig frustriert fühle. Wir haben die Abwesenheit von Feuer (lacht) in Ihrem Werk bemerkt (abgesehen von den apokalyptischen Feuern in NUIT ET BROUILLARD und H IROSHIMA), bis hin zu dem Punkt, dass Hélène Aughain in MURIEL einen falschen Kamin anzündet. Ja, darauf war ich sehr bedacht. Was die Abwesenheit von Feuer betrifft, habe ich keine Antwort … Man könnte sagen, dass mein Vater große Angst vor Feuer hatte. Als Kind geriet er bei einem Brand im Treppenhaus in Lebensgefahr. Er kam ohne Verbrennungen davon, aber er war wie besessen. Sobald er abends von der Apotheke nach Hause kam, sagte er: »Ich rieche Gas« und ging in die Küche, um nachzusehen, ob Gefahr bestand. So ging ich, ein schüchternes und gehorsames Kind, im Sommer mit Streichhölzern in den Garten, um das Gras und die Zweige anzuzünden und zu sehen, was passieren würde. Wenn er das gewusst hätte! Erziehen ist keine leichte Aufgabe!
»Ein Haufen Vorwürfe« · 21
Halten Sie sich immer noch für einen »mystischen Atheisten«, wie Sie es ausdrücken? (lacht) Ja, wenn ich zufällig die Zehn-Uhr-Messe auf France Culture einschalte, höre ich mir die Predigten an. Wenn ich mir mehrere Äpfel anschaue und die Art und Weise, wie jeder einzelne aussieht, hat das etwas sehr Rätselhaftes. Es ist schwer vorstellbar, dass nicht der Wille bestand, in Werkstätten mehrere Apfelsorten zu entwickeln. Manchmal ist es so perfekt gemalt … Die schönen amerikanischen Äpfel, rot, ich weiß nicht mehr, wie sie auf Englisch heißen. Sie kennen den Witz, den man Einstein oder manchmal auch Paul Valéry zuschreiben kann (das muss falsch sein): »Das Verrückteste an all dem ist, dass es einen Sinn haben könnte.« Wenn du einem Affen Buntstifte und ein leeres Blatt Papier gibst, wird er den Kreis und die Linie nicht einfach irgendwo hinmalen. Warum haben wir dieses Gehirn und warum schaffen wir so nutzlose Dinge wie Gemälde und Filme? Niemand hat mir eine Antwort geben können. Wenn Sie die Antwort haben, bin ich interessiert, ich werde einfach ein reiner Atheist sein, kein Mystiker (lacht). Ist das nicht Karl Krauss’ Ausdruck »mystischer Atheist«? Es müsste von Stefan George sein. Das hatte ich wohl gelesen, als ich noch Schönberg studierte. Es sollte in den Umkreis von Alban Berg gehören. Bringt dich »die nutzlose Ehrlichkeit von Alceste« zum Lachen, wie Floc´h behauptet? Schöne Formulierung. Das mag nach der Diskussion über die Frage, ob das Theater oder das Kino das Leben verändern kann, gesagt worden sein, aber sicher nicht so gut. Die ewige Frage. Ein Film oder ein Theaterstück, Kunst, Fiktion, all das ermöglicht uns schnellere und herzlichere Kontakte. Wenn Sie jemandem begegnen, der einer Zivilisation angehört, die nichts von dem weiß, was Sie an imaginären Welten kennen, wird der Dialog zweifellos monatelang sehr schwierig sein. Nehmen wir ein Beispiel, das mich in meine Vergangenheit zurückversetzt. Als ich den japanischen Schauspieler Eiji Okada kennenlernte, sprachen wir bei der zweiten Begegnung über Tschechow, nachdem er mir gesagt hatte, dass er eine so schwierige Rolle nicht spielen könne usw. Das schaffte dann plötzlich die erste Verbindung. Er kannte Tschechow und ich kannte Tschechow. Tschechow war also der Grund, warum wir überhaupt zusammen zu Mittag essen konnten. Es gab eine Zeit, in der ich dachte, dass die Menschen in den Krieg zogen, weil sie sich zu Hause langweilten,
22 · Alain Resnais im Gespräch
weil sie keine Leidenschaft für Frauen, Bücher, Musik oder die Gastronomie hatten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das war, als ich ungefähr 20 war. Wir haben gesehen, dass sehr kultivierte Menschen … Jean Champion ist großartig in MURIEL, wenn er Déjà singt. Ich denke immer noch, dass es ein außergewöhnliches Lied ist. Ich habe das Lied oft in meinem Kopf gehört, während ich die Straße entlanglief, oder ich hörte Teile des Liedes vor einem Arztbesuch. Wenn wir uns darauf einließen, würden wir oft Worte aus bekannten Liedern verwenden, um auszudrücken, was wir zu sagen haben. Déjà hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Es ist ein Lied über die Zeit. Ich habe den Eindruck, dass ich Paul Coline im Théâtre de Dix heures singen gesehen habe. Ich muss mich irren. Ich habe Paul Coline im Théâtre de Dix heures gesehen, aber ich hatte damals nur die Platte, ich glaube nicht, dass ich ihn singen gesehen habe. Er lebte noch zur Zeit von Muriel, und ich weiß, dass er ein wenig überrascht war, als wir ihn fragten, ob wir die Rechte kaufen könnten. […]
Streifzüge durch ein Werk Ist in MURIEL die Figur des Jean Dasté, der Mann mit der Ziege, eine Anspielung auf Picassos Mann mit Schaf? Nein, ganz und gar nicht. Ich würde eher einen Einf luss von Pudovkin mit den drei Ebenen in der Achse sehen. Sie waren Gegenstand einer langen Diskussion mit Anatole Dauman, der der Meinung war, dass das dreimalige Erscheinen der Ziege zu viel sei. Ich habe lange gezögert, darüber nachgedacht und schließlich beschlossen, dass ich diese Wiederholung der Stimme von Dasté haben wollte. Ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch war. Wer spielt die Kellnerin in der elsässischen Brasserie? Wenn sie nicht im Abspann genannt ist, liegt das daran, dass sie die echte Kellnerin in der echten Brasserie war. Wo ist das Zentrum? Das ist eine persönliche Anekdote. Als ich das erste Mal nach Brüssel fuhr, kam ich nachts an, und man konnte nichts sehen. Ich fragte: »Wo ist das Zentrum?« Mir wurde gesagt: »Aber Sie sind doch schon da …«
»Ein Haufen Vorwürfe« · 23
Die Türen der Wohnung von Hélène Aughain, immer noch in MURIEL, sind noch unfertig … Das ist gewollt. Hélène Aughain ist eine Frau, die nie sesshaft wird, und sie ist Antiquitätenhändlerin. Ihre Wohnung ist im Grunde genommen ein Laden, in dem die Leute etwas aussuchen. Alles, was den Eindruck der Unvollständigkeit, des Unwohlseins erwecken konnte, wurde verwendet. Die Wohnung ist im Filmstudio eingerichtet. Ich habe es schon gesagt, aber die Herausforderung des Films war: Wir drehen in Farbe, das ist das Wesentliche, wir bewegen die Kamera nie, wir drehen mit acht Tagen Verspätung zum Skript, wir erfinden nichts und wir tun nichts, damit es besser aussieht. Wir erlauben uns höchstens, einen Blumenstrauß zu entfernen, wenn er zu viel Platz im Hintergrund einnimmt. Ein typisches Beispiel ist: Dort ist der Bahnhof, gegenüber ein Café. Im Film gehen wir in das Café, es ist das Café gegenüber dem Bahnhof, auch wenn es schäbig aussieht. Es regnet, es regnet. Es ist sonnig, es ist sonnig. Wir drehen zur vereinbarten Zeit – acht Tage zu spät. Wenn wir vor einem Geschäft stehen, werden wir nichts am Schaufenster ändern. Wir bewegen die Kamera nur für die letzte Aufnahme. Es gab eine Diskussion mit dem Produzenten: »Aber Alain, nimm doch ein paar Schienen im LKW mit.« Ich lehnte die Schienen ab, was den Produzenten zu der Annahme verleitete, dass die Dreharbeiten schneller gehen würden. Sie waren viel langsamer. Es war der längste Dreh, den ich je gemacht habe. Es brauchte zwölf oder dreizehn Wochen. Statt 400 bis 500 gab es 800 Schnitte. Was braucht Zeit beim Film? Es ist die Einstellung der Kamera, nicht die Aufnahmesequenz. Selbst wenn es sich um Ophüls handelt, wenn man eine sehr komplizierte Aufnahme macht, die den ganzen Tag braucht, aber nur acht Minuten dauert, hat man einen großartigen Tag gehabt. Es ist mein teuerster Film und vielleicht derjenige, der die wenigsten Zuschauer hatte. Von der Presse wurde er schlecht aufgenommen, und die Leute kamen gar nicht erst. Jetzt ist er sozusagen ein Kultfilm. Ja, es ist schon seltsam, diese völlige Wandlung. Das heißt aber nicht, dass der Film viele Zuschauer anziehen würde. Eine Neuauf lage von Muriel wird nie ein breites Publikum anlocken … Filme, in denen die Helden keinen Erfolg haben, und bei Muriel ist das ja nicht ungerecht; ich denke, es ist eine dramatische Form, die nicht attraktiv ist. Die Figur, die Schwierigkeiten hat und nicht triumphiert, wenn wir bedauern, dass sie nicht erfolgreich war, ist alles in Ordnung, aber Alphonse oder Hélène, Bernard sind Menschen, die immer wieder Fehler machen, und das er-
24 · Alain Resnais im Gespräch
Falscher Kamin in Muriel
zeugt Unbehagen. Wir können nicht sagen, dass das Schicksal ihnen gegenüber ungerecht war. […] ((Abb. 2)) Wir haben eine besondere Zuneigung für JE T’AIME JE T’AIME (ICH LIEBE DICH, ICH LIEBE DICH, 1968), der zur falschen Zeit herauskam und darum nicht die Resonanz erhielt, die er verdient hätte. Hierfür gibt es zwei Gründe. Einer ist künstlich. Es gab lediglich die Hälfte des Vorschusses an Einnahmen. Also dachten die Koproduzenten: »Wenn nur die Hälfte finanziert ist, ist es nur halb so gut.« Der Film wurde also aufgegeben, und dann ging François Truffaut zu Mag Bodard, ohne mir etwas davon zu sagen, und sagte zu ihr: »Resnais hat einen fertig vorbereiten Film, es ist deine Pf licht als Produzentin, ihn zu produzieren.« Truffaut war sehr ritterlich. Sie antwortete: »Na gut, wenn Sie mich schon fragen.« Und der Film wurde ein Jahr später gedreht, aber das war nicht gut, er hing einfach zu lange in der Schwebe. Ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich bei den Frauen in Claude Ridders Leben nicht darauf geachtet habe, sehr unterschiedliche Schauspielerinnen zu engagieren. Ich habe nicht darüber nachgedacht, und Jacques Sternberg auch nicht. Psychologisch gesehen ist es gar nicht so schlecht, dass er immer mit demselben Typ Frau zusammen ist, aber aus dramaturgischer Sicht, wenn man den Lauf der Zeit sichtbar machen will, ist es nicht klug.
»Ein Haufen Vorwürfe« · 25
Heute erscheint er als ein wegweisender Film. Es ist ein Erfolg. Ich kann das nicht selbst beurteilen. Ich verstehe sehr gut, dass die Menschen den Überblick verloren haben. Ich irre mich wirklich. Ich hätte mir die Frage stellen sollen. Anouk Ferjac, Marie-Blanche Vergne, Irène Tunc, Carla Marlien, ähneln der Heldin Olga Georges-Picot im Grunde nicht, aber es gab Zuschauer, die dachten, es sei dieselbe Frau. Sie sind jedoch sehr unterschiedlich. Catrine ist viel zurückhaltender. Dann habe ich vielleicht zu subtil gedacht: Die Figur der Catrine ist zerstörerisch, obwohl sie sich selbst widerspricht; sie ist ein Mädchen, das ihren Gefährten ins Verderben führen wird, sie versteckt den Tod. Das Klischee einer dramatischen Schauspielerin ist zu vermeiden, wir mussten eine Frau nehmen, die gesund aussieht und der wir nicht misstrauen. Vielleicht haben wir nicht hart genug gearbeitet. Die Idee war, dass sie nicht als Verkörperung des Todes gesehen werden sollte. Sie sollte nicht von Anfang an wie eine verwilderte russische Heldin aussehen. Dies hat das Filmverständnis sicherlich beeinträchtigt. Einen Helden zu haben, der sich weigert, irgendetwas zu tun, und dass der Film im Mai ’68 in die Kinos kam, das war nicht der richtige Moment. Für Je t’aime je t’aime wurden jedoch 150.000 Eintrittskarten verkauft. Nicht schlecht im Jahr 1968. Aber letztes Weihnachten war er immer noch im Defizit. Die Figur des Claude Rich ist großartig. Ich sagte ihm, ich würde den Film nicht machen, wenn er nicht zusagt. Es war eine klare Entscheidung. Und Jacques Sternberg stimmte zu. Über die Zeit nach JE T’AIME JE T’AIME meinte Jacques Doillon: »Es war eine Zeit, in der er nichts machte, in der er im Stich gelassen worden war … « 8 Können Sie uns etwas über diese schwierige Zeit erzählen? Ich war für ein oder zwei Wochen in New York. Bernard Gicquel hatte dort ein Atelier und war für drei oder vier Monate weg. Er bot uns an, in seinem Studio zu wohnen. Die zwei Wochen verlängerten sich auf zwei Monate. Aus Frankreich kam nichts. Ich hatte keine Aufträge. Ich hatte den Übersetzer der Werke von Sade, Richard Seaver, kennengelernt. Es war eine lustige Situation. Ich wusste praktisch nichts über das Werk von Sade. Er kannte es sehr gut. Ich hatte fotografiert, ich kannte alle Orte. Er hatte kein bestimmtes Bild im Kopf. Wir dachten, wir würden uns gut ergänzen, und der englische Produzent Frank Perry finanzierte das Drehbuch von Délivrez nous du bien. Das war zur Zeit der Mondlandung. Es war ein Sonntag, an dem wir arbeiteten, und wir hatten uns
26 · Alain Resnais im Gespräch
geschworen, dass wir wegen der Mondlandung nicht mit der Arbeit aufhören würden. Wir haben es nicht geschafft (lacht) und haben aufgehört. Es ist also zeitlich eindeutig festzumachen. Wir konnten Dirk Bogarde überzeugen, aber es war ein Krisenjahr für das britische Kino. Sade hätte gedreht werden können, aber es muss gesagt werden, dass es sehr streng war. Ein Produzent willigte ein, einen Film mit Stan Lee in Auftrag zu geben. William Friedkin vermittelte mir den Kontakt zu seinem Agenten. Wir konnten einen Vertrag aushandeln, und ich bekam ein Stipendium, während Stan Lee schrieb. Kurz gesagt, ich habe gelebt, das ist alles. Die Rückkehr nach Frankreich war herzzerreißend. […] I WANT TO GO HOME (1988) ist ein unbeliebter Film. Zumindest in Frankreich. Aber er hinkt auch tatsächlich. Was halten Sie von der doppelten Erklärung, die wir für diese Frage vorschlagen? Auf der einen Seite beschreiben Sie die Unzulänglichkeiten zweier Kulturen (indem Sie sie gegeneinander antreten lassen) auf eine satirische Art und Weise, die das Publikum unentschlossen zurücklässt, ohne zu wissen, wohin es sich bewegen soll. Andererseits haben wir einen Resnais-Film über Comics erwartet, und diese Erwartung wurde enttäuscht (lacht). Warum habe ich dem Produzenten vorgeschlagen, mit Jules Feiffer zu arbeiten? Weil mir sein Theater gefallen hatte und weil mir sein Roman gefallen hatte. Ich hatte eine Art Rückzieher, weil ich dachte, dass er auch ein Comiczeichner ist. Ich mochte seine Comic-Geschichten, seine Graphic Novels, wie man heute sagt, sehr. Aber ich wollte, dass er ein Drehbuch für mich schreibt, so wie er ein Theaterstück schreibt. Tatsächlich fand er während der Arbeit an I Want to Go Home Zeit, ein Stück zu schreiben, das ich in New York gesehen habe – ich sage nicht am Broadway, weil es weiter oben aufgeführt wurde – und das ausgezeichnet ist, wild, aber ausgezeichnet. Beim Schreiben des Drehbuchs gab es ein wenig Unruhe. Ich habe ihn gebeten, nicht über das Zeichnen oder Comics zu sprechen. Er begann mit der Geschichte eines Soldaten, der 1944 in die Normandie zurückkehrte. Dieser Start war zu ähnlich zu anderen Filmen. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Dann tauchte etwas auf, das mir sehr gefiel, nämlich die falschen Freunde – das wurde fast der Titel –, all die englischen Wörter, die französisch klingen, aber zu Missverständnissen führen: »éventuellement« und »eventually« sind das Gegenteil. Aus dieser Idee entstand ein Wörterbuch mit allen Wörtern: »rampant racism (zügelloser Rassismus)«, der in Artikeln des Express als
»Ein Haufen Vorwürfe« · 27
»racisme rampant« bezeichnet wird, während es sich um »racisme déchaîné (entfesselter Rassismus)« handelt, was nicht ganz dieselbe Bedeutung hat. Wie im Italienischen bedeutet »morbido« das Gegenteil von »morbide«. Davon ausgehend konnten wir uns eine Handlung über Missverständnisse zwischen Amerikanern und Franzosen vorstellen. Das war also das zweite Thema. Bei einem dritten Besuch wollte er Comics untermischen. Wegen meines Rufs als Comic-Fanatiker war ich sehr zurückhaltend. Wahrscheinlich gibt es einen Vorbehalt gegenüber diesem Aspekt des Films, sonst hätte ich es gerne durchgezogen, und es war ein bisschen wie ein Zwischenstadium. Vielleicht ist es das, was dem ganzen Film eine gewisse Zurückhaltung verleiht. Ich habe das Thema Comic wie eine heiße Kartoffel behandelt (lacht) und mir gesagt: »Das ist zu sehr mein Geschmack, ich kann keine Fantasie in etwas stecken, das mich so sehr interessiert.« Man weiß nicht immer, auf welchem Fuß man tanzen soll. Marin Karmitz gefällt der Film sehr gut. Da er der Produzent ist, freue ich mich doppelt. Zweifellos waren die 7.000 Kilometer, die Jules Feiffer von mir trennten, für die Arbeit am Drehbuch nicht förderlich. Vielleicht haben wir es nicht bis zum Ende geschafft. Aber die Missverständnisse hielten an, denn als ich Feiffer die erste Arbeitskopie zeigte, dachte ich, er sei sehr enttäuscht, dann las ich drei Jahre später Interviews mit ihm, in denen er sagte, dass er den Film sehr mochte. Ich habe nach dem Feiffer von Carnal Knowledge (Die Kunst zu lieben, 1971) gesucht.9 Aber er stellte sich auch vor, dass der Film nicht zustande kommen würde, denn er hatte schon mehrmals unfertige Drehbücher gehabt. In Amerika ist dies üblich. Man bekommt Studienleistungen, um ein Drehbuch zu schreiben, aber wenn der Film nicht gedreht wird, spielt das keine Rolle. Er hat mehrmals gesagt – natürlich ironisch –, dass er es geschrieben hat, weil er seiner Frau Paris zeigen wollte (lacht), damit er 14 Tage in Paris verbringen konnte. Er konnte das Drehbuch nicht in 14 Tagen schreiben, sondern musste arbeiten. Man spürt, dass es bei allem ein Zögern gibt. Gleichzeitig liebe ich Feiffer nach wie vor, ich liebe sein Werk nach wie vor, ich liebe ihn als Menschen nach wie vor, auch wenn wir uns aus den Augen verloren haben. Was mich bewegte, war ein Artikel des Sohnes von Adolph Green10, demzufolge die letzten Worte seines Vaters vor seinem Tod waren: »I want to go home«. Ist das eine Erinnerung an den Film? Ich hatte eine große Zuneigung zu Adolph Green, die weder während der Dreharbeiten noch später nachgelassen hat. Aber ich glaube, es gab noch ein weiteres Missverständnis. Ich hatte Adolph Green auf der Bühne gesehen, aber 15 Jahre früher. Freunde sagten mir, dass diese Figur, dieser Schauspieler
28 · Alain Resnais im Gespräch
Adolph Green in I want to go home
sehr alt sei, dass ich Adolph Green in Höchstform am Broadway in der Nummer mit Betty Comden gekannt habe und dass ich ihn notwendigerweise mit diesen Augen gesehen habe und dass ich nicht bemerkt habe, dass er sich verändert hat. Hätten wir ihn nie kennengelernt, würden wir in dem Film jemanden sehen, der zu alt für die Rolle ist. Sobald ich mit Marin Karmitz über den Film spreche, ändere ich meine Meinung über all das und bin bereit, mich von seinen Argumenten überzeugen zu lassen (lacht) … ((Abb. 3)) […] Sie mögen es, etwas ein »erstes Mal« zu tun (lacht). Mir gefällt der Gedanke, dass etwas noch nicht gemacht wurde. Es stimuliert mich, aber es darf vom Zuschauer nicht wahrgenommen werden. Es ist ein inneres Spiel, und ich sage: mit Bescheidenheit. Es geht nicht darum zu sagen: »Ich bin innovativ oder ich bin modern«, nein, denn das kann eine Minute des Films sein. Oft ist es ein Detail, das mir genügt. Und dann passiert es auch, dass ich denke, ich habe etwas gemacht, was noch nie gemacht wurde, und wir haben ja nicht alle Filme gesehen, und plötzlich schaue ich mir Lubitschs Der Studentenprinz (1927) an (lacht) und sehe, dass die Vorwärtsbewegungen in Der Krieg ist vorbei für Lubitsch ganz normal sind. Letztendlich bin ich ganz froh darüber. Da ist die längste Einstellung von einem Schauspieler in Mélo, die Trennung zwischen Musik und Fiktion in L’A MOUR À MORT …
»Ein Haufen Vorwürfe« · 29
Bei L’amour à mort (Liebe bis in den Tod, 1984) war das in der Tat ein wichtiger Aspekt, denn es gab Leute, die sagten: »Ah, wenn man den Film ohne Musik sehen konnte, dann war er toll, aber von dem Moment an, als er diese Musik einsetzte …« (lacht). Henze kam, um den Film zu sehen, und ich gab ihm ein Notizbuch mit meinen Überlegungen, was die etwa 50 musikalischen Interventionen sein sollten. Wir haben uns gut verstanden. Ich glaube, dass es dafür keinen Präzedenzfall gab. Und was ist mit M ÉLO? Glauben Sie wirklich, dass es keine Filme gab, bei denen es länger gedauert hat? Ich hatte nicht das Gefühl, ein »erstes Mal« zu machen. Das liegt wahrscheinlich an dem Text, den der Schauspieler spricht. Normalerweise in Bernsteins Verfilmungen, denn es gab schon mehrere, darunter Mélo (1932), den ich nicht gesehen habe, und doch haben Paul Czinner, Victor Francen, Pierre Blanchar und Gaby Morlay mir sehr gut gefallen, aber es gab keine Kopie. Wenn in den Verfilmungen eine Passage aus einem langen Monolog eines Schauspielers in Bernstein übernommen wird, dann wird sie immer bebildert. Die Möglichkeit, mit der Mimik des Schauspielers zu arbeiten, wurde vielleicht nicht ausgeschöpft. Das kann ich nicht beurteilen. Mit einem sehr komplizierten Blickwechsel. Nun, ja. Azéma und Arditi mussten in den Vordergrund gerückt werden, damit sie Zuschauer von Dussolliers Figur werden konnten. Ich glaube, es sind 15 Scheinwerfer gewesen. Es ging um Orgelmusik und Charlie Van Damme saß am Keyboard. Die Scheinwerfer mussten synchronisiert werden und sich ein- und ausschalten, wenn sich die Kamera langsam vorwärts bewegte. Meine Idee war es, der Geschichte treu zu bleiben. Für mich ist es im Leben so, dass man je nachdem, was die Leute einem erzählen, anders darüber denkt. Es geht nicht nur darum, die Beleuchtung zu ändern. Ich könnte diese Entscheidung im Bezug auf den dokumentarischen Film verteidigen. In jedem Film haben Sie etwas gemacht, das für Sie wie das »erste Mal« war? Ja, ja (lacht). Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jeden Film genau aufzählen kann. Es muss erwähnt werden, dass die Geschichte sehr schnell abläuft. Ich glaube, in Le temps d’un retour habe ich zum ersten Mal kontinuierliche Gespräche an verschiedenen Orten aufgezeichnet. Menschen in einem Treppenhaus, und dann sind sie auf der Straße, oder in
30 · Alain Resnais im Gespräch
einem Taxi, und die Zeilen sind zusammengefügt, als ob das, was auf dem Weg nach draußen, auf dem Weg nach drinnen, auf dem Weg zum Taxi usw. gesagt wurde, nicht existierte. Dort, vor allem bei der unbeweglichen Aufnahme, dachte ich, ich sei innovativ. Ich war sehr stolz, sehr glücklich, als ich sah, dass man das in Desplechins Rois et Reine (Das Leben ist seltsam, 2004) wiederfindet. Er war ein Student der Filmwissenschaft, er muss Ihre Filme gesehen haben. Ich weiß es nicht. Ich mag Desplechin sehr, ich verpasse keinen seiner Filme. Agnès Varda wurde in La Pointe courte (1955) dafür kritisiert, dass sie Figuren weit weg am Strand filmt und ihre Worte hören lässt. Jetzt ist es alltäglich. Die Konventionen sind unterschiedlich. Zum Beispiel in den Paul-Newman-Filmen von Sidney Lumet. Das geht sogar so weit, dass ich manchmal widersprechen würde: Paul Newman und eine andere Figur unterhalten sich und gehen die große Treppe eines Rathauses oder von etwas Ähnlichem hinunter. Es gibt eine Menschenmenge, und dennoch kann man hören, was sie sagen, ohne den Lärm der Menge wahrzunehmen. Ich denke also, dass Lumet einen weiten Weg geht, da er nicht auf einen bestimmten Effekt aus ist. Wenn es darum ginge, uns ein Gefühl der Unwirklichkeit oder der Konzentration zu vermitteln, dann würde ich zustimmen. Aber hier kümmert er sich nicht darum. Jetzt muss ich ein »erstes Mal« für den nächsten Film finden. Ist das ein Problem? Ein kleines bisschen. Ich versuche immer, das aus der Geschichte herauszuholen. Und in PAS SUR LA BOUCHE (2003), abgesehen vom Ensemble des Films? Was könnte dort gewesen sein? Gab es Filme, in denen alle Schauspieler ihre eigenen Stimmen zum Singen beibehalten haben? Ich weiß es nicht. Ich war mir nicht sicher, ob ich Neuland betreten würde. Im Grunde gab es immer ein oder zwei, die sowieso synchronisiert wurden. Die Herausforderung bei Pas sur la bouche bestand darin, die echten Stimmen aller Schauspieler zu bewahren, unabhängig davon, ob sie singen konnten oder nicht. Das spielte keine Rolle. Es war ein »erstes Mal«, es muss noch andere geben. Ich habe mit Ihnen darüber gesprochen, wie man über einen Aberglauben sprechen würde. Manche Menschen stecken eine Hasenpfote in ihre linke Tasche. In ON CONNAÎT LA CHANSON?
»Ein Haufen Vorwürfe« · 31
Die Verwendung der echten Stimmen der Liedermacher ist das Gegenteil von Pas sur la bouche. Es war durch die Bekanntheit der Filme von Dennis Potter gerechtfertigt, aber er hat den ganzen Song und einen ganzen Sketch zuerst gemacht, und dann wurde das für den Film gespielt. Es gab aber keine Übereinstimmung zwischen den Stimmen der Schauspieler und den Stimmen der zeitgenössischen Sänger. Für mich war es unterschiedlich genug, um ihm diesen Tribut zu zollen, den er leider nicht zu sehen bekam. Ich hatte Angst, dass man uns vorwerfen würde, wir würden Potter ausplündern, wenn wir ihn nicht in den Abspann aufnähmen. Wir wurden angegriffen, zumindest in ein oder zwei englischen Zeitungen, weil es nicht originalgetreu Potter war. Sie sagten, dass Potter tragisch sei, während On connaît la chanson fröhlich sei! In den 1960er Jahren plante Agnès Varda einen Film mit dem Titel »La Mélangite« (die »Mischeritis«). Dieser Titel scheint uns für Ihre Werke angemessen zu sein. Ja, das stimmt. Ich würde mich sehr freuen, von Agnès Varda getauft zu werden (lacht). Sie mischen Städte und architektonische Stile (eine Szene in P ROVIDENCE (1976) ist das bekannteste Beispiel); Sie mischen auch eine breite Palette von Einflüssen: Kurt Weill, Josef von Sternberg, die Surrealisten usw. Ich akzeptiere alle Eindrücke, ob sie nun von einem Gemälde oder von einem Radfahrer kommen, der einen auf der Straße anrempelt. Bücher reden miteinander, Filme reden auch miteinander. Und Bücher und Filme sprechen miteinander? Aber ja. Und das tun auch Gemälde … Aus dem Französischen übersetzt von Sophie Rudolph
1 Auszüge aus einem Interview, zuerst erschienen in: Suzanne Liandrat-Guigues und JeanLouis Leutrat, Alain Resnais. Liaisons secrètes, accords vagabonds, Paris 2006. Abdruck der Übersetzung mit freundlicher Genehmigung der Edition Cahiers du cinéma. — 2 Pierre Kast (1920– 1984), Filmemacher (zuerst Assistent von Jean Grémillon), Kritiker, Romanautor. — 3 Frédéric de Torwanicki hat sich vertieft mit Heidegger auseinandergesetzt (Martin Heidegger. Souvenirs et Chroniques, Paris 1999). Weitere Bücher von ihm: Ernst Jünger. Récits d’un passeur du siècle, Monaco/Paris 2000; Propos en liberté de Karel Appel, Paris 1970. Siehe Jean Beaufret, Entretiens avec Frédéric de Torwanicki, Paris 1984. — 4 Es sei darauf hingewiesen, dass Tschechow einen Platz im Leben von Alain Resnais einnimmt: »Lange Zeit habe ich das Theater gehasst. Alles änderte sich an dem Tag, als ich als Teenager Die Möwe sah.« (L’Arc 31 [1967], S. 93) Siehe weiter in diesem Interview Tschechow als gemeinsame Sprache zwischen Eiji Okada und Alain Resnais.
32 · Alain Resnais im Gespräch Delphine Seyrig, von Resnais in New York in Ibsens Der Volksfeind entdeckt, spielt nach Marienbad in Die Möwe (mit einem ihrer Filmpartner, Sacha Pitoëff ). André Téchiné schrieb einen schönen Text über La Guerre est finie (Der Krieg ist vorbei), der von Zitaten Tschechows untermalt wird (Cahiers du Cinéma 181 [August 1966], S. 24–25). — 5 Französischer Verleihtitel der US-amerikanischen Serie New York Police Cops. — 6 Alex Raymond (1909– 1956), berühmter Comic-Autor (für King Features Syndicate): Flash Gordon (der im Januar 1934 beginnt), Jungle Jim, Rip Kirby; er illustriert auch Secret Agent X-9 nach Dashiell Hammett. — 7 Dieser Comicstrip erschien erstmals 1934 und wurde von der Chicago-Tribune-New York News Syndicate herausgegeben. Der Autor ist Milton Caniff (1907–1988). — 8 Positif 220–221 ( Juli-August 1979), S. 38. — 9 Jules Feiffer schrieb Carnal Knowledge für die Bühne und adaptierte es dann für die Leinwand (unter der Regie von Mike Nichols im Jahr 1971). Das Stück wurde 1990 noch einmal Off-Broadway aufgeführt. — 10 Adolph Green (1915–2003), zusammen mit Betty Comden Autor von Broadway-Musicals. Gemeinsam arbeiteten er und Comden an zahlreichen Filmmusicals, von Greenwich Village (1944) bis What a Way to Go (1964), außerdem On the Town, Singin’ in the Rain, The Bandwagon, It’s Always Fair Weather, Bells Are Ringing …
Thomas Weber
Erinnern als filmischer Diskurs Die frühen Filme von Alain Resnais1 I. Einleitung
Alain Resnais drehte von 1950 bis 1961 fünf Filme, die sich mit den medialen Darstellungsmöglichkeiten von Erinnerung beschäftigten: Les statues meurent aussi (Auch Statuen sterben, 1953), Toute la mémoire du monde (Das Gedächtnis der ganzen Welt, 1956), Nuit et brouillard (Nacht und Nebel, 1956), Hiroshima, mon Amour (1958) und L’année dernière à Marienbad (Letztes Jahr in Marienbad, 1961). In allen diesen Filmen geht es um die Prozessualität des Erinnerns, mit der einerseits ein Diskurs über die Darstellbarkeit von Erinnerung im Allgemeinen eingeleitet und andererseits die Frage nach ethischen und politischen Perspektiven auf das Erinnerte aufgeworfen wird: Es ist eine moralische Frage nach der Sichtweise der Zuschauenden. Vorauszuschicken ist dabei, dass die filmische Konstruktion von Erinnerung ihre eigene – hier nur verkürzt darstellbare – Problematik hat. Denn gerade dort, wo Erinnerung traumatisch zugespitzt ist, fehlen häufig geeignete Bilder, die sie dokumentieren könnten. Oder Erinnerungen sind nur aus der Perspektive der Täter *innen oder Sieger *innen – nicht aber der Opfer – verfügbar. Auch Zeug*innenaussagen – als redende Köpfe in Großaufnahmen – sind für sich genommen wenig anschaulich und werden dem filmischen Medium kaum gerecht. Jeder Versuch hingegen, Erinnerung an historische Ereignisse durch fiktionale Elemente darzustellen, wird von Historiker *innen meist mit Argwohn betrachtet und dem Vorwurf ausgesetzt, sie würden die Geschehnisse verzerren oder manipulieren. Einige gehen sogar so weit, dass sie den Film dafür verantwortlich machen, die authentischen Erinnerungen von Zeitzeug*innen zu überlagern, sodass sie im Rückblick das im Kino oder Fernsehen Gesehene mit eigenen Erlebnissen verwechseln. Im Folgenden möchte ich zunächst kurz die verschiedenen Ansätze rekonstruieren, die Resnais in seinen Dokumentarfilmen vorgeschlagen hat, um mich dann vor allem auf Hiroshima, mon amour zu konzentrieren. Dieser Film ist sowohl die Summe als auch eine Weiterentwicklung seiner vorausgegangenen Filme und kann paradigmatisch für die oben beschriebene Problematik stehen.
34 · Thomas Weber
Dabei geht es wohlgemerkt nicht darum, wie der Film als Quelle von Geschichtsschreibung herangezogen werden könnte; auch nicht um die Bedeutung und die Rezeption von Resnais’ Filmen im historischen Kontext – auf die ich nur kurz im Zusammenhang mit den von ihnen provozierten Diskussionen, Skandalen und Zensurmaßnahmen verweisen möchte. Vielmehr steht die Frage im Fokus, in welcher Form Resnais versucht, Erinnerung zu konstruieren, welche Entwicklung es in seinen Filmen gibt und in welche mediale Problematik sich diese Konstruktionen einschreiben. Im Hinblick hierauf ergibt es auch wenig Sinn, Resnais gegen den vielfach von der Kritik erhobenen Vorwurf des Formalismus2 in Schutz zu nehmen, da es meiner Meinung nach spannender ist, zu hinterfragen, ob in seinen formalen Experimenten nicht gerade die Botschaft liegt. Macht nicht gerade seine formale Methode die Möglichkeiten und Grenzen des Mediums bewusst, Erinnerung zu organisieren und damit auch den Umgang mit historischen Ereignissen, die von Vergessen und Verdrängen bedroht sind? Resnais’ formale Experimente zeigen die Unmöglichkeit, die Erinnerung an traumatische Ereignisse einfach nur mit offiziellen Bilddokumenten zu bebildern; stattdessen löst er die Darstellung von Erinnerung auf zum Prozess des Erinnerns und öffnet so das Kino hin zur Seite von Mitteilbarkeit und Anteilnahme. Wichtig ist dies zum einen im Hinblick darauf, dass Zuschauende ihre eigene Verantwortung für das Geschehene einsehen und annehmen, eine Wiederkehr des Verdrängten also zulassen können; zum anderen, um Erinnerungsarbeit auch für zukünftige Generationen zu leisten, weil das Kino so die Chance bietet, Erinnerung an etwas zu organisieren, das man nicht selbst erlebt hat. Zugleich stellt das formale Experiment die Selbstverständlichkeit der formalen Gestaltung in Frage und damit zur Diskussion: vielleicht als Mahnung in einer immer stärker von Medien geprägten Welt, der Auswahl und Anordnung von Bildern mit der nötigen Skepsis zu begegnen.
II. Die Sonderstellung von Alain Resnais
Alain Resnais erhielt durch seine filmischen Arbeiten in den 1950er Jahren eine Sonderstellung innerhalb der Autorenfilmszene, die sich rund um die Filmzeitschrift Cahiers du cinéma versammelt hatte. Im Gegensatz zu den meisten anderen verfügte er über eine professionelle Ausbildung zum Filmemacher. Zu Beginn arbeitete er als Cutter und Regieassistent, sah sich zunächst als Filmhandwerker, nicht als Autor. In zeitgenössi-
Die frühen Filme von Alain Resnais · 35
schen Interviews bezeichnete er sich selbst oft noch als Auftragsarbeiter, dem es nie darum gegangen sei, persönliche, gar autobiografische Anliegen in seinen Filmen umzusetzen – eine Haltung, die freilich mit einem starken Understatement kokettierte, da seine persönliche Handschrift schon recht früh deutlich wurde, selbst dort, wo er mit Drehbuchautor*innen zusammenarbeitete. Nachdem er Ende der 1940er Jahre seinen Militärdienst in Deutschland und Österreich abgeleistet hatte, bekam er die Gelegenheit, seine ersten Kurzfilme zu realisieren. Mit einem Film über van Gogh (Van Gogh, 1948) konnte er sich auch international einen Namen machen und drehte zunächst weitere Kurzfilme über bildende Kunst wie Gauguin (1950) und Guernica (1952). Es folgten die bereits genannten fünf Filme, in denen er das Thema Erinnerung thematisch variierte und mit jeweils anderen filmischen Mitteln bearbeitete.
III. Les statues meurent aussi (1953)
Das Thema Erinnerung klingt bei Resnais erstmals in dem Film Les statues meurent aussi an, den er zusammen mit Chris Marker zwischen 1950 und 1953 im Auftrag der Zeitschrift Présence Africaine drehte. Die
Besucherin im Museum der »toten Statuen«
36 · Thomas Weber
30-minütige Dokumentation geht von den in den Pariser Museen ausgestellten afrikanischen Skulpturen, Statuen, Masken, Figuren usw. aus, die in rascher Folge montiert werden. Neben diese den Hauptteil des Films ausmachenden Bilder treten Aufnahmen der Besucher *innen und Ausschnitte aus anderen Filmen über das Leben der Afrikaner *innen auf dem Land, über schwarze Arbeiter, die von einem Weißen angeleitet werden, über Schwarze, die als Patienten zu einem weißen Arzt kommen, über die Paraden von weißen Kolonialherren, über Demonstrationen von Schwarzen, die von weißen Polizisten auseinandergetrieben werden. Les statues meurent aussi ist genau genommen eher ein Film über das Vergessen als über das Erinnern. Durch den Kolonialismus wurde die Geschichte der afrikanischen Statuen ausgelöscht und damit die Erinnerung an ihren Kontext, in dem sie eine lebendige Funktion erfüllten; dadurch sind die Statuen gleichsam gestorben, zu toten Objekten geworden, die das Abendland der eigenen Kunstgeschichte einverleiben konnte. Resnais arbeitet mit der Aneinanderreihung der aus dem Kontext gelösten Objekte und verbindet sie mit einem anspruchsvollen literarisch-polemischen Kommentar, der das Verlorene beklagt und zugleich den Kolonialismus als Ursache dieses Verlustes benennt. ((Abb. 1)) Man erfährt nichts über die Statuen als solche, über ihre kunstgeschichtliche Bedeutung. Resnais führt sie als verstümmelte Objekte vor und versagt sich, sie nur ästhetisch genießend vorzustellen. Die von Resnais in diesem Dokumentarfilm gewählte Konstruktion kann Erinnerung nicht darstellen, sondern nur ihre Abwesenheit thematisieren. Eine Geschichte, die vom Kolonialismus ausgelöscht wurde, lässt sich einklagen, aber nicht rekonstruieren. Der Film drückt Trauer über das Verlorene aus, aber auch Wut über die Gegenwart, die fortgesetzte kolonialistische Praxis. Les statues meurent aussi wurde gleich nach einer ersten Aufführung – Frankreich engagierte sich gerade militärisch in Indochina – bei den Filmfestspielen von Cannes von der Zensur verboten. Grund waren die antikolonialistischen Züge vor allem des letzten Filmdrittels, in dem insbesondere ein kritischer, ironisch-bissiger Off-Kommentar zur angeblichen Modernisierung Afrikas die Gemüter erregte, in dem u. a. behauptet wurde, dass auf diesem Kontinent »›allmählich der Typ des guten Negers hergestellt werde, wie er dem Traum des guten Weißen entspringe‹«.3
Die frühen Filme von Alain Resnais · 37
IV. Nuit et Brouillard (1956)
Einen anderen Weg schlägt Resnais in Nuit et brouillard ein, dem wohl bekanntesten Dokumentarfilm über den Holocaust. Auch hier sind die Objekte stumm, weil ihre Geschichte ausgelöscht wurde zusammen mit den Menschen, die sie erzählen könnten, genauso wie deren Bilder, sodass das Geschehen aus der Perspektive der Opfer kein Gesicht hat. Anders als in Les statues meurent aussi versucht Resnais nun aber diese Abwesenheit zu durchdringen. Er reiht die wenigen authentischen Filmaufnahmen, die von alliierten Streitkräften bei der Befreiung gedreht oder von den Nazis selbst angefertigt wurden, nicht stumm aneinander. Nuit et brouillard beginnt in der Gegenwart mit einer Farbaufnahme von grünen Wiesen und Feldern im Morgennebel; eine leichte Drehung der Kamera lässt einen Stacheldrahtzaun und die unscheinbaren Ruinen des Konzentrationslagers Auschwitz erkennen. Leidenschaftslos, sachlich präzise führt der literarisch ausgearbeitete Off-Kommentar, geschrieben von dem Schriftsteller Jean Cayrol, der selbst das Konzentrationslager Mauthausen überlebt hatte, durch die Gebäudereste und erklärt ihre Funktion. Erst jetzt montiert Resnais in Schwarz-Weiß historische Aufnahmen: der Aufmarsch zum Reichsparteitag 1933, Judentransporte, Sammellager und rollende Züge. In Farbe nun über die Gleisanlagen zurück ins Lager. Im ständigen Wechsel zwischen Ruinen in Farbe und dokumentarischen Aufnahmen in Schwarz-Weiß enthüllt sich der Planet des Grauens: die überfüllten Baracken, die Gaskammern, das Krematorium. Fotos von der Selektion auf der Rampe. Die Kamera fährt dabei unauf hörlich vorwärts. Die Musik von Hanns Eisler wird leichter und spielerischer, je schwerer das ist, was die Bilder zeigen. Schließlich Berge von Brillen, Schuhen, Haaren, Leichen und Seife. Enthauptete, Eimer voller Köpfe. Am Schluss steht wieder in Farbe das Bild der Lagerruine. Der Wechsel von Farbe und Schwarz-Weiß strukturiert den Film. »Der Weg von der Farbe […] ins Schwarzweißbild«, wie der Filmkritiker Peter W. Jansen dazu notierte, »ist der Weg, den das Gedächtnis nimmt [und der Traum]«.4 Resnais lässt Gegenwart und Vergangenheit ineinander übergehen – eine Konstruktion, die weniger Erinnerung selbst darstellt, als vielmehr eine Form der Vergegenwärtigung ist. Schon hier deutet sich eine Konstruktion an, die in Hiroshima, mon amour noch konsequenter umgesetzt werden wird: So sehr Nuit et
38 · Thomas Weber
brouillard auch auf dem Erinnern beharrt, so unerbittlich die Kamera auch auf den Bergen von Leichenteilen verweilt, so wenig lässt sich die industriell geplante und wissenschaftlich akribisch durchgeführte Massenvernichtung einfach mit Bildern – so authentisch diese auch sein mögen – illustrieren. Nuit et brouillard löste einen Skandal aus. Kurz vor Beginn der Filmfestspiele in Cannes wurde der Film auf Drängen des deutschen Botschafters in Paris, von Maltzan, der im Auftrag des Auswärtigen Amtes am Quai d’Orsay vorstellig geworden war, aus dem offiziellen Wettbewerb zurückgezogen, da – wie Die Zeit damals berichtete – »nach den allgemein anerkannten Richtlinien zu diesem internationalen Wettbewerb nur solche Filme zugelassen werden sollen, die nicht das Nationalgefühl eines anderen Volkes verletzen oder das friedliche Zusammenleben der Staaten erschweren, die also nicht an das politische Ressentiment appellieren.«5 Zwar wurde der Film schließlich doch noch – wenn auch außer Konkurrenz – in Cannes gezeigt, weil ein Sturm der Entrüstung losgebrochen war: Jean Cayrol hatte sich in einem Brief an Heinrich Böll gewandt, der – ebenso wie eine Reihe von französischen Schriftstellern – gegen die Absetzung des Films protestierte. Doch der Schaden für das Ansehen Deutschlands war durch die eilfertige Diplomatie bereits entstanden. Und Die Zeit fragte kritisch nach: »Wer hat den Auftrag zu jenem Protest gegeben? Der Bundesaußenminister war damals nicht in Bonn. Der Staatssekretär war auf einer Dienstreise. Sollte wieder einmal in sicherlich gut gemeinter Absicht ein ›Nur-Fachmann‹ die Sache ohne politisches Fingerspitzengefühl beurteilt haben?« 6 Die Affäre ließ sich nicht vollständig auf klären und die Zeitschrift Film-Dienst sprach ein halbes Jahr später nur von »diplomatischen Mißverständnissen«7, die zur Absetzung des Films geführt hatten. Das verhinderte übrigens nicht, dass Nacht und Nebel seinen Weg auch in die deutschen Kinos fand. Erstmals wird der Film »in Anwesenheit des Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses Willy Brandt im Rahmen der Filmfestspiele Berlin (…) aufgeführt; es folgen Kinoaufführungen zusammen mit Edmund Lufts Dokumentarfilm Ernst Reuter.«8 Schließlich wurde der Film 1957 zur Vorführung an höheren Schulen empfohlen9 (auch wenn Gutachterausschüsse in einigen süddeutschen Ländern ihn »für die geschichtliche Unterrichtung der Jugendlichen«10 als ungeeignet ablehnten) und bestimmte hierdurch und mittels zahlreicher Wiederholungen im Fernsehen (u. a. am 9.11.1978 im ZDF) nachhaltig das Bild der Deutschen vom Holocaust (wenn auch in einigen Bundesländern mit einer gewissen Verspätung: Erstausstrahlung in Bayern am 1.9.1989 im BR3).
Die frühen Filme von Alain Resnais · 39
Nuit et brouillard löste eine internationale, zum Teil bis heute andauernde Debatte aus. Das Werk gilt als der Film, der für eine ganze Generation das Bild des Holocaust geprägt hat. Bereits in seiner Entstehungsphase sind verschiedene Varianten entstanden. Die westdeutsche und die ostdeutsche Version unterscheiden sich z. B. in Details, aber auch die Distribution und Rezeption unterscheiden sich in verschiedenen Ländern.11 Auch gab es in späteren Jahren mediale Transformationen durch Remediatisierungen, bei denen der Film in anderen Filmen ganz oder in Ausschnitten vorgeführt wurde. Zu nennen ist beispielsweise Un Spécialiste: Portrait d’un Criminelle Moderne (Ein Spezialist, 1999) von Eyal Sivan, eine verfremdend-essayistische Zusammenfassung des Eichmann-Prozesses, in der auch Ausschnitte aus Nuit et brouillard zu sehen sind, sowie Le regard du bourreau (2008) von Chris Marker, der einen Film über die Sondervorführung von Nuit et brouillard im Eichmann-Prozess gedreht hat und den Film nochmal in voller Länge, aber aus einer anderen Perspektive zeigt. Und selbst in Spielfilmen wie Die bleierne Zeit (1981) von Margarethe von Trotta und Die innere Sicherheit (2000) von Christian Petzold finden sich Referenzen auf Nuit et brouillard.
V. Toute la mémoire du monde (1956)
Gleich im Anschluss an Nuit et brouillard drehte Resnais noch eine andere kurze Dokumentation über die Bibliothèque nationale in Paris mit dem Titel Toute la mémoire du monde. Formal eher konventionell gestaltet, geht es in diesem Film um die alltägliche Konstruktion eines Gedächtnisses. Ich möchte ihn hier dennoch kurz erwähnen, weil Resnais durch den Off-Kommentar inhaltlich pointiert eine Unterscheidung von zwei verschiedenen Momenten von Erinnerung nahelegt, die indirekt auch in Hiroshima, mon amour wieder aufgenommen wird. Während die Kamera durch die endlos langen Gänge der Bibliothek gleitet, erläutert der Kommentar detailliert die lückenlose Erfassung der Bücher, ihre Stempelung, ihre Nummerierung, ihre Katalogisierung und systematische Einordnung ins Archiv durch die Bibliotheksverwaltung. Die Bibliothek selbst wird im Kommentar schließlich zum »Gefängnis der Bücher«, wie es an einer Stelle im Off-Kommentar heißt. ((2)) Diese kalte, wissenschaftliche, konservierende Seite der Erinnerung lässt nicht zufällig an Nuit et brouillard denken, an die unerbittliche
40 · Thomas Weber
Die Bibliothek als Gefängnis in Toute la mémoire du monde
Mathematik eines wissenschaftlich geplanten und industriell durchgeführten Massenmordes, was die meisten Kritiker – wohl zu Recht – als Übertreibung empfanden. Dem stellt der Kommentar am Ende des Films eine lebendige, dynamische Erinnerung gegenüber, die einsetzt, wenn die Bücher die unsichtbare Linie vom geordneten System der Bibliotheksverwaltung in den Lesesaal überschreiten. Sie werden damit zur Lektüre befreit, um sich in die lebendige Erinnerung des Lesenden zu verwandeln.
VI. Hiroshima, mon amour (1958)
Der nachfolgende Film, Hiroshima, mon amour, Resnais’ erster Spielfilm, setzt wieder stärker auf das technische und formale Experiment und spaltete dadurch Publikum und Kritik. Die einen sahen in ihm einen Geniestreich und verglichen Resnais mit Visconti, Welles oder Eisenstein.12 Die anderen, darunter auch japanische Kritiker13, warfen Resnais Formalismus vor, denn das Thema Hiroshima könne man nur um den Preis der Verharmlosung auf eine Liebesgeschichte reduzieren.
Die frühen Filme von Alain Resnais · 41
Ursprünglich sollte Resnais einen Dokumentarfilm über die Atombombe drehen, ließ dieses Vorhaben aber fallen, als er entdeckte, dass es bereits eine ganze Reihe von Filmen zu diesem Thema gab (darunter etwa Kinder von Hiroshima, 1952 von Kaneto Shindo). Er sprach mit Marguerite Duras über Alternativen und ließ ihr beim Verfassen eines Drehbuchs weitgehende Freiheit. Entstanden ist daraus eine doppelte Liebesgeschichte, die sich auf zwei verschiedenen, miteinander verwobenen Zeitebenen entwickelt. In der Gegenwart spielt die Geschichte von Riva, einer französischen Schauspielerin, die sich für Dreharbeiten in Hiroshima auf hält, ud dabei zufällig den Japaner Okada kennenlernt und sich in ihn verliebt. Sie verbringen die Nacht miteinander, doch die Romanze wird von kurzer Dauer sein, denn er hat Frau und Kinder und sie will in wenigen Stunden nach Paris zurückkehren. Doch Okada weckt in ihr Erinnerungen an die Zeit während des Krieges in Europa. Sie erinnert sich an ihre Liebe zu einem deutschen Soldaten, der nach der Befreiung Frankreichs erschossen wurde; sie selbst wurde von den Dorf bewohner *innen und sogar von der eigenen Familie geächtet, kahlgeschoren und in den Keller gesperrt, bis man sie davongejagt hat nach Paris. An dieser Geschichte besticht nun vor allem ihre Erzählweise, ihre formalästhetische Darstellung, die bis hin zur Auf lösung der narrativen Strukturen selbst voranschreitet, um die Abwesenheit von Erinnerung zu thematisieren (wie in Les statues meurent aussi), um Gegenwart und Vergangenheit miteinander zu verweben (wie in Nuit et brouillard) und um nach kurzem Schwanken zwischen dem konservierenden und dynamischen Aspekt von Erinnerung (wie in Toute la mémoire du monde) die Konstruktion des Films zu Letzterem hin aufzulösen. Dies wird gekoppelt mit der Konstruktion von Subjektivität, die zum entscheidenden, auch verstörenden Merkmal dieses Films wird. Es beginnt mit einem kuriosen Streit. Zuerst sieht man zwei ineinander verschlungene nackte Körper, deren Haut mit feinem Sand, fast wie Asche, bedeckt ist. Sandige Haut, die aufeinanderreibt. Die Haut wird feucht. Der Sand verschwindet. Eine männliche und eine weibliche Stimme aus dem Off widersprechen einander: »Nichts hast du gesehen in Hiroshima, gar nichts«, sagt der Mann. »Alles habe ich gesehen, alles«, behauptet dagegen die Frau. Und sie beginnt aufzuzählen, was sie alles gesehen hat – und was auch im Bild gezeigt wird: das Krankenhaus mit den Überlebenden, das Museum mit den verbrannten Steinen, den Fotos und authentischen Filmaufnahmen, die nach der Explosion gemacht wurden, den filmischen Rekonstruktionen mit Schauspieler *innen, den Statistiken,
42 · Thomas Weber
Intimer Streit in Hiroshima mon amour
den Modellen und Schautafeln. Schließlich wiederholt die männliche Stimme: »Nichts hast du gesehen in Hiroshima, gar nichts«. ((Abb. 3)) Dieser Off-Dialog zwischen Okada und Riva, der wie ein auf zwei Stimmen verteilter innerer Monolog wirkt, stellt das Bemühen der Französin, Hiroshima anhand der offiziellen Darstellungen zu begreifen, dem wiederholten Widerspruch Okadas gegenüber, dessen Familie in Hiroshima ums Leben kam und der sich mit der offiziellen Lesart der Geschichte nicht begnügen kann. Nach dieser einleitenden, rund 15-minütigen Sequenz beginnt der Film ein weiteres Mal, so als würde er diesen ersten Anfang verwerfen (wie übrigens auch Citizen Kane, 1941 von Orson Welles, eines der Vorbilder von Resnais, der sogar drei Anfänge hat). Riva kehrt vom Balkon zurück ins Zimmer, bleibt in der Tür stehen und betrachtet den auf dem Bett liegenden Okada, der den Arm seltsam auf den Rücken gedreht hat. Jetzt ein anderer Arm im Bild. Er gehört zu einem am Boden liegenden Mann, das Gesicht mit Blut verschmiert. Traum – Fantasie – oder Erinnerung? Okada bittet sie, sich für ihn an ihre Zeit während des Krieges zu erinnern, doch sie kann ihm ihre Geschichte nicht einfach erzählen. Eine Schubkarre im Keller, in den man sie eingesperrt hat, ein Wasserf leck an der Decke, ihr kahlgeschorener Kopf, eine Muschel vor dem
Die frühen Filme von Alain Resnais · 43
Spiegel ihres Mädchenzimmers. Ihre Erinnerungen kehren nicht geordnet zurück, sondern schubweise, nicht chronologisch, sondern assoziativ motiviert, ausgelöst von Einzelheiten, die mehr Aufmerksamkeit beanspruchen als die ganze Geschichte. Die Bilder erschließen sich nicht auf den ersten Blick, wirken zusammenhanglos und scheinen die narrative Struktur der Filmhandlung zu sprengen. Gegenwart und Vergangenheit f ließen ineinander. Es ist, als könnte die Normalität konventioneller Erzählkonzepte das Erinnern von traumatischen Erlebnissen nicht fassen, die durch Verdrängen, Verschieben oder Vergessen bedroht und damit nicht einfach erzählbar sind. Erst die nicht-narrative, auf assoziativen Bildverknüpfungen basierende Montage öffnet die Möglichkeit zur Darstellung des prekären Erinnerns, das nur radikal subjektiv sein kann, wie Schmerzempfinden oder das Gefühl des Aufeinanderreibens von sandiger Haut. Denn es handelt sich um Erfahrungen, die sich im Moment ihres Erinnerns nicht objektivieren lassen, und von denen man auch nicht abstrahieren kann. Den Eindruck von Subjektivität erreicht Resnais nun fast spielerisch nur mit Hilfe der Montage und mit dem partiellen Aussetzen der Narration; er verzichtet auf andere, aufwendigere Verfahren wie etwa die subjektive Kamera, optische Tricks wie Filter, Unschärfe, ungewöhnliche Perspektiven oder schiefe Kulissen, wie sie in der Filmgeschichte immer wieder verwendet wurden, und auch auf einen eher unfilmischen, romanhaften Ich-Erzähler aus dem Off. Mit Hilfe dieser formalen Gestaltung gelingt es ihm – ganz im Sinne der Nouvelle Vague –, sich vom französischen Kino seiner Zeit, also von der glatten und routinierten Ästhetik der sogenannten Qualité française eines Jean Aurenche oder Pierre Bost abzuheben und neue Maßstäbe für den schwierigen Umgang des Mediums mit traumatischen Erinnerungen zu setzen. Hiroshima, mon amour ist eine Bilanz der vorhergehenden Filme Resnais’ und zugleich Paradigma für die Personalisierung eines Themas in den audiovisuellen Medien. Der Film beginnt dokumentarisch, verwirft diesen Anfang und entscheidet sich für eine private Geschichte. Durch die Montage von assoziativen Bildfolgen, verbunden mit einem partiellen Durchbrechen der narrativen Struktur, stellt er jedoch nicht einfach nur die privaten Erinnerungen der Hauptfigur dar, sondern bildet den Prozess des Erinnerns selbst nach. Dadurch entsteht ein – auch im Rahmen der filmischen Konventionen ungewöhnlicher – Eindruck von Subjektivität, die keineswegs nur jene der Protagonistin ist. Denn
44 · Thomas Weber
verständlich werden diese Sequenzen nur dann, wenn die Zuschauenden ihnen während der Filmrezeption aktiv einen Sinn geben und so handelnd als Subjekte miteinbezogen werden.
VII. L’année dernière à Marienbad (1961)
Ohne aktive Deutungsarbeit durch die Zuschauenden erschließt sich auch kaum ein vielschichtiger Film wie L’année dernière à Marienbad, denn hier scheinen alle konkreten Verweise auf politische Verhältnisse oder gesellschaftliche Probleme in einer abstrahierend ästhetischen Darstellung aufgehoben oder bis zur Unkenntlichkeit in Anspielungen verbannt zu sein. Als das Publikum diesen Film 1961 auf den Filmfestspielen in Venedig vorgeführt bekam, reagierte es zutiefst gespalten. Während die eine Hälfte sich auf den eigenartigen Stil als Ausdruck der modernen Avantgarden einzulassen schien, reagierte die andere Hälfte zunächst völlig irritiert. Es hatte gerade einen ungewöhnlichen, leicht unterkühlten, vielleicht etwas langweiligen, vielleicht gerade deswegen auch verstörenden Film gesehen. Bis dahin hatte niemand einen derartigen Film erwartet, hatte niemand sich – zumindest im Kreis des populären Autorenkinos – auch nur vorstellen können, dass ein französischer Filmemacher derart formalistisch, schematisch, mit Sprache und ästhetischen Formen gleichermaßen spielend wie abweisend einen Film scheinbar ohne Sujet drehen könnte; schon gar nicht hatte man es von einem Filmemacher wie Alain Resnais erwartet, der bis dahin vor allem durch politisch ambitionierte Themen aufgefallen war. Die Handlung ist rasch erzählt: In einem Luxushotel in Marienbad trifft ein Mann auf eine Frau und erzählt ihr, sie seien ein heimliches Liebespaar gewesen und hätten sich letztes Jahr verabredet, um sich hier im Hotel wieder einzufinden, damit sie ihren festen Freund oder Ehemann, der gleichfalls im Hotel sei, verlasse und sie gemeinsam fortgehen könnten. Doch die Frau kann sich an nichts erinnern oder gibt das zumindest vor. Schließlich wird sie mit dem für sie fremden Mann das Hotel gemeinsam verlassen. Worauf es in diesem Film ankommt, ist jedoch weniger die Handlung als vielmehr die Art und Weise der Inszenierung. Irritierend ist vor allem die prädominante Figur der Wiederholung, wie sie in Form des Off-Kommentars, der Kamerafahrten, der Montage von wiederholten Szenen usw. überdeutlich hervortritt. Ursula von Keitz weist in ihrer Analyse des formalen Auf baus des Films darauf hin, dass
Die frühen Filme von Alain Resnais · 45
selbst das Voice-over, also die Stimme aus dem Off, noch den Eindruck der Wiederholung verstärkt mit Sätzen wie: »Wieder gehe ich, wieder diese Flure entlang (…).« Und von Keitz fährt fort, dass die Wiederholung letzthin sogar die zeitliche Ordnung auf löse, dass sie ein labyrinthisches »Zeitverlies« schaffe: »Jegliche konventionelle temporale Orientierung (…), die ein ›Vorher‹ oder ›Nachher‹ zu konstatieren erlaubte, ist aufgehoben zugunsten von Wiederholungen und Optionen, die sich das vorstellende und assoziierende Subjekt X immer wieder neu schafft.«14 Damit entsteht eine Art Labyrinth verschiedener Zeitebenen und Möglichkeitsräume ohne Eindeutigkeit, in denen sich auch die Zuschauenden nicht zurechtfinden. Dabei scheint die Materialität des Dargestellten prädominant: die überladenen Dekors des Schlosshotels an einem fiktiven Ort Marienbad, in dem eine saturierte, erstarrte, sich nicht mehr an ihre Vergangenheit erinnernde Gesellschaft sich letzthin in ihren leeren Ritualen und dekadenten Spielen verliert. Diese Gesellschaft scheint in den zahlreichen Statuen im Schlosspark selbst gespiegelt; James Monaco spricht von »an opera of statues«15, so als seien die Statuen in Stein verwandelte Menschen. In dieser statischen Gesellschaft scheint das Begehren zwischen Mann und Frau das einzig Lebendige zu sein, das Einzige, was die erstarrte Ordnung auf bricht – zumindest in der evozierten Imagination der beiden Protagonist *innen (als die man die Bilder auch deuten könnte). Emma Wilson spricht etwa von »virtual images, each a variation on the encounter between the man and the woman«.16 Für Wilson spielt sich der zentrale thematische Konf likt auf der Ebene der sexuellen Beziehung zwischen Mann und Frau ab. »L’année dernière à Marienbad explores the play of desire between two individuals, their fatal contamination of one another as their imagined narrative unfolds, their fear of each other’s difference, violence and unknowability.«17 In immer wieder neuen Spielarten zeigt sich diese Begegnung zwischen dem Fremden und der Frau, die immer wieder in neuen Innenund Außenräumen, neuen Kleidern und Frisuren, neuer Ausleuchtung die immer gleichen oder doch zumindest ähnlichen Dialoge führen. Die Darstellung dieser Begegnung schwankt zwischen schüchterner Annäherung, freudiger Vereinigung und Vergewaltigung – ohne dies zu vereindeutigen. Für Letzteres spricht etwa eine Weißüberblendung, die Resnais später noch einmal in La Guerre est finie (Der Krieg ist vorbei, 1966) für den Geschlechtsakt einsetzt. Tatsächlich gehört dies zu den leicht übersehenen Subtilitäten eines Films, der sich in seiner Darstellung zunächst nur auf inhaltsleere, immer
46 · Thomas Weber
wieder wiederholte Dialoge von in gesellschaftlichen Posen erstarrten Protagonist *innen in prunkvollen Dekors zu konzentrieren scheint. Nur am Rande sei erwähnt, dass Resnais hier an bekannte filmhistorische Vorbilder anknüpft, wie La règle du jeu (Die Spielregel, 1939, R: Jean Renoir). Dies zeigt sich dort etwa an Szenen wie dem Theaterstück am Anfang (als eine Art Theater im Theater) oder der gleichfalls in ein Schloss zurückgezogenen Gesellschaft, die ihre sozialen Gegensätze ebenso verdrängt wie den drohenden Krieg gegen Deutschland. Auch lassen sich die Statuen als Kommentar zu Marcel Carnés Les Visiteurs du Soir (Die Nacht mit dem Teufel, 1942) lesen, in denen sie schon einmal für die zu Statuen erstarrte Gesellschaft standen, die sich mit der deutschen Besatzung arrangiert hatte. Insofern hätte es hier vielleicht auch andere Interpretationsspuren gegeben, denen die zeitgenössische Kritik jedoch nicht gefolgt ist. Stattdessen hoben die meisten Kritiken und Arbeiten zum Marienbad-Film dessen formale Struktur hervor, mithin einen überdrehten, manieristischen Stil, der ein ambivalentes, d. h. ebenso abgestoßenes wie fasziniertes Publikum generiert, was sich teils sogar in der Kritik selbst zeigt. So schrieb etwa Peter W. Jansen in den 1990er Jahren in seinem ResnaisBuch über die Kritiken zum Marienbad-Film: »Noch beinahe jeder, der sich L’année dernière à Marienbad schreibend genähert hat, hat den ersten Zugang über die Wörtlichkeiten gesucht, oder hat sich dem Rhythmus, der Rhetorik dieses mäandernden Wörterstroms, dieser Wortkaskaden anvertraut. Nichts ist leichter zu imitieren, nichts leichter zu karikieren oder zu parodieren als das Außergewöhnliche, als Sprache und Bild, Geste und Ton, die jedes Risiko eingehen – auch das der Lächerlichkeit.«18 Die hier beschriebene, zu ablehnendem Spott neigende Haltung der Kritik zeigte zugleich auch deren Verunsicherung bei der Einordnung dieses Films im historischen Kontext. Prädominant scheint das Stilmittel der Wiederholung. Welche Bedeutung hat sie im Marienbad-Film? Ist sie wirklich mehr als nur ein formalästhetisches Spiel? Gerade das Prinzip der Wiederholung verstärkt hier den Eindruck einer in ihren dekadenten, ebenso luxuriösen wie sinnlosen Ritualen gefangenen Gesellschaft, die eine Herrlichkeit feiert und behauptet, die doch längst verloren ist, die mehr in ihrer eigenen Erinnerung existiert, ja diese mehr beschwört, als sich tatsächlich daran zu erinnern. Die Wiederholung erscheint als filmische Inkorporation von Erinnerung, als Vergegenwärtigung von traumatischen historischen Erfahrun-
Die frühen Filme von Alain Resnais · 47
gen, und lenkt den Blick auf die vom Film konstruierten Kommunikationsverhältnisse, also weniger auf die Figuren der Handlung als vielmehr auf die Relation zwischen verschiedenen Akteur *innen – zwischen Film, filmischer Darstellung und Zuschauenden –, kurzum auf die ActorSpectator-Beziehung, die durch die Art und Weise der filmischen Gestaltung (Auswahl des Bildausschnitts, Beleuchtung, Montage usw.) modifiziert wird. Mithin wird den Zuschauenden hier eine konventionalisierte Sichtweise verwehrt, weil ihnen – und hier ist der Marienbad-Film radikaler als die anderen Arbeiten von Resnais – eine schlussendliche Auf lösung, ein eindeutiges Interpretationsangebot verweigert wird. Die Wiederholung führt immer wieder aufs Neue vor, wie hohl und erstarrt eine Gesellschaft ist, die verzweifelt versucht, das Neue auszugrenzen und die unangenehme, vielleicht traumatisierte Vergangenheit mit immer neuen Behauptungen und Ritualen zu überspielen. Jeder Loop wird zur Inkorporation einer anderen Variation, die durch die Figur der Wiederholung den Prozess des Erinnerns traumatischer Erfahrungen selbst evoziert. All die Kamerafahrten durch die endlosen Flure oder die Spaziergänge im Park, die in immer wieder neuen Variationen wiederholt werden, verweisen trotz oder gerade wegen ihrer vordergründigen symmetrischen Anordnung auf traumatische Erfahrungen, die den Zuschauenden als Form subjektivierter Interpretationsmodi der Handlung begegnen: Obwohl unklar bleibt, was wirklich in Marienbad geschah oder geschieht, ob der Erzähler tatsächlich schon einmal in Marienbad oder an einem anderen Ort war, wo er die Frau getroffen hat, und unter welchen Umständen, wird Marienbad durch die Wiederholung der Szenen zur Beschreibung einer albtraumhaft, maskenhaft in ihren Ritualen und Konventionen erstarrten Gesellschaft, die sich kollektiv zur Verdrängung von Geschichte und Gegenwart gleichermaßen entschlossen hat. Tatsächlich verwendet Alain Resnais das Stilmittel der Wiederholung nicht nur in L’année dernière à Marienbad, sondern auch in späteren Filmen wie On Connaît la Chanson (Das Leben ist ein Chanson, 1997) oder dem in den 1990er Jahren herausgebrachten Doppelfilm Smoking (1993) und No-Smoking (1993). Die Wiederholung ist also keine Ausnahme im umfangreichen Werk von Resnais. Doch fragt es sich, welche Funktion dieses Stilmittel innerhalb der verschiedenen Arbeiten jeweils hat und ob es auch das Gleiche meint – ob Resnais also nicht in jedem Film damit immer auch etwas anderes zum Ausdruck bringen wollte.
48 · Thomas Weber 1 Der vorliegende Aufsatz basiert auf Auszügen aus den Publikationen: Thomas Weber, »Zur Konstruktion von Erinnerung in den frühen Filmen von Alain Resnais«, in: Schuld und Sühne? Kriegserlebnis und Kriegsdeutung in deutschen Medien der Nachkriegszeit (1945–1961), hg. von Ursula Heukenkamp, Amsterdam 2001, S. 395–405; Thomas Weber, »Kollektive Traumata. Die filmische Inkorporation von traumatischen Erfahrungen im Frühwerk von Alain Resnais«, in: AugenBlick, Konstanzer Hefte zur Medienwissenschaft 56/57: Erfahrungsraum Kino (2013), S. 113–133. — 2 Vgl. dazu Cinema 34 (Zürich, Sommer 1963). — 3 Original: »’où se préfabrique (…) le type du bon nègre rêvé par le bon blanc.’«. Wolfgang Jacobsen et al., Alain Resnais, München 1990, S. 76. — 4 Ebd., S. 18. — 5 Die Zeit, 19.4.1956. — 6 Ebd. — 7 Film-Dienst 3, 1957. — 8 Jacobsen et al., Alain Resnais (s. Anm. 3), S. 18. — 9 Siehe Film-Dienst 3, 17.1.1957. — 10 Süddeutsche Zeitung, 9.11.1978. — 11 Siehe dazu Ewout van der Knaap, »Nacht und Nebel«. Gedächtnis des Holocaust und internationale Wirkungsgeschichte, Göttingen 2008 und Sylvie Lindeperg, »Nacht und Nebel«. Ein Film in der Geschichte, Berlin 2010. — 12 Vgl. Patalas, Enno: »Hiroshima, meine Liebe (Hiroshima, mon amour)«, Filmkritik 4 (1960), S. 105. — 13 Vgl. Cinema 34 (1963). — 14 Ursula von Keitz, »Das Zeitverlies. Zur Desorientierung filmischer Chronologie in Alain Resnais’ L’annee dernière à Marienbad«, in: Zeitsprünge. Wie Filme Geschichte(n) erzählen, hg. von Christine Sprünge et al., Berlin 2004, S. 151–161, hier S. 156. — 15 James Monaco, Alain Resnais, New York 1979, S. 63. — 16 Emma Wilson, Alain Resnais, Manchester/New York 2006, S. 75. — 17 Ebd., S. 84. — 18 Peter W. Jansen/Wolfram Schütte, Alain Resnais, München 1990, S. 108.
Beate Ochsner
Filmische Teilhabe oder: Das Werden des Filmes »La perspective ne peut pas être vu que si on est passé d’un point a un autre, ça c’est sûr.« 1 (Alain Resnais) Großaufnahme einer Frau mit glitzernden Perlenohrringen. Ihr Blick richtet sich auf einen Tisch mit verschiedenen Dingen – eine Uhr, eine Geldbörse, ein Notizbuch. Sie wendet den Kopf, dabei geraten Schmuck, ein Taschentuch sowie eine schwarze Handtasche ins Blickfeld. Der Rückschnitt zeigt erneut die Frau aus einer anderen Perspektive, nun trägt sie den auf dem Tisch liegenden Schmuck am Hals. Die nächste Einstellung präsentiert eine Art Stillleben aus Dingen – eine Bürste, eine Nagelfeile sowie eine Parfümf lasche. Der erneute Rückschnitt zeigt sie an einem Kamin stehend, hinter sich den Tisch mit der Uhr. Sie blickt wie aufgeschreckt zurück und mit dem nächsten Schnitt steht sie erneut, wie in einer der vorangegangenen Positionen, vor einem Vorhang. Sollen die Blickachsen andeuten, dass sie auf sich selbst (zurück)blickt? Nein, in den nächsten drei Einstellungen scheint sie aus beiden Positionen ängstlich hinter sich zu schauen. Doch wo und wer ist und vor allem wann wird das – offenbar beunruhigende – Gegenüber, das (klassischerweise) durch diese Art der Montage hervorgebracht wird? Es folgen erneute Stillleben – mit einem Schmuckkästchen, Flakons, Handschuhen, Opernglas, Lippenstift, einer weiteren Uhr, die jedoch eine andere Zeit anzeigt, Streichhölzern, auf denen das Hotel, in dem die Frau sich befindet, abgebildet ist, außerdem einem verschließbaren Aktenkoffer. Die Frau setzt sich in Bewegung, nimmt eine Schreibmappe vom Kamin und begibt sich, aufgenommen in fünf unterschiedlichen Einstellungen, zum Bett, auf das sie sich, je nach vorangegangener Perspektive, mal von der rechten, mal von der linken Seite, niederlässt. Sie beginnt, einen Brief zu schreiben. Über die durchgehende Begleitmusik erhebt sich nun die Erzählerstimme, die zwei Sätze aus der vorangegangenen Parkszene wiederholt: »Non, non, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus moimême.« Ein Klopfen ist zu hören, die Frau hebt den Kopf, die Tür wird geöffnet. Ein Mann im Smoking tritt ein: »J’ai frappé. Vous ne m’entendiez pas?« »Mais si, je vous ai répondu d’entrer«. Aber nein, sie hat nicht ge-
50 · Beate Ochsner
antwortet – oder doch? Plötzlich und erneut nur durch einen Schnitt getrennt, erscheint die bisher in schwarz gekleidete Frau auf dem Bett in einem weißen Abendkleid mit beeindruckender, ebenfalls weißer Federboa in gleicher Pose, am gleichen Ort, im gleichen Zimmer. »Votre film, L’Année dernière à Marienbad est un des films les plus curieux que nous ait montré le cinéma«, so Filmkritiker François Chalais in einem Interview mit Alain Resnais aus dem Jahr 1961, »pour beaucoup il sera un énigme. […] j’aimerais bien pour éviter un maximum d’erreur connaître votre explication de votre film.«2 Doch der zu diesem Zeitpunkt durch Filme wie Nuit et Brouillard (1956) oder Hiroshima, mon amour (1959) bereits weithin bekannte und berühmte französische Filmregisseur Alain Resnais muss ihm die Antwort verwehren, da er seine eigenen Filme nach deren Fertigstellung kaum anschaue, sondern bereits an den nächsten denke. Außerdem glaube er nicht, dass der genannte Film ein wirkliches Rätsel darstelle, könne doch jede*r einzelne Zuschauer*in seine/ihre eigene Lösung finden,»et c’est solution sera vraisemblement toujours une bonne solution. Mais ce qui sera caractéristique, c’est que ce ne sera pas la même solution que celle de son voisin.«3 Chalais folgert daraus, dass Resnais den Zuschauer*innen eine »moule«, sprich eine Art Narrativ bereite, in das sie sich einbetten und das ›Rätsel‹ auf diese Weise lösen oder aber nicht. Letzteres bedeute, dass der Film nicht für sie oder sie nicht für den Film gemacht seien. Für mich aber weist Resnais’ Aussage auf etwas anderes hin: Ihr Schwerpunkt scheint mir weniger auf der Produktion einer filmsemiotisch präparierten Zuschauer*innenposition zu liegen, sondern vielmehr auf Prozessen medialer Teilhabe. Diese sind nicht mit subjektiven Lesarten zu verwechseln, sondern – und eben dies scheint mir der Begriff des »voisin« anzudeuten – weisen auf jene spezifischen Situationen, Umgebungen, Diskurse und Wahrnehmungen hin, die Zuschauer *innen zu dieser, jener oder auch einer anderen Lösung führen. Anstelle der zeichengebundenen Enträtselung einer vorgängigen Wirklichkeit bereiten Resnais’ Filme einer medienökologischen Perspektivierung den Weg, im Rahmen derer ›Film‹ als in und durch spezifische Situationen partizipatorisch hervorgebrachtes lebendiges und veränderbares Artefakt – in Resnais’ Worten »solution« – entsteht. Damit ist nicht Wiedererkennbarkeit oder Entschlüsselung Ziel der filmischen Produktion, vielmehr können Zuschauer *innen etwaige raumzeitliche ›Widersprüche‹, wie in und durch die oben beschriebene Montage hervorgebracht, als Herausforderung und Chance zugleich nutzen, um in Resonanz mit dem filmischen Gegenüber zu treten. Mit Fokus auf die performative Dimension des Filmischen verabschieden Resnais’ Filme dabei gleicher-
Filmische Teilhabe oder: Das Werden des Filmes · 51
Erstarrte Zuschauer*innen in L’Année dernière à Marienbad
maßen eine rein semiotische Lektüre wie die Auffassung vom Film als Repräsentationsmedium: Film kann, aber er muss nicht primär repräsentieren, er kann, aber muss nicht auf Basis narrativer oder ästhetischer Schemata wiedererkennbar, einordbar und auf diese Weise lesbar gemacht werden. Resnais’ Filme – so scheint mir – ›sind‹ nicht, sie ›werden‹ vielmehr im und durch den Schnitt, was Resnais’ Rolle als »monteur« ins rechte Licht rückt. Der Filmwissenschaftler Karel Reisz formuliert treffend: »[E]very cut […] should make a point. There must be a reason for transferring the spectator’s attention from one image to another.«4 Tatsächlich scheinen es die Übergänge, die Passagen und damit die Prozesse der Filmwerdung und -vergänglichkeit selbst zu sein, die Resnais’ Filme und Zuschauer *innen zwischen den Polen von Vergangenheit und Gegenwart, von Bewegung und Stillstand oder von Wissen und NichtWissen auszuloten suchen und auf diese Weise nicht nur ein anderes Kino, sondern auch ein anderes Publikum erzeugen. Was ihn, Resnais, dabei inspirierte, war – so meine Überzeugung – nicht die Funktion eines vorab Wissenden, eines kalkulierenden Auf- oder Erklärenden, sondern eine fast kindliche Neugierde, mit der Film und Kino zu einer Art epistemischen System geraten, in dem sich Handlungen, Abläufe und Vermittlungen ereignen. Die filmische Repräsentationsfunktion wird dabei abgelöst von einer Geschichte der filmischen Praktiken, Techniken und Dinge, aus denen der Film und mit ihm Möglichkeiten und Bedingungen des Sehens oder Verstehens emergieren. Inversionen von Ursache und Wirkung, von Vorher und Nachher, wie eingangs am Beispiel von L’Année dernière à Marienbad geschildert, erscheinen dabei eben erst im Nachhinein als willentliche Entscheidung: »La perspective ne peut pas être vu que si on est passé d’un point a un autre, ça c’est sûr.« ((Abb. 1))
52 · Beate Ochsner 1 Interview mit Alain Resnais. URL: https://www.youtube.com/watch?v=S_WSCZzi2rk (letzter Zugriff am 2.4.2021). — 2 Interview mit Alain Resnais. URL: https://www.youtube. com/watch?v=gTg_knL4cks (letzter Zugriff am 31.3.2021). — 3 Ebd. — 4 Karel Reisz, The Technique of Film Editing, Oxford 2010, S. 185.
Mirjam Schaub
»Innige Kälte« – L’Année dernière à Marienbad1 »Am Kino interessiert mich, dass die Leinwand hier wie ein Gehirn sein kann, wie in den Filmen von Resnais. […] Der Film arbeitet nicht nur mit Verknüpfungen durch rationale Schnitte, sondern mit Neu-Verknüpfungen über irrationale Schnitte: das ist ein anderes Bild des Denkens.« 2 L’Année dernière à Marienbad (Letztes Jahr in Marienbad, 1961) unter der Regie von Alain Resnais entstand nach einem Drehbuch von Alain Robbe-Grillet, einem der Mitbegründer des nouveau roman in Frankreich. Robbe-Grillet soll das Skript der Legende nach in nur vier Wochen verfasst haben, mit minutiösen Angaben zu Licht, Dekor und Kamerawinkeln, so dass sich Resnais später genötigt sah, zu erklären, er habe »wie ein Roboter« gehandelt.3 (Was allerdings, wie wir sehen werden, nicht der Wahrheit entspricht.) Gedreht wurde acht Wochen lang, von September bis November 1960. Der Film wurde 1961 nicht für Cannes nominiert, angeblich, weil Alain Resnais einen Aufruf Sartres gegen den Algerienkrieg mitunterzeichnet hatte. Dafür erhielt der Film in Venedig den Goldenen Löwen. Nicht wenige hat der Film verärgert und verstört. Ästhetizistisch, überladen, verschmockt – das waren noch die schmeichelhaftesten Attribute. Nicht wenigen erging und ergeht es mit L’Année dernière à Marienbad wie Elke Schmitter beim Lesen von Djuna Barnes. Denn dieser Film ist von »zuverlässiger und inniger Kälte« und bereitet ebenso viel Lust und ebenso viel Schmerz wie das »Lutschen eines Eiswürfels«.4 Kalt und kantig, beklemmend, wie ein Insiderbericht aus einem Sanatorium wirkt der Film auf viele, dabei transportiert er offensichtlich akkurat das existenzialistische Lebensgefühl der Zeit. Handelt es sich also um einen Film, der jede übergeordnete Sinngebung ablehnt und damit ein narzisstisches Spiel auf höchstem intellektuellen wie ästhetischen Niveau betreibt? Einige wenige empfanden den Film 1961 als beißende, hohntriefende, süffisant-ironisch Persif lage auf die längst schon untergegangene Aristokratie. »Resnais ist ein Witzbold, vergessen Sie das nicht«5, versichert Jean Gruault, Resnais’ Drehbuchautor seiner späteren Filme. Und er hat recht: Anders lässt sich der als Holzattrappe aufgestellte Hitchcock als stummer
54 · Mirjam Schaub
Gesprächspartner für die gelangweilten Kurgäste in L’Année dernière à Marienbad kaum erklären.6 (Hitchcocks Auftritte in seinen eigenen Filmen fand Resnais überaus lächerlich.) Die Provokation von L’Année dernière à Marienbad besteht jedoch darin, dass einen die »histoire du ridicule«, mit ihren übertriebenen »chichis chronologiques«, wie André Ferrier am 5. Oktober 1961 im France-Observateur bemerkt, verärgert und ratlos zurücklässt. Von den Eskapaden und Sperenzien mit der Zeit wird später noch die Rede sein. Schon der Titel des Films ist eine Anmaßung. Die scheinbar klare Ortsbestimmung – das titelgebende Marienbad, der berühmte Kurort, im heutigen Tschechien gelegen – wird keineswegs durch Bilder des realen Marienbad beglaubigt. Viele Dekors geben sich deutlich als Kulissen zu erkennen, und wer die bayerischen Schlösser Nymphenburg, Amalienburg und Schleißheim mit ihren angrenzenden Parkanlagen kennt, weiß, dass der Film hier gedreht wurde. Auch sonst verwendet der Film einige Mühe darauf, die Erwartungshaltung seiner Zuschauer *innen zu enttäuschen. Gewöhnlich wird Spannung in einem Film dadurch erzeugt, dass entweder ungewiss ist, was geschehen ist, oder ungewiss ist, was noch geschehen wird. In diesem Film geht es darum: Ist überhaupt etwas geschehen, letztes Jahr in Marienbad? Hat sich überhaupt etwas zugetragen? Wie soll diese Frage entschieden werden?
I. Pattsituation
Die Dramaturgie des Films arbeitet mit einer Pattsituation. Ein Gast des Hotels, gespielt von Giorgio Albertazzi (im Drehbuch nur mit X bezeichnet), ein Außenseiter im Schloss, allein schon durch seinen italienischen Akzent, versucht eine mit A bezeichnete schöne Frau (Delphine Seyrig) daran zu erinnern, dass sie eine Affäre miteinander verbindet – angeblich »letztes Jahr in Marienbad«. Die Frau jedoch verneint dies und behauptet ihrerseits, den Erzähler gar nicht zu kennen. (Wer hat sich eigentlich die immergleiche Frage ausgedacht, mit der Männer das Gespräch mit einer unbekannten Schönen eröffnen: »Haben wir uns nicht schon einmal gesehen?«) A ist nicht allein ins Hotel gekommen, sondern wird von einem Mann begleitet, der rein äußerlich an einen tasmanischen Vampir erinnert (gespielt von Sacha Pitoëff ). Robbe-Grillet nennt ihn im Drehbuch M, was die Zwischenstellung zwischen A und X schon gemäß der alphabetischen Ordnung bestätigt. X, als On- und Off-Erzähler der Geschichte, versucht
L’Année dernière à Marienbad · 55
nun, in einem einzigen »Akt der Überredung« (l’acte de persuasion) (RobbeGrillet) A von der Wahrheit seiner Erzählung zu überzeugen, die genauso gut eine infame Lüge oder eben eine Anmaßung sein kann. Umgekehrt versucht die Frau in einem »Akt der Abwehr« ihre Seelenruhe zu bewahren, die genauso gut das Produkt einer extremen Selbstverleugnung sein könnte. Ein klassisches Patt? Dennoch scheint sich zunächst die Version des Mannes zu bestätigen. Denn er beschreibt ja mittels seiner Erzählerrolle höchst suggestiv und manipulativ, was wir, die Zuschauer *innen, mit den Augen der Kamera angeblich sehen. Wenn das allerdings so klar wäre, bräuchte es dann den beständigen Kommentar aus dem Off? Je länger die Verdoppelung des Gesehenen durch die verbale Beschreibung anhält, desto deutlicher stellt sich der gegenteilige Effekt ein: Wir werden misstrauisch, warum es dieser Verdoppelung des Bildes durch den Ton bedarf. Etwa damit wir in den Bildern etwas übersehen, nämlich das, was nicht in der Beschreibung aufgeht und sich gegen die Absichten des Erzählers richtet? Langsam, aber sicher wird in L’Année dernière à Marienbad unentscheidbar, ob der Erzähler die Bilder zu seinem eigenen Vorteil herbeiruft oder ob er Teil eines Bilderarrangements wird, das größer ist als er selbst. Mitunter geschehen Dinge, die den Erzähler zu überraschen scheinen, so dass aus dem Off nur ein kleinlautes »Je ne me souviens plus«7 zu vernehmen ist. Wenn ihm die Kontrolle über das Erzählte zu entgleiten droht, macht der Erzähler die Architektur des Schlosses für seinen Misserfolg verantwortlich. Doch ebenso gut könnte ihn die enervierende Orgelmusik in den Wahnsinn treiben, die alles Gesagte zudeckt wie mit Jahrtausende altem Staub, grau wie Blei. In dieser barocken Ordnung, in der alle Sinnlichkeit und aller Exzess längst stein- und formgeworden sind, erscheint es in der Tat unmöglich, dass sich die aristokratisch gebärdende junge Frau je auf eine Affäre eingelassen haben soll. An Sex, Ausgelassenheit, Freiheit, Leichtigkeit ist in diesem ganzen Szenario nicht zu denken. A selbst bleibt so überirdisch schön wie unnahbar. Sie verkörpert den Inbegriff einer Frau, der man jede Vergangenheit andichten kann, gerade weil sie selbst so zeitlos, ja makellos ist. Aus der Distanz der Jahre erscheint sie von heute aus betrachtet wie das wandelnde Klischee der französischen Frau der 1950er Jahre, selbst wenn der Film 1961 gedreht wurde. A scheint einer Welt ohne Frauenwahlrecht, ohne Beruf oder Bestimmung, vor allem aber ohne Bankverbindung entsprungen. Sie sagt im ganzen Film nicht viel mehr, als dass sie wünsche, in Ruhe gelassen zu werden: »Taissez-vous!«, »Laissez-moi tranquille!«, »Je vous en supplie!« A spricht keinen vernünf-
56 · Mirjam Schaub
Delphine Seyrig als »A« in L’Année dernière à Marienbad
tigen Satz im Film. Was sie sagt, ist eher gehaucht als gesprochen. A ist mit einem Wort ein Schlag ins Kontor der Emanzipation. Stattdessen gibt sie zu verstehen – durch eine hochgradig ritualisierte Körpersprache: ihre ängstlich übereinander geschlagenen Beine, den schützenden Kreuzgriff über dem Busen, das ständige Festklammern an der eigenen Schulter. Es sind protektive, aber eben immer auch narzisstische Gesten, welche neben der eigenen Verletzlichkeit zugleich die Linien ihres Körpers unterstreichen. Sie scheint ihre Sinnlichkeit in ihrem eigenen Körper einschließen zu wollen. ((Abb. 1)) Das Anti-Emanzipatorische von A, der Affront darin, scheint nicht in der Absicht der Autoren Resnais und Robbe-Grillet gelegen zu haben – auch wenn das heute schwer vorstellbar ist. Vielmehr genügt ihr antifeministisches, klischiert feminines Rollenspiel einer Regie, welche die Geschichte eines Verdachts zu erzählen beabsichtigt. Nur weil A nichts Vernünftiges sagt, während sie Zurückhaltung und körperlichen Rückzug in jeder Geste signalisiert, wird es überhaupt möglich, zusammen mit dem Erzähler X zu argwöhnen, dass sie etwas zu verbergen sucht. Verdrängt sie etwas – oder stiftet ihr Körper sie zur Lüge an? Weiß ihr Körper mehr als sie? Womöglich hat der Erzähler recht und die schöne Frau gehört längst zum Inventar des Schlosses, so teilnahmslos und maskenhaft ist ihr Gesicht, so zögerlich und ritualisiert sind ihre Bewegungen, dass man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, hier werde jemand ferngesteuert. Aber von wem? Von den anderen Gästen, von der Architektur? Oder ist A am Ende das Geschöpf von X, Produkt seiner eigenen überspannten Fantasie, ein perfektes Konstrukt einer Frau, die es nie gab und
L’Année dernière à Marienbad · 57
auch nie geben wird? Oder ist X der Tod, der – den Topos des Jahresaufschubs bedienend – gekommen ist, sein Opfer nun doch noch zu holen? Oder ist A eine Art Fluchtgefährt, ein Schwanenboot, das der Erzähler braucht, um wenigstens in seiner Fantasie der Enge der geschlossenen Gesellschaft zu entkommen? Aber ist der Erzähler X überhaupt der Schlüssel zum Verständnis dessen, was in diesem Film gespielt wird? Spielt der andere, vornehmlich stumme Mann – M – nicht eine weit gewichtigere Rolle als zunächst angenommen? Zieht vielleicht er die Fäden der Geschichte? Ist es nicht er, der die Frau in einem Bild erschießt und ihr im nächsten die Freiheit schenkt? Für diese Interpretation spricht, dass M das ganze Hotel durch ein undurchschaubares, undurchsichtiges Spiel in Atem hält, das Resnais nicht nur als altes chinesisches Spiel ( jeu de Nim) anspricht, sondern auch eine Falle (piège) nennt.8 Bei dem Spiel werden 16 Streichhölzer in vier Reihen (zu siebt, zu fünft, zu dritt, allein) pyramidenförmig angeordnet. Pro Zug dürfen pro Reihe so viele Hölzer, wie man will, abgeräumt werden (alle, einige, eines). Verloren hat derjenige, der den letzten Zug machen muss. Das klingt einfach. Allerdings gewinnt immer nur M, egal, ob er den ersten Zug macht oder nicht. Alle sehen zu, und keiner versteht, warum. Denn es gibt ja bekanntlich kein Spiel, das allein einen Spieler bevorteilt, außer, der Tod sitzt selbst am Tisch. Es kann sich also nur um blutigen Ernst handeln. Oder um eine gottähnliche Strategie, die sehr an die Arbeit des Regisseurs erinnert, weil sie sich nach jedem Zug des Gegners neu auszurichten scheint. Man sieht im Laufe des Films mehrere Versuche, den Spieler zu schlagen – vergeblich. Für die Hotelgäste, aber auch für die Zuschauer *innen ist es sehr enervierend zuzusehen. Anscheinend wird offen gespielt, und trotzdem kann es nicht mit rechten Dingen zugehen.
II. Zwei Zeiten
Welches Spiel spielen Resnais und Robbe-Grillet so offensichtlich mit den Zuschauer *innen des Films, das zugleich so schwer zu durchschauen ist, wie Ms Strategie? Gilles Deleuze würde sagen: Der Erzähler und die schöne Frau verkörpern gleichsam zwei unvereinbare Auffassungen von Zeitlichkeit, wobei jede einzelne von ihnen »das Ganze« der Zeit ausmacht und keinerlei Ergänzung durch den anderen bedarf.9 (1) Resnais scheint auf der Seite des Erzählers X zu stehen. Er ist der Erforschung einer »reinen Vergangenheit« (passé pur) oder »reinen Erin-
58 · Mirjam Schaub
nerung« (souvenir pur) zugeneigt. Ins Bild gesetzt ist dies mit schwebenden, ungeschnittenen Kamerafahrten. Dazu gibt es die schon erwähnte Orgelmusik, zu der die labyrinthische Topografie des Schlosses und der angrenzenden Parks minutiös vermessen wird, während der Erzähler seine eigene Erzählung über A entfaltet. Das verbale Kontinuum, das er zu errichten versucht, greift dabei zugleich auf die Zukunft hinaus, denn der Rekurs auf das Vergangene ist ja nicht Selbstzweck, sondern soll die Liebe der Frau in die Zukunft hinein verlängern. (2) Im Unterschied hierzu interessiert sich Robbe-Grillet eher für eine andere Zeitform: für das Präsens, das Gegenwärtige. Als müsse sich das Unmittelbare gegen das Lullaby des Erzählers zur Wehr setzen, wird der Erzählteppich durch kurze, unvermutete »Gegenwartsspitzen« durchlöchert. Wir sehen unvermittelte sekündliche Zwischenschnitte oder flashs, die alles sein könnten, vergangen, gegenwärtig oder zukünftig. (Die schöne A erschossen auf ihrem Bett und kurz darauf wartend auf der Bettkante usw.). Die Gewalttätigkeit und Unvermitteltheit dieser Szenen stehen in harschem Kontrast zur enervierenden Ruhe der sich entfaltenden »Vergangenheitsschichten«. Kein Zufall wohl auch, dass diese flashSzenen grell und überstrahlt gedreht sind. Weiße Töne dominieren hier das ansonsten vorherrschende Schwarz-Grau. Dennoch nimmt im Film die erzählte Vergangenheit, die Off-Stimme Albertazzis ist hier deutlich im Vorteil, »unwiderstehlich mehr und mehr Gestalt an; sie wird immer zusammenhängender, immer gegenwärtiger und immer wahrer. Gegenwart und Vergangenheit sind schließlich ineinander übergegangen«.10 Der Erzähler versucht immer geschickter, die Wahrheit seiner Behauptungen durch eigens angestrengte Beweisführungen zu stützen: durch topologische Gedächtnisbrücken, (angeblich) gemeinsame Erinnerungen, Gespräche an besonderen Plätzen des Schlosses und des Schlossparks usw.; durch optische Erinnerungsstücke (etwa ein Foto der Frau auf der Parkbank); zuletzt durch den Verweis auf die schiere Anwesenheit von A im Schlosshotel, gleichsam als lebender Beweis und Unterpfand eines gegebenen Versprechens. Tatsächlich ist dieser letzte Vorstoß, wenn es sich denn überhaupt um eine große Lüge des Erzählers handeln sollte, der perfideste von allen, denn er baut As gegenwärtige, körperliche Anwesenheit aus zu einem Beweisargument für die Glaubwürdigkeit von Xs Narrativ. Das ist absolut unseriös – und funktioniert auch nur im Verein mit den anderen Strategien. Wie beantwortet A all diese Offerten? Neuerlich mit abweisenden Gesten, ausweichenden Antworten, abweichenden Erinnerungen, also mit denselben Mitteln, die auch der Erzähler wählt, um das Gegenteil glaub-
L’Année dernière à Marienbad · 59
haft zu machen. Allerdings ist A hierin zunächst weit weniger überzeugend als X. Denn unauf hörlich sendet sie – hier kehrt das Klischee des Weiblichen und des Femininen der 1950er Jahre zurück – ambivalente Zeichen aus: Mal wirkt sie alarmiert, mal verängstigt, mal souverän, mal desinteressiert. Es gibt keine wirkliche Kohärenz in ihrem Verhalten. Sie springt, wie Deleuze sagt, »von einem (Zeit-)Block zum anderen (…) und immerfort (über) einen Abgrund zwischen zwei Spitzen, zwischen zwei simultanen Gegenwarten«11, ihrer eigenen, der von M oder der von X.
III. Rätsel
Die Herausforderung von L’Année dernière à Marienbad besteht heute darin, sich weder über das antiquierte Frauenbild aufzuregen, noch darin, den Film auf seine rätselhafte Vieldeutigkeit festzulegen. Vielmehr geht es skandalöser Weise darum, ihn für zwei einander ausschließende Interpretationen offenzuhalten. Schließlich handelt es sich um einen Film, der die Unmöglichkeit zum Thema hat, bei einer einzigen für die gesamte Länge des Films gültigen Interpretation stehenzubleiben. L’Année dernière à Marienbad eröffnet zwei in sich stimmige Interpretationen, aber keine einzige, die der jeweils anderen begründet vorzuziehen wäre. Der Film zwingt dazu, die strenge Gleichzeitigkeit zweier einander ausschließender Perspektiven anzuerkennen. Es kann also nicht länger darum gehen, die Frage nach Wahrheit oder Falschheit mit der Aussicht auf Gewinn zu stellen. Damit radikalisiert der Film das, was Umberto Eco etwa zeitgleich in seiner Offenheit des Kunstwerkes (1962) behauptet. Mit Eco im Gepäck kann ein Film wie L’Année dernière à Marienbad durch seine jeweiligen Betrachter *innen sinnvoll nur erschlossen werden, wenn sie verstehen, dass er nicht nur auf die Gleichzeitigkeit, sondern auf die Gleichberechtigung seiner eigenen multiplen Codierungen hin angelegt ist.12 Eco behauptet bekanntlich im Ausgang von James Joyce, »jedes Kunstwerk, auch wenn es nach einer ausdrücklichen oder unausdrücklichen Poetik der Notwendigkeit produziert wurde«, sei »wesensmäßig offen für eine virtuell unendliche Reihe möglicher Lesarten«,13 und zwar weil seine Botschaft »von sich aus (und dank der Form, die sie angenommen hat) mehrdeutig«14 sei. Der Hinweis auf die Form ist hier entscheidend. Ecos Problem der Mehrdeutigkeit, die ihm wiederholt den Vorwurf der postmodernen Beliebigkeit eingebracht hat, wird von Resnais und Robbe-Grillet dahin-
60 · Mirjam Schaub
gehend behoben, dass das Drehbuch von L’Année dernière à Marienbad nicht unendlich viele verschiedene, sondern exakt zwei einander diametral entgegengesetze Lesarten durchspielt, zwischen denen keine weitere Wahl möglich ist. Nach den Gesetzen der Logik vom ausgeschlossenen Dritten, solange die Welt durch A und Nicht-A vollständig beschreibbar ist, können beide Interpretationen dessen, was in Marienbad im letzten Jahr geschah oder nicht geschah, nicht gleichzeitig wahr sein. Sie können nur beide gleichzeitig falsch sein. Das hat, wie Gilles Deleuze frühzeitig in seinen Kinobüchern bemerkt, philosophische Gründe. Es lohnt sich anzuerkennen, dass in L’Année dernière à Marienbad alles von der zeitlichen Ebene abhängt, auf der man sich jeweils gerade befindet (der Zuschauer, A, der Erzähler und M).15 Zeit selbst wird in L’Année dernière à Marienbad alle Wahrheit(en) früher oder später als Falschheit(en) enttarnen und zugleich die jeweils zuletzt gewonnene Einsicht neuerlich für wahr ausgeben. So zeigt der Film, laut Drehplan, Bilder niemals in ihrer chronologischen Reihenfolge. Im Drehplan ist jede Einstellung mit Wochentag und Uhrzeit vermerkt, doch die Zuschauer *innen können das Puzzle kaum richtig ordnen. Und das ist auch gar nicht nötig, »denn wenn man den Film sieht, muß man diese Welt, die beständig zwischen Traumzeit und Realität, zwischen Gegenwart und Vergangenheit schwankt, einfach akzeptieren (und ob es sich um eine tatsächliche oder eine erfundene Vergangenheit handelt, darüber ist bereits ausführlich diskutiert worden)«.16 Sylvette Baudrot, für die Continuity des Skripts verantwortlich, behalf sich mit einer Grafik17, denn sie müsse »mit konkreten Dingen arbeiten« und stehe für den »logischen
Sylvette Baudrots Grafik
L’Année dernière à Marienbad · 61
Teil des Ganzen« ein. Auf der x-Achse sind die 120 Sequenzen eingetragen, denen 430 Einstellungen zugeordnet sind, in denen sich das Dekor und die Kostüme verändern werden. Die Hauptrollen A, M und X sind deshalb mit ihrer jeweiligen Kostümnummer eingetragen. ((Abb. 2)) Auf der y-Achse sind überlappend die verschiedenen zeitlichen Blöcke eingetragen, »unten die Gegenwart, oben die Vergangenheit (l’année dernière) und dazwischen eine Zone, die mir zur besseren graphischen Unterscheidung von Gegenwart und Vergangenheit diente und darstellte, was wir ›zu allen Zeiten‹ nannten (in seiner Découpage sprach Resnais auch von ›Ewigkeits‹-Einstellungen.) Die großen schwarzen Flecke in der Mitte stehen für die Einstellungen, die zeitlich nicht genau festgelegt sind, alles was zukünftig oder zeitlos ist.«18 Robbe-Grillet wird später sagen, dass erst Baudrot einen »Ariadne-Faden in dieses Labyrinth«19 gebracht hat. Zeit ist, wie Gilles Deleuze schließt, in L’Année dernière à Marienbad nicht mehr chronologisch und sukzessiv, sondern chronisch (krankhaft, krankmachend) und achronologisch. In dieser Eigenschaft bringt sie »abweichende« und »falsche Bewegungen« hervor. Diese können auf der (inhaltlichen) Ebene des Erzählten oder auf der (formalen) Ebene der Bildgestaltung und des Bildanschlusses stattfinden.
IV. Verwerfungen im Realen
Die Folge sind Verwerfungen im Realen: nicht im Sinne Lacans, sondern »real« im Sinne der Wirklichkeitsbehauptungen, die der Film selbst aufstellt. (1) Falsche Handlungsanschlüsse: Das Kontinuum des Geschehens wird jäh gestört durch die »Wiederauferstehung« der gerade erst erschossenen A. (2) Wundersame Details: Wir sehen akkurat geschnittene Taxusbäumchen mit diffusem Schattenkranz, während die Salongäste noch bei wolkenverhangenem Himmel einen Schlagschatten besitzen, der nur aufgemalt sein kann; fernerhin findet die wundersame Vermehrung identischer Fotos statt … (3) Merkwürdige Verhaltensweisen: In einer Szene dringt der Erzähler in das Zimmer der A ein; unklar bleibt, ob die Tür offen oder geschlossen war. Im Wechsel sehen wir die mal offene, mal geschlossene Tür, f lankiert durch zwei Meter hohe Spiegel, jederzeit bereit, virtuelle Bilder von all denen zu zeigen, die sich gerade im Raum auf halten. Offenbar versucht A zu vermeiden, selbst im Spiegel aufzutauchen, und zwar schlicht dadurch, dass sie sich ganz dicht an ihn presst. Sie be-
62 · Mirjam Schaub
wegt sich mit dem Rücken zur Kamera entlang des einen (linken) Spiegels auf die Tür zu, in tastenden, trippelnden Schritten, als müsse sie ihr potenzielles Spiegelbild schützend in den Spiegeln hineinpressen, damit es ihr nicht durch die Tür nach draußen entwischt. Den anderen, rechten Spiegel hingegen überwindet sie, indem sie ihren Rücken an das Glas presst, auch hier mit trippelnden Schritten, diesmal weg von der Tür, als müsse sie sich nun vor dem Spiegel in Acht nehmen, um ja kein Bild von sich in den Raum hineinzulassen. Durch die Angel lugt sie nun neugierig durch den Türspalt. In jedem Fall hat sich mit diesem Winkelzug die Frage nach der Offenheit der Tür verschoben. Es sieht so aus, als trete die schöne A durch den einen Spiegel aus dem Zimmer hinaus und durch den anderen wieder hinein, und zwar unter Umgehung der Tür, die sich zwischen beiden befindet und welche A offenbar nicht benutzen muss, um das Zimmer – vor unseren staunenden Augen, mit uns als Zeugen – unmerklich zu verlassen. (4) Falsche Schnitte: Gemeint sind hiermit die sogenannten falschen Anschlüsse ( faux raccords), dergestalt, dass der Schnitt nicht die logische Fortbewegung einer Bewegung oder einer Situation zeigt, sondern dass der Schnitt »auf sich« aufmerksam macht, indem bestimmte Bilder im Schnitt verschütt gegangen sind und nun – da sie in der Vorstellung nicht spielend ergänzt werden können – fehlen. Wie Sylvette Baudrot bemerkt, besteht L’Année dernière à Marienbad »ganz und gar aus falschen Anschlüssen«20. Die Kostüme und die gestische Körpersprache stellen Verbindungen her. Eine auffällige Sequenz falscher Schnitte, als Schnitte, die darauf aufmerksam machen, dass etwas zwischen den Schnitten fehlt und dass es keine Kontinuität von Zeit und Raum und keine echte Chronologie gibt, findet sich gegen Ende des Films, als die schöne A und der immer verzweifelter wirkende Erzähler X gemeinsam in einem Gang auf die zurückweichende Kamera zugehen.
V. Vorwärtslaufen, Rückwärtsgehen
Während dieser Kamerafahrt findet die entscheidende Konversation zwischen beiden statt. Der Erzähler X berichtet von den Intimitäten, die stattgefunden haben sollen. Er ist ihr einen Schritt voraus, als er beiläufig bemerkt, dass er die Geliebte vorher »noch ein bisschen zappeln ließ«. Just als der Erzähler erklärt: »Je vous ai prise, à moitié de force«21, entwischt ihm die angebetete A – Ironie der Geschichte, ewiger Irrtum des
L’Année dernière à Marienbad · 63
Mannes – gleichsam in das Off des Bildschnitts, als Antwort auf seinen verbalen Übergriff. Nach dem Schritt ist sie ihm plötzlich mehr als drei Schritte voraus. Während dabei der Off-Text – Xs Rede – ungerührt weitergeht, folgen zwei Bilder einer Kamerafahrt aufeinander, die logisch nicht aufeinanderfolgen dürften. Und ganz, als bemerkte Resnais den faux pas und gedenke, ihn zu korrigieren, lässt er nun, da die Fahrt zum Stillstand kommt, A zum Erzähler X zurückgehen. Sie tut das auf wunderbar artifizielle Weise, so dass der faux raccord (der falsche Anschluss) im faux pas (Fehltritt) umso deutlicher wird. Sie geht rückwärts, als sähe man die im Schnitt ausgesparten, verschluckten Bilder nun gleichsam beim Zurückspulen. Als könne man den falschen Anschluss im nächsten Bild – im On (vor aller Augen) – korrigieren. A und X befinden sich schließlich (endlich! wie zum Dank!) bildlich auf gleicher Höhe, als der Erzähler auch seine erzählte Version korrigiert und eingesteht: »›Mais non … Probablement, ça n’était pas de force …‹ (La fin de la phrase est sans doute entendue off.) ›Mais c’est à vous seulement qui le savez‹«.22 Zum ersten Mal gesteht der Erzähler ein, dass nur die Frau die Wahrheit seiner Erzählung beglaubigen kann. Ist das also das eine, lang ersehnte Bild, das bildlich und sprachlich anzeigt, dass A und der Erzähler X doch noch auf dieselbe zeitliche Ebene gelangen? Jener lang vermisste Kreuzungspunkt in ein und derselben Gegenwart? Doch während die Filmbilder ja notwendig weiter vorwärtslaufen, betritt A den einzigmöglichen Treffpunkt »ad tergo«, rückwärts, linkisch, falsch, und damit eben nichtwirklich, nicht im Ernst. Folglich scheitert der Kuss, den der Erzähler ihr bei ihrer Begegnung geben möchte (und der in keinem Drehbuch steht). Im letzten Moment schert die Frau aus und verlässt das Bild über den äußersten rechten Rand. (Ich verkneife mir den Verweis auf den »Engel der Geschichte«, den Walter Benjamin meinte zu sehen, als er rückwärts in die Zukunft geblasen wurde.) Sylvette Baudrot gibt später eine überraschend pragmatische Auf lösung des Rätsels zu Protokoll: »In L’Année dernière à Marienbad gab es eine ziemlich lange Szene, in der Delphine Seyrig (A) und (Giorigio) Albertazzi (X) Seite an Seite einen Gang entlang gehen. Wir haben das in drei verschiedenen Gängen gedreht, noch dazu ohne bestimmte Reihenfolge, und dennoch sollte die Szene sowohl hinsichtlich der Dialoge als auch des Rhythmus eine vollkommene Kontinuität aufweisen. Ein Stück haben wir in Schloß Nymphenburg gedreht, ein anderes im Schloß Schleißheim, das dritte schließlich, das erste in der Chronologie – gegen Schluß der Dreharbeiten im Studio. Wir hatten Grünpf lanzen aufgestellt,
64 · Mirjam Schaub
um darüber die Anschlüsse von einem Gang zum anderen herzustellen, doch Resnais wollte nicht verschleiern, daß es sich um drei verschiedene Gänge handelt: so gab es zwar eine Kontinuität der Bewegung und im Spiel der Darsteller, der Dekor jedoch änderte sich.«23 Baudrot bestätigt in der Tat, dass Resnais die Nicht-Kontinuität, den falschen Anschluss als solchen auszustellen gedachte, um das entscheidende Gespräch von A und X weiter als ein Sich-Verfehlen zu zeigen. Immerhin erspart Resnais seiner Figur (A) die Vergewaltigung, die RobbeGrillet ihr ins Drehbuch schrieb, damit natürlich auch X vor ewiger Verdammnis rettend. »Wir kamen«, erinnert sich Baudrot, »während der Arbeit am Film auf drei verschiedene Möglichkeiten, ihn zu beschließen, jeweils zu einem anderen Zeitpunkt (an einer Stelle schreit Albertazzi: ›Dieses Ende ist nicht das richtige!‹), und ein möglicher Schluss war die berühmte ›weiße Kamerafahrt‹, statt der Vergewaltigungsszene, die Robbe-Grillet im Drehbuch vorgesehen hatte. Diese Einstellung mußte in meiner Graphik ›nach oben‹ geschoben werden: sie war ursprünglich zeitlich festgelegt, doch schließlich wollte Resnais sie lieber im ›alle Zeiten‹-Bereich haben.«24 Die Vergewaltigung findet also weder vergangen noch gegenwärtig noch zukünftig, sondern immer statt. Und sie betrifft nicht länger (allein) den Körper einer namenlosen A, sondern sie betrifft das VergewaltigtWerden durch die Zeit selbst. Bei Robbe-Grillet, so Deleuze, »gibt es niemals eine Aufeinanderfolge der vorübergehenden Gegenwarten, wohl aber die Simultaneität einer Gegenwart der Vergangenheit, einer Gegenwart der Gegenwart, einer Gegenwart der Zukunft, die aus der Zeit etwas Furchtbares und Unerklärbares machen.«25
VI. Schuss und Schluss
Welche Lösung kann es für einen solchen Film geben, welches »letzte Bild« sich finden lassen? Wie wird der zähe Ringkampf zwischen konkurrierenden Zeitauffassungen und divergentem Begehren entschieden? Die zweimalige Aufführung eines als einmalig angekündigten Theaterstücks (im Film) – einmal ist die schöne A anwesend, einmal nicht – eröffnet vielleicht die Möglichkeit, dass sich die parallelen Welten des Drehbuchs für einen Moment lang gegeneinander verschieben können, so dass das Gesetz ihrer strengen Simultaneität aufgehoben wird. Aufgehoben zugunsten einer kurzen Sukzession des Ereignisses zweier Welten in einer, die es ermöglicht, dass M seine Frau (A) verfehlt und A den Erzähler (X)
L’Année dernière à Marienbad · 65
trifft. Wir ahnen, dass das Spiel mit den unvereinbaren Zeitebenen ein philosophisches Nachspiel hat. L’Année dernière à Marienbad ist ein Angriff auf die chronologische Ordnung, auf die Zeit der Uhren. Nicht umsonst spielt eine der eindrucksvollsten Szenen im Waffensaal. Dort stehen die Herrschaften des Schlosses in Reih und Glied und blicken uns, die Zuschauer *innen, an. Urplötzlich reißen sie einer nach dem anderen die Pistolen hoch und drehen sich, um auf »Pappkameraden« zu schießen, die wiederum den Hitchcock aus Attrappe in Erinnerung rufen. Erst als der Erzähler – in der Mitte des Bildes platziert, selbst eine prima Zielscheibe abgebend – als letzter an der Reihe ist, merken wir, dass das eigentliche Zielobjekt kein optischer, sondern ein akustischer »alter Hut« und Pappkamerad ist, nämlich die laut tickende Standuhr im Hintergrund.26 Als X schießen will, ist die Uhr bereits getroffen, und mit ihr erledigt ist die metrische, chronologische Zeit, der Resnais und Robbe-Grillet 93 Minuten keinerlei Gelegenheit geben werden, die Ausgefallenheit ihrer Zeitbilder mit ihrem einfallslosen Ticktack zu (zer)stören. Robbe-Grillet legt im Drehbuch großen Wert darauf, dass die Zahl der Schüsse, die man hört, und die Zahl der Einschläge, die man sieht, nicht übereinstimmen. Es schießen mehr und andere Schützen als jene, die aktuell im Bild sind, so dass der Eindruck entsteht, es gäbe mehr Schüsse als Schützen, als verfolge wenigstens ein Schuss ein anderes Ziel als das Treffen einer Zielscheibe aus Pappe. Mindestens drei verirrte oder gegenüber dem Bild vor- oder nachträgliche Schüsse lassen sich ausmachen. Sie sind vielleicht so etwas wie »verstohlene Auszeiten«, Zwischenzeiten, welche die verschiedenen Parallelwelten des Films aufeinander
Die Geschichte ist von Anfang an zu Ende
66 · Mirjam Schaub
beziehbar machen: Während das Ticken der Uhr das Vergehen und Löchrigwerden der Zeit anzeigt, durchsieben die Schüsse die Ordnung des Sichtbaren und versehen sie mit Löchern. Bild und Ton geraten in L’Année dernière à Marienbad in einen Wettstreit, der weder das Gesehene noch das Gehörte unversehrt lässt. Für Überraschungen ist also gesorgt, ganz wie beim Eiswürfellutschen. ((Abb. 3))
1 Dieser Artikel ist die überarbeite Fassung zweier älterer Veröffentlichungen: Mirjam Schaub, Gilles Deleuze im Kino. Das Sichtbare und das Sagbare, München 2003, S. 171–181, sowie dies., Bilder aus dem Off. Zum Stand der philosophischen Kinotheorie, Weimar 2005, S. 96–109. — 2 Gilles Deleuze, Unterhandlungen (1972–1990), übers. von Gustav Roßler, Frankfurt am Main 1993, S. 217 f. — 3 Wolfgang Jacobsen / Peter W. Jansen / Benjamin Lenz / Peter H. Schröder, Alain Resnais (Reihe Film 38), München 1990. — 4 Elke Schmitter, »Djuna Barnes lesen: Einen Eiswürfel lutschen«, in: die tageszeitung (taz), 7.5.1992, S. 17–19. — 5 Der Drehbuchautor Jean Druault in: François Thomas, Das Atelier von Alain Resnais, München 1992, S. 50. — 6 Der Regieassistent Jean Léon in ebd., S. 99. — 7 Alain Robbe-Grillet, L’année dernière à Marienbad. Ciné-roman, illustré de 48 photographies extraites du film réalisé par Alain Resnais, Paris 1961, S. 140. Dt. ders., Letztes Jahr in Marienbad. Drehbuch, übers. von Helmut Scheffel, München 1961. — 8 Vgl. Jacques Rivette / André S. Labarthe, »Entretien avec Resnais et Robbe-Grillet«, in: Cahiers du Cinéma 123 (September 1961), S. 1–18, hier S. 2. — 9 Gilles Deleuze, Das Zeit-Bild. Kino 2, Frankfurt am Main 1985, S. 140. — 10 Alain Robbe-Grillet, L’année dernière à Marienbad (s. Anm. 7), S. 10. — 11 Deleuze, Das Zeit-Bild (s. Anm. 9), S. 140. — 12 Umberto Eco, Die Offenheit des Kunstwerkes. Aus dem Italienischen übers. von Günter Memmert, Frankfurt am Main 1977. — 13 Ebd., S. 57. — 14 Ebd., S. 88. — 15 Vgl. Deleuze, Das Zeit-Bild (s. Anm. 9), S. 160 f. — 16 Das Skript-Girl, wie es in der Filmbranche heißt, Sylvette Baudrot in Thomas, Das Atelier von Alain Resnais (s. Anm. 5), S. 106. — 17 Abgedruckt zuerst in den Cahiers du cinéma 123 (s. Anm. 8). Wiederabgedruckt in Thomas: Das Atelier von Alain Resnais (s. Anm. 5), S. 102 und S. 104. — 18 Sylvette Baudrot in Thomas, Das Atelier von Alain Resnais (s. Anm. 5), S. 105. — 19 Ebd. — 20 Sylvette Baudrot in L’Arc: Alain Resnais, Nr. 31, Aix-en-Provence 1967, S. 50. Zit. auch bei Deleuze, Das Zeit-Bild (s. Anm. 9), S. 390, Fußnote 3. — 21 Robbe-Grillet, L’année dernière à Marienbad (s. Anm. 7), S. 126. — 22 Ebd., S. 42 f. — 23 Sylvette Baudrot in Thomas, Das Atelier von Alain Resnais (s. Anm. 5), S. 108. — 24 Ebd., S. 105. — 25 Deleuze, Das Zeit-Bild (s. Anm. 9), S. 136. — 26 Robbe-Grillet, L’année dernière à Marienbad (s. Anm. 7), S. 47.
Anna Magdalena Elsner
Erinnerungen an Muriel ou le temps d’un retour »Elle est malade, non elle n’est pas malade«, antwortet Bernard ( JeanBaptiste Thierrée) seiner Stiefmutter Hélène (Delphine Seyrig), als diese ihn zu Beginn von Alain Resnais’ Film Muriel ou le temps d’un retour fragt, wo er die mysteriöse – im Film niemals sichtbar werdende – Muriel kennengelernt habe. Die Kamera folgt Bernard, wie er den Raum verlässt, sich an einem Tisch niederlässt und sich einer dort platzierten, auseinandergenommenen Pistole innig widmet. Als ich 2007 Muriel ou le temps d’un retour aus der Cambridge University Library auslieh, war der Grund dafür ein scheinbar banaler. Ich arbeitete zu diesem Zeitpunkt an meiner Doktorarbeit zur Trauer bei Marcel Proust und war über einige Artikel gestolpert, in welchen Bezüge zwischen Prousts Metaphorik der Zeit und der Erinnerung Resnais’ Hiroshima Mon Amour und L’Année Dernière à Marienbad gegenübergestellt wurden. Muriel ou le temps d’un retour wurde in diesen Texten jedoch nie als ein bemerkenswerter Teil der Proust-Resnais-Connection hervorgehoben. Dies schien mir verwunderlich, da der Zeit doch bereits im Filmtitel eine besonders bedeutende Stellung eingeräumt wird. Es schlich sich jedoch auch noch ein persönlicher Grund in diese Neugierde für den Film ein: Muriel, der weibliche Name, der den Anfang des Filmtitels ausmacht, war nämlich zugleich der Name meiner französischen Schwiegermutter, die seit ein paar Monaten ein auffälliges Verhalten – eine Mischung aus Aggression, Emotionslosigkeit, Gedächtnisverlust und Aphasie – aufwies, welches in einer ersten medizinischen Beurteilung als ein psychiatrisches Problem – eine Depression, ein Burnout, ja sogar eine Art weibliche Midlife-Crisis – gedeutet worden war. Die spezifische Symptomatik dieser Krise führte zu diesem Zeitpunkt dazu, dass Muriel mir täglich über 20 E-Mails – oft nur bestehend aus einzelnen Wörtern, Satzfragmenten oder Fragezeichen – schickte, und mich zigmal täglich anrief, nur um dann ähnlich unverständliche und teilnahmslose Fragmente ins Telefon zu hauchen, kurz darauf wieder aufzulegen und Minuten später wieder ähnlich unvermittelt anzurufen. Das Bild der verstört schauenden Schauspielerin Delphine Seyrig auf der DVD-Hülle der Kopie von Muriel ou le temps d’un retour in der Bibliothek ließ mich genau darum damals nicht los. Die Hülle zeigt eine
68 · Anna Magdalena Elsner
Plakat von Muriel ou le temps d’un retour
Frau mittleren Alters, deren Augen in die Ferne und doch auf nichts Präzises gerichtet sind. Obgleich sie niemanden und nichts visiert, ist in ihrem Blick eine Beunruhigung, ja sogar Furcht, zu erkennen. Man kann jedoch nicht sagen, ob diese aus der Ferne rührt – einer Ferne, welche der Betrachterin verschlossen bleibt – oder, da der Blick an nichts festzumachen ist, ihrem Inneren entstammt. ((Abb. 1)) Delphine Seyrigs Blick macht die Problematik von Muriel ou le temps d’un retour greif bar – zum einen die große historische Aufarbeitung von Frankreichs Rolle im Algerienkrieg, die Auseinandersetzung mit psychischen und physischen Traumata und ihren Effekten für Opfer, Täter und die diversen Kategorien dazwischen. Zum anderen das persönliche Schicksal von Hélène, ihrer unerfüllten Liebe zu Alphonse und die verschiedenen Lebenslügen, die mit ihrer Beziehung verknüpft sind. Vielleicht noch greif barer als diese großen Handlungsstränge des Films wird in Seyrigs Blick das Wesen einer Person, die krampf haft versucht, in der Gegenwart anzukommen. Einer Gegenwart, die nicht länger Ort des Erlebens ist, sondern die konstant unter Beschuss steht, die nicht mehr eindimensional erlebt wird, sondern – um eines der wichtigen Objekte des Films aufzugreifen – zu jedem Zeitpunkt kaleidoskopisch auseinanderfällt und sich dem Erleben entzieht. Muriel ou le temps d’un retour ist ein Film über dieses Auseinanderfallen und die Unbegreif lichkeit, die sich darin manifestiert. Es mag sein, dass sich der Proust-Resnais-Vergleich darum nicht so aufdrängt wie bei anderen Beispielen aus Resnais’ Œuvre, weil der Film in seinem
Erinnerungen an Muriel ou le temps d’un retour · 69
Umgang mit der Zeit die fragmentarische Destabilisierung so weit treibt, dass Muriel ou le temps d’un retour die Möglichkeit einer Narrativität selbst in Frage stellt. Doch genau deshalb wurde Resnais’ Film für mich zum Film über Muriel, welche kurz nachdem ich den Film gesehen hatte, mit frontotemporaler Demenz diagnostiziert wurde. Anders als bei anderen Demenzen sind bei dieser Form primär die Nervenzellen des frontalen und temporalen Lappens des Gehirns betroffen, jenem Teil des Gehirns, welches Emotionen und Sozialverhalten kontrolliert. Daher stehen Persönlichkeitsveränderungen im Vordergrund des Krankheitsbildes, so dass es bei der Diagnostik oft zu Verwechslungen mit psychischen Störungen kommt. Während das Gedächtnis also noch länger erhalten bleibt, gehen die emotionalen und sozialen Kompetenzen verloren, mit denen man der eigenen Erinnerung begegnet. Die Suche nach der Vergangenheit und deren unabdingbarer, wenn auch unkontrollierbarer Rückkehr sind die großen Themen von Muriel ou le temps d’un retour, und die Rezeption hat sich in diesem Zusammenhang oft gestritten, ob Resnais’ Film nun ein Film über Algerien und dessen Rolle in der französischen Geschichte und Identität sei oder nicht. Ähnlich wie Bernard zu Beginn über die im Film niemals sichtbare Muriel sagt, sie sei krank und zugleich nicht krank, könnte man vielleicht auch über Muriel ou le temps d’un retour sagen, dass der Film weder ein Film über Algerien ist noch, dass er Algerien vergisst oder auslässt. Die Vergangenheit, sowohl die nationale französische als auch die persönliche der Protagonisten, ist omnipräsent. Und doch bleibt sie ungreifbar, weil die emotionalen und sozialen Kompetenzen, welche nötig wären, um dieser Präsenz zu begegnen und ihr eine – persönliche oder kinematische – Form zu geben, nicht bestehen. Und in dieser Formlosigkeit der Erinnerung treffen sich für mich beide Muriels – die kranke, echte und die unsichtbare, erinnerte. Das führt zu einer Art Unbehagen, einer Diskrepanz und Unstimmigkeit, und vielleicht genau der Form von »espèce de malaise«, mit der Resnais seinen Film über die Zeit der Wiederkehr durchdrungen sehen wollte.1
1 Alain Resnais und Jean Cayrol, »Muriel en question«, in: Les lettres françaises, Venedig 1963.
Kristina Köhler
Voir et revoir Eine Wiederbegegnung mit Je t’aime, je t’aime
Lyon 2003, während meines Auslandsstudiums. An diesem Abend gehe ich allein ins Kino. Ich weiß nicht mehr genau, was mich bewegt hat, Je t’aime, je t’aime anzuschauen. Vielleicht ist es der Titel, der eine Liebesgeschichte zu versprechen scheint. Zweimal »Ich liebe Dich« sagen – das klingt nach Emphase. Ich ahne noch nicht, dass die Doppelung ein Stottern enthält, das die Liebeserklärung zur Formel werden lässt und meine Genreerwartung unterspült. Nach 90 Minuten trete ich verwirrt, fast atemlos auf die Straße. Auf dem Nachhauseweg fühle ich mich schwer und leicht zugleich, mein Raum- und Zeitgefühl sind durcheinandergeraten. Selten hat mich ein Film so überrascht, irritiert, genervt und berührt. Was war passiert? Ich erinnere mich, dass es mir zunächst schwerfällt, mich auf den Film und sein leicht unterkühltes Universum einzulassen. Krankenhaus-Flure, ein Labor mit weißen Mäusen in Glaskästen, Männer in weißen Kitteln, eine Autofahrt zu choraler Musik: Mit der angespannten Atmosphäre eines Thrillers entfaltet der Film in nur wenigen Einstellungen die Geschichte um eine Zeitreise, die zwischen Gegenwart und Vergangenheit, Leben und Tod changiert. Bezeichnenderweise muss der Film seinen Protagonisten erst zum Leben erwecken: Claude Ridder (Claude Rich) hatte sich mit einem Selbstmordversuch eigentlich schon aus dem Leben verabschiedet. Er überlebt und soll als Proband für ein Experiment eingesetzt werden, das eine Gruppe belgischer Wissenschaftler durchführt. Da Ridder nichts zu verlieren hat, willigt er ein. Und so reist er in die eigene Vergangenheit, in eine Minute vom 5. September 1966 um 16 Uhr. Was nun folgt, beeindruckt und verwirrt mich gleichermaßen. Geradezu sinnlich »taucht« der Film mit Ridder in dessen Vergangenheit ein: Unterwasserbilder, ein dumpfes Glucksen, Ridder kommt mit Taucherbrille, Schnorchel und Flossen aus dem Wasser. »C’était bien?« fragt eine Frauenstimme, zunächst aus dem Off. Und Ridder zählt auf, was er unter Wasser gesehen hat. Wieder und wieder bekommen wir diese scheinbar belanglose Szene zu sehen: in unterschiedlichen Variationen und Verschiebungen, mal früher, mal später einsetzend, so dass sie sich ins Gedächtnis regelrecht einbrennt. Sie wird zur Chiffre, über die Je t’aime, je
Je t’aime, je t’aime · 71
t’aime sein zentrales Thema, das Erinnern, etabliert.1 Dieses Erinnern funktioniert nicht im Sinne eines klassischen Flashbacks, der Erklärungen liefert und Leerstellen auffüllt, sondern erweist sich als fragmentarisch, verwirrend, unzuverlässig. Das verdeutlicht auch die Rahmenhandlung, in der das wissenschaftliche Experiment von Ridders Zeitreise außer Kontrolle gerät: Claude Ridder wird hin- und hergeworfen zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Statt kontrolliert in eine Minute seines Lebens zu reisen, schwemmt ein Wust an Bruchstücken seiner Vergangenheit herauf: Szenen aus Ridders
Je t’aime, je t’aime
72 · Kristina Köhler
Alltag, seine Arbeit in einem Verlag, verschiedene Liebschaften, dazwischen weiter zurückliegende Erinnerungsfragmente (der Krieg, ein Maschinengewehr, falsche Ausweispapiere). Und immer wieder verdichten sich die Szenen um Catrine, Ridders Beziehung zu ihr, ihren Tod. ((1+2)) Die Reise in die Vergangenheit liefert zwar Anhaltspunkte dafür, wer Claude Ridder gewesen sein könnte. Doch je mehr wir über ihn erfahren, desto unschärfer und widersprüchlicher wird das Bild. So wird uns gesagt, Ridder habe als Schriftsteller gearbeitet; doch wir sehen ihn vor allem als Verwaltungsangestellten in einem Verlag bei Tätigkeiten, die er leidenschaftslos und zugleich akribisch ausführt: Bestände inventarisieren, Seiten nachzählen, Bestellungen überprüfen. Zählen statt Erzählen – vielleicht ist das auch eine implizite Leseanleitung für Je t’aime, je t’aime. Das Nebeneinander der ungeordneten Szenen lässt sich höchstens mit inventarisierendem Blick betrachten, aber nicht zu einem sinnvoll aufeinander bezogenen Nacheinander anordnen. Es fällt mir schwer, damals im Kino, das auszuhalten. Auch die Liebesgeschichte von Claude und Catrine, die zunehmend ins Zentrum der Erinnerungsfragmente rückt, verwehrt sich einer Logik dramatischer Progression; vielmehr stellt der Film verschiedene Aggregatzustände des Liebens nebeneinander. Momente großer Intimität, verspielter Ironie und Zärtlichkeit wechseln sich ab mit Szenen, in denen die Liebenden komplett aneinander vorbeireden, sich nichts zu sagen haben, sich gegenseitig erschöpfen oder beschweren. Interessanterweise werden die unterschiedlichen Affekte nicht dramatisierend voneinander abgesetzt, sondern gehen nahtlos ineinander über. Das vermittelt sich auch über das eigentümliche Körperspiel von Claude und Catrine, über ihre Gesten, Blicke und Bewegungen: Egal, ob sie arbeiten, lieben, glücklich oder verzweifelt sind, stets hängen sie seltsam spannungslos in der Luft – unterstrichen durch ihre Kleidung (ein grob gestrickter Wollpullover, weite Hemden, ein unförmiger Mantel). Sie werden nicht als Handelnde in Aktion gezeigt, vielmehr sehen wir sie als Verweilende, Wartende, Ausharrende. Sie sind erschöpft und müde, gerade erst aufgewacht oder fast schon wieder eingeschlafen. Auf der Skala der Körperzustände, die Je t’aime, je t’aime um die beiden auslegt, ist der Unterschied zwischen der Entspannung eines in der Sonne liegenden Körpers am Strand und dem vor Ennui und Lebensüberdruss regungslosen Körper lediglich ein Effekt gradueller Verschiebung. Dabei lässt sich mitunter nicht so recht entscheiden, ob die Figuren noch schlafen oder schon tot sind. Ausgestreckt und mit geschlossenen Augen liegt Claude Ridder in der Zeitmaschine auf der amorphen Liege, die zunehmend mit seinem Körper verschmilzt.
Je t’aime, je t’aime · 73
»Détendue, heureuse, complètement détendue« sei auch Catrine im Moment ihres Todes dagelegen, erinnert sich Claude. Mich fasziniert die brutale Konsequenz, mit der mich der Film in den traumähnlichen Zustand von Ridders Zeitreise hineinzieht. Die zahlreichen Wiederholungen einzelner Szenen lassen den Sinngehalt von Gesten, Bewegungen und Worten in den Hintergrund treten und machen diese als rhythmisches Gefüge von Lauten, Impulsen, Schwingungen wahrnehmbar – unterstützt durch die sparsam eingesetzte Musik von Krzysztof Penderecki. Ein eher assoziatives Prinzip ergreift auch die Räume und Dinge. Losgelöst von einer Logik der Raumzeitlichkeit zirkulieren sie durch verschiedene Erinnerungsschichten – zum Beispiel die rote Decke mit dem schwarzen Blumenmuster oder die grüne BambusTapete, die mal in Ridders Schlafzimmer, mal in seinem Arbeitszimmer auftaucht, und dann in jenem seltsam entleerten Raum, in dem das Verhör mit der Glasgower Polizei stattfindet. * Eine DVD des Films steht seit vielen Jahren in meinem Bücherregal.2 Lange Zeit konnte ich mich nicht überwinden, ihn noch einmal zu schauen – als wollte ich die Intensität des früheren Kinoerlebnisses bewahren, als wäre ich dem brüchig-affizierenden Erinnern verpf lichtet, in das mich Je t’aime, je t’aime so effektiv verwickelt hatte. Dann schaue ich den Film noch einmal. Erneut überraschen mich die Vermischung von Science-Fiction, Melodrama und Thriller und die Überlagerung der damit verbundenen Affekte. Wieder frage ich mich, wieso Resnais und Drehbuchautor Jacques Sternberg Universalthemen wie Zeiterfahrung und Erinnerung auf scheinbar belanglose Alltags-Bruchstücke aus Ridders Leben und eine Liebesgeschichte prallen lassen, die – wie eigentlich alles, wovon erzählt wird – scheitert.3 Wieder hadere ich mit dem Protagonisten Claude Ridder, der wie eine Figur aus den Romanen von Albert Camus die Absurdität des Lebens zwar abgeklärt kommentiert und dennoch an ihr verzweifelt. Schließlich entdecke ich eine Dimension, die mir damals im Kino entgangen war: den eigenwilligen Humor des Films. Er tritt in bissigzynischen Dialogen zutage und artikuliert sich (im Geiste des absurden Theaters) in Ridders Monologen – etwa, wenn dieser verdrossen und vergnügt zugleich bei der eintönigen Arbeit am Schreibtisch über die Zeit sinniert, die nicht vergeht (»Il est trois heures à tout jamais«). Was in einigen Szenen als subtiles Augenzwinkern angelegt ist, steigert sich in
74 · Kristina Köhler
anderen Momenten zu surrealer Situationskomik (eine nackte Frau, die im Empfangszimmer des Verlags auf einem Schreibtisch badet). Je mehr das Experiment außer Kontrolle gerät, desto schräger, schriller und exzentrischer werden die Szenen; desto mehr kippen Ridders Erinnerungen in den Bereich von Halluzination und Traum. Dennoch bleibt die Komik so dosiert, dass nie ganz eindeutig ist, wer sich über wen lustig macht. Der ironisierende Unterton macht den Film noch schwerer greif bar. Das zeigt sich auch in der Rezeption. Während jüngere Auseinandersetzungen mit Je t’aime, je t’aime vor allem dessen philosophische Dimension hervorheben, ihn als Ref lexion auf universale Themen wie Zeit, Erinnerung und Subjektivität verstehen,4 zeigten sich zeitgenössische Filmkritiken aus den 1960er Jahren durchaus empfänglich für den eigenwilligen Humor. So vermerkte ein Kritiker der Neuen Zürcher Zeitung 1968, Resnais liefere mit Je t’aime, je t’aime eine »Karikatur« oder auch »Volksausgabe« der eigenen früheren Filme, in denen es stets um »Gedächtnis und die Bewußtwerdung« gegangen war;5 und: »aus der Komplexität wird gar ein Amüsement; Resnais gibt sich populär«.6 Womöglich ist das Spannungsverhältnis von Pathos und Ironie vor dem Hintergrund des historischen Kontextes besser zu verstehen. Je t’aime, je t’aime läuft im April 1968 in den Pariser Kinos an, während sich dort bereits die Studierendenproteste anbahnen – und verpasst so gewissermaßen sein Publikum. Doch gerade aus dem Geiste von 1968, so bemerkt Dominik Graf, sei Je t’aime, je t’aime als »revolutionär« zu verstehen: Der Gestus, mit dem der Film philosophische Ref lexion mit Versatzstücken des Populären (Science-Fiction, Thriller, Jazz) verbindet, stehe für die in dieser Zeit so wirkmächtige »Hoffnung auf eine kreative Verbindung von Massengeschmack und intellektueller Hochkultur«.7 Vielleicht geht Je t’aime, je t’aime sogar noch einen Schritt weiter: Anstatt eine programmatische »Vereinigung« von Hoch- und Populärkultur zu zelebrieren, werden hier auch die Brüche und Spannungen erfahrbar gemacht, die zwischen intellektuellem Verstehen und sinnlichem Erleben verlaufen. Mit einem Augenzwinkern bleiben beide aufeinander bezogen. So kann Je t’aime, je t’aime einerseits im Unlogischen, Irrationalen und Ungeordneten schwelgen und anderseits seinen Protagonisten sagen lassen: »Tout est raisonnable, tout s’explique.«
1 Vgl. zur Erinnerungsthematik des Films auch Sophie Rudolph, Die Filme von Alain Resnais. Reflexionen auf das Kino als unreine Kunst, München 2012, S. 142–146. — 2 DVD Je t’aime, je
Je t’aime, je t’aime · 75 t’aime. Editions Montparnasse, 2008. — 3 Auf ein ähnliches Missverhältnis zwischen Erinnerungs- und Liebesthematik verweist Jacques de Baroncelli in seiner Filmkritik von 1968: »[L]es problèmes sentimentaux de Ridder ne sont pas d’un intérêt majeur. […] A moins que l’amour ne soit vraiment l’unique souvenir que l’on retienne dans le cosmos intemporal!« Jacques de Baroncelli, »Je t’aime, je t’aime«, Le Monde 29.4.1968, o. S. — 4 Vgl. etwa Martine Bubb, »Le mystère de la chambre noire. Je t’aime je t’aime d’Alain Resnais«, in: Appareil 6 (2010), online: http://journals.openedition.org/appareil/552 (letzter Zugriff am 5.8.2021); Michel Paty, »La science, le cinéma et le temps. Le temps physique et le temps de la mémoire dans Je t’Aime Je t’aime d›Alain Resnais«, in: Raison présente 180 (2011), S. 87–98; Jackson B. Smith, »Outside and inside the time machines: structure and subjectivity in Alain Resnais’s Je t’aime, je t’aime«, in: New Review of Film and Television Studies (2021), DOI: 10.1080/17400309.2021.1935606. — 5 »Studio 4: Je t’aime, je t’aime [Zürcher Filmspiegel]«, Neue Zürcher Zeitung, 17.9.1968, S. 27. Die Rede von der »Karikatur« bleibt hier freilich ambivalent; der Rezensent scheint anzuzweifeln, dass dieser Effekt von Resnais bewusst eingesetzt wurde. — 6 »Je t’aime, je t’aime [Zürcher Filmspiegel am Wochenende]«, Neue Zürcher Zeitung, 20.9.1968, S. 19. — 7 Dominik Graf, Schläft ein Lied in allen Dingen. Texte zum Film, Berlin 2009, S. 180.
Petr Mareš
»One of you must speak English« Über Mehrsprachigkeit in den Filmen von Alain Resnais
In Chris Wahls Abhandlung über das »Genre« des polyglotten, also mehrsprachigen Films wird Alain Resnais nicht erwähnt,1 doch etliche seiner Werke ließen sich zweifellos in diese Kategorie einordnen (so liefern sie geeignetes Material für Ref lexionen, denen ich mich schon lange widme).2 Die folgende Skizze befasst sich daher damit, wie der Kontakt und die Konfrontation von Sprachen sowie von Figuren, die diese Sprachen verwenden, in Resnais’ Filmen inszeniert werden. Die Äußerungen in verschiedenen Sprachen, die zu hören, aber auch in schriftlicher Form zu sehen sind, sind zugleich eng mit dem Kontakt und der Konfrontation von unterschiedlichen Ethnien und Kulturen verbunden. Der erste Spielfilm von Resnais, Hiroshima mon amour (1959), erzählt von einer Begegnung und f lüchtigen Liebe zwischen einer französischen Schauspielerin und einem Japaner in Hiroshima – zwei Menschen, die durch ihre traumatisierenden Kriegserlebnisse gezeichnet sind. Ihre Annäherung wird dadurch ermöglicht, dass der Japaner f ließend Französisch spricht. Die Sprachfähigkeit des Japaners kann als Bestandteil der dramatischen Konstruktion des Films gesehen werden, zumal der Schauspieler Eiji Okada nicht wirklich Französisch sprechen konnte, sondern die Dialoge phonetisch auswendig lernte.3 So kann auch die grundlegende semantische Linie des Films konstruiert werden, getragen durch französische Dialoge und innere Monologe. Zugleich entstehen hier aber eine Asymmetrie und eine Spannung. Während der japanische Architekt einen, wenn auch limitierten Zutritt zu der anderen Kultur hat (was z. B. seine Faszination durch den Klang des Stadtnamens Nevers demonstriert), bleibt die Französin sprachlich von der japanischen Wirklichkeit abgetrennt; auch darum ist ihre Bemühung, die Hiroshima-Tragödie zu begreifen, ohne Aussicht auf Erfolg. Die seltenen japanischen Äußerungen sind für sie (wie für die meisten im Publikum) undurchdringlich; bezeichnenderweise wird der kurze Dialog zwischen dem Architekten und einer alten Japanerin nicht untertitelt. Die Konfrontation mit der fremden Welt evoziert auch der Nachdruck auf die sprachliche Landschaft4 von Hiroshima: Immer wieder werden verschiedene Schilder und Inschriften in japanischen Zeichen vorgeführt, oft sind es in die Nacht leuchtende Neonschriften.5
Mehrsprachigkeit in den Filmen von Alain Resnais · 77
Hiroshima mon amour
Außerdem entsteht eine Opposition zwischen der traditionellen japanischen Stadt und der modernen Internationalisierung, die sich in der auffallenden Präsenz des Englischen in der sprachlichen Landschaft des urbanen Raums manifestiert: Inschriften wie Hiroshima Gift Shop oder Atomic Tour sind zu sehen. Englisch wird auch zur Sprache eines oberf lächlichen Flirts, den ein Japaner der Französin in einem Nachtclub anbietet (»Are you alone?«). Bedeutend ist die merkmalhafte Absenz einer Sprache: Aus den Reminiszenzen an die Liebesbeziehung der Protagonistin mit einem deutschen Soldaten während der Zeit der nazistischen Okkupation Frankreichs ist das Deutsche völlig verdrängt. War es in Hiroshima mon amour vor allem die Spannung zwischen dem Französischen und dem Japanischen, so basiert der vierte Spielfilm von Resnais, La guerre est finie (1966), auf der Spannung zwischen der französischen und der spanischen Sprache und mithin zwischen Frankreich und Spanien. Der Held des Films, ein spanischer Widerstandskämpfer gegen das Franco-Regime, und seine Mitarbeiter bewegen sich sowohl im französischen als auch im spanischen Milieu. Doch die Relation beider Gegenden und Sprachen ist stark asymmetrisch. Obwohl das zentrale Thema die Situation in Spanien ist, ist dieses Land fast nicht zu sehen, und das Spanische erklingt nur selten; dazu werden die Spanier von französi-
78 · Petr Mareš
La guerre est finie
schen Schauspielern verkörpert,6 und die Hauptfigur gibt sich mit Erfolg für einen Franzosen aus. Das Spanische funktioniert so als zeitweilige Erinnerung an die Nationalität einiger Figuren (in Form von Begrüßungen, Höf lichkeitsformeln, einzelnen emotional betonten Ausdrücken u. ä.) und erscheint in der Kommunikation im größeren Umfang nur dann, wenn seine Absenz ganz unwahrscheinlich wäre (als Motivation für die Wahl des Französischen dient etwa die Anwesenheit einer nur Französisch sprechenden Person). Bezeichnend dabei ist, dass die längste Szene, in der das Spanische verwendet wird (die Diskussion in der kommunistischen Führung), eigentlich nur wenige hörbare Dialoge enthält. Die Äußerungen werden durch die Erzählerstimme überdeckt, die ihren Inhalt reproduziert und interpretiert. Als eine partielle Kompensation wirkt dann die (wieder betonte) sprachliche Landschaft, die verschiedene Schilder und Inschriften in beiden Sprachen umfasst.7 Die Strategie, die in La guerre est finie realisiert wird, besteht so in einer Dämpfung der Mehrsprachigkeit; das Französische als Sprache des intendierten Publikums dominiert, dagegen entspricht die Position des Spanischen der geheimen und maskierten Tätigkeit der Widerstandskämpfer. ((Abb. 2)) Einen Gegenpol zu La guerre est finie stellt dann die stilisierte Komödie I Want to Go Home (1989) dar, die schon zu der späteren Schaffensperiode von Resnais gehört. Hier wird der Zusammenstoß des Französischen und des Englischen sehr breit entfaltet. Die Konfrontation von Sprachen und von Benutzern dieser Sprachen wirkt als Quelle der Komik und als Bestandteil eines ironischen Spiels mit den nationalen sowie kul-
Mehrsprachigkeit in den Filmen von Alain Resnais · 79
turellen Stereotypen und Vorurteilen, die den Antinomien Amerika und Frankreich, hohe und populäre Kultur folgen. Die Handlung beruht auf der feinen Nuancierung von Sprachkenntnissen und Spracheinstellungen bei den sich in Paris und Umgebung treffenden Figuren. So ist der amerikanische Comiczeichner Joey Wellmann streng monolingual und im Grunde davon überzeugt, dass die Kenntnis des Englischen etwas Natürliches und Erwartbares sei; seine Verlorenheit und Verzweif lung, dass ihn niemand auf dem Land in Frankreich versteht, sind entsprechend wirklich tief und aufrichtig (»One of you must speak English«). Joeys Freundin Lena repräsentiert Bemühung und Kooperationsbereitschaft, doch ihre Versuche, Französisch zu kommunizieren, sind zum Scheitern verurteilt (»This is … Il est Joey Wellmann«). Seine Tochter Elsie tritt an die französische Sprache und Kultur mit naiver Bewunderung und Eifer heran; doch es ist typisch, dass sie in stressigen und emotional geladenen Situationen sofort ins Englische kippt. Auf der anderen Seite erklärt Isabelle, die Mutter des Professors Gauthier, dass sie die Kenntnis des Französischen als selbstverständlich ansieht; allerdings spricht sie zugleich f ließend Englisch. Eine Gruppe von Figuren (darunter Professor Gauthier) bewegt sich in beiden Sprachwelten und schaltet pragmatisch von einer in die andere Sprache um. Die »gewöhnlichen« Leute wiederum sind mit dem Französischen verbunden, eventuell nehmen sie das Englische als etwas, das man im Kino hören kann. Diese Differenzierung bildet eine passende Basis für die Inszenierung von komischen und frappanten Konfrontationen in der Kommunikation; dabei geht es nicht um Originalität, sondern um effektive Ausnutzung
I Want to Go Home
80 · Petr Mareš
der existierenden Komödienkonventionen. So heben mehrere Szenen unerwartete, manchmal rüde Reaktionen auf schüchterne Konversationsversuche sowie die unangenehmen Folgen sprachlicher Missverständnisse hervor. Es werden auch traditionelle Verfahren appliziert, wie die absichtlich irreführende Erklärung einer fremdsprachigen Äußerung, oder andererseits die Vortäuschung, dass man die von den Anderen verwendete Sprache nicht versteht. Exemplarisch ist schließlich die Szene, in der Joey Wellmann hören will, wie seine Tochter das Französische beherrscht. Sie bringt eine pathetische Tirade voll von Wut und Verachtung aus, doch Wellmann, der kein Wort versteht, ist begeistert, weil ihre Rede wirklich Französisch klingt. ((Abb. 3)) Diese verschiedenen Beispiele der durch die Sprache generierten (manchmal boshaften) Spiele, Missverständnisse und Konf likte gehen vor dem Ende des Films in Momente über, die die Möglichkeit der Empathie und der Kooperation zwischen den Repräsentanten unterschiedlicher Nationen und Kulturen andeutet. Zugleich sieht man jedoch, dass diese Gemeinschaft nur durch vorübergehende Euphorie und symbolische Akte entsteht (Zeichnungen, Singen von Liedern, Wiederholung einfacher Parolen). Es handelt sich so eher um eine Vision und den Ausdruck von Hoffnung. I Want to Go Home ist der Film, in dem Resnais die Problematik der Mehrsprachigkeit und ihrer Manifestierung in der Kommunikation am deutlichsten ref lektiert hat. Dies wurde allerdings zum Bestandteil eines als überstilisiert bewerteten Werks, das die betonte Theatralität mit Elementen der Comics kombinierte und zu den am wenigsten erfolgreichen Filmen in Resnais’ Karriere gehörte.
1 Chris Wahl, Das Sprechen des Spielfilms. Über die Auswirkungen von hörbaren Dialogen auf Produktion und Rezeption, Ästhetik und Internationalität der siebten Kunst, Trier 2005, S. 144–179. — 2 Vgl. z. B. Petr Mareš, »Lidové noviny – Hostages executed! Tschechen, Deutsche und ihre Sprachen in Hangmen Also Die!«, in: Zwischen Barrandov und Babelsberg. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert, hg. von Johannes Roschlau, München 2008, S. 111–122; »›Die goldene Stadt‹ von Veit Harlan. ›Schlechtes Blut‹, Deutsche und Tschechen«, in: Über die österreichische Geschichte hinaus. Festschrift für Gernot Heiss zum 70. Geburtstag, hg. von Friedrich Edelmayer et al., München 2012, S. 179–190. — 3 Vgl, hierzu Marie-Christine de Navacelle, Tu n’as rien vu à Hiroshima, Paris 2009, S. 82. — 4 Vgl. Peter Auer, »Sprachliche Landschaften. Die Strukturierung des öffentlichen Raums durch die geschriebene Sprache«, in: Sprache intermedial. Stimme und Schrift, Bild und Ton, hg. von Arnulf Deppermann und Angelika Linke, Berlin, Boston 2010, S. 271–298. — 5 Vgl. Emma Wilson, Alain Resnais, Manchester 2009, S. 58–59. — 6 Vgl. ebd., S. 111. — 7 Vgl. Roland-François Lack, »The Topography of La Guerre est finie (Spaces, Places, Non-Places and Other Spaces)«. URL: https://www.thecinetourist.net/the-topography-of-la-guerre-est-finie.html (letzter Zugriff am 12.5.2021).
Jörg Schweinitz
On connaît la chanson als Spiel ästhetischer Koketterie Persönliche Reflexion und theoretischer Horizont Als ich 1998 in einem Berliner Kino On connaît la chanson (Das Leben ist ein Chanson, 1997) zum ersten Mal sah, löste der Film von Alain Resnais bei mir eine Form der Begeisterung aus, die über das Vergnügen an einem guten, intelligenten Stück Kino mit einer wunderbaren Besetzung deutlich hinausging. Es war nicht nur der Spaß an der Leichtigkeit der unterhaltsamen und überraschenden Inszenierung, deren melodramatische Momente auf Rührung und im selben Augenblick auch auf ironische Distanz zielten und mithin eine gute Komödie hervorbrachten. Es war auch nicht nur das Interesse an Figuren, die einerseits mit Zeichen alltäglicher Realität ausgestattet mitfühlbar gemacht sind und gleichzeitig klar als mit wenigen Strichen typisierte mediale Artefakte aus dem Repertoire ausgestellt werden. Vor dem Hintergrund solch permanenter Ambivalenzen kam bei mir noch etwas anderes hinzu: die Begeisterung des Theoretikers über einen interessanten Fall, der das eigene theoretische Denken und dessen damalige Verfassung auf besondere Weise herausforderte und faszinierte. Zu jener Zeit saß ich an einer Untersuchung über filmische Stereotype und deren sich mehrfach wandelnde Wahrnehmung in der Filmpublizistik und -theorie seit den 1920er Jahren sowie über die verschiedenen Wege der kreativen filmischen Aneignung solch konventioneller Formen die Filmgeschichte hindurch. Zugleich war in den 1990ern der – inzwischen selbst zur historischen Kategorie gewordene – Begriff des postmodernen Kinos in aller Munde. Er passte perfekt zu zahlreichen großen Filmen jenes Jahrzehnts – und auch On connaît la chanson verführte dazu, Ideen aus dieser Richtung aufzurufen. Lehnte die klassische Filmtheorie, besonders die deutsche, den Bezug auf stereotype Formen des populären Kinos – seien es fest etablierte Figuren- und Handlungsmuster oder solche der Bildinszenierung und später auch des Ton- und Musikeinsatzes – noch als ästhetischen Gegensatz zum guten Film schlechthin, als Banalität, ab und sah darin ganz im Sinne Hermann Brochs »Das Böse im Wertsystem der Kunst«,1 so galten der französischen Filmtheorie die wiederkehrenden, eingeschliffenen
82 · Jörg Schweinitz
Muster schon in den 1940er und 1950er Jahren als wichtiges Material, das zwar erstarrt sei, mit dem sich aber ähnlich wie mit dem (ebenfalls stets vorgefundenen, konventionellen) Begriffsapparat der Sprache auf einer zweiten Ebene kreativ umgehen lasse: »In gewissen Fällen ergibt die Stereotypie eine Kristallisierung echter grammatischer Werkzeuge«,2 schreibt etwa Edgar Morin. Letztlich lasse sich auf diese Weise sogar die ästhetische Komplexität der Filme steigern. In der Theorie und Praxis der Postmoderne waren nun in den 1990ern endgültig alle Vorbehalte gegenüber jeder Stereotypik verf logen. Stereotype erschienen jetzt schlicht als notwendige Phänomene der Strukturierung sowohl des Films (die besonders deutlich in den Genres hervortreten) als auch der sozialen Imagination. Und spätestens für die Postmodernen waren sie zum Faszinosum geworden. Die Filme etwa von Tarantino oder den Coens feierten aktuelle wie historische Stereotype der Filmkultur. Sie taten das mit einem faszinierten und immer leicht distanzierten Blick, der den Konstruktcharakter der fiktiven Filmwelten als Welten akzentuierter Stereotype hervortreten ließ. Dies verband sich mit Formen milder Ironie, gepaart mit Begeisterung oder Nostalgie. Obwohl Resnais’ Film sich in vieler Hinsicht von diesem, sich zwischen den erwähnten amerikanischen (und anderen) Filmemachern aufspannenden Kino unterscheidet und sein eigenes, zudem sehr französisches Gesicht hat, teilt er doch manches mit ihm. Ich denke vor allem an das bewusste Verhältnis zum Repertoire filmischer und überhaupt populärer Imaginationen, und zugleich daran, wie hier der Bezug auf das Repertoire (der Figuren, der Handlungssituationen, der Bilder und Klänge) in ein eigentümlich ambivalentes, doppeldeutiges Spiel umschlägt. Immersive Teilhabe changiert mit einem nahezu gleichzeitigen distanzierten Blick, der die fiktionale Illusionswelt als solche von außen betrachtet und deren Konstruiertheit offenlegt. Das geschieht auf verschiedene Art. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass der Film eine Rezeption nahelegt, die immer wieder zur Immersion in die Welt der Fiktion einlädt, zur psychischen Teilhabe an den Figuren mit ihren Wünschen, Begehren, Sorgen, und gleichzeitig diesen immersiven Zugang auf kalkulierte Weise partiell außer Kraft setzt und uns aus der Unmittelbarkeit der präsentierten Welt herausrückt. Die eben noch emotional nahen Protagonistinnen und Protagonisten erscheinen in solchen Momenten mit leicht ironischem Blick als Figuren eines Spiels – ja, als Stereotype in einem ewigen Spiel, dessen Altbekanntheit unterstrichen wird von den vertrauten Sentenzen der im Soundtrack verwendeten Chansons aus mehreren Jahrzehnten.
On connaît la chanson · 83
Grundlegend trägt zu diesem Eindruck bei, dass das Figurenensemble von Resnais’ Film nahezu symmetrisch aufgebaut ist. Dafür sorgt zunächst der doppelte Fokus auf die Schwestern Odile und Camille, um die sich jeweils zwei Männer gruppieren. Letztlich ergeben sich zwei Dreiecksgeschichten, wie sie nicht nur aus dem Kino, sondern auch aus anderen narrativen oder dramatischen Gattungen gut bekannt sind. Zu Odile (Sabine Azéma), als eigentlichem Fixpunkt der Handlung, gehört ihr solider, aber aus Odiles Sicht etwas ermatteter, vom Alltag verschlissener Ehemann Claude (Pierre Arditi), der sich zunehmend schlecht behandelt fühlt, und ein wieder aufgetauchter, eher windiger alter Freund, Nicolas ( Jean-Pierre Bacri). Er umkreist und umgarnt Odile. Ihre Schwester Camille (Agnès Jaoui), die nicht frei von Zweifeln über den Sinn ihres Tuns eine Dissertation im Fach Geschichte schreibt und sich dafür als Fremdenführerin in Paris Geld verdient, gerät an Marc (Lambert Wilson), einen Immobilienmakler. Marc beginnt mit kleinen manipulativen Aktionen, die ihn auch in seinem Beruf kennzeichnen, ein Verhältnis mit Camille, und er plant für sich eine Zukunft mit ihr. Gleichzeitig lernt Camille den etwas älteren Simon (André Dussollier) kennen, der, wie sich später herausstellt, ein Mitarbeiter von Marc ist. Simon ist ein wenig realitätsuntüchtig und träumt von einer literarischen Karriere, aber arbeitet – auch er, um Geld für seine intellektuellen Ambitionen zu verdienen – in Marcs Immobilienbüro. Verliebt in Camille, ist er lange zu schüchtern, es ihr zu gestehen. Alle weiteren Figuren tauchen nur punktuell auf und sind lediglich funktional in Hinsicht auf dieses Ensemble und dessen Zusammenspiel knapp typisiert; das gilt mit Einschränkun-
On connaît la chanson
84 · Jörg Schweinitz
gen auch für Nicolas’ leidende Ehefrau Jane, die immerhin prominent (mit Jane Birkin) besetzt ist und eine Art Zwischenstellung einnimmt. Ihr recht kurzes Erscheinen trägt aber letztlich nur dazu bei, ihren Mann und dessen Beziehungsfähigkeit näher – unvorteilhaft – zu charakterisieren. Die zwei Dreieckskonf likte überlagern und durchdringen einander nun im Handlungsverlauf, weil die Figuren aus beiden Dreiecken in Kontakt geraten (so verkauft Simon Odile eine Wohnung, verschweigt ihr aber den Haken an der Sache) und schließlich alle in einer großen finalen Sequenz, gleichsam einem Showdown, zusammengeführt werden. Das lässt sukzessive eine nahezu geschlossene Welt entstehen. ((Abb. 1)) So symmetrisch und artifiziell konstruiert die Handlung in vieler Hinsicht erscheint, so typisiert sind die mit wenigen klaren Merkmalen ausgestatteten Hauptpersonen. Sie bekommen im Handlungsverlauf zwar jeweils ihre eigene Geschichte und taugen auch für kleinere Überraschungen und Wendungen, überschreiten aber nirgends den einmal festgelegten Typus. Insofern bleibt On connaît la chanson der Erzähltechnik solider klassischer Filmkomödien treu, denen ja vielfach allein schon durch Faktoren wie betonte Symmetrie und Rhythmik des Handlungsauf baus mit streng typisierten Figuren Momente von Stilisierung, Artifizialität und Derealisierung zuwachsen.3 Das wird noch dadurch ergänzt, dass auch die Bildformen an konventionelle Muster anschließen, so etwa – um nur ein Beispiel herauszugreifen – wenn es auf der großen Hausparty in der finalen Sequenz zum Bruch zwischen Marc und Camille kommt, die seine Manipulationen erkennt und sich daraufhin Simon zuwendet. Eine im klassischen Melodrama spätestens seit den
On connaît la chanson
On connaît la chanson · 85
1920er Jahren übliche Bildformel wird hier aufgegriffen: ein markanter senkrechter Balken im Interieur (hier wohl ein Leuchtstab), der die sich Trennenden voneinander visuell scheidet.4 ((Abb. 2)) An dem durch solche Stilisierung erzeugten derealisierenden Effekt ändert es auch nichts, dass das Geschehen in der aktuellen Alltagswelt der Pariser Mittelschicht der 1990er Jahre angesiedelt ist, die – in kleinen Beobachtungen präsentiert – die strenge geschlossene Struktur gelegentlich leicht umspielt. Das bringt demonstrativ Effekte von Real- oder Alltagserfahrung ins Spiel. Ich wähle den Begriff Effekte, weil sie vielfach zeichenhaft entstehen, und weil auch unsere Alltagswahrnehmung medial vorgeprägt ist. Sophie Rudolph, die in ihrer luziden Studie zum Filmwerk von Alain Resnais ihrerseits auf das »Formelhafte« der »stereotypen Charaktere« von On connaît la chanson eingeht, erinnert das Figurenensemble mit seinem alltäglichen »Identifikationspotenzial« zudem an die Figurenwelt in Fernsehserien, deren konventionelle, uns vertraute Fiktionswelten ja Reales und Imaginäres verschmelzen und dabei eine Art Realeffekt aus zweiter Hand hervorbringen. Resnais’ Film beziehe sich nun auf eine Alltagserfahrung, die von solchen Serien überformt und mithin selbst formelhaft ist. Zugleich schlägt Rudolph in Hinsicht auf die so gesehene Eigenart der Figurenwelt einen weiteren Bogen der Referenz vom »Vaudeville als genuiner Pariser Komödie« bis zum aktuellen Boulevardtheater.5 Und sie unterstreicht das beobachtete Oszillieren zwischen Realeffekten und Artifizialität durch eine Beobachtung, die ein Moment des Hybriden, des filmisch Unreinen, wie sie sagt, ins Spiel bringt: Wenn im Vorspann von On connaît la chanson die Figuren auf monochromem Grund mit gezeichneten Möbeln und Kleidern auf eine Weise erscheinen, die an Ankleidepuppen aus Papier erinnert, in denen nur die Fotografien ihrer Köpfe stecken, dann kündigen diese grafischen Figurinen den Charakter der Filmfiguren als Spielpuppen ostentativ an.6 Mit einer solchen Ostentation des Artifiziellen kommt die beschriebene milde Ironie ins Spiel; sie herrscht in Resnais’ Film tatsächlich durchweg, ja tritt vielfach geradezu multipliziert hervor. Das kündigt sich gleich in der Eröffnungssequenz an. Sie bietet, beginnend mit dem ersten Filmbild nach den Credits – eine Hakenkreuzf lagge –, ein kleines Reenactment über das Ende der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Die Szene dient einerseits als eine auf Resnais’ Film selbst übertragbare Liebeserklärung an Paris. Andererseits kündigt sie mit ihrem zunächst verblüffenden Verfahren (weshalb die Szene von der Kritik kaum jemals ausgelassen wurde) eine ästhetische Dimension an, die dann ebenfalls
86 · Jörg Schweinitz
zum ästhetischen Prinzip des Films erhoben werden soll: General von Choltitz (Goetz Burger), der letzte Stadtkommandant der Wehrmacht in Paris, empfängt im Büro, umgeben von seinen Adjutanten, ein Telefonat Hitlers, der vor dem Rückzug ultimativ die Zerstörung von Paris befiehlt. In diesem Moment beginnt von Choltitz mit schmerzhafter Mimik und der Stimme von Josephine Baker zu singen: J’ai deux amours, mon pays et Paris … (ich habe zwei Lieben, mein Land und Paris). Ein Wehrmachtsgeneral, der mit der Stimme eines schwarzen, weiblichen Revuestars singt, schon das verweist auf die ironische Dimension des beginnenden Films. Zudem wird uns im Publikum hierdurch und durch die sich anschließende Ton-Bild-Montage endgültig klar: Wir sind hier nicht in einem Historienfilm gelandet, sondern haben lediglich die Erzählung der Stadtführerin Camille, die wir nun bei ihrer Arbeit kennenlernen, vor Augen geführt bekommen. Dass in diesem Film gesungen wird, dass dies lippensynchron und dennoch mit geliehenen Stimmen, die überdies ständig wechseln, geschieht, dass dabei auch die Geschlechtergrenzen übersprungen werden – Männer mit Frauenstimmen und Frauen mit Männerstimmen singen – und die Historizität des medialen Klanges der Originalquelle von der Grammofon-Platte der 1920er Jahre über den frühen Tonfilmklang der 1930er bis zum LP- und Studiosound der 1960er und 1970er Jahre ausgestellt wird – diese ästhetischen Dimensionen kündigen sich hier an. Der Anfang setzt, wie es gute Filmanfänge tun, den Ton. Insgesamt sind es 36 Lieder aus den 1920er bis 1970er Jahren, die mit 49 kürzeren oder längeren Ausschnitten eingesetzt worden sind.7 Im Ergebnis entsteht eine kompilierte, ihren Montage-Charakter ausstellende Filmwelt. Die inhaltliche, dramaturgische Logik von Text und musikalischem Gestus im Verhältnis zu Figur und Filmhandlung ist dabei nicht einheitlich. Vielfach stehen die Liedtexte und Melodien für Stimmungen und Gedanken der jeweiligen Figur, teilweise verselbstständigen sie sich aber auch zu reinen Kabinettstücken (wie bei der grotesken Klage eines Hypochonders »J’ai la rate qui s’dilate«, die Nicolas mit der Stimme von Gaston Ouvrard vorträgt) oder zu furiosen auditiven Montagen jeweils mehrerer Lieder, die die Freude am Absurden akzentuieren. Als Resultat entsteht, was Resnais, wie er in mehreren Interviews sagte, für seinen Film anstrebte: »un cake avec trop de fruits confits«, ein Kuchen mit zu vielen kandierten Früchten.8 Damit verbunden bleibt stets die Betonung des Illusionsbruchs, die Verweigerung der illusionistischen diegetischen Integration des Gesangs aus dem Archiv. Insofern sind die in Kritiken häufiger diagnostizierten
On connaît la chanson · 87
Parallelen von Resnais’ Film zum klassischen Filmmusical begrenzt. Denn das klassische Filmmusical strebte nach einem vereinheitlichten ästhetischen Ganzen, nach weitgehender Integration von Musik, Gesang, Tanz und Handlungswelt. Was On connaît la chanson hervorbringt, ist Hybridität im engeren Sinne. Sie beruht auf der Zusammenfügung von Bruchstücken aus disparaten Quellen – auf einer Zusammenfügung, welche die heterogene Herkunft gerade nicht einebnet, sondern irritierend spürbar bleiben lässt, ja akzentuiert.9 Richard Dyer spricht in solchem Zusammenhang – den im Postmoderne-Diskurs häufigen Terminus Pastiche aufgreifend – von einem »pastiche as combination«,10 den er von jener anderen Form des Pastiches unterscheidet, die auf Imitation einer bestimmten (historischen) Gestaltungsweise und Stilistik beruht und die er daher »pastiche as imitation« nennt.11 Ein kombinatorischer Pastiche-Charakter stärkt selbstverständlich das Moment des Artifiziellen zusätzlich. In Begriffen der Zeittheorie des Films lässt sich sogar sagen, dass eine solche hybride Kombinatorik hier mit Blick auf die Ton-Bild-Welt eine »ästhetische Eigenzeitlichkeit« des Ganzen hervorbringt, das auf keine einheitliche kausale und kontinuierliche Zeitreferenz rückbeziehbar ist.12 Während die bildlich und in den Dialogen präsente Handlungswelt auf die damalige Gegenwart der 1990er Jahre verweist, und in der Rezeption eine klassische kontinuierliche zeitliche Abfolge der Ereignisse (eine Fabel) herstellbar ist, entzieht sich die hinzumontierte Ebene von Musik und Gesang spürbar dieser Zeitlogik – und damit letztlich der Film als Ganzes. Die ständige Kommentierung von inneren und äußeren Konf likten der Figuren durch die trivialen Weisheiten der Lieder, deren medialer Klang allein schon auf ihre Herkunft aus verschiedenen Zeiten hinweist, ironisiert diese Konf liktlagen zusätzlich. Sie schafft ihnen gegenüber Distanzmomente und verallgemeinert sie zugleich. Der Filmtitel On connaît la chanson ließe sich daher auch treffend mit der Wendung Es ist das alte Lied … ins Deutsche übertragen. Damit geschieht auf Grundlage des kombinatorischen Pastiches etwas Ähnliches, wie es Fredric Jameson für jenes Pastiche beschreibt, das Dyer imitativ nennt. Mit Blick auf postmoderne Filme – zu denken ist hier etwa an die historisiert inszenierten Werke der Coen-Brüder oder auch an Sergio Leones Once upon a Time in America (Es war einmal in Amerika, 1984) u. v. a. – spricht Jameson nicht ohne kritischen Unterton davon, dass sie »suggerieren, die Handlung spiele in irgendwelchen ›ewigen‹ 30er Jahren, außerhalb der real-historischen Zeit.«13 Resnais’ Verfahren des kombinatorischen Pastiches schafft nun einen anderen, aber ver-
88 · Jörg Schweinitz
wandten Effekt: Die Welt der 1990er Jahre und die darin eingelagerten Konf likte der Figuren werden zum Teil eines ewig gleichen menschlichen Seins – ewig, zumindest in Hinsicht auf die Welt der Moderne. Jameson selbst beschrieb einen ähnlichen Effekt, Jahre bevor Resnais seinen Film drehte: »Die Annäherung an die Gegenwart über die Kunstsprache des Simulakrums und des Pastiche einer zum Stereotyp gemachten Vergangenheit verleiht der gegenwärtigen Realität, der ›Offenheit‹ der historischen Gegenwart den Zauber und die Distanz eines schimmernden Trugbildes. Und diese bezaubernde neue Ästhetik ist dann selbst ein Symptom für das Schwinden von Historizität.«14 Ein ganz ähnliches Paradoxon gelingt Resnais: Die Historisierung seines Films durch die Chansons aus den 1920er bis 1970er Jahren sorgt auch hier für das Schwinden des Gefühls von der historischen Eigenart der handlungstreibenden Konf likte: Sie sind die ewig Gleichen … Mag durch diesen Effekt, verbunden mit dem Hervortreten des Artifiziellen, im Kinoerleben die Bewusstheit gegenüber dem Imaginationscharakter der filmischen Fiktionswelt gestärkt werden, so wirkt dem wiederum partiell der Umstand unserer Vertrautheit mit der Welt der Stereotype und mit alltäglichen medialen Formen entgegen. Vertrautheit führt tendenziell zu automatisierter Wahrnehmung und macht mithin eher blind für die Eigenart des Imaginären als einem Gegenpol des Realen. Denn das konventionell gewordene Imaginäre ist ja Teil unserer Realität und prägt sie mit. Darüber führt Resnais sogar einen kleinen filmischen Diskurs: Als Nicolas ihr ein Familienfoto zeigt, erinnert Odile dessen Bildinszenierung sofort an die Bilder einer Malzkaffee-Reklame aus derselben Zeit. Eine ähnliche Beobachtung hat Jacques Rancière an Resnais’ Film diskutiert. In dem Maße, in dem das Imaginäre etwa im Universum der populären Lieder des Jahrhunderts »zum großen Schatz gemeinsamer Erfahrungen« wird, dränge dies zur Neutralisierung des Fiktionscharakters in unserer Wahrnehmung: »Wir haben mit diesen ›närrischen‹ Liedern gelebt, mit denen, die unsere Großeltern geträllert haben, oder mit denen unserer Freunde aus den sechziger Jahren; sie bieten sich als das Repertoire an, in dem jede reale oder fiktive Erfahrung ihre Phrasen finden kann. Es wird auf diese Weise ein doppelter Nachweis der Fiktion geführt. (…) Aber es kommt auch zu deren eigener Auslöschung«15 – so fasst Rancière seine Ref lexion zusammen. Jahre nachdem ich On connaît la chanson erstmals sah und begann, über das Oszillieren gegensätzlichster Wahrnehmungsmodi in der Rezeption und die daraus resultierenden Effekte nachzudenken, kam mir ein Aufsatz von Georg Simmel in den Sinn. Auf den ersten Blick spricht
On connaît la chanson · 89
Simmel über ein ganz anderes Thema, nämlich über die Koketterie, die er im Geist seiner Zeit als weibliches Phänomen verhandelte. Er schrieb: »Indem sie das Ja und Nein, Hinwendung und Abwendung, abwechselnd dominieren und zugleich fühlen läßt, zieht sie sich aus jedem der beiden zurück und handhabt jedes als Mittel, hinter dem ihre eigene, unpräjudizierte Persönlichkeit in voller Freiheit steht.«16 Gilt Simmel Koketterie als weiblich, so habe sie die Funktion der Selbstbehauptung gegenüber der (in seiner Kultur) beschränkten individuellen Freiheit der Frauen. Das Spiel der Ambivalenz bringe für die Kokette Momente von Autonomie, ja – zumindest symbolischer – Macht hervor. Dieser Aspekt, das Verhältnis von Ambivalenz und Freiheit, ist mit Blick auf Resnais’ Film interessant. Mir geht es hier nicht um die etwaige Koketterie von Filmfiguren, sondern um einen ästhetischen Basiseffekt des Films. Strukturell gesehen ist es, was die Gleichzeitigkeit und Doppeldeutigkeit der verschiedenen, den Film prägenden Antinomien betrifft, sehr ähnlich wie bei Simmel. Vielleicht lässt sich On connaît la chanson in diesem übertragenen Sinne als ein kokettes Filmspiel verstehen, das sich inmitten aller ausgestellten stereotypen Formen unpräjudizierte ästhetische Freiheit geschaffen hat.
1 Hermann Broch, »Das Böse im Wertsystem der Kunst [1933]«, in: ders.: Dichten und Erkennen, Zürich 1955, S. 311–350, bes. S. 319–328 und S. 344–345. — 2 Edgar Morin, Der Mensch und das Kino. Eine anthropologische Untersuchung, Stuttgart 1958, S. 203, vgl. auch S. 196–198. — 3 Thomas Elsaesser hat diesen Effekt einmal beispielhaft an frühen deutschen Tonfilmkomödien gezeigt, vgl. Thomas Elsaesser, Das Weimarer Kino – aufgeklärt und doppelbödig, Berlin 1999, S. 252–278. — 4 Vgl. dazu zum Beispiel das amerikanische Melodrama von King Vidor The Crowd (Ein Mensch der Masse, 1929). — 5 Sophie Rudolph, Die Filme von Alain Resnais. Reflexionen auf das Kino als unreine Kunst, München 2012, S. 220. — 6 Vgl. ebd., S. 221. — 7 Zur Liedauswahl und ihrer Veränderung im Drehprozess vgl. François Thomas, »Quelles chansons pour ›On connaît la chanson?‹« (5.4.2017), in: https://www.cinematheque.fr/article/1022.html (letzter Zugriff am 1.7.2021) — 8 Ebd. — 9 Zum filmästhetischen Begriff Hybrid vgl. Jörg Schweinitz, Film und Stereotyp: Eine Herausforderung für das Kino und die Filmtheorie. Zur Geschichte eines Mediendiskurses, Berlin 2006, S. 91–97 sowie Irmela Schneider, »Von der Vielsprachigkeit zur ›Kunst der Hybridisation‹. Diskurse des Hybriden«, in: Hybridkultur. Medien, Netze, Künste, hg. von ders. u. Christian W. Thomsen, Köln 1997, S. 13–66. — 10 Richard Dyer, Pastiche, London 2007, S. 9–21. — 11 Ebd., S. 21–25. — 12 Eingehender dargestellt in Jörg Schweinitz, »Die ästhetische Eigenzeitlichkeit des Films. Plädoyer für ein theoretisches Konzept«, in: Montage AV 29/1 (2020), S. 185–192. — 13 Fredric Jameson, »Postmoderne – zur Logik der Kultur im Spätkapitalismus«, in: Postmoderne. Zeichen eines kulturellen Wandels, hg. von Andreas Huyssen und Klaus Scherpe, Reinbek 1986, S. 66. — 14 Ebd. — 15 Jacques Rancière, »La fiction difficile«. In: Cahiers du cinéma 521 (Februar 1998), S. 41–43, hier S. 43 (meine Übers., J. S.). — 16 Georg Simmel, »Die Koketterie«, in: ders., Philosophische Kultur. Über die Abenteuer, die Geschlechter und die Krise der Moderne. Gesammelte Essais, Berlin 1986., S. 100.
Stefanie Diekmann
Ritornell Über Alain Resnais’ Vous n’avez encore rien vu
Für diejenigen, die sich für das Verhältnis von Theater und Film interessieren, ist dieses Œuvre eine beglückende Entdeckung, eine verwirrende auch, da die Beziehungen zum Theater, die in den Filmen von Alain Resnais etabliert werden, vielfältig sind, auf mehreren Ebenen entwickelt und mehr oder weniger umständlich organisiert. Es beginnt kompliziert: mit jener beinahe statuarischen Szene, die in L’Année dernière à Marienbad (1961) gleich zu Beginn des Films vor einem ebenfalls statuarischen, unbewegt verharrenden Publikum aufgeführt wird und den Pygmalion-Komplex von Versteinerung und (Wieder-)Belebung, von Stasis und Bewegung antizipiert, der im Folgenden auch innerhalb des Films entfaltet werden wird. ((Abb. 1)) In den mehr als fünf Jahrzehnten nach L’Année dernière à Marienbad hat Resnais mehrfach Stücke von Alan Ayckbourne verfilmt: Smoking / No Smoking (1993), Cœurs (2006), Aimer, boire et chanter (2014). Er hat mindestens zwei Mal die Adaptibilität eines theateraffinen Genres ausgetestet – nicht nur in Mélo (1986), sondern bereits zwei Jahre zuvor in L’Amour á mort (1984) –, außerdem einen Film inszeniert, der beinahe wie ein Musical aussieht – On connaît la chanson (1997) –, und eine Weile später mit Pas sur la bouche eine Operette adaptiert (2006). Sein letzter Film erzählt von den Kabalen und Lieben unter den Mitgliedern einer Amateurtheatergruppe (Aimer, boire et
Vous n’avez encore rien vu
Vous n’avez encore rien vu · 91
chanter), und in allen seinen Filmen arbeitet er mit einem erstaunlich stabilen Ensemble, vor allem Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Dussolier, aber auch Lambert Wilson und Anne Consigny, die allesamt, mit Ausnahme von Dussolier, zu dem langen Line-up französischer Schauspielprominenz gehören, der in Vous n’avez encore rien vu (2012) zu einer Réunion aufgerufen wird. Das Interesse am Theater, im Œuvre von Resnais unübersehbar, kann als ein Interesse an der Form bezeichnet werden – aber nicht nur. Denn das Theater als Sujet, Vorlage, Form, die de facto nicht eine einzige ist, sondern viele – Tableau vivant (L’Année dernière à Marienbad), Melodrama (Mélo, L’Amour à mort), Tragikomödie (Smoking / No Smoking, Cœurs), Operette, Musical usw. –, wird bei Resnais mit einem spezifischen Ensemble von Themen verknüpft, das nicht mehr aus seinen Filmen verschwindet. Und weil auch das Theater nicht mehr aus den Filmen verschwindet, ließe sich darüber spekulieren, ob es von Resnais als derjenige Ort betrachtet worden ist, der es allererst gestattet, sich mit diesen Themen zu befassen, das heißt: mit Liebe, Lüge und Verrat. Mit der Freundschaft, die bisweilen größer ist als die Liebe, was nicht verhindert, dass sie für die Liebe preisgegeben wird. Mit dem Tod, der bei Resnais in Liebesdingen vieles klärt. Mit der Wiederkehr der Toten, die bereits in L’Année dernière à Marienbad in Gang gebracht wird und sich in L’Amour à Mort und Vous n’avez encore rien vu fortsetzt. Den letzteren Film als ein Vermächtnis des Regisseurs Resnais zu betrachten, mag nahe liegen, auch weil die Motive des Theaters, des Verrats, des Todes, der Wiederkehr und der Wiedergänger hier so offensichtlich profiliert und mit dem Motiv eines allwissenden Regisseurs und eines vertrauten Ensembles verknüpft werden. In einem herrschaftlichen Haus, in einem Saal von unbestimmten Ausmaßen versammeln sich zu Beginn der Handlung die Schauspieler *innen, die dorthin gebeten worden sind, um über die neue Inszenierung eines alten Stücks zu urteilen: Eurydice, in dem sie selbst einmal besetzt waren, in der ersten oder in der zweiten Produktion, in einer Haupt- oder in einer Nebenrolle, alle unter der Regie jenes Antoine d’Anthac, dessen Tod zu Beginn des Films in einer Serie von Telefonanrufen mitgeteilt wird. Was seriell beginnt (die Anrufe, die Ankünfte) verwandelt sich alsbald in eine Zeitschleife. Ein altes Ensemble findet sich ein, eine neue Inszenierung wird präsentiert, nicht auf der Bühne, sondern auf einer Leinwand, vor der die prominenten Gäste platziert sind. Und kaum hat die Projektion begonnen, beginnt auch die Wanderung der Zeilen, der Dia-
92 · Stefanie Diekmann
Vous n’avez encore rien vu
loge, die auf der Leinwand angefangen, im Saal aufgenommen und fortgesetzt werden, um von diesem Moment an zwischen Saal und Leinwand zu oszillieren. Als ließe sich das Schauspiel der Wiederbegegnung nicht anders gestalten. Oder als könnte die Geschichte von Leben, Sterben, Nachleben, die den Titel Eurydice trägt, nicht ins Werk gesetzt werden, ohne diejenigen, die schon einmal eine Rolle in dem entsprechenden Stück gespielt haben, zu einem Teil der Aufführung werden zu lassen. ((2)) Dass das Theater als ein Ort der Gespenster zu betrachten sei, ist das zentrale Thema eines klugen Buchs von Marvin Carlson, das unter dem Titel The Haunted Stage die Bühne als jenen Schauplatz beschreibt, auf dem jeden Abend die Gespenster umgehen.1 ›Again tonight‹, als wären sie nicht erst am Abend vorher den Bühnentod gestorben. ›Again tonight‹, als sei in jedem Moment daran zu erinnern, dass der erste Auftritt niemals der erste ist, sondern in einer langen Reihe von anderen Auftritten steht, in der sich Rollen und Körper verbinden, um irgendwann wieder getrennt zu werden, wenn auch nie endgültig, sagt Resnais, da die Rollen ein Nachleben in den Körpern führen und ihrerseits partiell von den Körpern besetzt bleiben. Vous n’avez encore rien vu: Der Titel ist, so betrachtet, ein Programm, das nicht eingelöst wird, da dieser Film (der nicht der letzte seines Regisseurs gewesen ist) davon erzählt, dass auf der Bühne wie auf der Leinwand nichts geschieht, das sich nicht schon ereignet hat, nicht schon gesehen worden ist. Dass keiner auftritt ohne eine Schar von Gespenstern im Gefolge, keine stirbt und zurückkehrt, ohne eine alte Choreografie zu wiederholen. Dass die Liebenden, die sich vor Publikum finden, nie alleine sind, dass ihnen weder ihre Sätze noch ihre Gesten alleine gehören, und dass der Tod, der hier fast durchweg das Gesicht von
Vous n’avez encore rien vu · 93
Mathieu Amalric trägt, das alles weiß und die Liebenden dennoch gewähren lässt, für eine Weile. Später wird auch der totgesagte Regisseur zurückkehren, noch später ein weiteres Mal sein Tod verkündet, noch später ein Begräbnis stattfinden, zu dem die jüngste Schauspielerin nicht rechtzeitig erscheint, was ihrer Figur bereits die ganze Zeit nachgesagt worden ist. Das Ende, sollte eines vorgesehen sein, bleibt unklar; gegenwärtiger sind die Motive des Nachlebens und der Wiederholung sowie die Entdeckung, dass das Kino vom Theater nicht loskommen kann. Nicht, wenn es von Liebe und Gespenstern erzählen will, das heißt: nicht, wenn es sich so gestaltet wie bei Alain Resnais.
1 Marvin Carlson, The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine, Ann Arbor 2001.
Biografie Alain Resnais wird als einziges Kind des Apothekers Pierre Resnais und seiner Frau Jeanne Resnais, geb. Gachet, am 3. Juni 1922 in Vannes, Departement Morbihan, geboren.1 Wie seine Altersgenossen Chris Marker oder der Kameramann Sacha Vierny war er daher alt genug, ein Veteran des Zweiten Weltkriegs zu sein und die relative Sorglosigkeit des Lebens vor dem Holocaust und der Atombombe kennen zu lernen. In den späten 1950er Jahren hingegen war er noch jung genug, sich an der ästhetischen Erneuerung des Kinos in Frankreich zu beteiligen. Von Geburt her Bretone, sei er, wie Marcel Oms schreibt, ein Nachfahre des großen Zauberers Merlin und ein Spielkamerad der Fee Melusine.2 John Francis Kreidl weist in seiner Monografie über Alain Resnais auf den in Frankreich sprichwörtlichen Charakter der Bretonen hin: Sie gelten als hart arbeitende Traditionalisten, eher gaullistisch als marxistisch orientiert, nüchtern und materiell, aber doch einer mystischen, keltischen Tradition verhaftet. Das paradoxe Temperament des Bretonen beruhe also auf materieller Handlungsorientierung gepaart mit walisisch-keltischem Mystizismus, Legenden vom Fliegenden Holländer und dem Glauben an das Gesetz des Zufalls.3 Auch wenn diese Darstellung zugegebenermaßen sehr verallgemeinernd ist, scheint sie nicht ganz unzutreffend. Sacha Vierny, der Kameramann, mit dem Resnais einen Großteil seiner Filme gedreht hat, gibt in einem Interview mit Gaston Bounore, der Anfang der 1960er Jahre die erste Monografie über Resnais vorlegte, zu, dass dieser an Magie (vor allem was menschliche Begegnungen betrifft) glaube.4 Resnais wächst in einem behüteten bürgerlichen Umfeld auf. 1931 tritt er in das katholische Collège Saint-François Xavier ein. Wegen seiner instabilen Gesundheit, er leidet an Asthma-Anfällen, nimmt er sehr unregelmäßig am Unterricht teil. Die Asthma-Anfälle, die nachließen, als er als junger Mann nach Paris zog, schiebt er selbst auf sein Umfeld, in dem er sich eingeengt fühlte: »J’ai eu une enfance catholique très stricte en Bretagne – et je déteste penser à mon enfance.«5 Bei seinen Schulkameraden gilt er als fada, als Verrückter, weil er immer ins Kino geht und Comics liest, was in seinem damaligen Umfeld als Zeitverschwendung angesehen wurde.6 Seine Kameraden Georges und Maurice Hilleret, die er bei einem Lagerfeuer der »Eclaireur de France« (den französischen Pfadfindern, S. R.) kennenlernt, berichten: »Pour nous, il était à part. Toujours plongé dans des bouquins. On l’enviait car il faisait ce qu’il voulait. (…) Et puis il y avait son appareil pho-
Biografie · 95
to et surtout sa caméra 8 mm! (…) Comme le local des éclaireurs ouvrait sur la cour de récréation du cours secondaire des filles, on les filmait de là. Et Alain montait ces films, nous les projetait. Souvent aussi, on allait à Aradon, sur le golfe du Morbihan où ses parents avaient une propriété. C’est là qu’il rangeait sa monstrueuse collection de comics et de space-opéras. Il avait tout ce qui pouvait exister dans le genre. C’était un immobile, un asthmatique, et il trouvait là sans doute l’occasion d’évasions dans un espace imaginaire.«7 Jeden Donnerstagnachmittag ging er ins Kino, obwohl seine Familie dem Kino gegenüber feindlich eingestellt war, vor allem wegen der Hygiene und des schlechten Rufes der Kinosäle, die angeblich voller Mikroben sein sollten. 1936 verlässt Resnais die Schule schließlich ganz und erhält Unterricht von seiner Mutter, die besonderen Wert auf seine literarische und künstlerische Bildung legt. Alain Resnais betont immer wieder gerne, er sei nur »durch Zufall« Regisseur geworden, weil er das Abitur nicht bestanden hatte und deswegen nicht wie sein Vater Apotheker werden konnte. Er versteht sich selbst als Studenten, als Autodidakten, da er keine staatliche Ausbildung jemals zu Ende durchlaufen hat. In seiner Biografie sind immer Begegnungen mit anderen Menschen, die ihm weitergeholfen haben, entscheidend gewesen. Als er 1937 in Paris eine Aufführung von Tschechows Stück Die Möwe unter der Regie von Sacha Pitoëff im Théâtre des Mathurins gesehen hat, ist sein Berufswunsch zunächst Schauspieler. 1940 zieht er nach Paris, wo er eine Zeitlang in der Rue de Courcelles, in der auch Proust lebte, wohnt. Er nimmt von 1940 bis 1942 Schauspielunterricht bei René Simon, bricht die Ausbildung aber ab, weil er, wie er selbst feststellt, »nicht talentiert genug« gewesen sei. Ein prägendes Erlebnis dieser Zeit ist für ihn eine Statistenrolle in Marcel Carnés Film Les visiteurs du soir. Resnais berichtet davon, wie enttäuscht er vom Verlauf der Dreharbeiten gewesen sei, da sich ihm durch diesen Einblick in den Entstehungsprozess die Magie des Films verf lüchtigt habe. Er frequentiert Filmclubs, unter anderem die Maison de Lettres, wo er André Bazin kennenlernt. Durch seinen Freundeskreis in Saint-Germain-des- Près lernt er die Cutterin Myriam kennen, die unter anderem mit Sacha Guitry, einem von Resnais’ großen Vorbildern, zusammenarbeitete. 1943 überlegt er, Buchhändler zu werden, und beginnt ein Praktikum in der Librairie Galignani’s in der Rue de Rivoli, als die I.D.H.E.C., die erste staatliche Filmhochschule, in Paris gegründet wird. Myriam drängt ihn, sich zu bewerben, da er zunächst nicht glaubte, ohne Abitur an einer Hochschule studieren zu können, und wird nach einem schriftlichen Exa-
96 · Biografie
men in den ersten Jahrgang in der Sektion Montage aufgenommen. In der mündlichen Auswahlprüfung stieß er auf Jean Mitry und Alexandre Arnoux als Gesprächspartner. Bereits nach einem Jahr verlässt Alain Resnais die Filmhochschule wieder, enttäuscht über die wenig praktisch orientierte Ausbildungssituation. Tatsächlich wurden damals an der Filmhochschule keine Filme gedreht, dafür gab es Unterricht in griechischer Mythologie. Als einzig brauchbaren Einf luss aus der Filmhochschulzeit nennt er in einem Interview mit Jean-Louis Leutrat und Suzanne Liandrat-Guigues seinen Lehrer Grémillon, der an der Tafel den Achsensprung erklärt habe. Vorher habe er beim Zusammenkleben seiner 8-mm-Filme immer Probleme damit gehabt, und Bücher über Filmtechnik gab es damals noch nicht. Nach dem Abbruch der Ausbildung an der Filmhochschule arbeitete er als Regieassistent bei Nicole Védrès für den von Pierre Braunberger produzierten Film Paris 1900, eine Dokumentation über Paris zur Jahrhundertwende, die ausschließlich aus Archivmaterialien (sog. found footage) montiert wurde. Die Begegnung mit Pierre Braunberger8 ist für Resnais’ Filmkarriere entscheidend, da dieser den jungen Resnais dabei unterstützte, seine ersten »professionellen« Filme zu drehen. Zuvor hatte Resnais schon eine Reihe von Filmen auf 16 mm gedreht, die nicht öffentlich zur Aufführung kamen.9 1948 forderte Braunberger Resnais auf, seinen zunächst auch auf 16 mm gedrehten Film Van Gogh erneut auf 35 mm zu filmen, und ließ ihn darauf folgend Gauguin und Guernica produzieren. Braunberger gab Resnais auch die Produktion von Toute la mémoire du monde und Le chant du styrène in Auftrag. Durch seine ersten Kurzfilme wurde der Produzent Anatole Dauman, dessen Produktionsfirma Argos Films in den 1950er Jahren mit der Produktion anspruchsvoller Kurzfilme hervortrat, auf Resnais aufmerksam. In Zusammenarbeit mit Anatole Dauman entstehen die Filme Nuit et brouillard (1955), Hiroshima mon amour (1959) und Muriel ou le temps d’un retour (1963). Es ist letztlich der Initiative dieser beiden wichtigen Produzenten zu verdanken, die das Talent Resnais’ entdeckt und gefördert haben, dass er schließlich seinen Weg in das Metier des Regisseurs gefunden hat, obwohl er das, wie er niemals müde wird zu erwähnen, doch nie wirklich beabsichtigt hatte.
1 Einige seiner Filmfiguren (die Frau in Hiroshima mon amour, Celia Teasdale in Smoking/ No Smoking) haben einen Vater, der Apotheker ist, was nur kurz im Dialog eingebracht wird,
Biografie · 97 ohne eine Bedeutung für den Film zu haben. Es gehört zu einer Reihe von »private jokes«, die er gerne in seine Filme einbaut. — 2 Marcel Oms, Alain Resnais, Paris 1988, S. 9. — 3 JohnFrancis Kreidl, Alain Resnais, Boston 1997, S. 24, Francis Lacassin berichtet von einigen der Gespenstergeschichten, die Alain Resnais in seiner Kindheit erzählt bekam: Die Schwester seiner Großmutter war berühmt dafür, dass sie eines Tages den Trauerzug einer Nachbarin an ihrem Fenster hatte vorbeiziehen sehen, obwohl man die Frau bei bester Gesundheit glaubte. Acht Tage später starb die Nachbarin tatsächlich und der Trauerzug spielte sich genau so ab, wie die Gelegenheitsprophetin ihn vorhergesehen hatte. Oft wurde dem jungen Alain Resnais auch das merkwürdige Abenteuer des Onkels seines Großvaters erzählt. Er hatte eines Tages auf dem Boot, dessen Kapitän er war, ein Gespenst überrascht, dass gerade dabei war, einen Längenund einen Breitengrad in das Bordbuch einzutragen. Wie der neugierig gewordene Kapitän identifizierte, war es die Position eines sinkenden Schiffes. An der Spitze des ersten Rettungsbootes, das die Ertrunkenen aufsammelte, stand das Gespenst. (Lacassin, zit. nach Jean-Louis Leutrat, Hiroshima mon amour : Étude critique, Paris 1994, S. 7f., Übersetzung S.R.) — 4 Gaston Bounore, Alain Resnais, Paris 1974, S. 19. — 5 »Ich hatte eine sehr streng katholische Kindheit in der Bretagne – und ich verabscheue es, an meine Kindheit zu denken« (zit. nach Leutrat, Hiroshima mon amour (s. Anm. 3), S. 7, Übersetzung S. R.). — 6 Vgl. Alain Resnais, ›Les photos jaunies ne m’émeuvent pas‹, propos recueillis par Antoine de Baecque et Claire Vassé, in: Cahiers du Cinéma (November 2000), S. 70–75. — 7 Zit. Nach Bounore, Alain Resnais (s. Anm. 4), S. 186 (dt. Für uns stand er abseits. Immer in Bücher vertieft. Wir beneideten ihn, weil er machte, was er wollte. (…) Und dann gab es seinen Photoapparat und seine 8 mm-Kamera. (…) Da die Räume der »éclaireurs« auf den Pausenhof einer Mädchenschule hinausgingen, filmten wir sie von dort aus. Alain montierte die Filme und führte sie uns vor. Oft gingen wir auch nach Aradon, im Golf von Morbihan, wo seine Eltern ein Grundstück hatten. Dort bewahrte er seine monströse Sammlung an Comics und Space-Opéras auf. Er besaß alles, was in dem Genre existierte. Er war durch sein Asthma stillgestellt und das bot ihm ohne Zweifel die Möglichkeit des Herumschweifens in imaginären Räumen.) — 8 Schaut man sich die Filmografie Pierre Braunbergers heute an, liest sie sich wie ein who’s who der französischen Filmgeschichte. Er produzierte zahlreiche Erstlingswerke großer Regisseure, die weltweiten Ruhm erlangen, darunter Jean Renoir, Luis Buñuel, Jean-Pierre Melville, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, François Truffaut. Erstaunlicherweise jedoch gibt es, abgesehen von einigen Sondernummern französischer Filmzeitschriften, kaum Forschungsliteratur über die Rolle des Produzenten Pierre Braunberger, was daran liegen mag, dass die Filmgeschichte, zumal in Frankreich, hauptsächlich als eine Geschichte der Filmautoren geschrieben worden ist. — 9 Etwa 20 Filme über Maler und einen verschollenen Spielfilm mit Danièle Delorme in der Hauptrolle.
Filmografie Dokumentarfilme
Van Gogh (F 1948, s/w, 20 Min.) Gaugin (F 1950, s/w, 12 Min.) Guernica (Co-Regie Robert Hessens, F 1950, s/w, 12 Min.) Les statues meurent aussi (Auch Statuen sterben, Co-Regie Chris Marker, F 1953, s/w, 30 Min.) Nuit et brouillard (Nacht und Nebel, F 1955, s/w und f, 31 Min.) Toute la mémoire du monde (Alles Gedächtnis der Welt, F 1956, s/w, 22 Min.) Le chant du styrène (F 1958, f, 13 Min.) Gershwin (Folge der TV Serie L’encyclopédie audiovisuelle) (F 1991, f, 52 Min.)
Spielfilme
Hiroshima, mon amour (F/JP 1959, s/w, 91 Min.) L’Année dernière à Marienbad (Letztes Jahr in Marienbad, F/I/ BRD/A 1961, s/w, 93 Min.) Muriel ou le temps d’un retour (Muriel oder die Zeit der Wieder kehr, F/I 1963, f, 116 Min.) La Guerre est finie (Der Krieg ist vorbei, F/SE 1966, s/w, 212 Min.) Loin du Viet-Nam (Fern von Vietnam, film collectif, Episode «Claude Ridder«, F 1967, f, 15 Min., ganzer Film 115 Min.) Je t’aime, je t’aime (Ich liebe dich, Ich liebe dich, F 1968, f, 91 Min.) L’An 01 (Regie Jacques Doillon, Jean Rouch, Episode «New York«, 1972, s/w, 4 Min., ganzer Film 90 Min.) Stavisky… (F 1974, f, 115 Min.) Providence (F/CH 1976, f, 110 Min.) Mon oncle d’Amérique (Mein Onkel aus Amerika, F 1980, f, 125 Min.) La vie est un roman (Das Leben ist ein Roman, F 1983, f, 111 Min.) L’Amour à mort (Liebe bis in den Tod, F 1984, f, 92 Min.) Mélo (F 1986, f, 112 Min.) I want to go home (F 1989, f, 105 Min.) Smoking / No Smoking (F/CH/I 1993, f, 140 Min./145 Min.)
Filmografie · 99
On connaît la chanson (Das Leben ist ein Chanson, F/CH/GB 1997, f, 117 Min.) Pas sur la bouche (Nicht auf den Mund, F/CH 2003, f, 115 Min.) Cœurs (Herzen, F 2006, f, 120 Min.) Les herbes folles (Vorsicht Sehnsucht, F/I 2009, f, 104 Min.) Vous n’avez encore rien vu (Ihr werdet euch noch wundern, F 2012, f, 115 Min.) Aimer, boire et chanter (F 2014, f, 108 Min.)
Autor*innen Diekmann, Stefanie ist Professorin für Medienkulturwissenschaft an der Stiftung Universität Hildesheim und war zuvor Professorin für Medien und Theater an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zu ihren Forschungsinteressen gehören die intermedialen Beziehungen des Films, Medienref lexion im Film sowie Ästhetik und Theorie des Dokumentarfilms. Aktuell befasst sie sich vor allem mit verschiedenen Facetten des Interviews vor der Kamera und schreibt neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit regelmäßig Film- und Ausstellungsrezensionen für Texte zur Kunst, perlentaucher.de, filmbulletin u. a. Elsner, Anna Magdalena ist Assistenzprofessorin für französische Literatur und Kultur an der Universität St. Gallen. Sie studierte in Oxford, Paris und Cambridge, wo sie 2011 promoviert wurde. Es folgten ein Joanna Randall McIver Research Fellowship an der Universität Oxford, ein Leverhulme Trust Fellowship am King’s College London und ein Marie Heim-Vögtlin Stipendium an der Universität Zürich. Ihre aktuellen Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Medical Humanities, wo sie sich mit Sterbedarstellungen in zeitgenössischer Literatur und Film beschäftigt. Köhler, Kristina, ist Juniorprofessorin für Kunst- und Mediengeschichte der Bildmedien an der Universität zu Köln. Von 2017–2020 war sie Juniorprofessorin für Filmwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, davor Assistentin und Oberassistentin am Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich, wo sie mit der Arbeit Der tänzerische Film. Frühe Filmkultur und moderner Tanz (2017) promoviert wurde. Sie ist Mitherausgeberin der Film-Konzepte und der Zeitschrift Montage AV. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Filmgeschichte bzw. Theorieund Wissensgeschichte des Films, Tanz- und Körperkulturen der Moderne, Medienarchäologie und Fragen des Medienwandels. Mareš, Petr ist seit 2004 Professor für tschechische Sprache an der Karlsuniversität in Prag (Tschechien). Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Stilistik, Text- und Kommunikationswissenschaft sowie in den Fragen der Multimodalität bzw. Intermedialität (Sprache im Film, Filmadaptionen der literarischen Werke). Er ist u. a. Mitglied des Redaktionsbeirats der tschechischen filmwissenschaftlichen Zeitschrift Iluminace.
Autor*innen · 101
Ochsner, Beate ist Professorin für Medienwissenschaft an der Universität Konstanz. Seit 2015 ist sie Sprecherin der DFG-Forschergruppe »Mediale Teilhabe. Partizipation zwischen Anspruch und Inanspruchnahme« (www.mediaandparticipation.com/). Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Audiovisuelle Produktion von Dis/Ability; mediale Teilhabe; audiovisuelle Praktiken des Sehens und Hörens; Monster und Monstrositäten; Serious Gaming. Rudolph, Sophie, Dr. phil., ist Lehrbeauftragte im Bereich Kultur- und Medienwissenschaft und Koordinatorin des Kontextstudiums an der Universität St. Gallen. Zuvor Studium der Romanistik, Medienwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt Organisation) an der Universität Mannheim und Filmwissenschaft an der Universität Paris III (Sorbonne Nouvelle). Dissertation mit dem Titel Die Filme von Alain Resnais. Reflexionen auf das Kino als unreine Kunst (2012). Forschungsinteressen umfassen gesellschaftliche Stereotype in populären Medien, Europäisches Autorenkino, Gender Studies und Environmental Humanities. Schaub, Mirjam, Dr. phil. habil., ist Professorin für Philosophie an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle a. d. Saale. Zuvor war sie Professorin am Department Design der HAW Hamburg und als solche Gründungsmitglied des künstlerisch-wissenschaftlichen Graduiertenkollegs »Performing Citizenship«. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Kunst-, Kino- und Kulturphilosophie, Epistemologie sowie politische Philosophie. Ihre Dissertation verfasste sie über »Gilles Deleuze im Kino. Das Sichtbare und das Sagbare« (2003). Schweinitz, Jörg, ist Professor em. für Filmwissenschaft der Universität Zürich. Er ist Mitherausgeber der Film-Konzepte, der Montage AV sowie mit Margrit Tröhler der Reihe Zürcher Filmstudien. Zu seinen Buchpublikationen gehören u. a.: Prolog vor dem Film: Nachdenken über ein neues Medium 1909–1914 (1992), Film und Stereotyp (2006), Die Zeit des Bildes ist angebrochen! Französische Intellektuelle, Künstler und Filmkritiker über das Kino, 1906–1929. (hg. mit Margrit Tröhler, 2016) und Film Bild Kunst. Visuelle Ästhetik des vorklassischen Stummfilms (hg. mit Daniel Wiegand 2016). Weber, Thomas ist seit 2011 Professor für Medienwissenschaft am Institut für Medien und Kommunikation (IMK) der Universität Hamburg, u. a. war er Leiter des Teilprojekts »Themen und Ästhetik« des DFG-For-
102 · Autor*innen
schungsprojekts »Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland 1945–2005«, Leiter des Teilprojekts »Authentizität transformieren« des Forscherverbunds »Übersetzen und Rahmen« und Mitglied des Graduiertenkollegs »Vergegenwärtigungen« (der Shoah) an der Universität Hamburg. Zuvor DAAD Lektor in Paris und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Universität Bonn.
F I LM- KONZ E PTE Begründet von Thomas Koebner Herausgegeben von Kristina Köhler, Fabienne Liptay und Jörg Schweinitz (Hefte 1–28 herausgegeben von Thomas Koebner und Fabienne Liptay, Hefte 29–52 von Michaela Krützen, Fabienne Liptay und Johannes Wende)
Heft 1/2006 Komödiantinnen 173 Seiten, € 14,– ISBN 978-3-88377-821-1 Heft 2/2006 Chaplin – Keaton. Verlierer und Gewinner der Moderne 108 Seiten, € 14,– ISBN 978-3-88377-822-8 Heft 3/2006 Nicolas Roeg Gastherausgeber: Marcus Stiglegger und Carsten Bergemann 112 Seiten, € 14,– ISBN 978-3-88377-836-5 Heft 4/2006 Indien Gastherausgeberin: Susanne Marschall 97 Seiten, € 14,– ISBN 978-3-88377-837-2 Heft 5/2007 Ang Lee Gastherausgeber: Matthias Bauer 104 Seiten, € 14,– ISBN 978-3-88377-861-7 Heft 6/2007 Superhelden zwischen Comic und Film Gastherausgeber: Andreas Friedrich und Andreas Rauscher 125 Seiten, € 14,– ISBN 978-3-88377-862-4 Heft 7/2007 3 Frauen: Moreau, Deneuve, Huppert 107 Seiten, € 14,– ISBN 978-3-88377-891-4
Heft 8/2007 Clint Eastwood Gastherausgeber: Roman Mauer 118 Seiten, € 14,– ISBN 978-3-88377-892-1 Heft 9/2007 Pedro Almodóvar Gastherausgeber: Hermann Kappelhoff und Daniel Illger 119 Seiten, € 17,– ISBN 978-3-88377-921-8 Heft 10/2008 David Lean Gastherausgeber: Matthias Bauer 105 Seiten, € 17,– ISBN 978-3-88377-922-5 Heft 11/2008 Helmut Käutner Gastherausgeber: Claudia Mehlinger und René Ruppert 115 Seiten, € 17,– ISBN 978-3-88377-943-0 Heft 12/2008 Wong Kar-wai Gastherausgeber: Roman Mauer 105 Seiten, € 17,– ISBN 978-3-88377-944-7 Heft 13/2009 Romy Schneider Gastherausgeber: Armin Jäger 107 Seiten, € 19,80 ISBN 978-3-86916-001-6 Heft 14/2009 Hollywoods Rebellen Marlon Brando, Jack Nicholson, Sean Penn Gastherausgeberin: Felicitas Kleiner 111 Seiten, € 17,80 ISBN 978-3-86916-002-3
Heft 15/2009 Die jungen Mexikaner Gastherausgeberin: Ursula Vossen 111 Seiten, € 17,80 ISBN 978-3-86916-025-2
Heft 24/2011 Max Ophüls Gastherausgeber: Ronny Loewy 92 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-134-1
Heft 16/2009 Neil Jordan 117 Seiten, € 19,– ISBN 978-3-86916-026-9
Heft 25/2012 Bertrand Tavernier Gastherausgeber: Karl Prümm 132 Seiten, € 26,– ISBN 978-3-86916-177-8
Heft 17/2010 Eric Rohmer Gastherausgeberin: Uta Felten 117 Seiten, € 19,– ISBN 978-3-86916-052-8 Heft 18/2010 Junges Kino in Lateinamerika Gastherausgeber: Peter W. Schulze 116 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-053-5 Heft 19/2010 Roman Polanski 140 Seiten, € 23,– ISBN 978-3-86916-070-2 Heft 20/2010 Jean-Luc Godard Gastherausgeber: Bernd Kiefer 116 Seiten, € 22,– ISBN 978-3-86916-071-9 Heft 21/2011 Michael Haneke Gastherausgeberin: Daniela Sannwald 100 Seiten, € 21,– ISBN 978-3-86916-114-3 Heft 22/2011 Gus Van Sant Gastherausgeber: Manuel Koch 124 Seiten, € 22,– ISBN 978-3-86916-115-0 Heft 23/2011 Ettore Scola Gastherausgeberin: Marisa Buovolo 106 Seiten, € 22,– ISBN 978-3-86916-135-8
Heft 26/2012 Alan J. Pakula Gastherausgeberin: Claudia Mehlinger 112 Seiten, € 25,– ISBN 978-3-86916-178-5 Heft 27/2012 Rouben Mamoulian und Frank Borzage Gastherausgeber: Armin Jäger 148 Seiten, € 28,– ISBN 978-3-86916-205-8 Heft 28/2012 Edgar Reitz 103 Seiten, € 26,– ISBN 978-3-86916-206-5 Heft 29/2013 Sofia Coppola Herausgegeben von Johannes Wende 112 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-247-8 Heft 30/2013 Michael Ballhaus Herausgegeben von Fabienne Liptay 123 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-245-5 Heft 31/2013 Jean-Pierre und Luc Dardenne Herausgegeben von Johannes Wende 117 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-264-5 Heft 32/2013 Ousmane Sembène Herausgegeben von Johannes Rosenstein 117 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-265-2
Heft 33/2014 John Lasseter Herausgegeben von Johannes Wende 104 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-333-8 Heft 34/2014 Takashi Miike Herausgegeben von Tanja Prokic´ 138 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-334-5 Heft 35/2014 Jean Renoir Herausgegeben von Lisa Gotto 110 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-367-3 Heft 36/2014 Doris Dörrie Herausgegeben von Fabienne Liptay 106 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-369-7 Heft 37/2015 Spike Jonze Herausgegeben von Johannes Wende 110 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-400-7 Heft 38/2015 Dominik Graf Herausgegeben von Jörn Glasenapp 116 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-402-1 Heft 39/2015 Satyajit Ray Herausgegeben von Susanne Marschall 113 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-446-5 Heft 40/2015 Milena Canonero Herausgegeben von Fabienne Liptay 114 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-448-9
Heft 41/2016 Pedro Costa Herausgegeben von Malte Hagener und Tina Kaiser 112 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-478-6 Heft 42/2016 Caroline Link Herausgegeben von Jörn Glasenapp 90 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-482-3 Heft 43/2016 François Ozon Herausgegeben von Johannes Wende 105 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-511-0 Heft 44/2016 Leni Riefenstahl Herausgegeben von Jörg von Brincken 140 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-515-8 Heft 45/2016 Stanley Kwan Herausgegeben von Johannes Rosenstein 118 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-553-0 Heft 46/2017 Bernd Eichinger Herausgegeben von Judith Früh 137 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-580-6 Heft 47/2017 Chantal Akerman Herausgegeben von Fabienne Liptay und Margrit Tröhler 103 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-589-9 Heft 48/2017 Luchino Visconti Herausgegeben von Jörn Glasenapp 112 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-640-7
Heft 49/2018 Ken Loach Herausgegeben von Claudia Lillge 106 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-651-3
Heft 57/2020 Quentin Tarantino Herausgegeben von Jörg Helbig 113 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-069-9
Heft 50/2018 Wim Wenders Herausgegeben von Jörn Glasenapp 126 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-655-1
Heft 58/2020 Veˇra Chytilová Herausgegeben von Margarete Wach 114 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-96707-087-3
Heft 51/2018 Rudolf Thome Herausgegeben von Tobias Haupts 121 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-731-2
Heft 59/2020 Ulrich Seidl Herausgegeben von Corina Erk und Brad Prager 108 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-96707-425-3
Heft 52/2018 Woody Allen Herausgegeben von Johannes Wende 98 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-767-1 Heft 53/2019 Ula Stöckl Herausgegeben von Claudia Lenssen 123 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-801-2 Heft 54/2019 Nicolas Winding Refn Herausgegeben von Jörg von Brincken 112 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-805-0 Heft 55/2019 Asghar Farhadi Herausgegeben von Jörn Glasenapp 108 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-859-3 Heft 56/2020 Jacques Demy Herausgegeben von Kristina Köhler 112 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-86916-869-2
Heft 60/2021 Roy Andersson Herausgegeben von Fabienne Liptay 86 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-96707-433-8 Heft 61/2021 Jonas Mekas Herausgegeben von Ann-Christin Eikenbusch und Philipp Scheid 110 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-96707-482-6 Heft 62/2021 Christopher Nolan Herausgegeben von Jörg Helbig 117 Seiten, € 20,– ISBN 978-3-96707-468-0